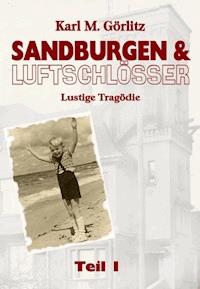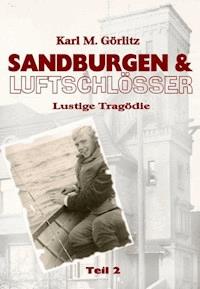Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer mitteldeutschen Flüchtlingsfamilie im goldenen Westen der Republik. Geschildert aus der Sicht ihres schwärzesten Schafes in drei Bänden. Ein gewaltiges Panorama vom Kriegsende bis zum Heute, randvoll mit Anektdoten, schrägen Typen und kreischkomischen Situationen. Sie werden Ihnen ans Herz wachsen: Die sächsische, teilgebildete Mutter und ihr etwas zu klein geratener Ehemann als großer Manager, die Söhne, von welchen der eine wohlgeraten und der andere auf krummen Wegen durchs Leben wandelt. Folgen Sie ihnen durch fast siebzig Jahre Zeitgeschichte, amüsanter kann eine Zeitreise kaum sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint
Sandburgen & Luftschlösser. Lustige Tragödie – Teil 3
Karl M. Görlitz
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2012 Karl M. Görlitz
ISBN 978-3-8442-3150-2
Für Rüdi und Rosa
Karl M. Görlitz
SANDBURGEN &
LUFTSCHLÖSSER
Lustige Tragödie
Aufstieg und Fall einer mitteldeutschen Flüchtlingsfamilie im prosperierenden Westen der Republik. Geschildert aus der platten Sicht ihres schwärzesten Schafes auf schlappen 1.800 Seiten in drei Bänden.
DER AUTOR :
Karl Michael Görlitz wurde 1943 zwischen Dessau und Wittenberg geboren und wuchs nach der Flucht am Niederrhein auf. Heute lebt er mit Mann und Frau in Berlin.
INHALT
Erste Schritte
Der erste Tag
Im Zeichen der Kogge
Heiligabend zu zweit
Die Mühen der Ebene
Der Knall
Knall II
Literarisches Zwischenspiel
Ein Abend mit Dichtern
Karriere
Rauf und Runter
Gestorben wird immer
Der Schnitter kommt wirklich
City West
Nichts als Ärger!
First Class Shopping
Noch mehr Charivari
Wir ziehen mal wieder um
Als Trauzeuge unterwegs
Weiter im Text
Intermezzo
Die Wende
Besuch von drüben
Gegenbesuch
Der Unfall
Das Restaurant
Fauler Zauber
Coswig
Geburtstag
ERSTE SCHRITTE
Anfangs war es mehr eine Wochenendbeziehung. Es war höchste Zeit geworden, ein wenig öfter nach den Rechten zu schauen, denn Rudi hatte schon wieder einen reizenden jungen Mann, mit dem er sich traf. Für eine rein platonische Freundschaft war dieser einfach zu hübsch. Rudi, der Schlingel, hatte jedesmal dieses gewisse Glitzern im Blick, wenn er von ihm sprach. Ein Glitzern, das sämtliche Alarmsirenen bei mir aufjaulen ließ.
Was du nicht besiegen kannst, mach zu deinem Freund.
Da ich ebenfalls bei ihm ein gewisses Wohlgefallen erregte, so wie er bei mir, fand er sich alsbald als umworbener Hausfreund bei uns wieder. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Im ersten Jahr pendelte ich zwischen Düsseldorf und der neuen Heimat. Hermann-Josef brauchte mich noch für seine Agentur, sowie auch einige Andere.
In Berlin gab es vorerst wenig zu tun für einen Freelancer, den niemand kannte und niemand brauchte. Der Arbeitsmarkt in meiner Branche war klein und es stand ein gewisses Überangebot heimischer Fachkräfte einem Mangel an Arbeitsplätzen gegenüber, da die Hochschulen munter alljährlich noch neue Konkurrenten auf den Markt entließen.
Dieser Auffassung war man auch beim Arbeitsamt, als ich mich harmlos nach Umzugsbeihilfen erkundigte, die der Senat dringend gesuchten Arbeitsplätzen gewährte.
»Na, das hat uns gerade noch gefehlt«, seufzte die Beamtin, mit welcher ich konferierte. »Noch'n Grafiker aus Westdeutschland, wo wir unsere eigenen schon nirgendwo mehr unterbringen!«
Kreative im Dutzend billiger und im Einzelnen fast umsonst, da sich alle unterboten.
Die Industrie war abgewandert und ihre Dienstleister hinterher. Den traurigen Rest des Kuchens mussten sich zu Viele teilen.
Nach längerem Suchen fand sich endlich eine kleine Agentur, die gelegentlich Hilfe benötigte. Man warb mit knatternden Reimen für eine Brotfabrik. Und für eine Kette von Autowaschanlagen mit Herz, auf deren Logo ein lustiges Auto blinzelte. Kleinvieh macht auch Mist. Wer wusste das nicht besser als ich, und was passt besser zum Broterwerb als die Gestaltung von Butterbrotpapier. Steinofen, Doppelkruste, Bauernschnitten, Hefeweizen. Es war entspannend. So entspannend, dass ich im Halbschlaf zweimal die Textblöcke für die Verpackungsseiten verkehrt herum montierte. Danach wollte man nicht mehr so gern mit mir. Zu Recht!
Für Tunten gab es eigentlich nur eine Alternative, und die hieß KaDeWe. Also bewarb ich mich und forderte einen für Kaufhausverhältnisse derart heftigen Preis, dass der Werbeleiter ziemlich blass um die Nase wurde. Er versuchte, mich herunterzuhandeln, und ich kam ihm ein wenig entgegen, aber nicht viel.
Danach hörte ich nichts mehr und ich rechnete schon lange nicht mehr mit eine Anruf, der zu einem zweiten Gespräch bat. Es hatte wohl etwas länger gedauert, bis der Mann der Geschäftsleitung klar gemacht hatte, dass er unbedingt einen Spezialisten aus Düsseldorf brauchte. Einen, der fast genau so viel verdiente, wie er selbst. Ganze hundertfünfzig Mark betrug der Unterschied, da ich später Gelegenheit bekam, das streng gehütete Geheimnis auf der Gehaltsabrechnung kurz einzusehen.
Ausschlaggebend für meine Einstellung waren vermutlich die netten Anzeigenentwürfe für Helmut Horten, die für eine warme Mahlzeit am Wochenende hergestellt worden waren und die mir jetzt plötzlich halfen. Was hatte ich damals geflucht, aber man soll ja nie nie sagen. Also sagte ich zu, obwohl ich als Pendler wesentlich mehr Knete heranschaffte.
Rosas Wohnung war in ein Zweizimmer-Appartement zurückverwandelt worden. Mein Zimmer überließ ich komplett Rosa, im anderen Zimmer hatte ich ihr ein schönes Wohn- und Schlafzimmer hergerichtet, mit den Möbeln, die wir uns geteilt hatten.
In Berlin stand der traurige Rest des geliebten Salons, der nun endgültig auseinandergerissen war, und Mutter hatte ich die grüne Daunengarnitur abgeschwatzt, die nutzlos in ihrem Keller stand, obwohl sie noch tadellos in Ordnung war. Lindgrüner Ziegenhaarsamt von den Bielefelder Werkstätten, fast nicht tot zu kriegen. Die Rückenkissen sind teilweise noch in Betrieb, längst neu bezogen und so verwohnt, dass sie in den Hundekörbchen gelandet sind. So vornehm liegen unsere Köter, auf reiner Daune, während unsereins mit Schaumflocken, (nicht nur vorm Maul), vorlieb nimmt.
Einen Gründerzeit-Esstisch im Barockstil mit gewundenen Beinen, den eine Nachbarin zum Berliner-Haushalt beigesteuert hatte, nahm ich mit, den runden Klapptisch mit den Stühlen behielt Rosa, sowie Sekretär und Schreibtisch, nebst Sitzecke und Hausrat. War ich in Düsseldorf, schlief ich auf meinem alten Bett, in Berlin pennten wir auf Rudis aufgeklappten Schaumstoffsofa, das herrlich ungemütlich war.
Überhaupt verloren sich unsere paar Möbel in der Neuköllner Riesenwohnung fast völlig, aber jeder Neuanfang braucht seine Zeit.
Wir waren es nicht gewohnt, beim Einzug gleich eine Kompletteinrichtung auf Kredit zu erwerben, so wie das heute gern gemacht wird. Erst nach und nach füllten sich die Räume und es war ein Gefühl, als lebte man in einem Fass ohne Boden, aber andererseits freute man sich um so mehr über jede größere Anschaffung. Wie langweilig es ist, gleich in ein perfektes Nest von der Stange zu hüpfen, war bei dem Pärchen über uns zu beobachten, unseren neuen Nachbarn. Äußerlich alternativ anzusehen, aber im Herzen stramm konsumorientiert, langweilten sie sich bald so sehr, dass nur eine Trennung Abwechslung versprach.
Dennoch waren es die einzigen in dem großen Eckhaus, die uns akzeptabel schienen und mit denen wir Kontakt pflegten, der über freundliche Bemerkungen im Hausflur oder Fahrstuhl hinausging.
Unter uns befand sich eine internistische Praxis, was bedeutete, dass man des Abends nicht so viel Rücksicht nehmen musste, denn das Parkett ohne Teppiche knallte ziemlich, wenn man mit Straßenschuhen darüber huschte. Neukölln hieß der Bezirk, in dem wir nun wohnten, und selten gab es eine Gegend, die schlechter zu ihrem Namen passte, denn neu war hier gar nichts. Eher im Gegenteil. Neu waren hier lediglich das Hertie-Kaufhaus und einige Häuser, die in den 50er Jahren die Bombenlücken füllten, und die auch schon wieder reichlich mitgenommen wirkten. Berliner Mischung in der Grundfarbe dreckig. Ein Arbeiterviertel, ziemlich hässlich, aber mit verstecktem Charme, der wirklich gut versteckt war.
Im ehemaligen Rixdorf lauerten gemütliche Bauernhäuschen mit Obstgärten hinter schwärzlichen Mietskasernen, was zutiefst überraschend war, und unweit davon spielte ein kompletter Park, mit Orangerie und leider vertrockneter Kaskade, Häschen in der Grube. Ein reicher Kiesgrubenbesitzer hatte seinen Tagebau mit freundlichen Grüßen und neuer Füllung an die Stadt zurückgegeben. Als noble Geste und völlig unpassend in der ärmlichen Umgebung. Aber schön.
Es gab noch einen Dorfplatz mit Barockkirche, Schmiede, Böhmischen Gottesacker und Stadtvillen der wohlhabenderen Landmännern ringsum, aber das gehörte schon nicht mehr zu unserem direkten Wohnumfeld, es lag aber sozusagen vor der Haustür, wie in anderer Richtung Kreuzberg, welches das berüchtigte Szenenviertel darstellte.
Zum Einkaufen für den täglichen Bedarf gab es das Warenhaus am Rathaus, zwei Fleischer, einige Häuser weiter Bäckerei und Obstladen. Im Parterre hatte sich eine Pizzeria mit äußerst schlichter Dekoration breitgemacht, und um die Ecke hatten sich noch Tier- und Zahnarzt niedergelassen. Deren Eingang war ungleich prächtiger, mit Stuck und Marmor, bei uns war der Gips abgeschlagen, dafür besaßen wir einen Fahrstuhl. Eine Bombe war im Weltkrieg ins Dach gerasselt und das teilzerstörte Haus war schmucklos wieder bewohnbar gemacht worden. Unsere Wohnung ging um die Ecke, was günstig für die Raumfolge war und uns das sogenannte Berliner Zimmer ersparte, ein Durchgangszimmer, welches den Seitenflügel mit dem Vorderhaus verband, wo sich ein zweiter Flur anschloss, der zur Küche, Schlafräumen und Dienstbotenkammer, sowie Personaleingang führte. Fast alle Großraumwohnungen waren ähnlich geschnitten, die nicht ganz so wichtigen Zimmer zum Hof, der im übrigen auch lärmgeschützter war.
Wir schliefen im Balkonzimmer, welches zur Innstraße lag. Gegenüber, auf Augenhöhe lag ein Ehepaar fast den ganzen Tag auf der Lauer. Hingebreitet auf Kissen im Fenster folgten ihre Gesichter wie Stiefmütterchen dem Lauf der Sonne, denn ansonsten gab es nicht viel zu sehen in der ruhigen Straße.
Unter ihnen ging ein besonders hübscher Apotheker, der auch nichts weiter mit der Geschichte zu tun hat, seinen Geschäften nach. Außer vielleicht, dass er einmal zum Kaffee herüberkam und sich angenehm überrascht zeigte, dass hinter den ständig geheimnisvoll zugehangenen Fenstern sich so etwas wie ein fast normaler Haushalt verbarg.
»Wir waren so neugierig, was sich wohl hinter den Pferdedecken in ihren Fenstern verbergen mochte, dass ich unbedingt einmal nachschauen musste.«, erklärte er uns erleichtert. So, so, als Pferdedecken wurden meine eleganten Fensterdekorationen von unten wahrgenommen! Nun ja, Heteromänner verstehen eben nicht viel von der Kunst, mit Stoffen zu zaubern, auch wenn sie zauberhaft aussehen.
Die Gegend litt schwer unter ihrer Bedeutungslosigkeit, dabei lag um die Ecke ein Hallenbad, von welchem man wahre Wunderdinge hörte. Ein Badepalast wie im alten Rom, mit säulenumstandenen Becken und Mosaiken unter der Gewölbedecke, Massagebänken aus eitel Marmor und wasserspeienden Delphinen, die von allerliebsten Putti geritten wurden. Das wärs eigentlich gewesen, um mich mit der Ödnis ein wenig mehr anzufreunden, aber das Bad war wegen Renovierung geschlossen und blieb es, solange wir in der Sonnenallee wohnten. Erst kurz vor unserem Wegzug wurde es feierlich wiedereröffnet und wir bekamen Gelegenheit, es trockenen Fußes zu durchschreiten. Gebadet haben wir dort nie.
Auch die Sonnenallee war eher schattig, vier Reihen alter Kastanien säumten Gehweg und Mittelpromenade, auf der schon lange niemand mehr promenierte. Im Sommer hatte man den Eindruck eines grünen Tunnels, der sich endlos lang hinzog. Das war wirklich schön und versöhnte ein wenig mit dem Blick auf den immergrünen Kunstrasen des Sportplatzes mit seinem gnadenlosen Flutlicht auf der anderen Straßenseite. Elf Freunde sollt ihr sein. Oftmals hörte sich das gar nicht so an, besonders am Sonntag, wenn spärliches Publikum das Rasengrün umstand und unzufrieden johlte. Hier brauchten wir keine Vorhänge um neugierige Blicke abzuwehren, und hier saßen wir am Wochenende mittags beim Frühstück und warfen gelegentlich einen gelangweilten Blick auf die vierundvierzig strammen Männerbeine, die sich unten tummelten. Fußball! Das war uns viel zu rustikal.
Da schlurrten wir doch lieber in den Hauspantöffelchen in unser geliebtes Ili-Kino, gleich neben dem Fußballfeld. Ein Kino, in welchem die Zeit in den 50ern stehen geblieben war, mit verblichenen Diplomen im Foyer, dessen Tapete auch schon museal zu nennen war, die es als Filmkunst-Lichtspieltheater von Weltrang auswiesen.
Der Typ hinter der Kasse war klasse. Genau so verschroben wie das Kino, welches er praktisch im Alleingang betrieb. Es gab zwar noch einen Filmvorführer und eine Chefin mit Kontrollzwang, mit welcher er telefonisch in ständigen Kontakt stand, aber gesehen hat man beide nie zusammen. Vielleicht führte er auch Selbstgespräche mit dem Telefonhörer, den er ständig am Ohr hatte und nur beiseite legte, um in der Kasse nach Wechselgeld zu kramen. Hatte man noch einen Zusatzwunsch, wie ein Eis oder ein Tütchen Gummibärchen, geriet er prompt ins Schleudern, denn dafür gab es eine Extrakasse. Und der Vorgang des Geldwechselns begann erneut. Schließlich musste alles seine Ordnung haben, und nachdem er die übergeordnete Instanz telefonisch informiert hatte, reichte er beides durch den Schlitz im Fenster, welcher danach wieder sorgfältig verschlossen wurde. Danach erhob er sich von seinem Platz und schlurfte aus dem Kassenbereich, nicht ohne vorher der Chefin kurz Bescheid zu geben, dass er nun den Akt des Einlasses vornahm.
In den 50er Jahren mochte er eine flotte Erscheinung gewesen sein, wenn er sommers in kurzen Höschen und nabelfrei, mit auf der mageren Brust flott zusammengeknoteten Hemd à la St.Tropez und Badelatschen hinter der Eingangstür erschien, aufschloss, und die Besucher nach strenger Prüfung der Kinokarte, die er soeben selbst verkauft hatte, einzeln einließ, bevor er wieder absperrte und die gemächliche Prozedur beim nächsten Besucher von neuem begann. War man erst einmal drin, war man auf sich selbst angewiesen und konnte sich hinsetzen, wo man wollte, denn es gab nur einen Einheitspreis. Zum Glück war es nie voll, denn ansonsten hätten die letzten Kunden rechts gehen müssen, um den Hinausströmenden Platz zu machen, die über den gesehenen Film diskutierten.
Die Leute in der Warteschlange murrten nur verhalten, denn wer ins Ili ging, wusste Bescheid und kam rechtzeitig. Wer wollte auch schon die blöden Werbefilme sehen. Erst wenn der Hauptfilm bereits angefangen hatte, machte sich gewisse Unruhe breit und der Mann an der Kasse geriet in Schwierigkeiten, die er mit der Chefin erst ausdiskutieren musste, bevor er zur Tat schritt. Gelegentlich zeigte man tatsächlich Filmkunst, wohl um den Ruf zu wahren, aber in der Hauptsache wurden die üblichen Blockbuster in der zweiten Verwertungskette nachgespielt, da es noch keinen Video-Verleih gab. Das Haus hatte aber eine Filmspezialität, die jede Samstagnacht gezeigt wurde: Cheech and Chong, die Dauerbekifften. Viele der sogenannten Off-Kinos hatten zu dieser Zeit ihre Spezialität des Hauses, so wie zum Beispiel das Kolonna in der Kolonnenstraße. Dort spielte jeden Sonnabend die Rocky Horror Picture Show, wo man mit einem Tütchen Reis nebst Wasserpistole antreten musste. Ein anderes Filmtheaterchen zeigte mit Hellzapoppin den wahrscheinlich lustigsten Film aller Zeiten zu Flaschenbier. Und wir hatten Cheech and Chong mit den Tütchen auf der Leinwand und im Herrenklo, da im Saal nicht geraucht werden durfte.
Es war ein Erlebnis, den Film mehrmals zu sehen, da man die witzigen Dialoge meist nicht mitkriegte, weil die breite Masse schon vorher grölte. So enthüllte sich der Sinn nur nach und nach, und es war immer eine Freude, eine neue Pointe zu entdecken.
Auch in der Kindervorstellung am Sonntagnachmittag war schwer was los bei den Glücklichen, die noch Einlass gefunden hatten. Bei dem Hollywood-Epos Die zehn Gebote saß doch tatsächlich eine fromme Familie hinter mir, die das Buch zum Film mit sich führte und einem Vater, der seinem Sprössling daraus predigte. Der aber hörte gar nicht zu, und bei der Szene, in welcher Moses das rote Meer teilt, brüllte er heulend los: »Moses renn! Moses renn!«, bis Papa ihn Mores lehrte und das Kind entfernte. Oder noch so ein Dialogfetzen, der mir im Ohr geblieben ist. Der hinterhältiger Kater im Trickfilm fällt in einen tiefen Brunnenschacht und ein Kind hinter mir sagt mit betroffener Stimme: »Der arme Bär!«
Armer Bär, armes Kino, arme Stadt. Schon längst hat das Ili-Kino seine Pforten geschlossen, aber damals in den Achtzigern siechte es munter vor sich hin in diesem Viertel voller Merkwürdigkeiten.
Unsere Sonnenallee war eine Allee voller Fachgeschäfte. Vom Hermannplatz bis zum Hertzbergplatz reihte sich Fachhandel an Fachhandel, der immer ein bisschen aus der Zeit geraten schien. Der Möbelhändler zeigte seinen Sachverstand an Modellen, die fast museumsreif waren, der Tapetenspezialist klebte Muster, die schon bei Kriegsende als veraltet galten, und in den Modegeschäften hingen Nylonkittel, in denen sich unsere Putzfrau daheim geniert hätte.
Vor allem Spezialgeschäfte zur Verschönerung des Heims waren in der Sonnenallee heimisch. Tapeten und Farben wurden abgelöst von Teppichböden und Farben, und die wiederum von Heimwerkerbedarf zum Ablösen der Tapeten. Ein Viertel im Umbruch, allerdings mehr innen, denn draußen wurde mit Farbe gespart. Es rechnete sich nicht für den Hausbesitzer, und viele waren dazu übergegangen, nur noch die allernötigsten Reparaturen durchführen zu lassen. Viele Kapitalisten waren längst nach Westdeutschland abgewandert und ließen ihren Besitz von Fachleuten verwalten, die darauf bedacht waren, profitabel zu arbeiten.
Von Besitzerstolz am Ererbten, oder der Maxime: Besitz verpflichtet, wie es so schön heißt, weit und breit keine Spur mehr.
Irgendwie war das Viertel in den 60er Jahren steckengeblieben. Einer Zeit des Aufbruchs. Nur wohin? In der Karl-Marx-Straße reihten sich dicht an dicht die Schuhgeschäfte. Jedes größere Handelshaus hatte hier seine Filiale, dabei sah man nicht mehr Fußgänger als anderswo. Seltsamer Volkssport! Ein Altberliner erklärte: Bis zum Mauerbau hatte die U-Bahn massenhaft Kunden aus Ostberlin herangekarrt, weil das die schnellste Verbindung ins westliche Konsumparadies gewesen war. Tatsächlich wirkte der Fernsehturm mit der aufgespießten Kugel, vom Hermannplatz aus gesehen, ziemlich nah, und in stillen Nächten hörte man das Gekreisch der S- Bahn vom Treptower Park.
Oft dachte ich an die Schwester dabei, die Fahrt damals, vom Bahnhof Friedrichstraße bis zur Helmholtzstraße, war mir endlos erschienen und ich hatte das Gefühl gehabt, weit draußen in der Pampa gelandet zu sein. In Wirklichkeit wohnten wir jetzt praktisch um die Ecke und befanden uns immer noch mittenmang der Stadt. Aber Treptower Park mit Ehrenmal, Rummelplatz (der sich hochstaplerisch Kulturpark nannte) und der stolzen Weißen Flotte am See hätten genau so gut auf einem fremden Planeten liegen können. Ein Planet, von dem nächtens gespenstisch herüberschallte, und der besonders im Winter seinen Mief von Braunkohle und Zweitaktgemisch mit freundlichen Grüßen zu uns wehen ließ. Über den Kanal, der gleichzeitig auch Grenze war, zu einem Land voller Abenteuer.
Seit der Grenzverkehr praktisch zum Erliegen gekommen war, war es vorbei mit den guten Geschäften im Viertel, und das sah man leider auch an den Auslagen. Soviel Teppichböden in längst aus der Mode gekommenen Braun- und Grüntönen lagen in den Fachgeschäften um uns herum, was die Gegend immer ein bisschen herbstlich aufmunterte, auch wenn in Schöneberg gerade Mai war.
Nach soviel Lokalkoloratur sollte vielleicht wieder die Handlung einsetzen, aber beim Stichwort Lokal muss ich noch schnell anfügen, dass um den Hermannplatz herum einige Schwulenbars lagen, in welchen das nicht ganz so toughe Vorstadtpublikum verkehrte, das man in der City, mit ihren anerkannten Schönheiten wie David Bowie, praktisch nie antraf. Die City-Hautevolee fuhr gelegentlich zu uns aufs Land, um sich über die schlichten Gemüter zu amüsieren, die immer noch mit toupierten Haaren und dem Herrenhandtäschchen am vom Cartier gebrochenen Handgelenk zu Marianne Rosenberg die Tanzfläche stürmten. Slumming nannte man hochnäsig diese Ausflüge und sie wurden zumeist von jenen unternommen, die auch in unserem Vorstadtidyll niemanden abkriegten. Leute, die höchstens in Ostberlin noch einen Jüngling fanden, der für eine Westjeans bereit war, beide Augen und einiges mehr zuzudrücken. Männer, deren Verfallsdatum längst abgelaufen war, oder jene, die nie eine Chance auf dem Markt der Begehrlichkeiten bekommen hatten.
Dabei gab es durchaus ganz nette Burschen, die gern in ihrem Viertel blieben, weil sie weite Wege scheuten, und lieber eine Tränke in der Nachbarschaft aufsuchten, um in trüber Beleuchtung zu fischen.
Es war wirklich etwas umständlich, mit dem Nachtbus aus der City nach Hause zu fahren, der gemächlich erst einmal durch halb Kreuzberg kreuzte, bevor er über den Kottbusser Damm den Endhaltepunkt Hermannplatz ansteuerte.Von dort mussten wir entweder laufen, oder in ein Taxi umsteigen, denn die Sonnenallee zog sich.
Klar, dass wir gern noch einen Abstecher zu einem Schlummertrunk machten, waren wir erst einmal am Hermannplatz angelangt, bevor uns die Beine in die Hand nahmen. Bald waren wir oftmals auch zu träge, die weite Reise in die City anzutreten und blieben samstags im Kiez bei Kreuzberger und Neurheinischen Schwestern. Vier Jahre Vorstadt - det prägt!
DER ERSTE TAG
Man kennt es ja. Der erste Arbeitstag ist doof. Man kennt die Leute nicht, man weiß nicht, welche Arbeit wartet und wie man sich am besten nützlich macht. Man hat das Gefühl, überall im Weg zu stehen und mit seinen Fragen die eiligen Arbeitsabläufe zu blockieren. Eines war schon vorab telefonisch geklärt worden: Ich wollte keinesfalls ein eigenes Büro, so wie es eigentlich geplant war. Nö! Allein in einem Hinterzimmer zu sitzen, ohne menschliches Miteinander und niemanden für ein Gespräch, das war absolut nicht mein Ding. Das kannte ich schon von diversen Arbeitsstätten, wo ich aus purer Langeweile fleißig geschafft hatte. Ganz normal im Atelier zwischen Kollegen wollte ich sitzen, ganz besonders zu Anfang, wo viele Fragen zu beantworten sind.
Ja, mit Vorzimmer-Cerberus, der lästige Besucher abbremst und mit Kanapee für die kreative Pause, hätte ich es schon gern gemacht. Aber so? Immer auf der Hut sein, dass jemand ohne anzuklopfen hereinstürmt und dich beim Nasenpopeln überrascht. Ach nö, Herr Butterbeck, das lassen sie mal. Keine Umstände bitte!
Anscheinend hatte genau das besondere Umstände bereitet, denn das ganze Atelier war frisch renoviert worden, für die Ankunft des großen Spezialisten aus der Werbemetropole.
Die neuen Kollegen waren genötigt worden, selbst mit Hand anzulegen, beim Weißen der Rauhfasertapete und anderen niederen Arbeiten, und entsprechend war die Stimmung der drei Mitarbeiter, aus denen die gesamte Atelierbelegschaft bestand.
So kannte die Begeisterung keine Grenzen, als ich in Begleitung des Werbeleiters erschien, um vorgeführt zu werden. - Aha, der Neue, sehr angenehm, hrmm – erfreut! Waren die Eisblumen am Fenster und der Rauhreif auf dem Tesafilmabroller nicht wunderschön? Und erst die Dahlien auf dem Balkon vor Frau Müllers Fenster, die in voller Blüte standen an diesem warmen Spätsommertag.
Meine neue Hinrichtungs- äh - Wirkungsstätte war in einem Altbau gleich neben dem großen Kaufhaus untergebracht, der äußerlich so schäbig war, dass niemand eine Verbindung zur Glitzerwelt der Ladenräume vermutete. Gut getarnt, denn unten gab es nur eine ganz normale Haustür, die leicht überwunden werden konnte.
War das nicht hier gewesen, wo sich während des Queen-Besuches einige unternehmungslustige Herren hatten einschließen lassen, für ein verlängertes frohes Wochenende? Um in aller Ruhe die damals noch üblichen Lohntüten zu öffnen, die dringend umgepackt werden mussten. Eine Sisyphosarbeit, die ganzen entwendeten Kleingeldbeträge auf einer Registrierkasse zu addieren. Schließlich will man ja wissen, wieviel man erbeutet hat, und das braucht seine Zeit, die Pausen für einen erfrischenden Schlummer in der Campingabteilung nicht mitgerechnet. »Noch nie in meinem Leben hab ich so viel und hart arbeiten müssen!«, soll einer von ihnen bei der Vernehmung gesagt haben, denn leider hatte man sie geschnappt, auf Grund von Prahlsucht! Blödmänner aber auch, müssen die denn auch gleich mit ihrem genialen Coup die falschen Ohren vollabern. Prahle nie ein Ding zum Scherz.......
»Wir haben die Wände in ihrem Raum extra weiß gelassen, damit sie die Flächen selbst gestalten können«, drang plötzlich die Stimme von Herrn Butterbeck an mein Ohr. »Richten sie sich hier im Atelier ganz nach ihrem Geschmack ein!«
Wie denn, was denn? Ganz nach meinem Geschmack? Ja, für die Breitseite gegenüber der Flügeltür mit mattgeätzten Scheiben wäre Platz für einen großen Aubusson-Wandbehang, und über der Tür zum Flur ein Kandinsky. Ein Überkandinsky! Aber vor allem würde ich den Pittoresken Herrn am Nebentisch auswechseln, der sich schon wieder eifrig über seine Arbeit beugte, nachdem er kurz von mir Notiz genommen hatte. Streber! Die anderen Beiden waren lässig stehengeblieben, Frau Müller und Herr Fritsch.
War das ein Reinfall! Ich hatte mich darauf vorbereitet, endlich mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, und dann das! Herr Fritsch strahlte Seriosität aus, schwarz gewandet von der Brille bis zur Sohle. Merinopullover mit Kragen und Knopfleiste, weißes Hemd mit dezenter Krawatte, teuer und unaufdringlich. Gepflegte Frisur, Naturlocke, noch einigermaßen winterfest. Aber diese Hornbrille über dem flotten, akkurat gemähten Schnäuzer im rundlichen Gesicht hätte nie eine Tunte getragen, so wahr mir Gott helfe!
Am nettesten schien mir noch diese Frau Müller. Von vorn war sie hübsch, auch wenn die Seitenansicht ein wenig den vorteilhaften Eindruck schmälerte, da ein klein wenig fehlendes Durchsetzungsvermögen in der Kinnpartie von ihrem Schöpfer angelegt worden war. (Also, vorsichtiger kann ich es jetzt nicht sagen, liebe Paula, auch wenn du mir ans Herz gewachsen bist. Dass der Fritsch dich immer als Henne karikiert hat, oder Milbenhuhn rief, ist wirklich nicht mir anzulasten. Und wenn wir schon bei dem unschmeichelhaften Vergleich bleiben wollen, bist du höchstens eine Glucke, unter deren Flügel sich gut sitzen lässt.)
Frau Müller mit i, also Mieler ausgesprochen, da sie aus der Tschechei stammte, wenn auch leider nicht verwandt mit dem bekannten Haushaltsgerätehersteller. Auch wenn sie sich jetzt in Zurückhaltung übte, so war ihre Gutmütigkeit unschwer zu erkennen. Freundlich sah sie aus. Sie wäre eine Alternative zu dem Modell neben mir gewesen, aber leider saß sie hinter der Flügeltür zum Balkonzimmer, in dessen Erker sich Kollege Fritsch breitgemacht hatte. Sie pflegte auch die Pflanzen in den Blumenkästen und saß ein wenig verschanzt hinter den halbhohen Materialschränken, die den Raum teilten, und der raumhohen Schrankwand, hinter welcher eine Art Notflur in ein weiteres Büro führte, das jeder passieren musste, der die Werbeleitung aufsuchte, die bereits in der Nachbarwohnung lag. Die Türen zum Treppenhaus waren versiegelt und nur als Notausgang nutzbar, das machte den Slalom zu den Büros der herrschenden Kaste notwendig.
Der Chefdekorateur hatte hier sein Reich, zusammen mit der Sekretärin in einem Raum. Sehr intim. Sein Vorgesetzter dagegen hatte gleich drei Vorzimmerdamen. Zwei männliche, Werbeassistenten geheißen, und eine Sekretärin, deren Bluse eindeutig weibliche Sekundärmerkmale durchschimmern ließ. Dahinten saßen sie also, die Werbeassistunten! Ebenfalls halb verborgen durch Geschränk, der Meister hatte durch die meist geöffnete Flügeltür freien Blick auf die attraktive Arbeitskraft hinter der Schreibmaschine, die zudem als zarter aber energischer Prellbock zwischen Herrscher und hungriger Meute diente. Ganz am Ende seines riesigen Zimmers mit Blick zum Hof thronte der Boss wie Hitler in der Reichskanzlei, nur moderner. Später musste ich feststellen, dass er auch genau so gern brüllte wie der Irrwisch aus Austria, aber vorhin beim Begrüßungsgespräch hinter verschlossener Tür hatte er sich äußerst jovial gezeigt.
Ein wenig theatralisch hatte sein Büro auf mich gewirkt mit den aufgestapelten Mustern und Versatzstücken, die in scheinbarem Durcheinander höchst abgezirkelt umherstanden. Sie standen allesamt auf der linken Seite, sozusagen als Work in Progress, während rechterhand ein flaches Regal in die Tiefe des Raumes führte, gefüllt mit Kunstbänden und Schöner Wohnen-Periodika rund um den Globus, und die selbstverständlich nach Farbe sortiert. Einige lagen natürlich wie rein zufällig herum, halb aufgeschlagen und erst wieder zu, wenn die Staubschicht störte.
Ein großer Konferenztisch in der Mitte, zusammengeschoben aus vier normalen Resopaltischen, aber Charles Eames-Stühle drumrum. Und ein Designerschreibtisch als Schanze, als letzte Hürde sozusagen, denn von einer Schanze hatte er auch gesprochen, vorhin, bei dem vertraulichen Gespräch, welches wir miteinander geführt hatten.
Von einer Schanze für mich hatte er gesprochen, vorausgesetzt, ich ergriffe nicht die Chance, um an seinem Stuhl zu sägen. Natürlich hatte er es etwas blumiger umschrieben und von Sprungbrett auf seinen Rücken gesprochen. Diesbezüglich hatte ich ihn beruhigen können, so karrieregeil wie er war ich schon lange nicht, und von Meuchelmord hielt mich meine Erziehung ab.
Er sähe es gerne, wenn ich Anweisungen aus dem Schatz meiner Erfahrungen gäbe, aber direkt weisungsbefugt war einzig er. Er hatte das letzte Wort, und das Vorwort auch, und meine Anweisungen erhielt ich ausschließlich von ihm. Und schon lange nicht von Chefdekorateur, der sich immer wieder ungefragt einmischte und ausdrücklich nicht befugt war, mir Anweisungen anzuweisen, in diesem ganzen Weisenhaus. Dieser gewisse Herr mit dem Namen, na, sagen wir mal: Herr Bukett, sei ohnehin eine Pfeife, vorsichtig ausgedrückt. Und überhaupt herrschte hier im allgemeinen ein rauher Ton, der vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig sein könnte.
Mit den Namen ist es immer so eine Sache, mancher fühlt sich auf den Schlips getreten, deshalb versichere ich sie und ihnen: Was ich erzähle ist reine Fiktion. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und die Handlung ist allein der Phantasie des Autors entsprungen. Das einzige, was sich nicht wegdiskutieren lässt, sind die neuneinhalb Jahre als Angestellter dieses hohen Hauses, und das der Autor auch schon zuvor unter einer Persönlichkeitsstörung litt.
Danach hatte sich mein neuer Boss noch einem anderen wichtigen Thema zugewandt und mich regelrecht beschworen, nur ja nicht über mein Gehalt zu reden. Mit niemanden! Am Besten auch nicht mit der Ehefrau (hoho), oder dem Finanzamt (hihi - wusste der Blödmann nicht, dass die Steuern direkt von der Buchhaltung abgeführt wurden?) und nicht unter Folter. Er hatte bereits größte Mühe gehabt, die Summe durchzusetzen, und mein Lohn sei nur durch ein Grundgehalt mit allerlei Funktionszulagen ermöglicht worden, und darüber zu reden käme einer Art Hochverrat gleich. (Mit wahrscheinlich tödlichen Folgen, so dramatisch wie er geklungen hatte.) Lohn blieb ein Geheimnis, und ich war der Mann mit geheimer Mission. Woraus die bestehen sollte, war mir allerdings ein wenig unklar geblieben.
Danach hat er mir noch viel Erfolg gewünscht. Und nun standen wir vor der jungfräulichen weißen Wand und ich überlegte, was ich hinhängen sollte, während der Typ neben mir unermüdlich einen Bogen Transparentpapier bekritzelte. Am Besten wohl mich selbst, dann wäre die Belegschaft noch am ehesten zufrieden gewesen – jedoch von diesem Gedanken nahm ich wieder Abstand. Da nehme ich doch lieber Andy. Andy Warhol mit Marilyn Monroe als Gruppenbild im Halbkreis aufgestellt. Vielfarbig, dynamisch, am besten in echt.
»Bestellen Sie, was Sie brauchen«, unterbrach mein neuer Boss den kreativen Moment. Tatsächlich? Ich brauchte Schönheit um mich herum. Am besten männliche. Der eine von den beiden Werbeassistenten hätte mir zugesagt, nur flüchtig waren wir bekanntgemacht worden, aber oho. Das war doch wohl das Schönste, was mir seit Jahren untergekommen war. Da verblasste ja selbst mein Ami mit dem Schelmenblick. Den blonden Adonis könnte ich schon gut gebrauchen, wäre er auch noch so doof. Allein sein Anblick würde mich erheitern, zu früher Morgenstund und auch gern am Abend. Doof war der bestimmt nicht, mit dem schnellen Blick, mit welchem er mich taxiert hatte, um dann freundlich loszulächeln. Der andere, na ja, war nicht ganz so schön gewesen, mit der Brille auf den karottenroten Sommersprossen der Nase. Oder war das Akne gewesen? Irgendwie hatte ich gar nicht so genau hingeschaut, geblendet von so viel Anmut des schöneren Werbeassistenten. Mann, war das ein Mann!
»Frau Müller hier, nimmt ihre diesbezüglichen Wünsche entgegen«, fuhr Butterbeck fort. Na toll! Weg mit dem Ding am Nachbartisch und her mit den jungen Franzosen.
Vorhin hatte ich ihn höflich interessiert gefragt, was er denn da mache, denn der Riesenstapel Transparentpapieres mit irgendwelchen Kritzeleien darauf hatte mich neugierig gemacht. Kreuze hier, Kreuze da. Wahlnacht war auch nicht, und da erkundigt man sich schon mal.
»Ick mach in Teletext!«, hatte er mir verdrossen geantwortet.
Aha, davon hatte ich andeutungsweise etwas gehört. Die Post unternahm einen Feldversuch in Berlin in überschaubaren Rahmen. Berlin, der beliebte Testmarkt unter uns Werbefachleuten Nansen1 genannt, wurde in ein neuartiges Kommunikationsprogramm eingebunden, von welchem wahre Wunderdinge zu vernehmen waren. Per Teletext wurden Bestellungen aufgegeben, die Hebamme gerufen, die Steuererklärung ausgefüllt und mit dem Hund Gassi gegangen, und alles im Fernsehen.
»Und was sind das für Kreuzchen, die sie da machen?« wagte ich noch einmal nachzuhaken.
»Det sin Pixel. Allet Pixel!«
Danach hatte er sich sofort wieder über die Arbeit gekrümmt, verärgert darüber, dass ich seinen demonstrativen Eifer mit einer Frage unterbrochen hatte.
Pixel??? - Was meinte der Mann damit? Doch wohl kaum die gelblichen Dinger an seinem Kinn. Computer hatten Pixel, glaubte ich mich zu erinnern. Wir schrieben 1980, und kein Mensch stand mit dem Pixel auf du und du, so wie heute. Pixelhaube? Schließlich war man hier in Preußen.
Deshalb hatte ich auch nur: »Aha« gesagt und beschlossen, mich später schlau zu machen. Wer verliert schon gern sein Gesicht, gleich am ersten Tag.
»Da ist ihnen gerade etwas runtergefallen!« Frau Müller war aber wirklich aufmerksam. Ein Wunschmädel mit geradezu hellseherischen Kräften. Verwirrt blickte ich zu Boden. Tatsächlich, die dezente Brosche an meiner Bluse hatte sich verabschiedet. Die Vorfreude, endlich im Kreis von Tunten zu wirken, hatte mich bewogen, ein Zeichen am Revers zu setzen. Das war hier, bei den neuen Kollegen, vielleicht auch gerade nicht so unbedingt notwendig.
Nur bei dem einen da, hätte ich mir soviel Geschmeide ans Hemd gebammelt, dass die Brusttaschen ausgerissen wären, aus Furcht, übersehen zu werden. Und nun machte auch noch Frau Müller dem Wunschtraum ein Ende, indem sie von Materialbestellung sprach. Material, dass ich nicht lache.
Praterial war wünschenswert!
Türe klapp. Ein kleiner Herr mit schütterem Haar und ebensolchem Anzug wuselte mit Trippelschritten in den Raum, ein hochkünstlerisches Lächeln wie angenagelt auf den Lippen. Mit Augen wie ein Frettchen, die unablässig hin und her schweiften, als müsste er sich absichern, dass keine Greifvögel ihn als Beute erwählten. Mit schnellem Blick erfasste er die Situation. Der Neue!
»Ach, Sie kommen mir ja wie gerufen!«, polterte mein neuer Boss los. Dem sich in sicheren Abstand haltenden Dazugetrippelten war anzumerken, dass er solcherlei nicht oft zu hören bekam, und wenn, war es meist mit Unannehmlichkeiten verbunden. Schon war er auf der Hut.
»Det könn' sie ma übernehmen. Zeigense dem Herrn Görlitz ma in Ruhe det janze Haus und jehn dann mit ihm nett ne Tasse Kaffee trinken. Seinse so nett, Herr Bukett!«
Aha, das war also der Herr Chefdekorateur, die Pfeife. Artig gab ich ihm meine Hand, die er mit schlaffen Gegendruck erwiderte, wobei sein Lächeln noch etwas zuckriger wurde. Strahlsüß.
Eine förmliche Vorstellung hielt Butterbeck anscheinend nicht mehr vonnöten. Der Mann wusste ohnehin, wer ich war.
»Ick hab gerade eilig wat zu tun, da kommse mir gerade recht. Und lassense sich Zeit. Wir sehen uns später, wenn ick durch bin.«
Wo durch, das ließ unser Boss offen, um danach gutgelaunt, dass er dem Neuen nicht den ganzen Palazzo persönlich vorführen musste, in seine Räumlichkeiten zu entschwinden.
Da stand ich nun, mutterseelenallein, wenn man von Frau Müller und dem feixenden Rest einmal absah, einem wildfremden Chefdekorateur gegenüber, dem gerade die Ungeheuerlichkeit zugemutet worden war, den Museumsführer für einen einfachen Mitarbeiter zu spielen. Na prima. Oberprima würde Claudia jetzt wieder sagen.
Wir wurden dann auch keine Freunde, obwohl der Mann zu unserer Community gehörte, wie unschwer festzustellen war. Auch nicht bei der gemütlichen Tasse Kaffee, bei der wir uns vom Schnelldurchlauf erholten, um danach den zweiten Teil der Blitzbesichtigung zu durchlaufen. Er musste auch noch aus eigener Tasche zahlen, weil Butterbeck vergaß, seine Ausgaben zu regulieren, wie ich später hörte. Nein, so direkt mochten wir uns beide wohl nicht so recht. (Wie übrigens niemand aus der ganzen Dekorationsabteilung, wo immer mal wieder Mordpläne geschmiedet wurden.)
Ich hatte meine Zigarette nur halb geraucht, als er schon eilig nach dem Kellner winkte, um den zweiten Teil der Tour an meiner Seite zu durchhuschen. So blieb mir nichts anderes übrig, als ihn im allgemeinen Gewühl zu verlieren, um zu meiner Tasse Kaffee und der Zigarette zurückzukehren. Schließlich hatte der Alte gesagt, wir sollten es langsam angehen lassen. Herr Bukett war mir einfach zu flink.
Mittags setzte ich mich in die Kantine, weil ich nicht elitär mit den Abteilungsleitern am reservierten in der Silberterrasse speisen wollte, und erfreute mich am einfachen Mahl am Tisch der Dekorateure, wo übrigens auch Frau Müller ein Wiedersehen mit mir hatte.
Am späteren Nachmittag gab es dann auch ein Treffen mit dem Boss, der mir seine Wünsche nun näher erläuterte.
»Machen sie mir einen Ausverkauf. Eine Riesenrasen-Aktion unter dem Motto Goldene Zeiten. Goldene Zeiten im KaDeWe! Machen sie was Irres und trimmen sie sich dabei auf den Stil des Hauses.« Dazu zeigte er einige Druckbeispiele, Gold in Gold. Glanzgold auf Mattgold. Kaum zu lesen, aber toll. Goldene Zeiten eben.
Genau das, was mir bevorstand.
IM ZEICHEN DER KOGGE
Da saß ich nun also und mühte mich, dieser Aktion ein Gesicht zu geben. Goldene Zeiten im Schlussverkauf. Ich entwarf goldene Kaskaden als Deckenhänger, Aufsteller, für die Schaufenster, den Lichthof und die Außenwerbung, als Plakat, Anzeige und Flyer. Dann noch eine nette Alternative. Und noch eine, und noch eine. Jedesmal schüttelte der Alte, der höchstens fünf Jahre älter war als ich, den Kopf.
»Nee, Herr Görlitz, dat isset noch nicht! Machense ma noch weiter und kitzeln se dat Letzte aus dem Thema.«
Bei der dreißigsten Alternative beschlich mich der Verdacht, in der Psychiatrie gelandet zu sein und an einer Beschäftigungstherapie teilzunehmen. Später sollte ich erfahren, dass Schlussverkauf und Weihnachten zu den Reizthemen meines Chefs gehörten, mit denen er sich nur höchst ungern befasste. Nur, wenn der Termin unmittelbar bevorstand und auch dann mit Widerwillen. Und bis zur nächsten Rabattschlacht war es noch lang hin. Es war Spätsommer oder Frühherbst, wie man will, und die goldenen Zeiten lagen noch weit in der Zukunft.
Seltsamer Verein, dachte ich so für mich hin und rechnete damit, mich bald wieder zu verabschieden. Bange war mir nicht, in Düsseldorf verdiente ich ohnehin besser.
Aber ich genoss die viele Freizeit, die der Job mir ließ. Die Probezeit nimmst du noch mit, bevor du wieder Pendler wirst. Ist das ein blöder Laden hier!, sprach ich zu mir selbst, bevor ich weiter kritzelte und kritzelte.
Mein neuer Nachbar war mit einem ähnlich wichtigen Projekt betraut. Der Haufen bearbeiteten Transparentpapieres auf seiner Seite nahm langsam beängstigende Ausmaße an, ohne dass es jemanden sonderlich interessiert hätte, am allerwenigsten den Boss. Kam er ins Atelier, warf er einen flüchtigen Blick auf das lichte Gebirge und den pixelnden Kollegen, und verschwand mit einer scherzhaften Bemerkung wie:
»Na, Eisenhärchen, fleißig, fleißig!«
Eisenhärchen mochte das gar nicht. Dabei war seine Frisur wirklich ungewöhnlich. Der Mann hatte einen Kopf wie grob geschnitzt. Typ Hohensteiner Kasper mit einer hohen Stirn, die fast im rechten Winkel zum platten Kopfdeckel stand. Seine spärlichen, gut gefetteten Haare trug er allesamt exakt von hinten nach vorn gekämmt, und genau auf der Stirnkante wie mit dem Lineal abgeschnitten. Furche um Furche in säuberlichen Reihen auf der hellen Kopfhaut, die aussah wie gestreift, und dann, zack, die englische Rasenbank über der Kartoffelnase.
Meist sah ich ihn im Profil und fühlte mich jedesmal an Frankensteins Monster erinnert. Zum Monster fehlten ihm jedoch die Körpergröße und die Verschraubungen an den Schläfen. Allerdings war er auch ohne Muttern verschroben. Schnükel, oder so, hieß er und kam aus dem Osten. Friegekauft oder zwangsüberwiesen blieb ungeklärt, denn eigentlich redete er nicht viel. Im Kaufhaus am Alex war sein vorheriger Wirkungskreis, und dort hatte er wohl allerlei Beschriftungen den Schaufenstern angetan. Je weniger Waren, desto mehr Parolen. Irgendwas wollten die Leute ja sehen. Scheiben-Schnükel hatten die dortigen Kollegen ihn gerufen, aber das hörte er auch nicht gern. Noch weniger aber seinen westlichen Spitznamen, den er regelrecht hasste.
War Butterbeck grinsend verschwunden, explodierte er jedesmal förmlich, wie Rumpelstilzchen, mit welchem er dann auch äußerlich eine fatale Ähnlichkeit aufwies. Dann brüllte er auf, wie ein verwundeter Löwe. »Arschloch verdammtes, elende Drecksau!« und noch einiges Schmeichelhaftes mehr, von welchem der Anstand mir gebietet, es nicht zu Papier zu lassen.
Solange sein Chef aber in natura zugegen war, zeigte er überströmendes Interesse und war mit allen seinen Vorschlägen mehr als einverstanden.
»Selbstverständlich, prima Idee, wird sofort erledigt, Herr Sturmbannführer. Jawoll.« Sogar am Telefon benahm er sich wie in einer preußischen Militärposse, sobald er die Stimme seines Herrn vernahm.
Er knickte bei jedem Jawohl förmlich zusammen, und krümmte sich dermaßen, dass er beim fünften oder sechsten Abnicken mit der Stirn auf das vor ihm liegende Reißbrett schlug. Kein Witz! Bisher dachte ich immer, Hubert von Meyerinck übertreibt hemmungslos in seinen Knallchargenrollen. Mitnichten! Die Wirklichkeit war noch viel gnadenloser und der Mann trug schwere Verletzungen davon. Auch wenn sie äußerlich nicht so direkt zu sehen waren.
War das Telefonat beendet, richtete sich der Kollege wieder auf zu der beeindruckenden Größe seiner 1,60 m und schmetterte den schuldlosen Hörer auf die erschrockene Gabel mit einer Wut, dass die Fensterscheiben vor Angst erzitterten.
»Mistkerl! Blödmann! Scheißauftrag!!!«
Es war eine Wucht. Besonders für den Telefonhörer, der schon zweimal ausgewechselt worden war und den Zuhörer, der ebenfalls immer öfter an Wechsel dachte. Auch Butterbeck tobte gern. Ein blitzeschleudernder Zeus, wenn etwas nicht nach seinem Willen lief. Und das war einiges. Der Mann litt außerdem an einer Entscheidungsneurose. Er ließ Muster für Fenstereinbauten und Sonderschauen anfertigen, gleich im Dutzend. Damit spielte er wie ein kleiner Junge mit der Eisenbahn. Wochenlang, bis es fast zu spät war. Diese Farbe, dieser Stoff vielleicht, jener Warenträger eventuell.
»Herr Spallek, baun se mir ma davon ein Produktfenster!«
Selbst fasste er schon lange nichts mehr an. Dafür gab es Leute. Aber die Kunst des Delegierens lag ihm auch nicht so recht. Nichts lief in seinem Sinne, da er sich nicht richtig mitzuteilen wusste. Es brauchte schon hellseherische Fähigkeiten, um den verborgenen Sinn der gemurmelten Absichten zu erahnen. Aber wehe, jemand schwamm nicht gleich auf der Welle, die Monsieur gerade trug, und hatte etwas missverstanden. Dann wurde sein Büro zur Löwengrube und der Boss brüllte, als wolle er sich gleich selbst fressen. Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Kaum war er wieder geschlossen und der Abgekanzelte auf Knien hinausgerutscht, lächelte er spitzbübisch den erschütterten Zeugen an. Ja, unser Ton ist rauh, liebe Frau.
Die anderen gingen etwas pfleglicher miteinander um und murrten nur hinter dem Rücken. Bevor ich anfing, Alpträume von goldenen Zeiten zu erleiden, rettete mich eine dringende Aufgabe. Eine Sonderschau für Küchenzubehöhr, in Neudeutsch Kitchen-Workshop geheißen.
Butterbeck war ausschließlich für Design modernsten Zuschnitts. Davon war er regelrecht besessen. Nostalgie war etwas völlig Fremdes für diesen vorwärts strebenden Geist. Dass es vor der Bauhaus-Moderne schon andere Stilrichtungen gegeben hatte, interessierte ihn nicht die Bohne, ja, war geradezu ein Reizthema für ihn. (Vielleicht weil er auch über keinerlei Wissen diesbezüglich verfügte?)
Und nun hatte die Leitung des Hauses ihm wieder etwas aufs Auge gedrückt, was ihm gar nicht passte. Olle Küchenherde und uralte Kochmaschinen sollten aufgestellt werden, zwischen welchen die modernen Gerätschaften zum Verkauf auslagen. Also, das lag ihm nun gar nicht, und das war mein Glück.
Meine Vorschläge überzeugten ihn, bis hin zu den Zeitungsanzeigen, und plötzlich hatte ich alle Hände voll zu tun, denn auch die Direktionsetage hatte sich begeistert gezeigt von seiner Präsentation. Mir war es recht, dass er die Lorbeeren bei diesen Herren einkassierte, nach Karriere in diesem Haus stand mir nicht der Sinn. Mir war nach Privatleben, da gab es einiges nachzuholen ...
Die Küchenaktion wurde ein Erfolg, mit Anzeigen und Plakaten, die aussahen, wie von Oma im Kreuzstichmuster gestickt. Ganz allerliebst. Von da ging es aufwärts und ich wurde ein wichtiger Mann in der Abteilung, der zu allem seinen Senf dazu geben musste.
Ich brüllte zurück, wenn der Boss laut wurde, dass die Wände wackelten, nur mit dem Unterschied, dass der Ärger von mir nicht so spurlos abprallte, wie bei ihm.
Oftmals dachte ich, der Kerl habe das Gemüt eines Kettenhundes, doch gelegentlich überraschte er auch durch eine gewisse Sensibilität. Ich begann mich für die graue Eminenz im Hintergrund zu halten und zog daraus ein nicht geringes Vergnügen. Manchmal lief ich durch das Riesenhaus und sang: Unter den Blinden ist der Einäugige König. Vergessen war, dass ich in Düsseldorf noch einen Blindenstock auf Rollen, mit Fahrradlampe und Klingel, zum Abschied von Hermann-Josef und Kurt erhalten hatte, bei dessen Auswahl ich sogar noch ahnungslos mithalf.
Düsseldorfs blindester Grafiker hatten sie mich gern gerufen, und in gewisser Weise hatten sie recht damit. Starke Vorstellungskraft und ein optisches Gedächtnis haben auch Nachteile. War ich auf einen roten Umschlag programmiert und der Vorgang mittlerweile in einem grünen abgelegt, sah ich ihn ums Verrecken nicht, auch wenn er direkt vor meiner Nase lag und in dicken Lettern auf sich hinwies. Das ist annähernd so geblieben. Zu Hause brauche ich gelegentlich ein Foto von unserer Wohnung, um die Ecken zu sehen, die noch nicht fertig sind, da ich im Geist immer die Lösung imaginiere. Solange, bis ich tatsächlich den Realzustand übersehe. Erst ein Foto vermittelt den nötigen Abstand, und manchmal erschrecke ich dann regelrecht. Blind.
Überdies wähnte ich mich immer öfter, in einer Behörde gelandet zu sein. Nicht nur wegen der ausufernden Bürokratie der Verwaltung, sondern auch wegen der Mentalität vieler Mitarbeiter. Es gab Laufzettel und Formulare für fast alles, Stechuhren und Stechschritt. Manchmal fand ich es regelrecht verwunderlich, dass in diesem Warenumschlags-Amt auch noch Geld erwirtschaftet wurde, so umständlich, wie alle Vorgänge geregelt waren. Man konnte das Gefühl kriegen, die Verwaltung sei zum Selbstzweck geworden, so emsig, wie sie Vorschriften und Formulare produzierte, die als Hemmschuh wirkten. Irgendwie kannte ich das bisher aus der freien Wirtschaft anders. Ich begriff es einfach nicht und bockte.
Angefangen hatte es mit den Stechuhren und diesen Anwesenheitskärtchen. Entweder ich steckte sie falschrum in die Uhr, oder ich ordnete sie im falschen Fach ein. Nach einer Weile gaben sie erschöpft auf. Ähnlich war es mit dem Pünktlichkeitswahn. Meist blieb ich abends länger, wenn wirklich was zu tun war. Das regte niemanden auf. Aber morgens! Umständehalber musste ich durch die Dekoabteilung, da alle anderen Türen um acht Uhr in der Früh noch geschlossen waren, und jedesmal lief ich meinem Spezi in die Arme, der bei mir nicht weisungsbefugt war. Der war mit der Anwesenheitskontrolle der Dekorateure beschäftigt, da anscheinend die Kontrolle im Personaleingang nicht ausreichend war. Zum Glück mussten die nicht auch noch ihre Fingernägel vorweisen, sonst wäre der Mann bis Mittag beschäftigt gewesen. Rauschte ich nur fünf Minuten zu spät an ihm und seinen Schäfchen vorbei, erscholl mir ein giftiges: »Mahlzeit!« entgegen, was ich mit einem gutgelaunten Lächeln und einem dummen Spruch wie: »Was gab's denn heute?« oder ähnlich Geistreichem quittierte. Auf die Dauer war das ein ödes Spiel, und so gewöhnte ich mir an, erst dann den Arbeitsplatz aufzusuchen, wenn die Luft wieder rein war, und ich plädierte für Gleitzeit.
Tatsächlich war ich dann auch der erste Mitarbeiter, der offiziell diese Möglichkeit erhielt, bis sie allgemein in der Abteilung eingeführt wurde. Passiver Widerstand kann äußerst effizient sein, das wusste niemand besser. Leider war ich dann auch der erste, dem sie wieder aufgekündigt wurde, da mein Minuskonto auf unvertretbare Weise angeschwollen war. Das war einige Jahre später, als die Gnadensonne nicht mehr so hell strahlte.
Es war nicht nur so, dass die Grafikabteilung verdächtig klein war und technisch vollkommen unzulänglich ausgerüstet, nein, es gab sogar noch eine Konkurrenzabteilung namens Verkaufsförderung, die ähnliche Ziele verfolgte, allerdings mit noch weniger Effizienz.
Und das Beste war: die wirklich wichtigen Großanzeigen wurden außer Haus gegeben. Ein Dozent vom Lette- Verein erledigte das. Ein wirklich netter Mann und guter Grafiker, der sich damit ein dickes Zubrot verdiente. Mir gefiel überhaupt nicht, wie man ihn ohne Vorwarnung von heute auf morgen absägte, nachdem ich das Geschäft aufs Auge gedrückt bekam. Jedoch was sollte ich machen? Wir verstanden uns gut, mir grollte er nicht, und überdies hatte er es kommen sehen, nachdem immer mehr Aufträge an meinen Schreibtisch abgeladen wurden.
Nach einem halben Jahr hatten auch die Tunten am Mittagstisch den Schock überwunden, dass ich mich ungefragt dazu gesellt hatte und nun auch das Frühstück mit ihnen gemeinsam verzehrte. Es war der Tisch der Auserwählten, der Erstkräfte, an welchem man nicht ungebeten saß. Anfangs versuchten sie mich zu ignorieren und benahmen sich hochmütig, aber steter Tropfen höhlt den Stein, wie schon gesagt.
Auch Hagen, der mich ja auch als Privatperson kannte und zu vermitteln versuchte, konnte an ihrer Abneigung wenig ändern. Es war und blieb eine Unverschämtheit in ihren Augen. Dabei hätte ich in der Silberterrasse sitzen können, aber mir war das Personal lieber, zumal einige allerliebste Geschöpfe die Pause versüßten. Auch die blonde Lichtgestalt aus Butterbecks Vorzimmer saß mit an dem Tisch. Und wenigstens in den Pausen wollte ich was Schönes vor Augen haben. Es war nicht so, dass ich mich rasend in ihn verliebte, diese Position war an Rudi vergeben, allerdings, aus dem Bett geworfen hätte ich ihn auch nicht.
Nein, es war wirklich nur der Wunsch etwas Nettes zu sehen, und außerdem saßen noch andere Cremeschnittchen am langen Tisch mit der orangefarbenen Resopalplatte, die vergeblich ein wenig Fröhlichkeit in der muffigen Kantine verbreiten sollte. Orange und Braun waren die Grundfarben im Saal, wie in Neukölln. Hier kam kein Fremder rein, er wäre auch nicht freiwillig geblieben. Ein riesiger Raum, verräuchert und kahl. Selbst die große Fensterfront war durch halbtransparentes Glas uneinsehbar. Aber was da so manchesmal hinter der Milchglasscheibe saß, war spektakulär.
Besonders die weiße Flotte der französischen Köche und Bäcker war mir eine Augenweide, auch wenn sie nicht schwul waren. Oder die Schönheitsköniginnen aus der Parfümabteilung, von welchen die Meisten unverkennbar weiblichen Geschlechts waren, zwischen denen aber einige ebenso unverkennbare Visagisten rumzickten, deren bestes Ergebnis das eigene Gesicht darstellte. Es wollte gar nicht zusammenpassen, die elegant ausstaffierte Gesellschaft auf den schäbigen Plastikschalen mit Stahlrohrbeinen in der nüchternen Umgebung. Als sei man in der Theaterkantine eines Gesellschaftsstückes gelandet mit großer Besetzung gelandet.
Aber es war hochinteressant, denn stets herrschte ein eifriges Kommen und Gehen, da die Pausenzeiten gestaffelt waren. Die Kantine war anregend, das Essen weniger. Zwei Hauptgerichte. Ein schlichtes für den kleinen Geldbeutel und ein exklusives für die Besserverdienenden. Das trennte die Spreu vom Weizen. Am Essplatz von Herrn Bukett, der ebenfalls mit einigen seiner alten Getreuen an einem Vierertisch saß, verzehrte man natürlich die gehobene Variante, egal was angeboten wurde.
An unserem Tisch ging es eher gemischt zu. Einer war so geizig, dass er sich noch die Teebeutel von zu Hause mitbrachte, weil sie an der Theke einen Groschen kosteten, andere taten so, als wären sie mit Goldlöffeln im Maul geboren worden. Man konnte seine Studien machen. Lediglich zwei Heteros saßen bei uns. Ein Substitut mit Frau und Kind und unsere Frau Müller. Ach ja, das Neutrum Gisela war auch meist anwesend und beklagte sich bei Hagen über die Ungerechtigkeit des Tages. Der große Wortführer war ein Kleiner Bayer, pfiffig und wendig, jederzeit zu einem Schmäh bereit. Ein lustiges Kerlchen, welches stets in einen Rechtsstreit, meist mit seinem Vermieter, verwickelt war und saukomische Anekdoten darüber lautstark zu verbreiten wusste.
Nach dem hinreißenden Assistenten gefiel der mir am Besten. Gern kam er ins Atelier geschlichen, auf der Suche nach menschlicher Wärme nebst einem Gläschen, um sein Öfchen anzuheizen. Der Mann war erfrischend direkt und gehörte zu den beliebtesten Kollegen, worauf er ziemlich stolz war. Kurt der Kurze.
Nach Feierabend gingen wir gern zusammen noch ein Bier trinken, in der Andreas Kneipe gleich neben dem großen Kaufhaus. Man konnte diese Kneipe auch als erweiterte Kantine für uns betrachten, da einige schon die Mittagspause am Tresen verbrachten. Eigentlich war es verboten, ohne Vermerk auf der Stempelkarte das Haus zu verlassen. Aus versicherungstechnischen Gründen, wie es hieß, aber Typen wie Waldi, das war unser Stoffkünstler, oder die etwas robusteren Herren aus der Tischlerei und der Schmiede, ignorierten ständig die Vorschriften und verbrachten ganze Nachmittage gesellig. Bis der Pieper sie ans nächste Telefon rief, um Rückmeldung zu machen und zu erfahren, wo die nächste Arbeit auf sie lauerte.
Hätte Herr Bukett auch nur geahnt, wo sich seine Schäfchen herumtrieben, wären sie auf der Stelle gefeuert worden. Bestrafung war dieses Mannes höchstes Vergnügen. Und er hielt viel aus, um dieser Lust weiterhin zu frönen. Manchmal sah man ihn aus Butterbecks Zimmer kommen, grau und erschöpft, denn er war sein beliebtestes Hassobjekt und der Boss ließ keine Gelegenheit aus, ihn zu demütigen.
»Hört denn das nie auf?«, vernahm ich einmal zufällig, als er sich allein wähnte und verzagt die Flügeltür hinter sich und seinem Herrn schloss Er hätte fast Mitleid verdient, aber anderseits war er so boshaft, dass das Mitgefühl sich bei allen, die enger mit ihm zu tun hatten, in Grenzen hielt.
Leider, leider besaß der Mann auf der Seite zur Kneipe hin keine Augen, denn nur die Geschäftsleitung hatte Fensterscheiben, die einen Durchblick ermöglicht hätten. Dort aber hielt er sich so gut wie nie auf. Und machte er einen Kontrollgang ums Haus, musste er sich aus versicherungstechnischen Gründen unmittelbar an den Schaufensterscheiben entlang bewegen, da er sonst wegen Verlassens des Betriebsgeländes hätte ausstempeln müssen. Also konnte er auch nicht mal eben über die Straße, um Stichproben vorzunehmen. Wie ein hungriger Hai im Aquarium kreiste er mehrmals täglich von außen um die Schaufenster, immer auf der Suche nach Mitarbeitern, die schnell eine Zigarette rauchten oder ein Privatschwätzchen hielten. Er hatte so eine Art, unvermittelt wie ein Geist aufzutauchen und er hatte eine Nase für Saumseligkeiten.
»Haben Sie nichts zu tun !?« Dieser Spruch, mit zuckersüßer Stimme gestellt, war gefürchtet, denn meistens war er der Beginn größter Unannehmlichkeiten.
So kamen die Kneipenbesucher immer davon. In den Hintergrund abtauchen, wenn er ums Gebäude schlich, und wenn der Pieper loslegte, sichern, schwupps über die Straße zur Toreinfahrt oder zum Seiteneingang mit dem Fahrstuhl, der selten genutzt wurde und vorrangig den Diktatoren aus der zweiten Etage diente.
Bedauerlicherweise saß in unserer Kantine nicht nur der schöne Jürgen aus dem Vorzimmer und sein fast genau so lieblicher Exfreund, der im übrigen auch Jürgen hieß. Natürlich nicht, denn auch der weniger attraktive Kollege hatte hier sein Plätzchen. Mister Neumann entsprach sämtlichen Vorurteilen, die Heteromänner von Schwulen haben, gleich im Quadrat. Vom einfachen Dekorateur war er emporgestiegen in die lichten Höhen von Butterbecks Sekretariat, wie auch sein schöner Kollege.
Jürgen Menzel war gelebte Diskretion, sein Büropartner das genaue Gegenteil. Meist erschienen sie im Duett. Wie Max und Moritz auf der Berliner Durchreise (bekannte Modewoche). Der in sich gekehrte große Blonde und sein unentwegt plappernder Gegenpart, der ständig Belanglosigkeiten von sich gab. Ein sonniges Gemüt. Mit einer Selbstsicherheit, die fast schon beneidenswert war. Ich ärgerte mich manchmal, wenn ich eine unbeabsichtigte Blödheit begangen hatte und es erst hinterher merkte. Dieser hier kannte keinerlei Selbstzweifel. Er war authentisch bis zur Selbstaufgabe und merkte nicht einmal, wenn er ungeheuren Blödsinn verzapfte. Für ihn war das außerordentlich befreiend und seine Welt blieb zeitlebens zuverlässig flach.
Direkt hässlich konnte man ihn auch nicht nennen, so ein bisschen Typ Elton John, den ich auch nicht so unbedingt sexy finde. Sein Freund war ein heißblütiger Italiener, ein bisschen klein und pummelig, aber oho. Originell waren sie beide.
Ausgerechnet dieser Kollege schien ein Auge auf mich geworfen zu haben. Irgendwie hatte ich den Aufprall nicht gespürt, weil ich meinerseits nur Augen für die Herrlichkeit an seiner Seite besaß. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hatte er mich zu einem privaten Treffen unter Kollegen zu sich nach Hause gelockt. Da geht man doch auch gern mal eine private Verbindung ein, wenn ein solcher Kreis von berufsbezogenen Fachleuten zum Gedankenaustausch auch noch die Freizeit opfert.
Ja, und da sitzt dann kein großer Blonder oder sonst ein Kollege, außer dem festlich geschmücktem Gastgeber, und der erzählt dir, wie gut er erst einmal in seiner Jugendzeit, in Unna vor vier Jahren, ausgesehen hat. Und zum Beweis hat er dir einen in Kalbsleder gebundenen Folianten in XXL-Format auf den Schoß gedrückt, der um die Zeugungsfähigkeit fürchten lässt, und in welchem er eifrig blättert, von Geburt bis Mallorca-Urlaub in Monaco, während er immer näher rutscht, und die Tür geht auf, weil der heißblütige Italiener erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Wo Italiener doch so eifersüchtig sind und kleine Pötte erst recht schnell überkochen. Der arme Carlo mag sich gewundert haben, dass meine Begrüßung so enthusiastisch ausfiel. Man weiß ja nie, ob die Vendetta in diesen Kreisen gänzlich ausgestorben ist.
Mir gegenüber legte er jedenfalls von Stund an ein gewisses Misstrauen an den Tag, während ich ihn nie darüber aufklären mochte, warum ich eigentlich gekommen war. Das erschien mir herzlos. Und so hörten wir noch gemeinsam ein abwechslungsreiches Stündchen deutsches Schlagergut. Ja, und dann hatte ich vorher noch blöderweise eine Geburtstagseinladung bei seinen Freunden angenommen. Wenn man noch fremd ist, eine gute Gelegenheit, den Bekanntenkreis zu erweitern, und Kollege Uwe hatte das Maul ziemlich weit aufgerissen.
»Du führst mich in die Geheimnisse der Grafik ein und ich dich in die Berliner Gesellschaft«, hatte er getönt und dabei eine Liste von Prominenten heruntergerasselt, die klang wie das Berliner Who is Who, die ebenfalls eingeladen worden waren. Er kannte diese tatsächlich, denn er führte die VIP-Kartei des Hauses und entschied, wer zu welchem Empfang eingeladen wurde und welcher Autor zur Signierstunde. Natürlich gab es gewisse Anweisungen vom Direktorium, aber die Einladungslisten liefen über seinen Schreibtisch, und die Verhandlungen mit den gehätschelten Promis führte fast ausschließlich er mit seiner leicht quäkenden Telefonstimme, die zu exorbitanten Schmeicheleien fähig war.
Ebenso stellte er die Programme für Veranstaltungen im Haus zusammen, und die Mannequins für Modenschauen wurden auf seine Empfehlung engagiert, vorausgesetzt Butterbeck war mit deren Aussehen einverstanden. Prominenz war Uwes ganze Welt und die Upperclass sein Leben. Darin harmonierte er auch vollkommen mit seinem Freund Carlo, der die Generalvertretung für ein bekanntes Kreditkarten-Unternehmen innehatte. Beide wohnten standesgemäß am Rüdesheimer Platz, und bei der Einrichtung war auch nicht gespart worden. Dort sah er aus wie auf den Fotos, die in Illustrierten von den Behausungen prominenter Mitbürger Zeugnis ablegten. Jaha. Und nun sollte ich ganz allein in diese illustre Gesellschaft eingeführt werden, denn Rudi hatte wenig Lust verspürt auf den ganzen Rummel.
Schon das Haus in der Kantstraße, in welchem die Prominenzfete stattfinden sollte, wirkte nicht eben vertrauenerweckend, aber derlei war in Berlin bedeutungslos. Hinter wackeligen Stiegen und Putzschäden im Treppenhaus verbargen sich oftmals ganze Schlösser, zumindest im Vorderflügel. Hinten allerdings hatte man schon vor dem Krieg gespart. Sogar unsere Wohnung in Neukölln hatte einst den beliebten Personaleingang besessen, jetzt war er zugemauert. Dieser Quatsch mit dem Status war längst abgeschafft worden. Unsereins konnte nur grinsen über Schilder wie Aufgang nur für Herrschaften oder die formidablen Klingelkästen in der Küche, die anzeigten, in welchem Raum Hilfe benötigt wurde. Wahrscheinlich damit sich das blöde Zimmermädel nicht in der weitläufigen Dreizimmerresidenz verirrte. Viele Mieter bevorzugten mittlerweile die relative Ruhe der Hinterhäuser, abgeschirmt vom Straßenlärm. Und dennoch! Irgendetwas war geblieben von der minderen Wertschätzung des Gartenhauses, wie es im eleganten Westen Berlins vornehm umschrieben wurde.
Der Innenhof, den ich durchquerte, zeigte noch Spuren des ehemaligen Großbürgertums, mit seiner runden Rabatte in der Mitte, die nur wenig verwildert war. Aber die Zweizimmerbutze, die ich betrat, war dann doch eher auf Personalniveau. Wohin man auch blickte, waren Bömmelchen und Fransen, kunstseidene Lampenschirmchen mit Glasperlenbehang in Puffrosarot. Rosa Wolken vor den Fenstern, rosa Stimmung unter den ausschließlich männlichen Gästen. Hier sollte ein Stelldichein der Prominenzen stattfinden? Hatte denen noch keiner gesagt, dass die Sechziger Jahre längst vorbei waren? Im Trend lag immer noch Art-Deko, die Retrowelle schwappte erst langsam zu den Fünfziger Jahren. Oder waren die so ultramodern, dass sie zehn Jahre einfach übersprangen, und ich erlebte zum ersten Mal, wie wir Geschichte wurden? Nein, wohl doch nicht, die Gäste waren originell. Die meisten von ihnen waren von der effeminierten Sorte, die angeblich viel mutiger ihre Sexualität zeigten, als wir gewöhnlichen Homomänner. Diese hier waren besonderes mutig.
Schon im Hof war das Gekreisch unüberhörbar gewesen. Ich glaub ja gerne, dass eine gewisse Courage dazu notwendig ist, sich dermaßen affektiert zu geben, aber warum es immer die hässlichsten Vögel der Community sein müssen, erklär mir mal einer. Weil bei denen sowieso schon keine Chance besteht, den Traummann zu finden? Und eh alles egal ist? Emanzipation ist ja gut und schön, aber muss man seine Sexualität gleich dermaßen plakativ dem abgeneigten Publikum vor die Füße knallen? Und dauernd?
Oder gehts es auch eine Nummer leiser und etwas weniger exaltiert. Die Parallelen zur Frauenemanzipation schienen mir unübersehbar. In den Fernsehdiskussionen rissen auch immer jene den schmallippigen Mund am weitesten auf und tönten über männliche Gewalt gegen Frauen, die sie am wenigsten zu befürchten hatten. Man muss nicht gleich ein Macho sein und beladen mit Vorurteilen, wenn man die Komik sieht. Und komisch konnten sie sein - gelegentlich. Meist fand ich allerdings die Kreischschwestern nervtötend und ziemlich unoriginell. Nur wenn eine gewisse Pfiffigkeit dahinter steckt, mag ich es leiden. Und besonders helle schien mir an jenem Abend keiner.
Schon der Gastgeber starrte mich fassungslos an, nachdem er sein Geschenk ausgewickelt hatte. Jüngst hatte ich mir eine ultraschicke Artdeco-Schachtel als Zigaretten-Etui in Schwarzlack mit Silberstreifen gegönnt. Mit wehem Herzen hatte ich mich von dem schönen Stück getrennt. Und nun das! Der Typ sah nur eine alte Blechschachtel vor sich. So eine Schachtel war das. Kollege Uwe war an meine Seite geeilt, um die Vorstellung zu übernehmen. Der jauchzte auch gleich los:
»Ah, wie toll, Mike, das ist ja reines Art-Deco!«
Stimmt, vorher hatte ich sie noch extra sauber gemacht und auf Hochglanz poliert. Die Dose glänzte mit mir um die Wette. Offensichtlich war das Geburtstagskind in Stilfragen nicht so bewandert, denn sein Mienenspiel änderte sich nicht. Immer noch stierte er kommentarlos auf das hochelegante Etui.
»Meensch, wo hast du das nur aufgetrieben?«, sprang Uwe bei. »Das ist ja supertoll!«
Für teures Geld hatte ich im Antiquitätenhandel die Rarität erworben und mein Herz blutete noch ein wenig, sie gleich wieder herzugeben. Der so Beschenkte war leider nicht zu überzeugen. Blech bleibt Blech, und Uwe redete ohnehin viel Blech. Mit spitzen Fingern packte er das alte Ding auf den Gabentisch und würdigte es keines Blickes mehr. Ebenso wenig wie mich, was in dem kleinen Wohnraum gar nicht so einfach war, denn ich fand mich alsbald von zänkischen Nebelkrähen aller Art umlagert, die mich anscheinend für prominent hielten. Wer weiß, was Uwe ihnen vorher erzählt hatte. An blühender Phantasie bestand offensichtlich ein gewisser Überschuss in seinen grauen Zellen. Ach nein, bei ihm waren sie ja rosa. Die von ihm groß angekündigten Spitzen aus Film, Funk und Fernsehen hatten es allesamt vorgezogen, einen anderen Termin wahrzunehmen.