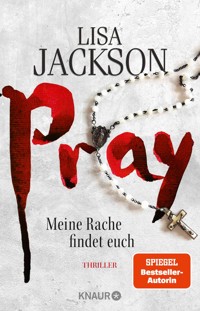6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein West-Coast-Thriller
- Sprache: Deutsch
Er wählt seine Opfer mit Bedacht und tötet sie langsam. Doch eigentlich übt er nur – denn das wahre Ziel seiner Obsession ist die berühmte Schauspielerin Jenna Hughes. Bis zu dem Tag, an dem er sie in seiner Gewalt hat, will er seine Kunst perfektioniert haben. Als Jenna sich vor dem Trubel Hollywoods in einen abgelegenen Ort in den Bergen Oregons zurückzieht, sieht der Killer seine Stunde gekommen. Unablässig beobachtet er sein Opfer, verfolgt jede ihrer Bewegungen – und muss mit wachsendem Zorn erkennen, dass sie eine neue Liebe und damit einen Beschützer gefunden hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lisa Jackson
Sanft will ich dich töten
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Hartmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Er wählt seine opfer mit Bedacht und tötet sie langsam. Doch eigentlich übt er nur – denn das wahre Ziel seiner Obsession ist die berühmte Schauspielerin Jenna Hughes. Bis zu dem Tag, an dem er sie in seiner Gewalt hat, will er seine Kunst perfektioniert haben. Als Jenna sich vor dem Trubel Hollywoods in einen abgelegenen Ort in den Bergen Oregons zurückzieht, sieht der Killer seine Stunde gekommen. Unablässig beobachtet er sein Opfer, verfolgt jede ihrer Bewegungen – und muss mit wachsendem Zorn erkennen, dass sie eine neue Liebe und damit einen Beschützer gefunden hat …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Epilog
Danksagung
Prolog
Im vergangenen Winter
Sie wartete, reglos.
Als ob sie seine Nähe spürte.
Er konnte es fühlen – dieses pulsierende Verlangen zwischen ihnen, als er über eine spärlich beleuchtete Fläche hinweg auf das Bett blickte, in dem sie im Halbdunkel lag. Jenna Hughes. Die Frau seiner Träume. Die eine Frau, für die er seit langem lebte. So nahe. Und in seinem Bett. Endlich in seinem Bett.
Und er war bereit. Weiß Gott, er war bereit. Schweißperlen traten ihm auf Oberlippe und Stirn. Sein Glied wurde steif, seine Nerven waren wie elektrisiert.
Die Lampen waren gedimmt; ein paar Nachtlichter verliehen dem großen Raum eine intime Atmosphäre voller Schatten und dämmeriger Winkel. Leise Musik, der romantische Soundtrack des Films Beneath the Shadows, wisperte durch den höhlenartigen Raum. Sein Atem bildete eine Wolke in der kalten Luft, während er sie in dem hauchdünnen schwarzen Body betrachtete, den er für sie gekauft hatte. Wie lieb, dass sie ihn zu diesem ganz besonderen Stelldichein angezogen hatte. Zu ihrem ersten.
Braves Mädchen.
Der Body aus Seide und Spitze schmiegte sich perfekt an ihre Figur. Genauso, wie er es sich vorgestellt hatte.
Durch den zarten Stoff hindurch konnte er ihre Brüste sehen. Die dunklen Brustwarzen, die durch die Spitzen lugten, sahen beinahe nass aus. Hatte sie sie für ihn befeuchtet? In freudiger Erwartung?
Wunderschön.
Er lächelte in sich hinein in der Gewissheit, dass sie genauso begierig war wie er.
Wie lange hatte er diesem Augenblick entgegengefiebert? Er wusste es nicht mehr. Egal. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Die Pillen, die er zum Wodka geschluckt hatte, zeigten Wirkung; er näherte sich dem perfekten Rauschzustand – gerade genug Chemie, um den Genuss dieses Augenblicks zum Äußersten zu steigern.
»Ich bin hier«, ließ er sie leise wissen, in der Erwartung, dass sie den Kopf drehte, eine fein geschwungene schwarze Augenbraue hochzog und ihm einen verheißungsvollen Blick zuwarf. Oder vielleicht würde sie sich auf den Ellenbogen aufstützen und ihm langsam mit einem Finger winken, ihn schweigend zu sich heranziehen, den Blick ihrer silbergrünen Augen in den seinen gesenkt.
Doch sie rührte sich nicht. Kein Strähnchen ihres ebenholzschwarzen Haars bewegte sich. Sie lag einfach da auf dem Bett und starrte an die Decke.
Das war nicht richtig.
Er erstarrte.
Sie sollte ihn anblicken. So wollte er es.
»Jenna?«, rief er leise.
Nichts. Nicht einmal ein flüchtiger Blick aus den Augenwinkeln in seine Richtung.
Was war los mit ihr? Da lag sie nun, gekleidet wie eine verdammte Nutte, und tat, als sei es ihr völlig gleichgültig, dass er bei ihr war, dass diese Nacht eine ganz besondere für sie war. Für ihn. Für sie beide.
Nicht schon wieder!
Er knirschte mit den Zähnen vor Enttäuschung über ihr kaltes Desinteresse. War das ein Spielchen? Wollte sie ihn reizen? Was zum Teufel ging hier vor?
»Jenna, sieh mich an«, befahl er in scharfem Flüsterton.
Doch als er sich ihr näherte, bemerkte er, dass sie nicht so perfekt war, wie er geglaubt hatte. Nein … Ihr Make-up stimmte nicht. Ihr Lippenstift war zu blass, ihr Lidschatten kaum sichtbar. Er hatte gewollt, dass sie mehr wie eine Hure aussah. So verlangte es sein Plan. Hatte er ihr nicht gesagt, sie solle eine Prostituierte darstellen? Ist sie nicht auch angezogen wie eine Prostituierte? Ist das nicht ein Teil deines Traums?
Verdammt, er konnte nicht mehr richtig denken. Sein Verstand war nicht so klar, wie er gehofft hatte. Das lag wahrscheinlich an den Drogen … Oder war etwas anderes der Grund? Etwas Bedeutsames? Jenna reagierte nicht so, wie er gehofft hatte.
Sie wusste genau, was ihm gefiel.
Andererseits war sie schon immer eigensinnig gewesen. Distanziert. Eiskalt. Das war einer der Gründe, weshalb er sich so von ihr angezogen fühlte.
»Komm schon, Baby«, flüsterte er, beschloss, ihr noch eine Chance zu geben, obwohl es ihm schwer fiel, sich zu konzentrieren. Vielleicht war er doch ein bisschen zu high und erkannte diese feinen Nuancen der Lust nicht, für die sie bekannt war. Das musste es sein. Sein Verstand war etwas zu benebelt, sein Denken nicht ganz klar, seine Lust hatte die Oberhand über seine Vernunft. Innerlich zitterte er, empfand ein Gefühl der Beklemmung in der Brust. Seine Erektion war steinhart, drängte sich gegen seinen Hosenlatz, doch die Bilder in seinem Bewusstsein waren etwas verschwommen.
Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Schluss mit der Warterei.
Er kniete sich mit einem Bein neben sie auf die Matratze, wobei die Sprungfedern laut quietschten.
Sie sah ihn immer noch nicht an.
»Jenna!«, sagte er schärfer als beabsichtigt. Sein Temperament drohte mit ihm durchzugehen, seine Zunge war ein wenig schwerfällig.
Ruhig bleiben. Sie ist schließlich hier bei dir, nicht wahr?
»Jenna, sieh mich an!«
Sie zuckte nicht einmal mit der Wimper.
Starrsinniges, undankbares Weib! Nach allem, was er für sie getan hatte! Nach all den Jahren, während derer er nur an sie gedacht hatte! Wut stieg in ihm auf, seine Hände begannen zu zittern.
Beruhige dich! Du kannst sie immer noch haben. In deinem Bett. Sie ist schließlich nicht gegangen, oder?
»Jenna, ich bin hier«, sagte er.
Sie ignorierte ihn.
Rasender Zorn drohte ihn zu übermannen, doch er versuchte, ihn niederzukämpfen. Sie trieb ein Spielchen mit ihm, weiter nichts. Sie wusste, dass er sie umso mehr begehrte, umso erregter wurde, je gleichgültiger sie sich gab. Und das war desto besser.
Oder?
Er wusste es nicht. Konnte sich nicht recht darauf besinnen.
Er schwitzte, obwohl die Temperatur im Raum nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt lag. Doch zugleich glühte er innerlich, brachte ein Feuer sein Blut in Wallung.
Spürte sie es denn nicht – dieses intime Band, das sie aneinander fesselte?
Er beugte sich über sie und fuhr mit zitterndem Finger die Kontur ihrer Wange nach. Sie fühlte sich warm an.
Dann begriff er. Das alles gehörte zu ihrem Traum. Er sollte sie nicht als Jenna Hughes betrachten, sondern als eine der Rollen, die sie auf der Leinwand gespielt hatte. War sie nicht angezogen wie Paris Knowlton, die Prostituierte aus New Orleans in ihrem Film Beneath the Shadows? Hatte er nicht selbst gewollt, dass Jenna in dieser Nacht die Rolle der Paris spielte? Und tat sie nicht genau das? Plötzlich ging es ihm besser, und die Glut, die durch seine Adern strömte, rührte nun eher von Lust und Drogen als von Wut her.
»Paris«, raunte er und berührte liebevoll ihr dunkles Haar. Es schimmerte blauschwarz im trüben Licht. »Ich habe dich gesucht.«
Immer noch keine Antwort.
Gott, was wollte sie denn? Er spielte schließlich seine Rolle … oder etwa nicht?
»Jenna?«
Nicht einmal ein flüchtiger Blick in seine Richtung. Plötzlicher Zorn flammte auf. Er hörte das Blut in seinen Ohren rauschen. »Oh, ich verstehe«, fauchte er und fuhr mit den Fingern grob über ihren Hals. »Dir macht das wirklich Spaß, wie? Du spielst anscheinend gern die Hure.«
Er hörte ein leises Keuchen.
Endlich!
Seine Finger legten sich um ihren Hals. Er fühlte sich warm an unter seiner Berührung. Nachgiebig. Er versuchte, ihren Puls zu ertasten, während er zudrückte.
Ein Stöhnen.
Schmerz oder Wollust?
»So hast du’s gern, nicht wahr? Du magst es, wenn ich grob bin, wie?«
»O Gott, nein!« Ihre Stimme schien aus weiter Ferne zu kommen, hallte in seinem Kopf, wurde von den Wänden zurückgeworfen. »Nicht!«
Sein Griff wurde fester, grub sich in ihr beinahe heißes Fleisch.
»Aufhören! Bitte! Was soll das?«
Er war so erregt, dass er zitterte, doch er konnte die Hände nicht von ihrem Hals lösen, um den Reißverschluss seiner Hose zu öffnen. Dann schüttelte er sie, dass ihr Kopf heftig hin und her geschleudert wurde. Ihre schönen grünen Augen waren noch immer starr auf ihn gerichtet.
Ein entsetzter Schrei hallte durch den Raum.
Jennas Kopf fiel in den Nacken.
Ihr Hals bewegte sich unter seinen Händen.
Ein weiterer panischer Schreckensschrei brach sich an den Deckenbalken und hallte in seinem Kopf nach.
»Miststück!« Er schlug sie grob ins Gesicht.
Klatsch! Der Schlag riss ihren Kopf herum.
»O Gott!« Jetzt weinte sie. Schluchzte. »Nein, nein, nein!«
Ihr Make-up zerlief, ihre makellosen Gesichtszüge waren durch den Schlag verzerrt. Ihr Haar löste sich, die dichte schwarze Perücke fiel auf das zerwühlte Laken, Jennas kahler Kopf schimmerte im Dämmerlicht.
Ein Keuchen.
Sie warf den Kopf zur Seite.
So war es schon besser.
Er hob wieder die Hand.
»Nicht … O Gott, bitte nicht!«, flehte sie mit unbewegten Lippen. »Was soll das?« Sie jammerte laut, beinahe unverständlich, und ihre Stimme klang schrill vor Panik. Doch ihre Schultern blieben steif. Regungslos. Keine Leidenschaft zeigte sich auf ihrem Gesicht.
Hier war irgendetwas faul, sehr faul …
»O Gott, o Gott, o Gott … aufhören, bitte.«
Der verängstigte Tonfall, das atemlose Schluchzen hallten durch den Raum, und doch rannen keine Tränen aus Jennas Augen, sie blinzelte nicht einmal. Ihre Lippen zitterten nicht. Ihre Schultern bebten nicht. Ihr Körper zuckte nicht …
Er blinzelte. Rang um Klarheit in seinem Kopf. Seine Erektion erschlaffte, als ihm bewusst wurde, wo er war und was er da tat.
Verdammt!
Er blickte auf Jenna Hughes nieder und ließ sie, als hätte er sich die Hände verbrannt, auf die zerknitterten Seidenlaken zurückfallen.
Krach!
Ihr Kopf schlug auf dem Bettrahmen auf.
Ein Kreischen schieren Entsetzens gellte durch den Raum.
Jennas Hals brach.
Ihr kahler Kopf löste sich vom Körper.
»O Gott, neiiiin!«
Der Kopf rollte mit weit aufgerissenen Augen von der Matratze.
Mit einem dumpfen Aufprall landete der Kopf auf dem Boden dieses Raumes, der seine Zuflucht und sein Heiligtum war.
Die Schreie wurden hysterisch; entsetzliche Schluchzer erfüllten den Raum, prallten von den Wänden ab und jagten ihm eiskalte Schauer über den Rücken.
»O Gott! Bitte nicht!« Ihre Stimme schien hoch aufzusteigen, das ganze Haus zu erfüllen. Also empfand sie doch. Und trotzdem sah sie ihn nicht an. Etwas war faul hier … gründlich faul.
Auf dem Boden zogen Jennas Züge sich zusammen und verflossen zu einem Brei, der einmal ihr Gesicht gewesen war.
Sein Verstand wurde schlagartig wieder klar.
Er erkannte, dass seine beinahe perfekte Schöpfung, seine Wachsmaske von Jenna Hughes’ hinreißendem Gesicht, zerstört war.
Weil er nicht hatte warten können.
Weil er zu viele Pillen geschluckt hatte.
Weil er sie so sehr begehrte, dass er die Beherrschung verloren und sie geschlagen hatte. Lange bevor das Abbild richtig fest geworden war.
»Dummkopf«, knirschte er und schlug sich selbst vor den Kopf. »Idiot!« All die Arbeit für nichts und wieder nichts. Das wunderschöne Gesicht – würde er es rekonstruieren können? Eben noch war es beinahe lebensecht gewesen, und jetzt war es dahin; ehemals ein Michelangelo, jetzt ein Picasso, mit verzerrten Zügen um blinde Augen herum, die glasig und leer starrten.
Er richtete sich auf, wich vor dem Chaos auf dem Bett zurück. Kein Blut war zu sehen. Kein Fleisch, keine Knochen. Nicht von dieser leblosen Gestalt. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und blickte über die Schatten seiner dunklen, sorgfältig vorbereiteten Bühne hinweg, auf der mehrere beinahe perfekte Mannequins stumm und abwartend in der Dämmerung standen. Sie waren wunderschön, aber nicht lebendig. Nachbildungen von Jenna Hughes.
Aber diese eine! Er sah sein vormaliges Meisterwerk noch einmal an und furchte die Stirn. Eine erbärmliche Nachbildung! Er war in letzter Zeit unkonzentriert gewesen.
»Bitte … lassen Sie mich gehen.«
Er kam wieder auf die Füße und spähte über die Schulter in die dunkle Ecke. Sein Blick heftete sich auf die lebendige Frau, die, nackt und gefesselt, gerade aus ihrem durch Drogen herbeigeführten Schlaf erwachte. Es war ihre Stimme gewesen, die er hörte. Ihre Panik, die durch den Raum gellte.
»Bitte«, wimmerte sie noch einmal leise, und er lächelte, empfand neue Hoffnung, als er ihren Körperbau und die Gesichtszüge musterte. Die Breite der Stirn, die gerade Nase, die hohen Wangenknochen unter großen, angsterfüllten Augen. Sie war schmutzig blond, doch die Haarfarbe war seine geringste Sorge. Was das Gesicht betraf, war sie beinahe ein Volltreffer. Er grinste breit, und das Chaos vor ihm war bereits wieder vergessen.
Die nächste Nachbildung der Jenna Hughes würde perfekt sein.
Dieses erbarmungswürdige Geschöpf, das gefesselt um sein Leben flehte, war anatomisch genau das Richtige.
Seine Wut verrauchte sogleich, als er zum Fenster hinüberschaute, durch dessen Scheiben schwaches Mondlicht drang. Draußen auf der Fensterbank schmolz der Schnee.
Der Winter ging zu Ende.
Frühlingshaftes Tauwetter lag bereits in der Luft.
Er musste sich beeilen.
1. Kapitel
Im diesjährigen Winter
Sie sorgen sich also wegen des bevorstehenden Unwetters«, sagte Dr. Randall in seinem Sessel beim Schreibtisch ruhig. Er hatte sich so gesetzt, dass nur eine Orientbrücke auf dem polierten Holzfußboden seines Sprechzimmers ihn von seinem Klienten trennte.
»Ich mache mir Sorgen wegen des Winters.« Die Antwort klang zornig, aber es war ein kalter Zorn. Der Mann, groß und wortkarg, saß in einem Ledersessel beim Fenster. Er musterte Randall mit hartem, unversöhnlichem Blick.
Randall nickte, als ob er verstünde. »Sie machen sich Sorgen, weil …?«
»Sie wissen, warum. Wenn die Temperaturen sinken, scheint sich immer alles zum Schlimmeren zu verändern.«
»Zumindest für Sie.«
»Genau. Für mich. Deswegen bin ich doch hier, oder?« Sein steifer Nacken und die weiß hervortretenden Knöchel der gefalteten Hände verrieten seine Anspannung.
»Weswegen sind Sie hier?«
»Behandeln Sie mich nicht wie ein Kind. Sparen Sie sich dieses hinterhältige Psychogequatsche.«
»Hassen Sie den Winter?«
Ein Stutzen. Sekundenlanges Zögern. Der Patient blinzelte. »Überhaupt nicht. Hassen ist ein reichlich starkes Wort.«
»Was würden Sie dann sagen? Was wäre das richtige Wort?«
»Es ist nicht die Jahreszeit, gegen die ich etwas habe. Vielmehr das, was dann passiert.«
»Vielleicht liegt Ihre Sorge, dass in dieser Jahreszeit alles schlimmer wird, nur in Ihrer eigenen Wahrnehmung begründet.«
»Wollen Sie abstreiten, dass im Winter Schlimmes geschieht?«
»Natürlich nicht, aber auch in anderen Monaten ereignen sich manchmal Unfälle oder andere Tragödien. Menschen ertrinken im Sommer beim Baden, stürzen beim Bergwandern von Felsen, erkranken durch Parasiten, die sich nur in der heißen Jahreszeit vermehren. Jederzeit kann Schlimmes passieren.«
Der Patient biss die Zähne zusammen, sodass sein Kinn hart und kantig aussah, während er sich offenbar innerlich mit dieser Vorstellung auseinander setzte. Er war ein hochintelligenter Mann, sein IQ war beinahe der eines Genies, doch es fiel ihm schwer, mit der Tragödie fertig zu werden, die sein Leben so stark beeinträchtigte. »Vom Verstand her weiß ich das, aber für mich persönlich ist im Winter immer alles schlimmer.« Er blickte aus dem Fenster, hinter dem graue Wolken den Himmel verdunkelten.
»Wegen des Vorfalls in Ihrer Jugend?«
»Sagen Sie’s mir. Sie sind der Seelenklempner.« Er warf dem Psychologen einen kalten Blick zu, bevor er flüchtig lächelte, ein kurzes Aufblitzen von Zähnen, das, wie Dr. Randall vermutete, die meisten Frauen schwach gemacht hätte. Dieser Mann war ein interessanter Fall, und er wurde noch interessanter durch den Pakt, den sie miteinander geschlossen hatten: Es durfte keine Notizen, keine Aufnahmen, nicht einmal eine Termineintragung in Dr. Randalls Kalender geben – nichts, was darauf hindeuten konnte, dass sie einander je begegnet waren. Die Sitzung war streng geheim.
Sein Patient warf einen Blick auf die Uhr, griff in seine Gesäßtasche und zückte sein Portemonnaie. Er zählte die Scheine nicht ab. Sie steckten bereits säuberlich gefaltet in einem Extra-Fach.
»Wir sollten uns bald wiedersehen«, schlug Dr. Randall vor, während das Geld auf einer Ecke seines Schreibtisches abgelegt wurde.
Der hoch gewachsene Mann nickte knapp. »Ich melde mich.«
Und das würde er tatsächlich tun, dachte Dr. Randall und strich gedankenverloren die Falte aus den knisternden Zwanzigern, während die Stiefeltritte seines Patienten bereits auf der hinteren Treppe verhallten. Denn so sehr der Mann sich einzureden versuchte, dass er keine Therapie benötigte – er war doch klug genug zu erkennen, dass die Dämonen, die er sich austreiben wollte, sich tief im dunkelsten Winkel seiner Seele eingenistet hatten und sich ohne geeignete Maßnahmen – die Behandlung, gegen die er sich so sehr sträubte – nicht würden vertreiben lassen.
Hochmut kommt vor dem Fall, dachte Randall und schob die Scheine in seine abgeschabte Brieftasche. Er hatte es immer wieder erlebt. Auch wenn es seinem Patienten selbst nicht bewusst war – dieser Mann stand kurz vor einem Absturz.
»Gottverdammter Köter, wo zum Teufel steckst du jetzt schon wieder?«, knurrte Charley Perry und schob seinen Kautabak in die andere Backe. Er stromerte durch die Wildnis, weit oberhalb des Columbia River, wo es kaum etwas anderes als überaltertes Nutzholz gab. Gerade drang das erste Tageslicht zwischen den Bäumen hindurch. In der Schlucht kündigte sich bereits der Winter an, und seine blöde, nichtsnutzige Spanielhündin hatte sich wieder mal aus dem Staub gemacht. Er erwog, sie einfach zurückzulassen – wahrscheinlich fand sie den Weg zu seiner Hütte auch allein –, doch sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe. Schließlich war sie im Grunde das Einzige, was er auf der Welt hatte. Tanzy war früher ein verdammt guter Jagdhund gewesen, erinnerte sich Charley, aber mittlerweile war sie – wie er selbst auch – halb taub und von schwerer Arthritis geplagt.
Er spähte durch das kärgliche Unterholz und pfiff gellend. Der Ton schrillte durch den Wald, während über Charley die Äste knarrten. Mit behandschuhter Hand umklammerte er den Lauf seiner Büchse, einer Winchester, die sein Daddy ihm vor mehr als einem halben Jahrhundert vermacht hatte, als er aus dem Krieg zurückkam. Charley besaß neuere Waffen, viele sogar, doch an dieser hing er ganz besonders, ebenso wie an dem müden alten Hund.
Verdammt, dachte er, ich werde doch wohl nicht auf meine alten Tage nostalgisch?
»Tanzy?«, rief er in der Gewissheit, dass er sich damit jede Chance auf Jagdbeute verdarb. Blödes Miststück von Hund!
Er stapfte einen vertrauten Pfad entlang, den Blick auf den Boden geheftet, auf der Suche nach Spuren von Rehen oder Elchen oder womöglich einem Bären, obwohl die sich eigentlich längst zum Überwintern in ihre Höhlen zurückgezogen haben mussten. In der Stadt kursierten Gerüchte über einen Berglöwen, der angeblich im Sommer in der Nähe der Wasserfälle gesichtet worden war, doch Charley war bisher weder auf eine Fährte noch auf sonst irgendeinen Hinweis dafür gestoßen, dass die Raubkatze in diesen Bergen jagte. Er wusste nicht so genau, wie Pumas den Winter verbrachten; er glaubte allerdings nicht, dass sie Winterschlaf hielten. Wie auch immer – in den zweiundsiebzig Jahren, die er nun in diesen Bergen lebte, hatte er nicht ein einziges Mal einen zu Gesicht bekommen. Und er glaubte nicht, dass er dieses Pech ausgerechnet heute haben würde.
Seine Füße schmerzten trotz der dicken Wollsocken und der Jagdstiefel vor Kälte. Der Granatensplitter, der immer noch in seiner Hüfte steckte, bereitete ihm ebenfalls Schmerzen. Trotzdem ging er auf die Jagd, durchstreifte die Wälder, wie er es als kleiner Junge mit seinem Pa getan hatte. Seinen ersten Bock hatte er mit vierzehn Jahren am Settler’s Bluff erlegt. Teufel, das war lange her.
Ein heftiger Windstoß schlug ihm ins Gesicht, und er fluchte. »Komm schon, Tanzy! Ab nach Hause, altes Mädchen!« Es war an der Zeit, in seinem zerbeulten alten Ford-Pritschenwagen zurück in die Stadt zu fahren, sich eine Zeitung zu kaufen und im Canyon Café einen Kaffee zu trinken mit den paar von seinen Freunden, die noch lebten und gesund genug waren, um ihre Frauen für ein, zwei Stunden allein zu lassen. Später würde er dann das Kreuzworträtsel lösen und ein Feuer im Ofen anzünden.
Wo zum Teufel steckte der Köter?
Er pfiff noch einmal und hörte ein Winseln, dann ein Bellen.
Endlich! Charley drehte sich um und marschierte eilig einen tiefen Bachlauf entlang, in dem Tanzy unvermittelt verrückt spielte. Die Nase dicht am Boden, schnüffelte der Hund um einen vermoderten Baumstamm herum. »Was hast du da, Mädchen?«, fragte Charley und stieg über einen ausgebleichten Baumstumpf hinweg ins Unterholz. Unter seinen Stiefeln knackten kleine Zweige, während er sich zu dem Hund vorarbeitete und sich darauf gefasst machte, dass ein Eichhörnchen oder Wiesel aus dem offenbar hohlen Baumstamm hervorschoss. Er konnte nur hoffen, dass sich dort kein Stachelschwein oder Stinktier versteckt hatte.
Eine Windbö fuhr durch die Äste über ihm, und da roch er es – den stechenden Geruch von verrottendem Fleisch. Was immer in dem Baumstamm steckte, war längst tot. Keine Gefahr, dass es herausschoss und ihm einen Heidenschrecken einjagte.
Tanzy bellte aus Leibeskräften, sprang gegen den Stamm und wich wieder zurück, das gefleckte Fell gesträubt, wild mit dem Schwanz peitschend.
»Okay, okay, lass mich mal sehen.« Charley ließ sich mit knirschenden Gelenken auf ein Knie nieder. Er beugte sich hinab und spähte in den ausgehöhlten Baumstamm. »Hm, schwer zu sagen.« Aber irgendetwas steckte da drinnen, und es stank. Seine Neugier gewann die Oberhand, er hob den Stamm ein wenig an, sodass das blasse Licht der Wintersonne hineinfiel. Und dann erkannte er, was in dem Stamm steckte.
Ein menschlicher Schädel starrte ihm entgegen.
Charley gefror das Blut in den Adern. Er schrie auf und ließ den Baumstamm fallen.
Das Holz splitterte, als es auf dem Waldboden aufschlug.
Der Schädel, mit winzigen spitzen Zähnen, Strähnen von blondem Haar und Resten faulen Fleisches an den Knochen, rollte in die Tannennadeln und das trockene Laub.
»Himmelherrgott!«, flüsterte er, und es war tatsächlich ein Gebet. In diesem Moment frischte der Wind auf, schüttelte den Schnee von den Bäumen und fuhr ihm in den Nacken. Charley wich einen Schritt zurück. Er ahnte Böses – Böses, das aus dem finstersten Winkel von Luzifers Herzen kam und das im Dämmerlicht dieses Waldes lauerte.
»Charley Perry ist ein Spinner«, knurrte Sheriff Shane Carter und schenkte sich eine Tasse von dem Kaffee ein, der seit Stunden in der Küche seines Büros auf der Heizplatte köchelte. Sobald die Glaskanne leer war, wurde frischer Kaffee aufgebrüht.
»Ja, aber dieses Mal behauptet er, in der Nähe von Catwalk Point einen menschlichen Schädel gefunden zu haben. Das können wir nicht einfach ignorieren«, wandte BJ Stevens ein. Sie war eine kleine Frau, ein bisschen breit in den Hüften und mit drei Männernamen gesegnet. Billie Jo Stevens. Es schien sie nicht sonderlich zu stören.
»Schick zwei Männer rauf.«
»Hab ich schon. Donaldson und Montinello.«
»Charley hat auch schon ein paar Mal behauptet, er hätte Bigfoot gesehen«, erinnerte Carter sie, während er durch den Pausenraum zu seinem Büro im hinteren Teil des Gerichtsgebäudes von Lewis County ging. »Und dann war da noch die Sache, als er überzeugt war, ein UFO hätte direkt über der Brücke geschwebt. Weißt du noch?«
»Na schön, er ist eben ein Exzentriker.«
»Ein Verrückter«, korrigierte Carter. »Er ist völlig durchgeknallt.«
»Aber harmlos.«
»Wir wollen hoffen, dass es sich hier auch nur um eine seiner Spinnereien handelt.«
»Aber du fährst rauf, um dich zu überzeugen«, stellte sie fest, denn sie kannte ihn besser, als es ihm lieb war.
»Ja.« Carter ging an Computer-Monitoren, klingelnden Telefonen, Büronischen, alten Schreibtischen und einem Aktenschrank vorbei zu seinem Büro, einem verglasten Raum mit Jalousetten, die er herunterlassen konnte, wenn er ungestört sein wollte. Die zwei Fenster boten Ausblick auf den Parkplatz des Gerichtsgebäudes und auf Danby’s Einrichtungshaus auf der anderen Straßenseite. Wenn er den Hals reckte, konnte er auf die Hauptstraße hinunterschauen. Doch diese Mühe machte er sich selten.
Er stellte die Tasse auf den Tisch und rief seine E-Mails ab, doch die ganze Zeit über wurde er das eigentümliche Gefühl nicht los, dass hinter Charley Perrys Geschichte mehr steckte, als sie ahnten. Sicher, Charley war nicht ganz richtig im Kopf, ein exzentrischer Einzelgänger, der nach seinen eigenen Gesetzen lebte, besonders was das Wildern betraf. Aber im Grunde war er harmlos und in Carters Augen ein ganz anständiger Bursche. Hin und wieder flippte er allerdings aus – vielleicht brauchte er auch einfach mehr Aufmerksamkeit. Die Bigfoot-Geschichte hatte ihm einige Beachtung durch die Presse eingebracht. Zwei Jahre später hatte er behauptet, ein UFO entdeckt zu haben und an Bord gebeamt worden zu sein, weil die Aliens – menschenähnlich, aber mit riesigen Köpfen – Forschungen an ihm betreiben wollten. Nun, falls die armen Aliens angenommen hatten, Charley sei ein Musterexemplar der Spezies Mensch, waren sie wahrscheinlich bitter enttäuscht von der Menschheit. Kein Wunder, dass sie sich nie wieder hatten blicken lassen.
Das Telefon klingelte, und der Sheriff meldete sich automatisch, während er einen Schluck aus seiner Tasse trank und den Blick vom Monitor löste.
»Carter.«
»Montinello, Sheriff.« Durch die schlechte Handy-Verbindung war Deputy Lanny Montinello kaum verständlich. »Ich schätze, Sie sollten mal raufkommen zum Catwalk Point. Sieht aus, als hätte der alte Charley Recht. Wir haben es mit einer Leiche zu tun. Oder wenigstens mit dem größten Teil einer Leiche.«
»Verdammt«, knurrte Carter. Nachdem er noch ein paar Fragen gestellt hatte, wies er Montinello an, den Fundort abzusperren und Charley auf Eis zu legen. Sobald er das Gespräch beendet hatte, informierte er die Spurensicherung, griff dann nach Jacke, Hut und Waffe und holte BJ ab. Unterwegs hinterließ er noch rasch Nachrichten beim Gerichtsmediziner und im Büro des Bezirksstaatsanwalts.
»Na, was hab ich gesagt?«, bemerkte BJ, während er seinen Chevrolet Blazer über die kurvenreiche Holzfällerstraße hinauf zum Catwalk Point steuerte, einem Berg, der sich neunhundert Meter über dem Flussbett des Columbia River erhob. Sie waren unterwegs aufgehalten worden; man hatte sie zu einem Unfall mit Verletzten auf einer Landstraße südlich der Stadt gerufen, was sie zwei Stunden gekostet hatte.
Als sie schließlich am Ende des schlammigen Kieswegs ankamen, war das Gebiet bereits mit gelbem Flatterband abgesperrt. Nicht dass hier oben so bald mit Gaffern zu rechnen gewesen wäre. Früher oder später würde natürlich die Presse Wind davon bekommen und über sie hereinbrechen, doch bis dahin würde es noch eine Weile dauern. Carter zog sich die Kapuze seiner wasserdichten Jacke über den Kopf und stieg aus dem Wagen.
Es war winterlich kalt; für die nächsten paar Tage war ein Schneesturm angekündigt worden. Der Boden war beinahe gefroren, die hohen Fichten schwankten und wiegten sich im eisigen Hauch des starken Ostwindes, der durch die Schlucht tobte.
Vorsichtig suchten Carter und BJ sich ihren Weg durch eine tiefe Senke bis zu der Stelle, wo die Spurensicherer vom Oregon State Kriminallabor schon an der Arbeit waren.
Ein Fotograf machte Aufnahmen, während ein anderer seine Videokamera auf den Boden richtete. Sie hatten bereits eine große Fläche mit einem Raster versehen und den Schauplatz gesichert. Durch den Schnee hindurch wurden Bodenproben genommen, Unrat wurde durchsucht, ein hohler Baumstamm gekennzeichnet. Knochen lagen sorgfältig angeordnet auf einer Plastikplane. Das Skelett war klein, leider unvollständig. Und der Schädel sah merkwürdig aus; die Zähne waren zu klein und zu spitz.
»Was wissen wir bisher?«, fragte Carter Merline Jacobosky, eine gertenschlanke Ermittlerin mit scharfen Gesichtszügen und noch schärferem Verstand. Sie zog die Augenbrauen über der randlosen Brille zusammen und presste die farblosen Lippen aufeinander, ließ das Klemmbrett sinken, auf dem sie eifrig gekritzelt hatte, und betrachtete noch einmal die menschlichen Überreste.
»So dem ersten Eindruck nach? Weiblich, weiß, Mitte zwanzig bis Mitte dreißig, würde ich sagen, aber berufen Sie sich nicht auf mich, bevor der Autopsiebericht vorliegt. Jemand hat sie in den Baumstamm da gezwängt.« Merline deutete mit ihrem Stift auf den hohlen Zedernstamm. »Uns fehlen ein paar Knochen, wahrscheinlich von Tieren weggeschleppt, aber wir suchen noch. Haben schon eine Elle und einen Fußwurzelknochen gefunden. Vielleicht haben wir mit dem Rest auch noch Glück.«
»Vielleicht«, versetzte Carter skeptisch und betrachtete den Waldboden und die zerklüfteten Berge, die steil zum Columbia River hin abfielen. Es war raues Terrain, der Wald war dicht, der Fluss breit und reißend an dieser Stelle, wo er sich sein Bett zwischen den Staaten Oregon und Washington gegraben hatte. Obwohl durch eine Reihe von Dämmen gezähmt, strömte er tosend nach Westen, wie die Gischtkronen verrieten, die zwischen den Bäumen hindurch zu sehen waren. Wenn eine Leiche in den Columbia geworfen wurde, bestand kaum noch die Chance, sie jemals zu bergen.
Er hörte das Heulen eines Motors, der mit der Steigung kämpfte, und erkannte gleich darauf den Dienstwagen des Gerichtsmediziners. Dahinter folgte ein weiteres Fahrzeug, das einem der Stellvertretenden Bezirksstaatsanwälte gehörte.
Merline war noch nicht fertig. Sie fuhr fort: »Ich will Ihnen sagen, was ich wirklich merkwürdig finde. Schauen Sie sich mal ihre Zähne an.« Jacobosky ging in die Knie und benutzte ihren Schreibstift als Zeigestock. »Sehen Sie die Schneide- und die Backenzähne? Das ist kein natürlicher Verfall … Ich glaube, sie sind abgefeilt worden.«
Carter spürte einen unheilvollen Schauer den Rücken hinablaufen. Wer würde jemandem die Zähne abfeilen? Und warum? »Damit die Leiche nicht identifiziert werden kann?«, fragte er.
»Vielleicht, aber warum hat der Täter die Zähne dann nicht einfach gezogen oder herausgebrochen? Warum hat er sich die Mühe gemacht, sie spitz zuzuschleifen?« Sie hockte sich auf ihre Fersen und tippte sich mit dem Kugelschreiber an die Lippen, während sie den Schädel musterte. »Das ergibt keinen Sinn.«
»Vielleicht ist unser Freund ein Zahnarzt mit einem schrägen Sinn für Humor.«
»Schräg trifft es auf jeden Fall.«
»Irgendwelche Papiere?«, fragte er, obwohl er die Antwort schon ahnte.
»Bisher nicht.« Jacobosky schüttelte den Kopf und blätterte eine Seite auf ihrem Klemmbrett um. »Auch keine Kleidungsstücke oder persönlichen Gegenstände. Aber wir suchen weiter, unterm Schnee, im Eis und tiefer im Boden. Wenn es hier irgendwo Beweismaterial gibt, werden wir es finden.« Sie blickte mit zusammengekniffenen Augen zu Carter auf. Graue Wolken jagten über den Himmel.
»Was ist das hier?« Carter beugte sich hinab und betrachtete den Schädel mit den grotesken Zähnen und den leeren Augenhöhlen. Er deutete auf das Haar. In den verbliebenen Strähnen klebte etwas. Eine rosafarbene Substanz, die er nicht für Fleisch hielt. Sie erinnerte ihn an Radiergummi-Krümel.
»Weiß ich nicht. Noch nicht. Aber es ist jedenfalls eine künstliche Substanz. Wir lassen sie im Labor untersuchen.«
»Gut.« Er richtete sich auf und sah, dass BJ mit einem der Fotografen sprach. Gerade kam Luke Messenger, der Gerichtsmediziner, dazu. Groß und schlaksig, mit krausem rotem Haar und Sommersprossen, näherte er sich dem Fundort und betrachtete stirnrunzelnd die Leiche.
»Unvollständig?«, erkundigte er sich bei Jacobosky.
»Bisher ja.« Er ging vor den Knochen in die Hocke, während Amanda Pratt, die Stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, die das Pech hatte, diese Aufgabe zugewiesen zu bekommen, sich einen Weg hügelabwärts suchte. Sie trug eine dicke Daunenjacke, Wollmütze und -schal und roch nach Zigarettenrauch.
»Gott, was für ein scheußliches Wetter«, bemerkte sie und rümpfte angesichts der Leiche die kecke Nase. »Himmel, was haben wir denn da! Sie steckte also in einem hohlen Baumstamm?«
»Sagt Charley.«
»Dem kann man doch kein Wort glauben«, versetzte sie trocken, während sie den Schauplatz in Augenschein nahm.
»Vielleicht sagt er dieses Mal die Wahrheit.«
Ihre Augen blitzten hinter dünnen, kunststoffgerahmten Brillengläsern. »Ja, klar. Und ich bin die Königin von England. Nein, lieber von Spanien. In England ist es zu kalt, verdammt noch mal. Herrgott, das ist ja eine ganz schöne Versammlung hier oben.« Sie ließ den Blick über die Fahrzeuge schweifen. »Ist Charley noch hier?«
»In einem der Pick-ups da drüben.« Jacobosky wies mit einer Kopfbewegung auf einen weißen Pritschenwagen, der mit laufendem Motor am Ende der Straße stand. Montinello saß hinterm Steuer. Charley Perry kauerte auf dem Beifahrersitz. »Er ist nicht sonderlich begeistert, dass wir ihn hier oben festhalten«, fügte Jacobosky hinzu. »Meckert ständig herum, dass er nach Hause gehen und sich aufwärmen will.«
»Kann ich ihm nicht verübeln. Ich rede mit ihm.«
»Gut«, sagte Amanda. »Vergiss nicht, deinen Quatschdetektor mitzunehmen.«
Carter lachte, betrachtete noch einmal eingehend den mit dem Raster überzogenen Fundort und sagte dann zum Gerichtsmediziner, der noch immer vor der Leiche hockte: »Lassen Sie mich wissen, was Sie herausgefunden haben.«
»Sobald wir mit der Untersuchung durch sind«, antwortete Messenger, ohne aufzublicken. »Sie erfahren es als Erster.«
»Danke.« Carter stieg den Hang hinauf, wo er Charley so griesgrämig wie eh und je vorfand. Er hielt mit beiden Händen eine Tasse Kaffee, die jemand ihm heraufgebracht hatte, und starrte Carter so böse aus dem Seitenfenster an, als sei der Sheriff persönlich verantwortlich dafür, dass ihm der Tag verdorben war. Carter klopfte an die Scheibe, woraufhin Charley widerwillig das Fenster herunterkurbelte.
»Wollen Sie mich verhaften?«, fragte er. Ein kurzer silbriger Bart bedeckte sein kräftiges, vorspringendes Kinn. Seine Augen blitzten wütend hinter starken Brillengläsern.
»Nein.«
»Dann lassen Sie mich von einem Ihrer Jungs nach Hause bringen. Ich habe meine Pflicht und Schuldigkeit getan, oder etwa nicht? Da braucht man mich doch wohl nicht wie einen verdammten Verbrecher zu behandeln.« Er spie einen kräftigen Strahl Kautabaksaft aus dem Fenster, der auf Kies und schmutzigem Schnee landete. Glück für ihn, dass dieses Gebiet nicht mehr zum Fundort gehörte.
»Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen.«
»Ich habe schon den ganzen Vormittag über Fragen beantwortet!«
Carter lächelte. »Nur noch ein paar, dann lasse ich Sie von Deputy Montinello nach Hause bringen.«
»Toll«, knurrte Charley und verschränkte die Arme vor der schmächtigen Brust. Er zeigte sich kooperativ, wenn auch widerwillig. Tatsächlich hatte er nun einmal nicht mehr Informationen zu bieten. Er erzählte Carter, dass er auf Jagd gewesen war, seinen Hund verloren und ihn in der Schlucht bei dem hohlen Baumstamm wiedergefunden hatte. Er hatte den Baumstamm angehoben, und da war der Schädel herausgerollt, woraufhin er sich zu Tode erschrocken hatte. »… und mehr weiß ich nicht«, schloss er verdrießlich. »Ich bin nach Hause gerannt und habe Ihr Büro angerufen. Und machen Sie mir jetzt bloß keinen Ärger, weil ich mit Tanzy auf Jagd gegangen bin. Ich brauchte einen Spürhund, um wieder nach Hause zu finden«, setzte er hinzu, als sei ihm gerade bewusst geworden, dass er wegen des Jagens mit seinem Hund Schwierigkeiten bekommen könnte. Hastig fuhr er fort: »Zwei von Ihren Leuten haben mich vor ein paar Stunden wieder hier raufgeschleppt, und seitdem friere ich mir hier den Hintern ab!«
»Das tun wir alle, Charley«, sagte Carter und schlug mit der flachen Hand gegen die Tür des Dienstwagens. »Bringen Sie ihn nach Hause«, wies er Lanny Montinello an. Dann blickte er noch einmal in Charleys graues Gesicht. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich an, ja?«
»’türlich«, erwiderte Charley, sah Carter dabei jedoch nicht an. Der Sheriff vermutete, dass der alte Eigenbrötler nicht die ganze Wahrheit sagte. Sie hatten sich noch nie gut verstanden, erst recht nicht, seit Carter Charleys Bigfoot-Geschichte entlarvt und ihm einmal gedroht hatte, den Wildhüter über seine Wilderei zu informieren. Nein, Charley Perry würde wohl nicht noch einmal anrufen, nicht, wenn er mit dem Sheriff sprechen musste. Carter warf Montinello einen Blick zu und sagte noch einmal: »Bringen Sie ihn nach Hause.« Die Vernehmung war beendet.
»Mach ich.« Montinello legte den Gang ein, und Carter schlug noch ein paar Mal mit der flachen Hand gegen die Tür, während Charley das Fenster hochkurbelte. Binnen Sekunden war der Pick-up hinter dichtem altem Baumbestand verschwunden. Die Fichten erhoben sich dräuend und schienen bis an die stahlgrauen Wolken zu reichen. Schon fielen die ersten Tropfen eisigen Regens.
Carter vergrub die Hände tief in den Taschen seines Parkas und blickte auf den Fundort am Fuß des Abhangs nieder, wo es von Ermittlern wimmelte. Amanda Pratt stand ein paar Meter entfernt, rauchte und führte ein lebhaftes Gespräch mit Luke Messenger. Und mittendrin lag auf einer Plastikplane die Leiche der Unbekannten mit ihren abgefeilten Zähnen und der roten Substanz im Haar.
Wer war sie und wie zum Teufel war sie in diese gottverlassene Gegend gekommen?
2. Kapitel
Klick!
Die Fenstertüren öffneten sich.
Ein Windstoß trug die Winterkälte in das dunkle Haus. Die beinahe schon erloschene Glut im Kamin leuchtete rot auf. Der alte Hund, der auf dem Teppich vor Jennas Sessel lag, hob den Kopf und stieß ein tiefes, warnendes Knurren aus.
»Pssst!«, machte der Eindringling.
Aus schmalen Augen folgte Jennas Blick der Silhouette, die sich in das große Zimmer schlich. Trotz der Dunkelheit erkannte sie ihre älteste Tochter, die in Richtung Treppe huschte. Genauso, wie sie es erwartet hatte. Na großartig. Ein junges Mädchen, das mitten in der Nacht nach Hause geschlichen kam.
»Still, Critter!«, zischte Cassie in scharfem Ton, während sie sich auf Zehenspitzen zur Treppe stahl.
Jenna betätigte den Lichtschalter neben sich.
Augenblicklich war es hell in dem Blockhaus. Cassie blieb wie vom Donner gerührt auf der untersten Treppenstufe stehen. »Verdammt«, flüsterte sie und wandte sich mit hängenden Schultern langsam zu ihrer Mutter um.
»Das gibt Hausarrest bis in alle Ewigkeit«, sagte Jenna, die noch immer in ihrem Lieblings-Ledersessel saß.
Cassie ging sofort in die Offensive. »Wieso bist du noch wach?«
»Ich habe auf dich gewartet.« Jenna erhob sich und blickte in das mürrische Gesicht ihrer Tochter, von der so viele Leute behaupteten, sie sei das Abbild von Jenna in jungen Jahren. Cassie war um anderthalb Zentimeter größer als ihre Mutter, doch sie hatte die gleichen hohen Wangenknochen, die dunklen Wimpern und Brauen und das spitze Kinn wie ihre Mutter. »Wo warst du?«
»Aus.« Sie warf ihr gesträhntes Haar über die Schulter zurück.
»Das weiß ich selbst. Du hättest aber im Bett sein sollen. Ich erinnere mich sogar, dass du gegen elf Uhr so etwas wie ›Gute Nacht, Mom‹ gesagt hast.«
Cassie verdrehte theatralisch ihre grünen Augen und schwieg. »Also, mit wem warst du aus?«, bohrte Jenna nach. »Nein, lass mich raten … Du warst mit Josh zusammen.«
Cassie äußerte sich noch immer nicht dazu, doch für Jenna stand fest, dass sie sich mit Josh Sykes getroffen hatte. Seit Cassie mit dem Neunzehnjährigen ging, war sie verschlossen, mürrisch und aufmüpfig.
»Also, wo wart ihr? Ich will es genau wissen.«
Cassie verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich mit einer Schulter an die vergilbte Holzbohlenwand. Ihr Make-up war verwischt, ihr Haar zerzaust, ihre Kleidung zerknittert. Jenna brauchte nicht lange zu überlegen, was ihre Tochter getrieben hatte, und es ängstigte sie zu Tode. »Wir sind nur ein bisschen rumgekurvt«, behauptete Cassie.
»Um drei Uhr morgens?«
»Ja.« Cassie zog eine Schulter hoch und gähnte.
»Draußen ist es eisig kalt.«
»Und?«
»Jetzt hör mir mal zu, Cassie: So nicht. Ich habe keine Lust, dir jedes Wort aus der Nase zu ziehen.«
»Weiß gar nicht, warum dich das was angeht.«
»Ach nein?« Jenna stand auf und ging auf ihre rebellische Tochter zu. Dabei nahm sie einen Geruch nach Zigarettenrauch und vielleicht noch etwas anderem wahr. »Zunächst einmal, weil ich dich liebe und nicht will, dass du dir dein Leben versaust.«
»So wie du?« Cassie zog schnippisch eine Augenbraue hoch. »Als du mit mir schwanger geworden bist?«
Der Hieb traf genau da, wo er treffen sollte, doch Jenna ging nicht darauf ein. »Das war eine etwas andere Situation. Ich war fast zweiundzwanzig. Erwachsen. Auf mich selbst gestellt. Außerdem reden wir jetzt nicht über mich. Du bist diejenige, die gelogen und sich heimlich davongeschlichen hat.«
»Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
»Du bist sechzehn, zum Kuckuck.« Und bereits eine Frau. Cassies Figur hätte so manchen Hollywoodstar vor Neid erblassen lassen.
»Ich bin einfach nur mit ein paar Freunden ausgegangen.«
»›Rumgekurvt‹.«
»Ja.«
»Aha.« Jenna glaubte ihrer Tochter kein Wort. »Kennst du nicht das alte Sprichwort: ›Wer schläft, sündigt nicht‹?«
Cassie sah sie nur böse an.
»Hör zu, so kommen wir nicht weiter. Geh jetzt ins Bett. Wir reden morgen darüber.«
»Es gibt nichts, worüber wir reden müssten.«
»O doch. Zum Beispiel die Tatsache, dass du dich aus dem Haus schleichst und geradewegs auf das Dilemma einer Teenager-Schwangerschaft zusteuerst. Dann wäre da noch die Sache mit den Drogen. Und das ist erst der Anfang.«
»Mach’s nicht so spannend«, versetzte Cassie, und Jenna fühlte sich an ihre eigene Jugend erinnert. »Du kannst Josh bloß nicht leiden.«
»Es gefällt mir nicht, dass er solchen Einfluss auf dich hat, dass du alles dafür tun würdest, um mit ihm zusammen sein zu können. Und dass er dich dazu bringt, mich zu belügen.«
»Das stimmt n …«
»Hör auf zu leugnen. Ich an deiner Stelle, Cassie, ich würde mich hüten, meinen Vorsprung derart zu verspielen. Beziehungsweise das, was davon noch übrig ist.«
Doch Cassies Temperament ging mit ihr durch. Trotzig warf sie ihrer Mutter vor: »Du kannst keinen von meinen Freunden leiden. Jedenfalls seit wir hierher gezogen sind. Das alles ist deine Schuld. Ich wollte nicht umziehen.«
Das stimmte allerdings. Ihre beiden Töchter waren auf die Barrikaden gegangen, als Jenna beschloss, L. A. zu verlassen und etwas Frieden und Normalität in dieser ruhigen kleinen Stadt an den felsigen Ufern des Columbia River in Oregon zu suchen. Seit anderthalb Jahren hörte Jenna sich die Klagen nun schon an. »Das ist Schnee von gestern. Wir leben hier, Cassie, und wir werden das Beste daraus machen.«
»Ich versuch’s ja.«
»Mit Josh.«
»Ja, mit Josh.« Cassies Augen funkelten rebellisch.
»Um dich an mir zu rächen.«
»Nein«, entgegnete Cassie gedehnt und reckte provozierend das Kinn. »Ob du’s glaubst oder nicht, hier geht es ausnahmsweise einmal nicht um dich. Okay? Wenn ich mich an dir ›rächen‹ wollte, würde ich zurück nach Kalifornien gehen und bei Dad wohnen.«
»Ist es das, was du willst?« Jenna hatte das Gefühl, einen Schlag die Magengrube bekommen zu haben, doch sie zeigte keinerlei Regung, wollte Cassie nicht wissen lassen, dass sie einen sehr empfindlichen Nerv getroffen hatte.
»Ich will nur, dass man mir vertraut, okay?«
»Vertrauen muss man sich verdienen, Cassie«, hielt Jenna ihr vor. Gleich darauf biss sie sich auf die Zunge, als ihr bewusst wurde, dass sie genauso redete wie seinerzeit ihre eigene Mutter.
»Wir reden morgen weiter«, entschied sie, um das Thema zu beenden. Sie knipste die Lampe aus und hörte, wie Cassie die Treppe hinauftrottete. Ich werde allmählich wie meine Mutter, dachte sie, ließ jedoch nicht zu, dass ihre Gedanken zu weit in diese beängstigende Richtung schweiften. »Komm schon, Critter«, sagte sie zu dem Hund, während sie die Tür wieder verschloss und dann die Treppe hinaufstieg. Ihr Schlafzimmer befand sich im Zwischengeschoss, gleich neben dem Treppenabsatz, die Zimmer ihrer Töchter eine halbe Treppe höher. »Lass uns schlafen gehen.« Der alte Hund tappte hinter ihr her, etwas schwerfällig aufgrund seiner Arthritis. Jenna wartete auf ihn und hörte, wie Cassies Tür leise geschlossen wurde. »Endlich sind alle sicher daheim.« Und du musst in zweieinhalb Stunden aufstehen. Bei dem Gedanken stöhnte sie innerlich auf. Sie stieg die letzten Stufen hinauf, als sie plötzlich aus den Augenwinkeln etwas im Bleiglasfenster des Treppenabsatzes zu sehen glaubte.
Eine Bewegung?
Ihr eigenes verschwommenes Spiegelbild?
Critter knurrte leise, und Jennas Muskeln verkrampften sich. »Psst.« Sie spähte durch das verzerrende bunte Glas und ließ den Blick prüfend über den Hof und die Wirtschaftsgebäude ihrer Ranch gleiten – ›das Lager‹, wie Cassie es nannte. Sicherheitslampen warfen einen gespenstischen blauen Schein auf die Scheune, den Stall und die Schuppen. Die alte Windmühle stand wie ein hölzernes Skelett an der Straße, Jenna hörte das Knarren der Flügel, die sich langsam drehten. Das Haupttor stand weit offen, weil das Schloss eingefroren war und sich um die Pfosten herum hohe Schneeverwehungen aufgehäuft hatten. Die Straße zum Tor war leer – kein Motorengeräusch durchbrach die nächtliche Stille.
Dennoch, die bewaldeten Hügel und zerklüfteten Flussufer waren dunkel und in Dunst gehüllt, die wolkenverhangene Nacht bot perfekte Deckung für …
Für wen?
Sei nicht albern.
Natürlich lauerte niemand in den winterlichen Schatten.
Natürlich nicht.
Schlimmstenfalls lungerte Josh Sykes noch herum, versteckte sich hinter der Scheune und hoffte womöglich darauf, Cassie ins Haus folgen zu können.
Oder?
Es war bestimmt nichts Bedrohlicheres als ein geiler Freund, der ums Haus schlich.
Wieder knurrte der betagte Hund.
»Psst«, machte Jenna noch einmal und öffnete die Flügeltür zum Schlafzimmer, einer gemütlichen kleinen Suite, die sie mit niemandem teilte.
Sie war in diese abgelegene Gegend am Columbia River gezogen, um ihren Seelenfrieden zu finden, und deshalb würde sie jetzt das dumme Gefühl in ihrem Bauch ignorieren. Sie war einfach nur nervös und aufgewühlt, weil ihre halbwüchsige Tochter ihr Sorgen bereitete. Weiter nichts.
Trotzdem konnte sie, als sie in ihr dunkles Schlafzimmer trat, das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas geschehen würde.
Etwas, das ihr nicht behagen würde.
Etwas Böses, das allein sie betraf.
3. Kapitel
Cassie!«, rief Jenna die Treppe hinauf. »Allie! Frühstück! Beeilt euch, in einer halben Stunde müssen wir los!« Sie horchte auf Lebenszeichen von oben, ging dann in die Küche und warf einen Blick auf die Uhr über dem Herd. Sie würden zu spät kommen. So viel stand schon mal fest. In einer Dreiviertelstunde musste Allie in der Schule sein, und sie brauchten mindestens zwanzig Minuten für den Weg zur Junior High School. Jenna schaltete den Fernseher ein, schob zwei englische Muffins in den Toaster und rief: »Macht schon, Mädchen!«
Aus dem Obergeschoss ertönte das Scharren und Poltern von Schritten. Endlich.
Sie stürzte die zweite Tasse Kaffee hinunter, wäre beinahe über Critter gestolpert, der vor der Arbeitsplatte lag, stellte die leere Tasse in die Spüle und öffnete die Kühlschranktür. Immer noch kein Geräusch von fließendem Wasser. Gewöhnlich war Cassie um diese Zeit in der Dusche. Jenna nahm eine Packung Orangensaft aus dem Kühlschrank und füllte zwei Gläser. Der Toaster spuckte die Muffins aus. Im Fernsehen kündigte der Wetterbericht die bisher heftigsten Schneefälle der Jahreszeit an. Die Temperaturen waren weit unter den Gefrierpunkt gesunken.
Während sie die ersten Muffins mit Butter bestrich, hörte sie Schritte auf der Treppe. Sekunden später tauchte Cassie auf.
»Wir haben kein Wasser«, verkündete sie mürrisch.
»Wie bitte?«
»Ich habe gesagt, wir haben kein Wasser, verdammt. Ich wollte duschen – nichts!« Wie zum Beweis ging sie zur Spüle und drehte den Hahn auf. Nichts geschah.
»Kein heißes Wasser?«, fragte Jenna voller böser Vorahnung nach. Ein Problem mit dem Durchlauferhitzer wäre noch das kleinere Übel gewesen, aber wenn etwas mit den Leitungen nicht stimmte …
»Auch kein kaltes.« Cassies Blick fiel auf die Kaffeekanne. »Wie hast du …?«
»Habe gestern Abend alles vorbereitet und die Zeitschaltuhr gestellt.« Sie stand an der Spüle, drehte an den Wasserhähnen herum – vergebens. »Verdammt. Dann musst du dich heute wohl mal ungeduscht anziehen.«
»Bist du verrückt geworden? Ich kann unmöglich mit fettigen Haaren zur Schule gehen.«
»Du wirst es überleben. Und die Schule auch.«
»Aber, Mom …«
»Iss einfach dein Frühstück und zieh dir dann was Frisches an.«
»Kommt nicht infrage. Ich gehe nicht in die Schule.« Cassie ließ sich auf einen Stuhl in der Ecke fallen. Sie hatte dunkle Ränder um die Augen und konnte nach dem späten Rendezvous der vergangenen Nacht ein Gähnen nicht unterdrücken.
»Du gehst. Kennst du das alte Sprichwort: Früh übt sich, was ein Meister werden will?«
»Versteh ich nicht.«
»O doch.«
»Na gut, aber das ist bescheuert.«
»Mag sein, aber heute Morgen ist es dein Motto.«
Cassie verdrehte die Augen und trank einen Schluck von ihrem Saft, rührte den Muffin auf ihrem Teller jedoch nicht an. Critter ließ sich unter dem Tisch nieder und legte den Kopf auf Cassies Knie. Sie schien es gar nicht zu bemerken.
»Du und ich, wir haben noch ein Wörtchen miteinander zu reden. So etwas wie letzte Nacht wird nicht wieder vorkommen. Ich will nicht, dass du dich aus dem Haus schleichst. Nie wieder. Es ist gefährlich.«
»Das sagst du nur, weil du Josh nicht ausstehen kannst.«
»Darüber haben wir doch gestern Nacht schon gesprochen. Es geht nicht darum, dass ich etwas gegen Josh habe.« Auch wenn sein IQ niedriger ist als seine Schuhgröße. »Aber mir gefällt es nicht, dass er dich manipuliert.«
»Tut er ja gar nicht.«
»Und falls ihr beiden Sex habt …«
»O Gott. Erspar mir das.«
»… muss ich es wissen.«
»Das geht dich nichts an.«
»Natürlich geht es mich was an. Du bist minderjährig.«
»Können wir vielleicht später darüber reden? Oder noch besser gar nicht?« Cassie warf ihrer Mutter einen finsteren Blick zu, als fände sie, Jenna sei unglaublich altmodisch. Was nach Jennas eigener Meinung durchaus zutreffen mochte. Doch sie musste behutsam vorgehen, sonst würde sie das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollte, und Cassie dem geilen Josh Sykes geradewegs in die offenen Arme treiben. Jenna sah auf die Küchenuhr, die anzeigte, wie die Sekunden ihres Lebens verrannen. »Gut, später. Nach der Schule, wenn wir mehr Zeit haben.«
»Toll. Genau das, was wir brauchen: mehr Zeit«, brummte Cassie, während Jenna – die der Ansicht war, die Wahl des geeigneten Zeitpunkts zähle zu den wichtigsten Fähigkeiten im Leben – die Küche verließ und die Konfrontation damit bis zum Abend auf Eis legte. Sie ging den kurzen Flur entlang zur Treppe. »Allie? Bist du wach?«
Schritte ertönten, und gleich darauf kam Allie, noch im Pyjama, in die Küche geschlurft. Ihr rotblondes Haar sah wüst aus, ihr Koboldgesichtchen trug eine Oscar-würdige Leidensmiene. »Mir geht es nicht gut.«
»Was fehlt dir denn?«, fragte Jenna, obwohl sie ahnte, dass es nichts war. Solche Szenen erlebte sie neuerdings häufiger mit ihrer Zwölfjährigen. Allie war nie gern zur Schule gegangen. Sie war intelligent, aber ein verträumtes Kind, das einfach nicht ins System passte – eines von denen, die sich in der Schule genauso fehl am Platze fühlten wie auf dem Mond. Aber sie musste sich nun einmal anstrengen, das Beste daraus zu machen.
»Halsschmerzen«, klagte Allie und gab sich alle Mühe, krank auszusehen.
»Lass mal sehen.«
Gehorsam öffnete Allie den Mund, und Jenna blickte ihr in den offenbar völlig gesunden Rachen. »Kein bisschen gerötet.«
»Es tut aber weh«, jammerte Allie kläglich.
»Das wird sicher gleich besser. Iss dein Frühstück.«
»Ich kann nicht.« Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen, verschränkte die Arme auf dem Tisch und vergrub das Gesicht in der Beuge. »Dad würde mich niemals zwingen, zur Schule zu gehen, wenn ich krank bin.«
Ich auch nicht, dachte Jenna, nahm den Köder jedoch nicht auf und verkniff sich eine passende Bemerkung über Robert Kramer und seine nicht gerade berückenden Leistungen als Vater. Allie sah ihre Mutter finster an und ignorierte demonstrativ ihr Frühstück.
Perfekt. Jenna blickte auf die Uhr. Der Morgen hatte unerfreulich begonnen und entwickelte sich zusehends unerfreulicher, dabei war es noch nicht mal acht. Sie mochte gar nicht daran denken, was der Rest des Tages noch bringen würde. Sie ließ die Mädchen am Tisch sitzen, prüfte die Wasserhähne im gesamten Haus und kam zu dem Schluss, dass Cassie Recht hatte: Es gab kein Wasser. Als sie wieder die Küche betrat, war Leben in Allie gekommen. Sie ließ die Muffins unbeachtet, denn sie hatte eine Packung tiefgefrorener Waffeln entdeckt und schob gerade zwei in den Toaster. Anscheinend war ihr Appetit doch mächtiger als ihre Halsschmerzen.
Cassie trank ihren Saft und starrte auf den Fernseher. Eine Reporterin stand irgendwo in einem dunklen Wald vor dem Schauplatz eines Verbrechens, dem gelben Flatterband nach zu urteilen.
»Was ist da los?«, fragte Jenna.
»Oben am Catwalk Point haben sie eine Frau gefunden«, antwortete Cassie, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen. »Ich habe es schon im Radio gehört.«
»Wer ist sie?«
»Das sagen sie nicht.«
Wie zur Antwort auf Jennas Frage sagte die kecke rothaarige Reporterin in Mantel und Halstuch jetzt: »… Aus dem Büro des Sheriffs wurde bisher noch nichts über die Identität der Frau verlautbart, die Charley Perry, ein Mann, der nicht weit vom Fundort entfernt lebt, gestern Morgen entdeckt hat.« Auf der Mattscheibe erschien ein älterer Mann. Jenna kannte ihn nicht, erinnerte sich jedoch vage, ihn schon mal im Café im Ort gesehen zu haben. Er erzählte, wie er die Leiche gefunden hatte, als er auf der Jagd war.
»Catwalk Point ist nicht weit von hier«, bemerkte Allie. Ihre Waffel sprang aus dem Toaster, und sie legte sie zu dem Muffin auf ihren Teller. »Das ist irgendwie gruselig.«
»Allerdings«, stimmte Jenna zu, wechselte dann jedoch rasch den Tonfall. »Die Polizei kümmert sich darum. Kein Grund zur Sorge.«
Cassie seufzte laut, als könne sie nicht glauben, was sie da hörte. Allie holte die Sirupflasche und goss sich eine Pfütze auf den Teller, die für zehn Pfannkuchen gereicht hätte. Ihre zwei kleinen Waffeln ertranken geradezu darin.
Jenna äußerte sich nicht dazu. Sie sah angespannt auf den kleinen Bildschirm, wo inzwischen die Szene gewechselt hatte. Die Reporterin sprach jetzt mit Sheriff Carter, einem großen, breitschultrigen Mann, neben dem die Frau sehr klein und zierlich wirkte. »Es ist noch zu früh, um die Todesursache mit Gewissheit zu bestimmen«, sagte er zurückhaltend. Er sprach mit leichtem Akzent. Sheriff Carter war ein wettergegerbter Mann mit wie gemeißelt wirkenden Zügen, skeptischen, tief liegenden Augen und einem dunklen Oberlippenbart. Sein Haar war glatt, kaffeebraun und adrett geschnitten. »Wir sind noch mit der Identifizierung der Leiche befasst.«
»Denken Sie, dass Sie es mit einem Mordfall zu tun haben?«
»Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht sagen. Gegenwärtig müssen wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen«, erwiderte er fest, und damit war das aufgezeichnete Interview zu Ende.
»Danke, Sheriff Carter«, sagte die Reporterin und wandte sich wieder der Kamera zu. »Das war Karen Tyler mit einem Bericht vom Catwalk Point.« Anschließend wurde zurück ins Studio geschaltet, wo ein glatt rasierter Mann mit schütterem Haar sagte: »Danke, Karen«, bevor er lächelnd zu den Sportmeldungen überging.
Jenna schaltete den Fernseher aus. »Los jetzt«, sagte sie.
Cassie sah ihre Mutter an, als habe sie den Verstand verloren. »Ich habe doch gesagt, so kann ich nicht zur Schule gehen.«
»Und da hast du dich geirrt. Beweg dich. Ich habe keine Zeit für Streitereien.«
Leise schimpfend schob Cassie ihr unberührtes Frühstück von sich und lief polternd die Treppe hinauf.
»Du auch«, sagte Jenna und deutete mit dem Finger auf ihre jüngere Tochter. Die Waffeln waren beinahe vollständig verzehrt.
»Ich habe Halsschmerzen, ehrlich.«
Das war Allies jüngster Trick, um nicht zur Harrington Junior High School zu müssen. Jenna ließ sich nicht darauf ein. Schon gar nicht, als sie sah, dass Allie ohne jegliche Beschwerden ihren Saft austrank. »Ich denke, du wirst es überleben. Aber ich rufe später mal in der Schule an und erkundige mich, wie es dir geht. Los jetzt.«
Allie kam offenbar zu dem Schluss, dass ihre Strategie nicht fruchtete, schob sich das letzte Stück Waffel in den Mund und hastete die Treppe hinauf, während Jenna die Nummer von Hans Dvorak wählte, einem Pferdetrainer im Ruhestand, der jetzt in Teilzeit als Vormann auf ihrer kleinen Ranch arbeitete. Sie hatte Hans ebenso wie Critter beim Kauf der Farm übernommen. Beim dritten Klingeln meldete er sich mit tiefer, von jahrelangem Zigarettenkonsum rasselnder Stimme. »Hallo?«
»Hans, hier ist Jenna.«
»Bin schon auf dem Weg«, sagte der ältere Mann rasch, als habe er sich verspätet.
»Ich bringe jetzt erst mal die Kinder zur Schule, aber wir haben hier ein kleines Problem.« Sie hörte eines der Mädchen auf der Treppe und erklärte dem Mann hastig das Wasserproblem.
»Das ist wahrscheinlich die Pumpe«, sagte er. »Hat Probleme mit der Stromzufuhr. Ist auch früher schon mal passiert, vor fünf Jahren etwa.«
»Können Sie das reparieren?«
»Ich werd’s versuchen. Aber womöglich brauchen Sie einen Elektriker oder irgendeinen Handwerker, der sich besser mit Strom auskennt als ich – vielleicht zusätzlich auch noch einen Klempner.«
Jenna stöhnte bei dieser Vorstellung innerlich auf, wenngleich sie Wes Allen kannte, einen Elektriker und Gelegenheitskünstler, der am Columbia Theater in the Gorge arbeitete, dem Theater am Ort, in dem sie ehrenamtlich tätig war. Dann war da noch Scott Dalinsky, der im Theater für die Licht- und Tontechnik zuständig war. Doch ihm würde Jenna Arbeiten in ihrem Haus nicht anvertrauen. Obwohl er Wes’ Neffe und der Sohn ihrer Freundin Rinda war, fühlte Jenna sich in Scotts Nähe unbehaglich. Sie hatte ihn zu oft dabei ertappt, dass er sie anstarrte, sodass sie sich in seiner Gegenwart nicht mehr unbefangen fühlen konnte.
»Ich bin in einer halben Stunde da«, versprach Hans.
»Danke.«
Hans war ein Geschenk Gottes. Mit seinen dreiundsiebzig Jahren half er immer noch bei der Versorgung der Tiere und dem Management der Farm. Er war der Verwalter der früheren Besitzer gewesen, und als Jenna in das Haus einzog, hatte sie ihn geradezu angefleht zu bleiben. Er hatte sich einverstanden erklärt, und sie hatte diese Entscheidung seither nicht eine Sekunde lang bereut. Auch heute war sie wieder einmal froh, ihn zu haben. Wenn Hans nicht selbst in der Lage war, das Problem zu beheben, würde er jemanden auftreiben, der es konnte.
Allie, die ihre wilde Mähne inzwischen halbwegs gebändigt hatte, kam ins Zimmer. Sie trug bereits eine Fleecejacke und hatte sich den Riemen des Schulrucksacks über die Schulter gelegt.
»Hast du dir die Zähne geputzt?«, fragte Jenna, ehe ihr klar wurde, wie unsinnig diese Frage war. »Ich weiß, das ist nicht das, was der Zahnarzt empfehlen würde, aber falls du einen schlechten Geschmack im Mund hast, kau auf dem Weg zur Schule ein Kaugummi.«
»Schon okay«, sagte Allie mit matter Stimme, um ihre Mutter dezent daran zu erinnern, dass sie sich nicht gut fühlte.
»Du schreibst heute einen Mathe-Test, nicht wahr? Bist du gut vorbereitet?«
Allie furchte die Stirn und zog die Brauen zusammen. In diesem Augenblick war sie ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. »Ich hasse Mathe.«
»Du bist immer gut in Mathe gewesen.«
»Aber wir haben Algebra.« Allie rümpfte angewidert die Nase.
»Nun ja, da mussten wir alle durch«, versetzte Jenna und ärgerte sich gleich darauf über sich selbst. Sie nahm ihre Jacke vom Haken an der Hintertür und schlüpfte hinein. »Hör zu, ich versuche heute Abend, dir zu helfen, und wenn ich es nicht kann, springt Mr Brennan vielleicht ein. Er war Ingenieur bei der Air Force und …«
»Nein!«, wehrte Allie hastig ab. Jenna gab es auf – ihre Töchter mochten es beide nicht, dass sie sich mit einem Mann traf, obwohl Robert seit ihrer Scheidung schon zwei Mal wieder geheiratet hatte. Das war selbst für Hollywoodverhältnisse ein Rekord. Harrison Brennan war ihr Nachbar, Exmilitär und Witwer. Seit ihrem Einzug zeigte er mehr als nur ein flüchtiges Interesse an Jenna, und doch fasste er sie nicht ehrfurchtsvoll mit Glacéhandschuhen an, wie so viele andere Einwohner der Stadt es getan hatten, als sie nach Falls Crossing gezogen war.
»Okay, ich werde jedenfalls tun, was ich kann«, versprach sie und streifte ein Paar Lederhandschuhe über, während sie zum Treppenabsatz ging. »Cassie, beeil dich! Wir warten im Auto!«
»Ich komm ja schon!«
»Ist gut.« Wieder in der Küche, sagte sie zu Allie: »Komm, wir wärmen den Wagen schon mal vor.« Im nächsten Moment war sie zur Hintertür hinaus. Eiskalte, trockene Luft schlug ihr entgegen. Eine Bö drang in den überdachten Durchgang und zauste Jennas Haar. Während sie die Garagentür aufschloss, sah sie flüchtig zum Himmel auf. Tief hängende, metallisch graue Wolken streiften die Hügel der Umgebung und kündigten Schnee an, wie es der Wetterbericht vorausgesagt hatte. »Brrr«, machte Jenna fröstelnd und schwor sich, diesen Durchgang im nächsten Sommer mit dreifacher Isolierverglasung wetterfest zu machen.
Critter und Allie folgten ihr in die Garage, der ebenfalls Wärmedämmung und ein neues Dach nicht geschadet hätten. Nachdem sie alle drei in den Jeep gestiegen waren, steckte Jenna den Schlüssel ins Zündschloss.
Sie trat aufs Gas und drehte den Zündschlüssel.
Der Motor sprang nicht an.
»Nun mach schon«, beschwor Jenna den Geländewagen und warf einen Blick auf Allie, die den Sicherheitsgurt anlegte. »Der Motor ist kalt«, erklärte sie, ebenso zu ihrer eigenen Beruhigung wie zu der ihrer Tochter. Verbissen versuchte Jenna es noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal, aber der verdammte Motor sprang nicht an. Ihr blieb keine Zeit, um lange darüber nachzudenken, woran es liegen konnte. Frustriert sah sie zur angrenzenden Garagenbucht hinüber, wo der alte Ford Pritschenwagen stand, den sie mit der Ranch übernommen hatte. »Wir nehmen den Pick-up.«
»Echt?«
»Ja. Komm.« Jenna war bereits aus dem Jeep gestiegen und auf dem Weg zur Fahrertür des Pick-ups, als Cassie, ihr Handy am Ohr, in die Garage hastete.
Mit einem Blick auf die Szene blieb sie abrupt stehen. »Ich ruf dich zurück«, sagte sie und klappte ihr Handy zu. Während sie das Gerät in ihrer Tasche verstaute, wandte sie sich an ihre Mutter: »Das soll wohl ein Witz sein?«
»Nein.«
»Darin kann ich mich doch nicht blicken lassen, in diesem … Wrack«, protestierte sie und deutete auf die eingedellte Stoßstange des Ford.
»Doch, das kannst du.«
»Aber …«
»Wenn du nicht bald mit dem Gejammer aufhörst, garantiere ich dir, dass er schon bald dir gehört.«
»O Gott!« Cassies Gesicht war eine Maske des Entsetzens.
»Steig ein. Sofort