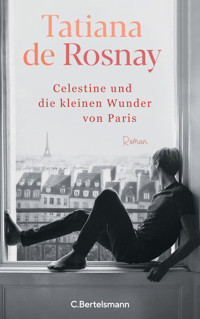10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der ergreifendsten Romane über das Schicksal jüdischer Kinder im Holocaust
Paris im Sommer 1942. Sarah, ein zehnjähriges jüdisches Mädchen, wird nach der Deportation durch die französische Polizei von ihren Eltern getrennt. Nach angstvollen Tagen gelingt ihr die Flucht. Sie muss ihren kleinen Bruder retten, den sie zu Hause im Wandschrank versteckt hat – den Schlüssel dazu hält sie in der Hand ... Sechzig Jahre später findet die Journalistin Julia heraus, dass die Pariser Wohnung ihrer Schwiegereltern einmal Juden gehört hat. Sie ahnt noch nicht, dass die Spurensuche ihr Leben vollkommen verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TATIANA DE ROSNAY lebt als Tochter einer Engländerin und eines französischen Biologen in Paris. Sie hat bisher 13 Romane geschrieben. »Sarahs Schlüssel« ist mit 12 Millionen verkauften Exemplaren ihr größter Erfolg. Die Kino-Verfilmung mit Kristin Scott Thomas in der Hauptrolle wird regelmäßig im Fernsehen wiederholt.
Sarahs Schlüssel in der Presse:
Ein bemerkenswerter Roman, souverän und mit viel Einfühlungsvermögen geschrieben.« Paula Fox
»›Sarahs Schlüssel‹ ist ein Thriller, politisch wie psychologisch.« Deutschlandradio Kultur
»Oft fällt das Lesen schwer, so erschütternd ist diese Geschichte.« Maxi
»Ein starker Roman, den man so schnell nicht vergisst.« Marie-France
Von Tatiana de Rosnay außerdem im Penguin Verlag:
Fünf Tage in Paris
Tatiana de Rosnay
Sarahs Schlüssel
Roman
Aus dem Englischen von Angelika Kaps
Die Originalausgabe (auf Französisch) erschien 2007 unter dem Titel Elle s’appelait Sarah bei Éditions Héloïse d’Ormesson, Paris
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2007bei Éditions Héloïse d’Ormesson, Parisvertreten durch die Literarische Agentur GaebTatiana de Rosnay: Sarahs Schlüssel. Übersetzt von Angelika Kaps.© der deutschen Übersetzung: Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH,Berlin und München 2007© dieser Ausgabe 2023 beim Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCoverkonzeption und -gestaltung: www.buerosued.de, MünchenCovermotiv: Trevillion Images © Marc OwenGesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29698-8V001
www.penguin-verlag.de
Für Stella, meine Mutter
Für meine schöne, rebellische Charlotte
In Gedenken an Natacha, meine Großmutter (1914–2005)
VORWORT
Die Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Aber einige der geschilderten Ereignisse sind es nicht, vor allem jene, die sich im besetzten Frankreich im Sommer 1942 zugetragen haben, insbesondere die große Zusammentreibung im Vélodrome d’Hiver, die am 16. Juli 1942 mitten im Herzen von Paris stattgefunden hat.
Dies ist kein historisches Werk und hat auch nicht den Anspruch, eines zu sein. Ich möchte damit den Kindern des »Vél d’Hiv« meinen Tribut zollen, die nie mehr zurückgekommen sind. Und denen, die überlebt haben, um davon zu berichten.
T. de R.
Mein Gott! Was tut dieses Land mir an? Da es mich von sich stößt, betrachten wir es kalten Bluts und schauen wir zu, wie es seine Ehre und sein Leben verliert.
Irène Némirovsky, Suite Française (1942)
Tiger, Tiger, grelle Prachtin den Dickichten der Nacht,wes unsterblich Aug und Handwohl dein furchtbar Gleichmaß band?
William Blake, »Songs of Experience«
PARIS, JULI 1942
Das Mädchen hörte als Erste das laute Hämmern an der Tür. Ihr Zimmer lag der Wohnungstür am nächsten. Erst dachte sie, noch benommen vom Schlaf, es sei ihr Vater, der aus seinem Versteck im Keller hochgekommen war. Er habe seinen Schlüssel vergessen und sei ungeduldig, weil niemand sein erstes, schüchternes Anklopfen gehört hatte. Aber dann dröhnten Stimmen laut und brutal durch die Stille der Nacht. Das war nicht ihr Vater. »Polizei! Machen Sie auf! Sofort!« Das Hämmern ging wieder los, lauter. Es drang ihr bis ins Mark. Ihr kleiner Bruder, der neben ihr in seinem Bett schlief, regte sich. »Polizei! Aufmachen! Aufmachen!« Wie spät war es? Sie spähte durch die Vorhänge. Draußen herrschte noch Dunkelheit.
Sie fürchtete sich. Ihr fiel die geflüsterte Unterhaltung ein, die sie kürzlich spätnachts belauscht hatte, als ihre Eltern glaubten, sie würde längst schlafen. Sie war zur Wohnzimmertür geschlichen und hatte durch einen kleinen Spalt in der Füllung gelinst und gehorcht. Die nervöse Stimme ihres Vaters. Das ängstliche Gesicht ihrer Mutter. Sie redeten in ihrer Muttersprache, die das Mädchen zwar verstand, aber nicht so fließend sprach wie die Eltern. Ihr Vater hatte geflüstert, dass ihnen schwere Zeiten bevorstünden. Dass sie tapfer und sehr vorsichtig sein müssten. Er benutzte seltsame, unbekannte Wörter: »Lager«, »einpferchen«, »große Zusammentreibung«, »Verhaftungen im Morgengrauen«, und das Mädchen überlegte, was das alles wohl bedeuten mochte. Ihr Vater hatte gemurmelt, dass nur die Männer in Gefahr seien, nicht die Frauen, nicht die Kinder, und dass er sich jede Nacht im Keller verstecken würde.
Am Morgen hatte er dem Mädchen erklärt, es sei sicherer, wenn er für eine Weile unten schliefe. Bis »die Dinge sich wieder beruhigt haben«. Welche »Dinge« denn, dachte das Mädchen. Was bedeutete »beruhigt«? Wann würden sich die Dinge wieder »beruhigt« haben? Sie wollte herausfinden, was er mit »Lager« und »Zusammentreibung« gemeint hatte, aber sie mochte nicht zugeben, dass sie ihre Eltern mehrmals heimlich belauscht hatte. Deshalb traute sie sich nicht, ihn zu fragen.
»Aufmachen! Polizei!«
Hatte die Polizei Papa im Keller gefunden? Waren sie deshalb hier? War die Polizei gekommen, um Papa an jene Orte mitzunehmen, von denen er nachts so besorgt getuschelt hatte: die »Lager« weit außerhalb der Stadt?
Das Mädchen lief mit leisen Schritten zum Zimmer ihrer Mutter am Ende des Flurs. Ihre Mutter wachte sofort auf, als sie ihr die Hand auf die Schulter legte.
»Es ist die Polizei, Maman«, flüsterte das Mädchen. »Sie schlagen an die Tür.«
Ihre Mutter schlüpfte mit den Beinen unter der Decke hervor und strich sich das Haar aus dem Gesicht. Das Mädchen fand, sie sah müde aus, alt, viel älter als ihre dreißig Jahre.
»Sind sie gekommen, um Papa mitzunehmen?«, fragte das Mädchen ängstlich, die Hände auf den Armen der Mutter. »Sind sie seinetwegen hier?«
Die Mutter antwortete nicht. Wieder die lauten Stimmen. Die Mutter zog hastig einen Morgenmantel über ihr Nachthemd, fasste das Mädchen an der Hand und ging zur Tür. Ihre Hand war heiß und feucht. Wie die eines Kindes, dachte das Mädchen.
»Ja?«, sagte die Mutter furchtsam, ohne den Riegel aufzuschieben.
Eine Männerstimme. Sie rief ihren Namen.
»Ja, Monsieur, das bin ich«, antwortete sie. Ihr Akzent kam deutlich heraus, beinahe hart.
»Machen Sie sofort auf. Polizei.«
Die Mutter griff sich an die Kehle, und das Mädchen bemerkte, wie blass die Mutter war. Sie wirkte wie ausgeblutet, wie erstarrt. Als könnte sie sich nicht mehr bewegen. Noch nie hatte das Mädchen so viel Angst im Gesicht der Mutter gesehen. Ihr Mund wurde ganz trocken vor Schreck.
Wieder hämmerten die Männer gegen die Tür. Die Mutter öffnete sie ungeschickt mit zittrigen Fingern. Das Mädchen zuckte zusammen, in Erwartung, grüngraue Uniformen zu sehen.
Zwei Männer standen dort. Der eine war ein Polizist, erkennbar an seinem dunkelblauen, knielangen Umhang und der hohen zylindrischen Kappe. Der andere trug einen beigefarbenen Regenmantel. Er hielt eine Liste in der Hand. Er wiederholte den Namen der Mutter. Und den Namen des Vaters. Er sprach akzentfrei Französisch. Dann sind wir sicher, dachte das Mädchen. Wenn sie Franzosen sind und keine Deutschen, sind wir nicht in Gefahr. Wenn sie Franzosen sind, werden sie uns nichts tun.
Die Mutter zog ihre Tochter fest an sich. Das Mädchen spürte den Herzschlag der Mutter durch den Morgenmantel hindurch. Sie wollte sie wegstoßen, wollte, dass die Mutter Haltung bewahrte und den Männern kühn entgegentrat, anstatt sich vor ihnen zu ducken, dass sie ihr Herz beruhigte, damit es aufhörte, wie das eines zu Tode erschrockenen Tieres zu schlagen. Sie wollte, dass ihre Mutter tapfer war.
»Mein Mann ist … nicht hier«, stammelte die Mutter. »Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht.«
Der Mann mit dem beigefarbenen Regenmantel drängte an ihnen vorbei in die Wohnung.
»Beeilung, Madame. Sie haben zehn Minuten. Packen Sie ein paar Sachen ein. Genug für ein paar Tage.«
Die Mutter rührte sich nicht. Sie starrte den Polizisten an. Er stand auf dem Treppenabsatz, mit dem Rücken zur Tür. Er wirkte gleichgültig, gelangweilt. Sie legte eine Hand auf seinen marineblauen Ärmel.
»Monsieur, bitte«, hob sie an.
Der Polizist drehte sich um, wischte ihre Hand weg. Ein harter, leerer Ausdruck lag in seinen Augen.
»Sie haben doch gehört. Sie kommen mit uns. Ihre Tochter auch. Tun Sie einfach, was man Ihnen sagt.«
PARIS, MAI 2002
Bertrand kam wie üblich zu spät. Ich versuchte, mich nicht zu ärgern, tat es aber dennoch. Zoë lehnte gelangweilt an der Hauswand. Sie sah ihrem Vater so ähnlich, dass ich manchmal lächeln musste. Heute nicht. Ich blickte an dem alten, hohen Gebäude hinauf. Mamés Haus. Die alte Wohnung von Bertrands Großmutter. Bald würden wir dort wohnen. Wir würden den Boulevard du Montparnasse mit seinem Verkehrslärm, den unablässig heulenden Sirenen der Ambulanz bei drei benachbarten Krankenhäusern, seinen Cafés und Restaurants verlassen, um in diese ruhige, schmale Straße am rechten Seine-Ufer zu ziehen.
Der Marais war ein Arrondissement, in dem ich mich nicht gut auskannte, obwohl ich seine altehrwürdige, abgebröckelte Schönheit bewunderte. Freute ich mich über den Umzug? Ich wusste es nicht. Bertrand hatte mich nie direkt nach meiner Meinung gefragt. Wir hatten im Grunde nicht viel darüber diskutiert. Mit seiner üblichen Begeisterung hatte er die ganze Sache vorangetrieben. Ohne mich.
»Da kommt er«, sagte Zoë. »Nur eine halbe Stunde zu spät.«
Wir beobachteten, wie Bertrand mit seinem geschmeidigen Gang die Straße entlanggeschlendert kam. Schlank, dunkel, Sexappeal verströmend, der Prototyp eines Franzosen. Er telefonierte, wie gewöhnlich. Hinter ihm lief sein Geschäftspartner, der bärtige, rotwangige Antoine. Ihre Büros befanden sich in der Rue de l’Arcade, gleich hinter La Madeleine. Bertrand war lange Zeit Mitarbeiter in einem Architekturbüro gewesen, schon vor unserer Heirat, aber vor fünf Jahren hatte er sich zusammen mit Antoine selbständig gemacht.
Bertrand winkte uns zu, zeigte dann aufs Telefon, wobei er die Brauen zusammenzog und einen finsteren Blick aufsetzte.
»Als könnte er den Menschen am anderen Ende nicht abwimmeln«, spöttelte Zoë. »Na klar.«
Zoë war erst elf, aber manchmal wirkte sie schon wie ein Teenager. Einmal wegen ihrer Größe – und erst recht der ihrer Füße, würde sie grimmig hinzufügen –, die alle ihre Freundinnen klein erscheinen ließ, und zum anderen wegen einer frühreifen Klarsichtigkeit, die mich oft in Staunen versetzte. Es war etwas Erwachsenes an ihrem ernsthaften Blick aus den nussbraunen Augen, an der nachdenklichen Art, wie sie das Kinn hob. Sie war schon immer so gewesen, selbst als kleines Kind. Ruhig, reif, manchmal zu reif für ihr Alter.
Antoine gesellte sich zu uns und begrüßte uns, während Bertrand weiter telefonierte, gerade laut genug, damit die ganze Straße mithören konnte, wobei er mit der freien Hand in der Luft herumfuchtelte, Grimassen schnitt und sich gelegentlich umdrehte, um sich zu vergewissern, dass wir auch ja jedes Wort mitbekamen.
»Ein Problem mit einem anderen Architekten«, erklärte Antoine mit diskretem Lächeln.
»Ein Konkurrent?«, fragte Zoë.
»Ja, ein Konkurrent«, erwiderte Antoine.
Zoë seufzte.
»Was bedeutet, dass wir womöglich den ganzen Tag hier herumhängen.«
Ich hatte eine Idee.
»Antoine, hast du zufällig einen Schlüssel für Madame Tézacs Wohnung?«
»I do have it, Julia«, sagte er strahlend. Antoine antwortete immer auf Englisch, wenn ich Französisch sprach. Ich vermutete, er tat es aus Freundlichkeit, aber insgeheim nervte es mich. Es gab mir das Gefühl, mein Französisch sei noch immer ungenügend – nach all den Jahren, die ich bereits hier lebte.
Antoine präsentierte mit großer Geste den Schlüssel. Wir beschlossen, zu dritt vorzugehen. Zoë tippte mit flinken Fingern den Zahlencode an der Haustür ein. Wir gingen durch den belaubten, kühlen Hof zum Fahrstuhl.
»Ich hasse diesen Fahrstuhl«, sagte Zoë. »Den müsste sich Papa mal vornehmen.«
»Schatz, er renoviert nur die Wohnung deiner Großmutter«, stellte ich klar. »Nicht das ganze Gebäude.«
»Das sollte er aber«, sagte sie.
Während wir auf den Fahrstuhl warteten, trillerte mein Handy die Darth-Vader-Melodie. Ich schaute nach der Nummer auf dem Display. Es war Joshua, mein Boss.
Ich meldete mich. »Ja?«
Joshua kam gleich zur Sache. Wie immer.
»Wir brauchen dich um drei Uhr hier. Um die Juli-Ausgabe abzuschließen. Ende der Durchsage.«
»Gee whiz«, sagte ich. Ich hörte ein Glucksen am anderen Ende, bevor er auflegte. Joshua fand es immer lustig, wenn ich »gee whiz« sagte. Vielleicht erinnerte es ihn an seine Jugend. Auch Antoine schien sich über meine altmodischen Ausdrücke zu amüsieren. Ich stellte mir vor, wie er sie im Geist hortete, um sie mit seinem französischen Akzent bei anderer Gelegenheit zum Einsatz zu bringen.
Der Fahrstuhl war eine jener unnachahmlichen antiquierten Pariser Anlagen – mit einer winzigen Kabine, einem von Hand zu schließenden eisernen Gitter und einer hölzernen Flügeltür, die einem unweigerlich ins Gesicht schwang. Eingequetscht zwischen Zoë und Antoine – eine Spur zu großzügig mit seinem Vétiver-Duft –, erhaschte ich einen Blick auf mein Spiegelbild, während wir hinauffuhren. Ich sah genauso in die Jahre gekommen aus wie der ächzende Fahrstuhl. Wo war die blühende Schönheit aus Boston, Massachusetts, geblieben? Die Frau, die mir entgegenblickte, war in jenem grässlichen Alter zwischen fünfundvierzig und fünfzig, diesem Niemandsland aus abfallendem Gelände, tiefer werdenden Falten und dem heimlichen Herannahen der Menopause.
»Ich hasse diesen Fahrstuhl auch«, sagte ich grimmig.
Zoë grinste und kniff mich in die Wange.
»Mom, sogar Gwyneth Paltrow würde in diesem Spiegel wie ihre eigene Großmutter aussehen.«
Ich musste lächeln. Das war so typisch Zoë.
Die Mutter fing an zu schluchzen, leise zunächst, dann lauter. Das Mädchen blickte sie erstaunt an. Sie hatte in ihren zehn Jahren die Mutter noch nie weinen gesehen. Entsetzt beobachtete sie, wie die Tränen über das fahle, eingefallene Gesicht der Mutter liefen. Sie wollte ihr sagen, dass sie aufhören sollte zu weinen. Sie konnte die Schmach nicht ertragen, sie vor diesen fremden Männern weinen zu sehen. Aber die Männer beachteten die Tränen der Mutter überhaupt nicht. Sie forderten sie auf, sich zu beeilen. Man habe keine Zeit zu verschwenden.
Der kleine Junge lag noch immer schlafend in ihrem gemeinsamen Zimmer.
»Aber wohin bringen Sie uns?«, fragte die Mutter verzagt. »Meine Tochter ist Französin, sie wurde in Paris geboren – was wollen Sie von ihr? Wo bringen Sie uns hin?«
Die Männer antworteten nicht. Sie ragten drohend und mächtig über ihr. Die Augen der Mutter waren weiß vor Angst. Sie ging in ihr Zimmer und sank aufs Bett. Das Mädchen folgte ihr. Nach ein paar Sekunden richtete die Mutter sich auf und drehte sich zu ihr um. Ihre Stimme war ein Zischen, ihr Gesicht eine starre Maske.
»Weck deinen Bruder. Zieht euch beide an. Nimm ein paar Sachen mit für ihn und dich. Schnell! Beeil dich!«
Die Angst schnürte dem kleinen Jungen die Kehle zu, als er durch die Tür spähte und die Männer sah. Er beobachtete seine Mutter, wie sie aufgelöst und schluchzend versuchte, die Koffer zu packen. Er nahm alle Kräfte seines vierjährigen Körpers zusammen und rührte sich nicht von der Stelle. Das Mädchen redete ihm gut zu. Er hörte nicht auf sie. Er stand reglos da, die kleinen Arme vor der Brust verschränkt.
Das Mädchen zog ihr Nachthemd aus, nahm eine Baumwollbluse und einen Rock. Sie schlüpfte in ein Paar Schuhe. Der Bruder beobachtete sie. Sie konnten die Mutter im anderen Zimmer weinen hören.
»Ich gehe in unser Versteck«, flüsterte er.
»Nein!«, drängte sie. »Du kommst mit uns. Du musst.«
Sie packte ihn, aber er entwand sich ihrem Griff und schlüpfte in den langen, tiefen Schrank, der in der Wand ihres Zimmers verborgen war. In dem sie immer Verstecken spielten. Sie verkrochen sich oft darin und schlossen sich ein. Es war wie ihr eigenes kleines Haus. Maman und Papa wussten natürlich Bescheid, spielten aber mit. Sie riefen ihre Namen, sagten mit lauter, klarer Stimme: »Aber wo sind die Kinder nur hin? Wie seltsam, eben waren sie doch noch hier!« Und ihr Bruder und sie kicherten vor Vergnügen.
Sie hatten eine Taschenlampe da drin und ein paar Kissen und Spielzeuge und Bücher und sogar eine Karaffe mit Wasser, die Maman jeden Tag frisch auffüllte. Ihr Bruder konnte noch nicht lesen, deshalb las das Mädchen ihm aus Un Bon Petit Diable vor. Er liebte die Geschichte vom Waisenkind Charles und der schrecklichen Madame Mac’miche, und wie Charles ihr alle Grausamkeiten heimzahlte. Das Mädchen musste ihm die Geschichte immer wieder aufs Neue vorlesen.
Sie konnte das kleine Gesicht ihres Bruders matt aus der Dunkelheit herüberscheinen sehen. Er hielt sein Lieblingsstofftier an sich gepresst, er hatte keine Angst mehr. Vielleicht wäre er dort tatsächlich sicher. Er hatte Wasser und die Taschenlampe. Und er konnte sich die Bilder in dem Buch ansehen, sein liebstes war das von Charles’ köstlicher Rache. Vielleicht sollte sie ihn fürs Erste dort lassen. Die Männer würden ihn niemals finden. Sie würde ihn später am Tag herausholen, wenn sie wieder zurück nach Hause durften. Und Papa, der noch immer im Keller war, würde wissen, wo sich der Junge versteckte, falls er hochkam.
»Fürchtest du dich da drinnen?«, fragte sie leise, als die Männer nach ihr riefen.
»Nein«, sagte er. »Ich fürchte mich nicht. Schließ mich ein. Sie kriegen mich nicht.«
Sie machte die Tür vor dem kleinen weißen Gesicht zu, drehte den Schlüssel im Schloss herum. Dann ließ sie den Schlüssel in ihre Tasche gleiten. Das Schloss wurde von einer drehbaren Vorrichtung verborgen, die aussah wie ein Lichtschalter. Es war unmöglich, die Konturen des Schranks in der Täfelung der Wand zu erkennen. Ja, hier würde er sicher sein. Davon war sie überzeugt.
Das Mädchen murmelte seinen Namen und legte die Handfläche an die Holzpaneele.
»Ich hole dich später raus. Versprochen.«
Wir betraten die Wohnung, tasteten nach den Lichtschaltern. Nichts tat sich. Antoine öffnete ein paar Fensterläden. Sonnenlicht strömte herein. Die Zimmer waren kahl und staubig. Ohne Möbel wirkte das Wohnzimmer riesig. Goldene Strahlen fielen durch die hohen, schmutzigen Fensterscheiben und sprenkelten die dunkelbraunen Dielenbretter.
Ich ließ meinen Blick zu den leeren Regalen schweifen und zu den dunkleren Rechtecken an den Wänden, wo die schönen Gemälde gehangen hatten, zu dem Marmorkamin, der mich an die vielen Winterfeuer erinnerte und an Mamé, wie sie ihre zarten, blassen Hände den wärmenden Flammen entgegengestreckt hatte.
Ich trat an eins der Fenster und schaute hinunter in den ruhigen, grünen Hof. Ich war froh, dass Mamé nach ihrem Umzug ihre leere Wohnung nicht mehr hatte sehen müssen. Es hätte sie verstört. Es verstörte auch mich.
»Riecht noch immer nach Mamé«, sagte Zoë. »Shalimar.«
»Und nach dieser schrecklichen Minette«, sagte ich naserümpfend. Minette war Mamés letztes Schoßtier gewesen. Eine inkontinente Siamkatze.
Antoine sah mich überrascht an.
»The cat«, erklärte ich. Ich sagte es auf Englisch diesmal. Natürlich wusste ich, dass »Katze« auf Französisch »la chatte« hieß, aber »la chatte« konnte auch »Muschi« bedeuten. Und ich wollte vermeiden, dass sich Antoine über irgendwelche kuriosen Zweideutigkeiten kaputtlachte, bloß das nicht.
Antoine taxierte die Wohnung mit professionellem Blick.
»Die elektrische Anlage ist völlig veraltet«, stellte er fest und zeigte auf die altmodischen weißen Porzellansicherungen. »Und die Heizung auch.«
Eine schwarze Schmutzschicht, schuppig wie ein Reptil, überzog die überdimensionierten Heizkörper.
»Warte, bis du die Küche und die Bäder siehst«, sagte ich.
»Die Badewanne hat Klauenfüße«, sagte Zoë. »Ich werde sie vermissen.«
Antoine prüfte die Wände, klopfte dagegen.
»Ich nehme an, ihr wollt alles komplett renovieren?«, fragte er und sah mich an.
Ich zuckte die Schultern.
»Ich weiß nicht genau, was Bertrand vorhat. Es war seine Idee, diese Wohnung zu übernehmen. Ich war nicht so versessen darauf, hier einzuziehen, ich wollte etwas … etwas Praktischeres. Etwas Neues.«
Antoine grinste.
»Aber sie wird nagelneu sein, wenn wir damit fertig sind.«
»Mag sein. Aber für mich wird es immer Mamés Wohnung bleiben.«
Die Wohnung trug noch immer ihren Stempel, obwohl Mamé schon vor neun Monaten in ein Pflegeheim gezogen war. Die Großmutter meines Mannes hatte viele Jahre hier gelebt. Ich erinnerte mich noch gut an unsere erste Begegnung vor sechzehn Jahren. Ich war beeindruckt gewesen von den alten Gemälden, dem marmornen Kaminsims, prahlerisch beladen mit Familienfotos in reich verzierten Silberrahmen, von der täuschend schlichten, eleganten Einrichtung, den ungezählten Büchern, dicht an dicht in den Regalen der Bibliothek, von dem großen Flügel, üppig drapiert mit rotem Samt. Das sonnige Wohnzimmer blickte auf einen ruhigen Innenhof, dessen gegenüberliegende Mauer mit dichten Efeuranken überzogen war. Genau hier war ich ihr zum ersten Mal begegnet, hatte ich ihr ungeschickt die Hand entgegengestreckt, weil ich noch nicht vertraut gewesen war mit diesem »französischen Küsschentick«, wie meine Schwester Charla es nannte.
Man schüttelte einer Pariserin nicht die Hand, selbst wenn man ihr zum ersten Mal begegnete. Man gab ihr einen Kuss auf jede Wange.
Aber das hatte ich damals noch nicht gewusst.
Der Mann mit dem beigefarbenen Regenmantel sah wieder auf seine Liste.
»Moment«, sagte er. »Da fehlt noch ein Kind. Ein Junge.«
Er nannte den Namen des Jungen.
Das Herz des Mädchens setzte für einen Schlag aus. Die Mutter blickte zu ihrer Tochter. Das Mädchen legte geschwind den Zeigefinger an die Lippen. Eine Bewegung, die der Mann nicht mitbekam.
»Wo ist der Junge?«, drängte er.
Das Mädchen trat vor, rang die Hände.
»Mein Bruder ist nicht hier, Monsieur«, sagte sie im perfekten Französisch einer gebürtigen Französin. »Er ist Anfang des Monats mit ein paar Freunden weggefahren. Aufs Land.«
Der Mann im Regenmantel blickte sie nachdenklich an. Dann machte er mit dem Kinn eine ruckartige Geste zu dem Polizisten.
»Durchsuchen Sie die Wohnung. Schnell. Vielleicht versteckt sich der Vater auch irgendwo.«
Der Polizist trampelte durch die Zimmer, riss Türen auf, guckte unter Betten und in Schränken nach.
Während er sich polternd durch die Wohnung arbeitete, schritt der andere Mann im Zimmer auf und ab. Als er ihnen den Rücken zudrehte, zeigte das Mädchen ihrer Mutter schnell den Schlüssel. Papa wird kommen und ihn holen, Papa wird später kommen, gab sie ihr lautlos zu verstehen. Die Mutter nickte. Ist gut, schien sie zu sagen. Ich verstehe, wo der Junge ist. Aber dann runzelte die Mutter die Stirn, machte eine schließende Bewegung mit der Hand, wo willst du den Schlüssel für Papa hinterlegen, woher wird er wissen, wo er ist? Der Mann drehte sich jäh um. Die Mutter erstarrte. Das Mädchen zitterte vor Angst.
Er starrte sie eine Weile lang an, dann schloss er abrupt das Fenster.
»Bitte«, sagte die Mutter. »Es ist so heiß hier drin.«
Der Mann lächelte. Das Mädchen glaubte, noch nie ein hässlicheres Lächeln gesehen zu haben.
»Es bleibt zu, Madame«, sagte er. »Heute früh hat eine Frau ihr Kind aus dem Fenster geworfen und ist dann hinterhergesprungen. Wir möchten nicht, dass so was noch mal passiert.«
Die Mutter sagte nichts, gelähmt vor Entsetzen. Das Mädchen starrte den Mann wütend an, hasste alles an ihm. Sie verabscheute sein fleischiges Gesicht, seinen glänzenden Mund. Den kalten, abgestumpften Ausdruck seiner Augen. Die Art, wie er dastand, die Beine gespreizt, den Filzhut ins Gesicht gezogen, die fetten Hände hinter dem Rücken verschränkt.
Sie hasste ihn mit aller Kraft, so wie sie noch nie zuvor im Leben jemanden gehasst hatte, noch mehr als diesen abscheulichen Jungen in der Schule, Daniel, der ihr diese schrecklichen Sachen zugeflüstert hatte, schreckliche Sachen über den Akzent ihrer Mutter, den Akzent ihres Vaters.
Sie horchte, wie der Polizist mit seiner lärmenden Durchsuchung fortfuhr. Er würde den Bruder nicht finden. Der Schrank war zu geschickt verborgen. Der Bruder war sicher. Sie würden ihn nie finden. Niemals.
Der Polizist kam zurück. Er zuckte mit den Schultern, schüttelte den Kopf.
»Es ist niemand hier«, sagte er.
Der Mann im Regenmantel schubste die Mutter zur Tür. Er wollte die Wohnungsschlüssel haben. Sie händigte sie ihm stumm aus. Sie gingen hintereinander die Treppe hinunter, kamen nur langsam voran wegen der Taschen und Bündel, die die Mutter trug. Das Mädchen überlegte hastig, wie sie dem Vater den Schlüssel zukommen lassen konnte. Wo sollte sie ihn hinterlassen? Bei der Concierge? Würde sie um diese Zeit schon auf sein?
Ja, sie war tatsächlich schon auf und wartete in ihrer Loge. Sie machte ein seltsames, hämisches Gesicht. Wieso schaute sie so, fragte sich das Mädchen, wieso sah sie nicht zu ihrer Mutter oder zu ihr, sondern nur zu den Männern, als wolle sie die Mutter und sie gar nicht sehen, als würde sie sie gar nicht kennen. Obwohl die Mutter immer freundlich zu dieser Frau gewesen war und gelegentlich auf ihr Baby aufgepasst hatte, auf die kleine Suzanne, die unter Magenschmerzen litt und deshalb oft gereizt war, und sie war so geduldig gewesen, hatte Suzanne endlos in ihrer Muttersprache vorgesungen, und das Baby hatte das geliebt, war immer friedlich eingeschlafen.
»Wissen Sie, wo der Mann und der Sohn sind?«, fragte der Polizist. Er gab der Concierge die Wohnungsschlüssel.
Sie zuckte die Schultern. Sie sah weiterhin weder das Mädchen noch die Mutter an. Mit einer flinken, gierigen Bewegung steckte sie die Schlüssel in die Tasche.
»Nein«, sagte sie zu dem Polizisten. »Ich habe von dem Mann in letzter Zeit wenig gesehen. Vielleicht hält er sich irgendwo versteckt. Mit dem Jungen zusammen. Sie könnten im Keller nachsehen oder auf dem Dachboden. Ich führe Sie hin.«
In der kleinen Loge begann das Baby zu wimmern. Die Concierge warf einen Blick über die Schulter.
»Wir haben keine Zeit«, sagte der Mann im Regenmantel. »Wir müssen weiter. Wir kommen später noch mal, falls nötig.«
Die Concierge ging zu dem greinenden Baby und drückte es an ihre Brust. Sie sagte, sie wisse, dass im Gebäude nebenan noch andere Familien seien. Sie sprach ihre Namen mit einem Ausdruck von Abscheu aus, als wären es unanständige Wörter, dachte das Mädchen, als wären es welche von diesen schmutzigen Wörtern, die man nicht in den Mund nehmen durfte.
Schließlich steckte Bertrand sein Telefon in die Tasche und wandte sich mir zu. Er bedachte mich mit einem seiner unwiderstehlichen Grinsen. Wieso hatte ich nur einen so unverschämt attraktiven Ehemann, fragte ich mich zum x-ten Mal. Als ich ihn vor so vielen Jahren bei einem Skiurlaub in Courchevel in den französischen Alpen kennengelernt hatte, war er ein schmaler, jungenhafter Typ gewesen. Mit seinen siebenundvierzig Jahren jetzt war er kräftiger und markanter, strahlte Männlichkeit, französische Lebensart und Klasse aus. Er war wie ein guter Wein gereift und hatte an Würze und Ausdruck gewonnen. Wohingegen ich anscheinend meine Jugend irgendwo zwischen dem Charles River und der Seine gelassen hatte und mit den zunehmenden Jahren nicht unbedingt aufgeblüht war. Während Falten und graue Haare Bertrands Schönheit noch akzentuierten, hatten sie meine beeinträchtigt.
»Und?«, sagte er und legte seine Hand unbekümmert und besitzergreifend auf meinen Hintern, obwohl sein Partner und unsere Tochter zusahen. »Ist es nicht toll?«
»Toll«, echote Zoë. »Antoine hat uns gerade erzählt, dass alles renoviert werden muss. Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich erst in einem Jahr einziehen können.«
Bertrand lachte. Ein verblüffend ansteckendes Lachen, eine Mischung aus Hyäne und Saxofon. Das war das Problem mit meinem Ehemann. Hinreißender Charme. Und er liebte es, ihn voll auszuspielen. Ich fragte mich, von wem er ihn geerbt haben mochte. Von seinen Eltern, Colette und Édouard? Ungemein intelligent, kultiviert, gebildet. Aber nicht charmant. Von seinen Schwestern Cécile und Laure? Wohlerzogen, vornehm, perfekte Manieren. Aber sie lachten nur, wenn sie sich genötigt fühlten. Ich vermutete, dass er ihn von Mamé geerbt hatte. Rebellische, streitlustige Mamé.
»Antoine ist ein solcher Pessimist«, lachte Bertrand. »Wir werden schon früh genug hier einziehen. Es wird ein Haufen Arbeit sein, aber wir setzen die besten Leute dran.«
Wir folgten ihm durch den langen Flur mit den knarzenden Dielen, besichtigten die Schlafzimmer, die zur Straße hinausgingen.
»Diese Wand muss weg«, erklärte Bertrand mit ausgestrecktem Arm, und Antoine nickte. »Wir müssen die Küche näher ranholen. Sonst ist das unserer Miss Jarmond hier nicht praktisch genug.«
Er sagte das Wort auf Englisch, wobei er mich mit einem frechen Augenzwinkern ansah und mit den Fingern kleine Anführungszeichen in die Luft malte.
»Es ist eine recht große Wohnung«, bemerkte Antoine. »Ziemlich groß sogar.«
»Ja, schon. Aber ursprünglich ist sie wesentlich kleiner und bescheidener gewesen«, sagte Bertrand. »Meine Großeltern haben es nicht leicht gehabt damals. Bis in die Sechziger verdiente mein Großvater nur wenig Geld. Dann kaufte er die Wohnung gegenüber dazu und verband die beiden miteinander.«
»Dann hat grand-père als kleiner Junge also nur in diesem einen Teil gelebt?«, fragte Zoë.
»Genau«, sagte Bertrand. »In diesem Teil hier. Das dort war das Zimmer seiner Eltern, und er hat hier geschlafen. Es war sehr viel kleiner.«
Antoine klopfte nachdenklich gegen die Wände.
»Ja, ich weiß, was du denkst.« Bertrand lächelte. »Du willst aus diesen beiden Zimmern einen großen Raum machen, stimmt’s?«
»Stimmt!«
»Keine schlechte Idee. Erfordert allerdings einige Arbeit. Das ist eine ziemlich vertrackte Wand hier, ich zeige es dir später. Dicke Wandverkleidungen. Lauter Rohre und Leitungen dahinter. Nicht so einfach, wie es aussieht.«
Ich sah auf die Uhr. Halb drei.
»Ich muss los«, sagte ich. »Ein Meeting mit Joshua.«
»Was machen wir mit Zoë?«, fragte Bertrand.
Zoë verdrehte die Augen.
»Ich kann doch den Bus zurück zum Montparnasse nehmen.«
»Was ist mit der Schule?«, meinte Bertrand.
Erneutes Augenrollen.
»Papa! Heute ist Mittwoch. Keine Schule mittwochnachmittags, erinnerst du dich?«
Bertrand kratzte sich am Kopf.
»Zu meiner Zeit war –«
»War es donnerstags, da war am Donnerstag keine Schule«, leierte Zoë.
»Dieses alberne französische Bildungssystem«, seufzte ich. »Und dafür ist dann Schule am Samstagvormittag!«
Antoine stimmte mir zu. Seine Söhne besuchten eine Privatschule, wo es am Samstagmorgen keinen Unterricht gab. Aber Bertrand war – wie seine Eltern – überzeugter Anhänger der staatlichen Schule. Ich hätte Zoë gern auf eine zweisprachige Schule geschickt, es gab mehrere in Paris, aber der Tézac-Clan hatte das nicht zugelassen. Zoë war Französin, geboren in Frankreich. Sie sollte auf eine französische Schule gehen. Zurzeit besuchte sie das Lycée Montaigne in der Nähe des Jardin du Luxembourg. Die Tézacs vergaßen gern, dass Zoë eine amerikanische Mutter hatte. Zum Glück war Zoës Englisch perfekt. Ich hatte nie etwas anderes mit ihr gesprochen, und sie flog oft genug nach Boston, um meine Eltern zu besuchen. Und die meisten Sommer verbrachte sie auf Long Island bei meiner Schwester Charla.
Bertrand drehte sich zu mir um. Er hatte dieses kleine Funkeln in den Augen, dieses Funkeln, das mich nervte, weil es bedeutete, dass er gleich etwas sehr Lustiges oder sehr Grausames sagen würde, oder beides. Antoine wusste offenbar ebenso gut, was es ankündigte, der Art nach zu urteilen, wie er sich auf die eingehende Betrachtung seiner quastenverzierten Lackleder-Slipper verlegte.
»Oh ja, in der Tat, wir wissen, was Miss Jarmond von unseren Schulen hält, von unseren Krankenhäusern, unseren endlosen Streiks, unseren langen Ferien, unseren Installationssystemen, unserem Postdienst, unserem Fernsehen, unserer Politik, unserer Hundescheiße auf den Bürgersteigen«, sagte Bertrand und blitzte mich mit seinen perfekten Zähnen an. »Wir haben das so viele Male gehört, so viele Male, nicht wahr? I like to be in America, everything’s clean in America, jeder hebt die Hundescheiße auf in Amerika!«
»Lass das, Papa, du bist gemein!«, sagte Zoë und nahm meine Hand.
Draußen sah das Mädchen einen Nachbarn im Schlafanzug aus dem Fenster lehnen. Es war der nette Musiklehrer von gegenüber. Sie hörte ihm immer gern zu, wenn er Geige spielte. Er spielte oft für sie und ihren Bruder quer über den Hof hinweg. Alte französische Lieder, wie »Sur le pont d’Avignon« und »À la claire fontaine«, und auch Lieder aus dem Land ihrer Eltern, Lieder, zu denen ihre Mutter und ihr Vater dann fröhlich zu tanzen anfingen, so dass die Schuhe der Mutter flott über die Dielen glitten, und ihr Vater wirbelte sie herum und herum, immer wieder, bis ihnen allen ganz schwindelig war.
»Was machen Sie da? Wohin bringen Sie diese Leute?«, rief er.
Die Stimme hallte durch den Hof und übertönte die Babyschreie. Der Mann im Regenmantel antwortete nicht.
»Aber das können Sie nicht machen«, sagte der Nachbar. »Das sind ehrliche, gute Menschen! Das können Sie nicht machen!«
Beim Klang seiner Stimme begannen Fensterläden aufzugehen, Gesichter spähten durch Gardinen.
Aber das Mädchen bemerkte, dass niemand sich rührte, niemand etwas sagte. Sie sahen einfach zu.
Die Mutter blieb abrupt stehen, den Rücken unter Schluchzern gebeugt. Die Männer schubsten sie weiter.
Die Nachbarn sahen schweigend zu. Sogar der Musiklehrer war verstummt.
Plötzlich drehte sich die Mutter herum und schrie aus vollem Hals. Sie schrie den Namen ihres Mannes, drei Mal.
Die Männer packten sie bei den Armen und begannen, sie heftig zu schütteln. Sie ließ ihre Taschen und Bündel fallen. Das Mädchen versuchte einzuschreiten, aber die Männer stießen sie beiseite.
Ein Mann erschien im Türrahmen, ein dünner Mann in verknitterter Kleidung, mit unrasiertem Kinn und roten, müden Augen. In aufrechter Haltung kam er über den Hof.
Als er die Männer erreichte, sagte er ihnen, wer er war. Er hatte einen starken Akzent, genau wie die Frau.
»Nehmen Sie mich zusammen mit meiner Familie mit«, sagte er.
Das Mädchen ließ ihre Hand in die des Vaters gleiten.
Jetzt war sie sicher, dachte sie. Sie war sicher bei ihrer Mutter, bei ihrem Vater. Es würde alles nicht lange dauern. Das war französische Polizei, keine deutsche. Niemand würde ihnen etwas tun.
Bald würden sie wieder in der Wohnung sein, und Maman würde Frühstück machen, und ihr kleiner Bruder konnte wieder aus seinem Versteck kommen. Und Papa würde zur Werkhalle am Ende der Straße gehen, wo er als Meister arbeitete und mit seinen Mitarbeitern Gürtel und Taschen und Brieftaschenherstellte, und alles würde wie früher sein. Bald würden sie wieder in Frieden leben können.
Draußen zeigte sich schon Tageslicht. Die schmale Straße war menschenleer. Das Mädchen blickte zurück zu ihrem Wohnhaus, zu den stummen Gesichtern in den Fenstern, zu der Concierge, die ihre kleine Suzanne an sich drückte.
Der Musiklehrer hob die Hand langsam zu einem Abschiedsgruß.
Sie winkte ihm lächelnd zurück. Alles würde wieder gut werden. Sie würde zurückkommen, sie würden alle zurückkommen.
Aber der Mann wirkte bestürzt.
Tränen liefen ihm übers Gesicht.
Gemein? Deine Mutter liebt das«, gluckste Bertrand und zwinkerte Antoine zu. »Das stimmt doch, Liebes? Oder etwa nicht, chérie?«
Im Kreis tanzend, schwebte er durchs Wohnzimmer und schnipste mit den Fingern zur Melodie von West Side Story.
Ich kam mir Antoine gegenüber lächerlich und dumm vor. Wieso hatte Bertrand solches Vergnügen daran, mich als abfällige, voreingenommene Amerikanerin hinzustellen, die ewig an den Franzosen herumkritisierte? Und warum stand ich einfach nur da und ließ es mir gefallen? Früher war es irgendwann mal lustig gewesen. Am Anfang unserer Ehe hatte es als Standardscherz bei unseren amerikanischen und französischen Freunden immer für allergrößte Heiterkeit gesorgt. Am Anfang.
Ich lächelte, wie gewöhnlich. Aber mein Lächeln kam heute etwas gequält.
»Hast du in letzter Zeit mal Mamé besucht?«, fragte ich.
Bertrand war bereits mit dem Ausmessen von irgendetwas beschäftigt.
»Was?«
»Mamé«, wiederholte ich geduldig. »Ich glaube, sie würde dich gerne sehen. Um über die Wohnung zu sprechen.«
Er warf mir einen Blick zu.
»Hab keine Zeit, amour. Gehst du?«
Ein flehender Blick.
»Bertrand, ich gehe jede Woche, das weißt du.«
Er seufzte.
»Sie ist deine Großmutter«, sagte ich.
»Und sie liebt dich, l’Américaine«, grinste er. »Und das tue ich auch, bébé.«
Er kam herüber und drückte mir einen sanften Kuss auf die Lippen.
Die Amerikanerin. »Sie sind also die Amerikanerin«, hatte Mamé vor so vielen Jahren in ebendiesem Raum bemerkt und mich aus grauen Augen grüblerisch gemustert. L’Américaine. Wie grundamerikanisch hatte ich mich da gefühlt mit meiner legeren Garderobe, den Turnschuhen und dem offenherzigen Lächeln. Und wie urtypisch französisch war diese siebzigjährige Frau mit ihrer aufrechten Haltung, der aristokratischen Nase, der makellosen Haarrolle und den scharfsinnigen Augen gewesen. Und doch hatte ich Mamé vom ersten Augenblick an gemocht. Ihr ansteckendes gutturales Lachen. Ihren trockenen Humor.
Ehrlich gesagt, hatte ich sie immer lieber gemocht als Bertrands Eltern, in deren Gegenwart ich mir bis heute wie »die Amerikanerin« vorkam, obwohl ich jetzt seit fünfundzwanzig Jahren in Paris lebte, seit fünfzehn Jahren mit ihrem Sohn verheiratet war und ihnen vor elf Jahren ihr erstes Enkelkind, Zoë, geschenkt hatte.
Auf dem Weg nach unten, der mir eine erneute Begegnung mit meinem unerfreulichen Abbild im Fahrstuhlspiegel bescherte, erkannte ich plötzlich, dass ich Bertrands Sticheleien viel zu lange mit einem gutmütigen Schulterzucken erduldet hatte.
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund wurde mir heute zum ersten Mal klar, dass ich es leid war.
Das Mädchen hielt sich dicht bei den Eltern. Sie liefen ihre Straße hinunter, der Mann im beigefarbenen Regenmantel trieb sie zur Eile an. Sie fragte sich, wohin sie wohl gingen. Wieso mussten sie sich so beeilen? Man führte sie in eine große Autowerkstatt. Sie erkannte die Gegend wieder, sie war nicht weit von ihrem Haus entfernt, von der Halle, in der ihr Vater arbeitete.
In der Werkstatt beugten sich Männer in blauen, ölbefleckten Overalls über Motoren. Die Männer starrten sie schweigend an. Niemand sagte ein Wort. Dann sah das Mädchen eine weitere große Gruppe von Menschen mit Taschen und Körben zu ihren Füßen. Die meisten waren Frauen und Kinder, stellte sie fest. Einige von ihnen kannte sie flüchtig. Aber niemand wagte es, sich zuzuwinken oder zu begrüßen. Nach einer Weile erschienen zwei Polizisten. Sie riefen Namen aus. Der Vater des Mädchens hob die Hand, als ihr Name genannt wurde.
Das Mädchen sah sich um. Sie sah einen Jungen, den sie von der Schule kannte, Léon. Er sah müde und ängstlich aus. Sie lächelte ihn an, wollte ihm zu verstehen geben, dass alles gut würde und sie bald alle wieder nach Hause gehen könnten. Es würde nicht lange dauern. Aber Léon schaute sie an, als wäre sie verrückt. Sie senkte den Blick, die Wangen hochrot. Vielleicht hatte sie alles falsch verstanden. Ihr Herz pochte heftig. Vielleicht würden sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie geglaubt hatte. Sie kam sich sehr naiv vor, dumm und jung.
Ihr Vater beugte sich zu ihr. Sein unrasiertes Kinn kitzelte sie am Ohr. Er sagte ihren Namen. Wo war ihr Bruder? Sie zeigte ihm den Schlüssel. Der kleine Bruder sei in Sicherheit in ihrem geheimen Wandschrank, flüsterte sie, stolz auf sich. Dort sei er sicher.
Die Augen ihres Vaters wurden weit und bekamen einen seltsamen Ausdruck. Er packte ihren Arm.
»Aber es ist alles in Ordnung«, sagte sie, »es geht ihm gut. Der Schrank ist tief, und er hat da drin genug Luft zum Atmen. Und er hat Wasser und die Taschenlampe. Es geht ihm gut, Papa.«
»Du verstehst nicht«, sagte der Vater. »Du verstehst das nicht.«
Und zu ihrem Entsetzen sah sie, dass sich die Augen ihres Vaters mit Tränen füllten.
Sie zog ihn am Ärmel. Sie konnte es nicht ertragen, ihren Vater weinen zu sehen.
»Papa«, sagte sie. »Wir kommen doch wieder nach Hause, oder nicht? Wir gehen wieder zurück, nachdem sie unsere Namen aufgerufen haben, oder?«
Ihr Vater wischte sich die Tränen ab. Er schaute zu ihr hinunter. Ein schrecklich trauriger Blick, den sie nicht ertragen konnte.
»Nein«, sagte er. »Wir werden nicht zurückkehren. Sie werden uns nicht lassen.«
Ein kaltes Grausen durchfuhr sie. Sie erinnerte sich wieder an die Gespräche, die sie belauscht hatte, an die Gesichter ihrer Eltern hinter dem Türspalt, an ihre Furcht, ihre Qualen mitten in der Nacht.
»Was meinst du damit, Papa? Wohin gehen wir denn? Wieso gehen wir nicht wieder nach Hause? Sag es mir! Sag es!«
Die letzten Worte schrie sie beinahe.
Ihr Vater schaute sie an. Wieder sagte er ihren Namen, sehr leise. Seine Augen waren noch immer feucht, seine Wimpern benetzt mit Tränen. Er legte ihr die Hand auf den Rücken.
»Sei tapfer, mein Liebes. Sei tapfer, so tapfer, wie du kannst.«
Sie konnte nicht weinen. Ihre Angst war so groß, dass sie jedes andere Gefühl in ihr aufsog, wie ein monströses, gewaltiges Vakuum.
»Aber ich habe ihm versprochen, dass ich wiederkomme, Papa. Ich habe es ihm versprochen.«
Das Mädchen sah, dass er wieder angefangen hatte zu weinen, dass er ihr nicht zuhörte. Er war ganz versunken in seinen eigenen Kummer, seine eigene Angst.
Sie wurden alle nach draußen geschickt. Die Straße war leer, bis auf eine Reihe von Bussen, die am Bordstein standen. Ganz gewöhnliche Busse, wie sie das Mädchen mit der Mutter benutzte, um durch die Stadt zu fahren: gewöhnliche, alltägliche grünweiße Busse mit Plattformen am Heck.
Man befahl ihnen, in die Busse zu steigen, und sie wurden gegeneinandergeschubst. Das Mädchen hielt erneut nach grüngrauen Uniformen Ausschau, horchte nach der schroffen, kehligen Sprache, die sie fürchten gelernt hatte. Aber dies waren nur Polizisten, französische Polizisten.
Durch die verschmutzte Fensterscheibe des Busses erkannte sie einen von ihnen, den jungen Rothaarigen, der ihr oft auf dem Heimweg nach der Schule über die Straße geholfen hatte. Sie klopfte gegen das Glas, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als sich ihre Blicke begegneten, schaute er schnell weg. Er wirkte verlegen, beinahe verärgert. Sie überlegte, warum. Als die Letzten in die Busse gedrängt wurden, protestierte ein Mann. Er wurde gewaltsam hineingestoßen. Ein Polizist schrie, dass er schießen würde, wenn jemand versuchte zu fliehen.
Teilnahmslos sah das Mädchen auf die vorbeiziehenden Gebäude und Bäume. Sie konnte nur an ihren Bruder im Schrank denken, wo er auf sie wartete, in der leeren Wohnung. Er war ihr einziger Gedanke. Sie überquerten eine Brücke, sie sah die Seine glitzern. Wohin fuhren sie? Papa wusste es nicht. Niemand wusste es. Alle hatten Angst.
Ein lauter Donnerschlag ließ sie alle zusammenfahren. Der Regen kam in Strömen nieder, so dicht, dass der Bus anhalten musste. Das Mädchen lauschte den Tropfen, die auf das Dach prasselten. Es hielt nicht lange an. Bald nahm der Bus seine Fahrt wieder auf, Reifen zischten auf glänzendem Kopfsteinpflaster. Die Sonne kam hervor.
Der Bus hielt an, und sie stiegen aus, beladen mit Bündeln, Koffern, weinenden Kindern. Diese Straße kannte das Mädchen nicht. Hier war sie noch nie gewesen. Sie sah die oberirdische Metro am einen Ende der Straße.
Sie wurden zu einem großen, fahlen Gebäude geführt. Darauf stand etwas in riesigen dunklen Buchstaben, das sie aber nicht entziffern konnte. Die ganze Straße war voller Familien, so wie ihre, die aus den Bussen stiegen und von Polizisten angeschrien wurden. Wieder französische Polizisten.
Die Hand ihres Vaters umklammernd, wurde sie in eine gewaltige überdachte Arena geschubst. Massen von Menschen waren hier versammelt, sowohl in der Mitte der Arena als auch auf den harten Metallsitzen in den Rängen. Sie konnte unmöglich sagen, wie viele Menschen es waren. Hunderte. Und immer mehr strömten herein. Das Mädchen blickte hoch zu dem gewaltigen blauen Oberlicht, das wie eine Kuppel geformt war. Die Sonne schien gnadenlos hindurch.
Ihr Vater fand für sie alle einen Sitzplatz. Das Mädchen sah dem unaufhörlichen Hereinsickern der Menschen und dem Dichterwerden der Menge zu. Der Lärm wurde lauter und lauter, ein anhaltendes Summen von Tausenden von Stimmen, jammernden Kindern, klagenden Frauen. Die Hitze wurde unerträglich, nahezu erstickend, als die Sonne am Himmel höher stieg. Es gab immer weniger Platz, alle wurden gegeneinandergedrängt. Sie beobachtete die Männer, die Frauen, die Kinder, ihre gepeinigten Mienen, ihre verängstigten Blicke.
»Papa«, sagte sie, »wie lange müssen wir hierbleiben?«
»Ich weiß es nicht, meine Süße.«
»Warum sind wir hier?«
Sie legte die Hand auf den gelben Stern, der vorne auf ihrer Bluse aufgenäht war.
»Es ist deswegen, stimmt’s?«, sagte sie. »Alle hier haben einen.«
Ihr Vater lächelte, ein trauriges, klägliches Lächeln.
»Ja«, sagte er. »Es ist deswegen.«
Das Mädchen runzelte die Stirn.
»Das ist ungerecht, Papa«, zischte sie. »Das ist ungerecht!«
Er umarmte sie, flüsterte zärtlich ihren Namen.
»Ja, mein Liebling, das stimmt, es ist ungerecht.«
Sie saß an ihn gelehnt, die Wange gegen den Stern auf seiner Jacke gedrückt.
Vor etwa einem Monat hatte ihre Mutter die Sterne an alle ihre Sachen genäht. An sämtliche Kleidungsstücke der Familie, außer an die des kleinen Bruders. Davor waren ihre Ausweise mit den Wörtern »Jude« oder »Jüdin« gekennzeichnet worden. Und dann hatten sie auf einmal lauter Dinge nicht mehr tun dürfen. Wie im Park spielen. Und Fahrrad fahren,ins Kino gehen, ins Theater, ins Restaurant, ins Schwimmbad. Sie durften keine Bücher mehr aus der Bücherei ausleihen.
Sie hatte die Schilder gesehen, die augenscheinlich überall angebracht worden waren: Juden verboten. Und an der Tür der Werkhalle, in der ihr Vater arbeitete, stand auf einem großen Anschlag Jüdischer Betrieb. Mama durfte erst nach vier Uhr nachmittags einkaufen gehen, wenn es in den Geschäften wegen der Rationierungen nichts mehr gab. Sie durften nur im letzten Wagen der Metro fahren. Und sie mussten zur Sperrstunde zu Hause sein und durften das Haus nicht vor dem Morgen verlassen. Was war ihnen überhaupt noch erlaubt? Nichts, dachte sie. Nichts.
Ungerecht. So ungerecht. Warum? Warum sie? Wozu das alles? Es schien plötzlich, als könnte ihr niemand darauf eine Antwort geben.
Joshua war bereits im Konferenzraum und trank seinen dünnen Kaffee, den er so gerne mochte. Ich eilte hinein und setzte mich zwischen Bamber, Leiter der Bildredaktion, und Alessandra, Redakteurin für Sonderberichte.
Der Raum ging auf die geschäftige Rue Marbeuf hinaus, nur einen Steinwurf von den Champs-Élysées entfernt. Dieser Stadtteil war nicht gerade mein liebster in Paris – zu überfüllt, zu protzig –, aber ich hatte mich daran gewöhnt, mir jeden Tag meinen Weg über die breiten, staubigen Bürgersteige des Boulevards zu bahnen, der zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit vollgepackt mit Touristen war.
Seit sechs Jahren schrieb ich für das amerikanische Wochenmagazin Seine Scenes. Wir brachten sowohl eine gedruckte Ausgabe als auch eine Online-Version heraus. Ich berichtete in der Regel über alle Ereignisse, die für eine in Paris ansässige amerikanische Leserschaft interessant sein könnten. »Lokalkolorit« – vom gesellschaftlichen und kulturellen Leben (Shows, Filme, Restaurants, Bücher) bis hin zu den bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen.
Es war tatsächlich harte Arbeit. Die Abgabetermine waren kurzfristig. Joshua war ein Tyrann. Ich mochte ihn, aber er war ein Tyrann. Er gehörte zu der Kategorie Boss, die keinerlei Privatleben, Ehen und Kinder respektierten. Eine Frau, die schwanger wurde, strafte er mit Nichtachtung. Eine Frau mit einem kranken Kind zog verärgerte Blicke auf sich. Aber er hatte ein gewieftes Gespür, ein exzellentes redaktionelles Geschick und eine unheimliche Gabe für perfektes Timing. Wir verneigten uns alle vor ihm. Sobald er uns den Rücken zukehrte, beschwerten wir uns über ihn, aber wir bewunderten ihn restlos. Joshua war um die fünfzig, ein geborener und eingefleischter New Yorker, der die letzten zehn Jahre in Paris verbracht hatte, und er sah irreführend gutmütig aus. Er hatte ein längliches Gesicht und tranige Augen. Aber sobald er den Mund aufmachte, gab er den Ton an. Man hörte Joshua zu. Und man unterbrach ihn nie.
Bamber kam aus London und war Ende zwanzig. Er maß über eins achtzig, trug violettfarbene Brillengläser, hatte mehrere Bodypiercings und im Ton von Orangenmarmelade gefärbtes Haar. Er besaß einen herrlich britischen Humor, den ich unwiderstehlich fand, den Joshua aber nur selten verstand. Ich hatte eine Schwäche für Bamber. Er war ein diskreter, tüchtiger Kollege. Außerdem war er eine wunderbare Stütze, wenn Joshua einen schlechten Tag hatte und seine Laune an uns allen ausließ. Bamber war ein wertvoller Verbündeter.
Alessandra war Halb-Italienerin, hatte eine Pfirsichhaut und war beängstigend ehrgeizig. Ein hübsches Mädchen mit einem glänzenden schwarzen Lockenschopf und so prallen, feuchten Lippen, die Männer ganz verrückt machen. Ich konnte mich nie recht entscheiden, ob ich sie mochte oder nicht. Sie war halb so alt wie ich und verdiente schon genauso viel wie ich, auch wenn mein Name im Impressum vor ihrem stand.
Joshua ging die Liste der anstehenden Themen durch. Es war ein deftiger Artikel über die Präsidentschaftswahlen geplant, ein brisantes Thema seit Jean-Marie Le Pens umstrittenem Sieg im ersten Durchgang. Ich war nicht übermäßig erpicht darauf, ihn zu schreiben, und insgeheim erleichtert, als er Alessandra zugeteilt wurde.
»Julia«, sagte Joshua und schaute mich über seine Brille hinweg an, »das ist was für dich. Sechzigjähriges Gedenken an das Vél d’Hiv.«
Ich räusperte mich. Was hatte er gesagt? Es hatte sich angehört wie »das Weldief«.
Mir fiel nicht das Geringste dazu ein.
Alessandra sah mich herablassend an.
»16. Juli 1942. Klingelt’s?«, sagte sie. Manchmal hasste ich ihre näselnde Miss-Alleswisser-Stimme. Wie zum Beispiel heute.
Joshua fuhr fort:
»Die große Zusammentreibung im Vélodrome d’Hiver. In der Kurzform Vél d’Hiv. Eine berühmte Sporthalle, in der Radrennen stattgefunden haben. Tausende jüdische Familien sind dort unter fürchterlichen Bedingungen eingesperrt worden. Dann nach Auschwitz geschickt, dann vergast.«
Jetzt klingelte es. Nur schwach.
»Ja«, sagte ich bestimmt und sah Joshua an. »Okay, was soll es sein?«
Er zuckte die Achseln.
»Na ja, du könntest damit anfangen, nach Überlebenden oder Zeugen des Vél d’Hiv zu suchen. Dann stell den genauen Ablauf der Gedenkfeier fest, wer sie organisiert, wo, wann. Schließlich Fakten. Was ist damals genau passiert. Es ist eine heikle Geschichte, weißt du. Die Franzosen reden nicht gerne über Vichy, Pétain und das alles. Das ist nichts, worauf sie übermäßig stolz sind.«
»Es gibt da einen Mann, der dir helfen könnte«, sagte Alessandra etwas weniger herablassend. »Franck Lévy. Er hat eine der größten Organisationen gegründet, die Juden hilft, nach dem Holocaust ihre Familien wiederzufinden.«
»Ich habe von ihm gehört«, sagte ich, während ich mir den Namen notierte. Das stimmte. Franck Lévy war eine bekannte Persönlichkeit. Er veranstaltete Kongresse und schrieb Artikel über gestohlene jüdische Besitztümer und die Gräuel der Deportationen.
Joshua stürzte einen weiteren Kaffee hinunter.
»Kein Wischiwaschi«, sagte er. »Keine Sentimentalitäten. Fakten. Zeugenaussagen und« – mit Blick zu Bamber – »starke, überzeugende Fotos. Sichtet auch altes Material. Viel ist darüber nicht vorhanden, das werdet ihr feststellen, aber vielleicht kann euch dieser Lévy-Typ weiterhelfen.«
»Ich fange mit einem Besuch im Vél d’Hiv an«, sagte Bamber. »Verschaff mir mal einen Eindruck davon.«
Joshua lächelte sarkastisch.
»Das Vél d’Hiv existiert nicht mehr. Wurde ’59 abgerissen.«
»Wo hat es gestanden?«, fragte ich, froh, dass ich nicht die einzige Ignorantin hier war.
Wieder antwortete Alessandra.
»Rue Nélaton. Im fünfzehnten Arrondissement.«
»Wir könnten trotzdem mal hinfahren«, sagte ich mit Blick zu Bamber. »Vielleicht wohnen noch Leute in der Straße, die sich an die Geschichte erinnern.«
Joshua hob die Schultern.
»Ihr könnt es versuchen«, sagte er. »Aber ich glaube, ihr werdet nicht viele Leute treffen, die bereit sind, mit euch zu reden. Wie ich schon sagte, die Franzosen sind da empfindlich, das ist ein hochsensibles Thema. Vergesst nicht, es war die französische Polizei, die all diese jüdischen Familien verschleppt hat. Nicht die Nazis.«
Als ich Joshua zuhörte, wurde mir klar, wie wenig ich darüber wusste, was im Juli 1942 in Paris geschehen war. Auf der Schule in Boston war dieses Thema nicht behandelt worden. Und seit ich vor fünfundzwanzig Jahren nach Paris gekommen war, hatte ich darüber kaum etwas gelesen. Es war wie ein Geheimnis. Etwas, das in der Vergangenheit begraben lag. Etwas, das niemand erwähnte. Ich brannte darauf, mich vor den Computer zu setzen und mit der Internetrecherche zu beginnen.
Sobald die Besprechung vorbei war, ging ich hinüber in mein Kabuff von Büro, das auf die laute Rue Marbeuf hinausging. Unser Arbeitsplatz war sehr beschränkt. Aber ich hatte mich daran gewöhnt. Es machte mir nichts aus. Zu Hause hatte ich keinen Platz zum Arbeiten. Bertrand hatte mir versprochen, dass ich in der neuen Wohnung ein großes Zimmer ganz für mich allein bekäme. Mein eigenes Büro. Endlich. Es schien zu schön, um wahr zu sein. Ein Luxus, an den ich mich nur langsam gewöhnen würde.
Ich machte den Computer an und ging ins Internet, zu Google. Ich tippte »vélodrome d’hiver« »vél d’hiv« ein. Die Einträge waren zahlreich und viele davon sehr ausführlich.
Ich las den ganzen Nachmittag über. Ich tat nichts weiter als lesen und Informationen notieren und nach Büchern über die Okkupation und die Zusammentreibung suchen. Die meisten dieser Bücher waren nicht mehr erhältlich, stellte ich fest. Warum? Weil niemand etwas über das Vél d’Hiv lesen wollte? Weil es niemanden mehr interessierte? Ich rief in einigen Buchhandlungen an. Man sagte mir, es würde schwierig sein, noch an diese Bücher zu kommen. »Bitte versuchen Sie es«, bat ich.
Als ich den Computer ausstellte, spürte ich eine überwältigende Müdigkeit. Die Augen taten mir weh. Kopf und Herz waren mir schwer geworden von all dem, was ich erfahren hatte.
Über viertausend jüdische Kinder, zwischen zwei und zwölf Jahren, waren im Vél d’Hiv eingepfercht gewesen. Die meisten von ihnen französische Kinder, in Frankreich geboren.
Keines von ihnen ist von Auschwitz zurückgekommen.
Der Tag schleppte sich endlos und unerträglich dahin. An ihre Mutter geschmiegt, beobachtete das Mädchen, wie die Familien um sie herum langsam den Verstand verloren. Es gab nichts zu trinken oder zu essen. Die Hitze war erdrückend. Die Luft war erfüllt von einem trockenen, flusigen Staub, der ihr in Augen und Kehle brannte.
Die großen Stadiontüren waren geschlossen. An den Wänden standen Polizisten mit dumpfer Miene und hielten drohend ihre Gewehre vor sich. Sie konnten nirgendwohin. Sie konnten nichts tun. Außer hier sitzen und warten. Warten auf was? Was würde mit ihnen geschehen, mit ihrer Familie, mit diesen Massen von Menschen?