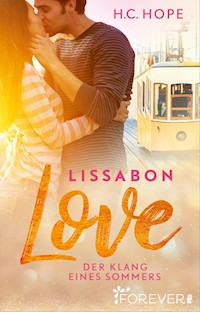10,48 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Gefühlvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine romantische, dramatische und emotionale Krankenhaus-Romance in Berlin für alle Fans von »Grey‘s Anatomy« und Ava Reed
»Unfälle passieren weltweit sekündlich. Ohne Vorboten. Das Schicksal ist ein mieser Regisseur, der seine Schauspieler nicht vorwarnt. Und dann bleibt den Menschen nur die Hilfe der 112. Und ich werde sie ihnen geben.«
Tiana erfüllt sich ihren Traum und beginnt als Notfallsanitäterin auf der Rettungswache nahe der Berliner Heidenwald-Klinik am Spreeufer zu arbeiten. Dabei trifft sie nicht nur auf dramatische Patientenschicksale sondern auch auf den attraktiven leitenden Oberarzt der Notaufnahme, Hannes Abendroth, der ihr schon kurz nach der ersten Begegnung nicht aus dem Kopf geht. Als Hannes am Abend ihres Einstandes in der Stammbar des Personals auftaucht und ihre Handynummer möchte, finden sich die beiden schon bald in einem Strudel der Gefühle wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Saving Hearts - Herzrasen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Dieser Roman enthält mögliche triggernde Inhalte: körperliche Gewalt, Suizid, Selbstverletzung, Erkrankungen
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Diana Steigerwald
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Gedicht
Genfer Arztgelöbnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Leo und Clemens.
Immer.
Ich widme dieses Buch außerdem meinen Freunden.
Ich hoffe, ich habe euch damit auf Papier konserviert.
Ihr seid toll!
In der Stille zwischen den Sekunden,
wenn der Verstand schweigt,
lauscht das Herz.
Genfer Arztgelöbnis
Als Mitglied der ärztlichen Profession
gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.
Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein.
Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.
Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.
Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.
Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren.
Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben.
Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.
Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen.
Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen.
Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können.
Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.
Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.
(Offizielle deutsche Übersetzung der Deklaration von Genf, autorisiert durch den Weltärztebund. 2017)
Kapitel 1
Tiana
Heute ist einer dieser ersten Tage. Ein Anfang, der meine Gewohnheiten durcheinanderwirbelt und mich dazu zwingt, die vertraute Ordnung loszulassen.
Von jetzt an folgen Tage, auf die mich niemand mehr vorbereitet.
Kein Szenario mehr, das akribisch am Whiteboard aufgeschlüsselt wird. Keine nach Gummi müffelnde Resusci-Anne, die mehrfach wiederbelebt werden soll.
Ab jetzt folgt das Leben. Hart und ungefiltert.
Ich schlucke, und der Gurt meiner Umhängetasche gräbt sich in meine Schulter. Das Gewicht der Anatomiebücher, die ich unmöglich in der WG lassen konnte, schlägt sich auf meinen Brustkorb nieder.
Unfälle passieren sekündlich. Ohne Vorboten. Das Schicksal ist ein mieser Regisseur, der die Darstellenden nicht vorwarnt. Und dann bleibt den Menschen nur die Hilfe der 112. Und ich werde sie ihnen geben.
Entschlossen stoße ich die Tür neben dem Garagentor zur Rettungswache Süd nahe dem medizinischen Campus der Heidenwald Klinik auf und gehe hinein. Der Geruch von warmem Gummi und die scharfe Note von Benzin liegen in der Luft. Das Quietschen meiner Sneakersohlen auf dem beschichteten Boden und die dumpfen Schläge der Bücher in der Umhängetasche gegen mein Bein sind meine einzigen Begleiter. Vor mir steht der weiße Rettungswagen Nummer 17 mit neonroten Streifen. Als mein Blick das Blaulicht auf dem Dach streift, klopft mein Herz schneller. Hier parkt er, mein zukünftiger Arbeitsplatz. Das Fahrzeug, in dem ich mit einem hoffentlich netten Team zur Rettung kommen werde. Als Begleiterin bei Panik, Ängsten und manchmal auch Trauer. Diese ungefilterten Emotionen werden auf mich einprasseln, und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als den Menschen zu helfen, damit umzugehen.
»Hallo?«, fragt eine männliche Stimme, und ich zucke zusammen.
Ein blonder Kerl, nur unwesentlich älter als ich, mit stechend blauen Augen, steigt aus dem Rettungswagen, den er offenbar gerade gereinigt hat.
»Kann ich dir helfen?« Er stemmt lässig die Hände in die Hüften, und ich bewundere das aufgestickte Rote Kreuz auf seiner muskulösen Brust, die sich unter dem Poloshirt abzeichnet.
Ein Kribbeln jagt meine Wirbelsäule hinauf. Der Moment, in dem man das erste Mal dieses weiße Poloshirt überstreift, fühlt sich sicher episch an. Als wäre die Verantwortung, Leben zu retten, direkt in den Stoff eingearbeitet. Ich kann es kaum erwarten, das Shirt zu tragen.
»Äh, ja. Ich bin Tiana und habe heute den ersten Tag hier«, sage ich schnell.
Ein wissender Ausdruck gleitet über seine Miene, als er lächelt. »Hey, cool, dass du schon da bist. Ich bin Gabriel, Notfallsanitäter, und fahre mit den Schnuckel hier.«
Er tätschelt die Motorhaube des Rettungswagens, bevor er mir die Hand reicht.
»Willkommen bei uns auf der Rettungswache Süd. Hier ist immer was los, deshalb mache ich dich am besten gleich mit dem restlichen Team bekannt und überreiche dir deine Kluft.«
Ich drehe den goldenen Ohrstecker meiner verstorbenen Großmutter im Ohrläppchen und nicke. »Gerne.«
Wie wohl die anderen Teammitglieder auf mich reagieren?
Hoffentlich darf ich anfangs hospitieren, um mich daran zu gewöhnen, dass auch ich vollwertige Verantwortung für die Versorgung der Verletzten trage.
Vielleicht hätte ich heute Nacht doch noch mal das Kapitel zu den Herz-Kreislauf-Notfällen durchackern sollen … oder das über Vergiftungen.
Gabriel hält mir die Tür zum gefliesten Flur der Wache auf, und ich atme tief ein. Hoffentlich wird es ein guter erster Tag. Einer, der mir die Angst vor dem ersten Einsatz als ausgebildete Notfallsanitäterin nimmt. Obwohl mir die Ausbildung einiges abverlangt, mich die ein oder andere schlaflose Nacht gekostet hat und noch viel mehr Kaffee als sonst inhalieren ließ, wusste ich schon am ersten Tag, dass dieser Beruf der richtige für mich ist. Er motiviert mich zu körperlicher und geistiger Fitness.
Als ich den schmalen Flur entlanggehe, staut sich Hitze unter meiner Leinenbluse, und ich schließe die Augen. Fühle den harten Boden unter den Füßen und lausche Gabriels Schritten. Ein Lufthauch streift meine Wange, als er an mir vorbeigeht.
Ich öffne die Augen und folge ihm.
Du schaffst das, Tiana! Ganz sicher!
Erste Tage sind dazu da, epische Erinnerungen zu schaffen. Und ich kreiere hier meine.
Hannes
»Scheiße!« Ich presse die Hand auf den blutenden Hals des jungen Mannes unter mir, der gerade vor unserer Notaufnahme zusammengebrochen ist. Zwei Pfleger schieben uns auf der Liege Richtung Operationstrakt. »Ich brauche sofort Blutkonserven und Dr. Bernstein. Die Wunde muss verschlossen werden, sonst kollabiert er.«
Sein Puls rast, und die Sättigung auf dem Pulsoxymeter sinkt alarmierend. Der Mann scheint etwas jünger als ich zu sein. Anfang zwanzig. Sein blondes Haar ist verklebt und das Shirt blutverschmiert. Die Hose ist von Dreck durchzogen, und seine Stoffschuhe sind löchrig. Ob er auf der Straße nächtigt oder unter einer Parkbank im Görlitzer Park? Vielleicht war er in ein geplatztes Drogengeschäft verwickelt. Das Messer hätte seine Halsschlagader fast zertrennt, und die vernarbten Einstichstellen in der Armbeuge bestätigen meine Vermutung.
Seine Arteria carotis pulsiert unter meiner Handfläche. Ich halte sein Leben in der Hand, und ich will es nicht loslassen.
Schweißperlen rinnen über meine Stirn.
»Wo bleibt Dr. Bernstein? Ich brauche Kompressen«, brülle ich, als die Pfleger uns in einen Operationssaal schieben und die OP-Schwester mir einen Mundschutz überstreift. Der Druckverband, den eine Pflegerin angelegt hatte, ist längst mit Blut vollgesogen.
OP-Schwester Trixi schiebt sterile Kompressen unter meine Hand, und ich drücke sie auf die Wunde.
»Dr. Bernstein ist gleich da«, informiert sie mich und stülpt sich die OP-Haube über. Ich nicke.
»Wenn er seinen Hintern nicht in einer Minute herbewegt hat, vernähe ich.« Ich habe schon Operationen durchgeführt, außerhalb meiner Position als Anästhesist und Oberarzt der Notaufnahme.
Das Pulsoxymeter piepst. »Er kollabiert. Wo bleiben die Konserven?« Ich schwinge mich von dem Verwundeten herunter, während Trixi meinen Platz einnimmt und eine weitere OP-Schwester die Blutkonserven anbringt. Schnell streife ich mir OP-Kittel, Haube und Handschuhe über. Mikrochirurgie ist zwar erst auf dem Vormarsch, aber unser Gefäßchirurg bestand auf die teuren Geräte, die kleinste Gefäße vierzigfach vergrößern. Damit werde ich die perforierte Arterienwand vernähen.
Ich ziehe den OP-Scheinwerfer zu mir, während Trixi die angelegte Infusion überprüft. »Kollege, du wirst mir doch nicht ins Handwerk pfuschen?«, tönt es hinter mir.
Trotz des kollabierenden Patienten auf der Liege atme ich erleichtert auf.
»Du warst schon schneller, Bernstein.« Ich mache ihm Platz, und er leitet weitere kreislaufstabilisierende Maßnahmen ein, die ich überwache. Als sie endlich wirken, beruhigt sich mein Puls.
»Ich hatte noch eine Besprechung auf der Onkologie. Verrückter Tag heute.« Dr. Sebastian Bernstein klemmt die Arterie ab.
»Wem sagst du das? Mein tägliches Programm.« Ich gehe zur Tür und werfe noch einen Blick auf den besten Gefäßchirurgen der Stadt. Es erfüllt mich jedes Mal mit Stolz, Teil des hochrangigen Teams in der Heidenwald Klinik zu sein.
»Du hast es dir ausgesucht, mein Freund«, sagt Dr. Bernstein. Die Schiebetür zur Schleuse aus dem OP öffnet sich, und ich trete ein.
Ja, ich habe mir den Job ausgesucht, weil es mich beflügelt, Kranken und Verletzten zu helfen und weil jeder Tag einem Überraschungsei ähnelt. Man weiß zwar, dass es aus Schokolade besteht, aber nie, was im gelben Kern wartet. Ich liebe diese Arbeit, obwohl sie mir mein Privatleben raubt. Und den Schlaf. Mutter zieht jedes Mal einen Schmollmund, wenn ich wegen einer zusätzlichen Schicht unser Sonntagsdinner absage oder ihre Verkupplungsversuche mit den Töchtern ihrer Patchwork-Näh-Club-Freundinnen ignoriere. Ihrer Meinung nach sollten Männer Ende zwanzig in festen Händen sein.
Gerede! Ich bin glücklich, solange ich das Piepen der Monitore und den scharfen Geruch von Desinfektionsmittel um mich habe.
Ich streife den OP-Kittel und die Haube ab und reinige meine Hände gründlich, bevor ich die Schleuse zum Aufzug verlasse. Oben angekommen empfängt mich das vertraute Stimmengewirr. Der ureigene Puls meiner Station. Diese unterschwellige Hektik, die wachsamen Blicke der Fachkräfte und die immer besetzten Stühle des verglasten Warteraumes scheinen einen eigenen Organismus zu bilden. Einen, den ich nicht missen will.
»Espresso?« Schwester Ellen schiebt sich mitsamt einem Becher Kaffee in mein Sichtfeld.
»Sie sind die Beste.« Das ist sie wirklich. Ellen ist diejenige, die nicht nur die Vitalzeichen unserer Patientinnen und Patienten überwacht, sondern auch mein Wohlbefinden. Manchmal steckt sie mir heimlich einen Apfel oder einen Müsliriegel in meinen Arztkittel, wenn ich wieder einmal vergessen habe, mein zwei Tage altes Sandwich aus dem Kühlschrank zu essen. Das sie entsorgt. »Was würde ich nur ohne Sie tun?« Ich nippe am Espresso.
»Verhungern, vermutlich?« Sie grinst und streicht sich eine blonde Strähne hinters Ohr.
»Und den Kühlschrank mit alten Sandwiches überladen«, sagt Schwester Carina, die mit einem Klemmbrett an uns vorbeihuscht. »Ich frage mich schon lange, ob Sie in Ihrem Kühlschrank zu Hause das gleiche Chaos verursachen.«
»Und ich habe mich schon immer gefragt, wie ihr Krankenschwestern es schafft, bei dem ganzen Stress eure Augen und Ohren überall zu haben. Sogar über den Kühlschrankinhalt wisst ihr Bescheid.« Ich trinke den Espresso leer und setze mich anstatt in mein Büro an die weiße Laptop-Insel, um den Bericht des Messerstichpatienten zu verfassen. Ich sollte wirklich anfangen, die Dokumentation in meinem Büro zu erledigen, um mir wenigstens einen Ruhemoment am Tag zu gönnen. Doch an der Laptopinsel bin ich vor Ort, schneller bei den Verletzten, wenn es sein muss, und gut erreichbar für die Belegschaft. Die Kühlschrankfrage konnte ich zum Glück umgehen, denn zu Hause liegt noch mindestens ein Sandwich in Gesellschaft einer halb leeren Packung Milch, zweier Eier und Butter. Und diesen Triumph gönne ich Schwester Carina nicht.
»Ich schätze, das wird uns Frauen evolutionsbedingt in die Wiege gelegt. Natürlich verfeinern wir unsere Sinne im Laufe des Lebens, ganz besonders, wenn es sich um Skandale, Klatsch und Tratsch handelt.«
»Bin ich etwa ein Skandalobjekt?« Ich werfe den beiden einen amüsierten Blick zu und checke den Monitor, der anzeigt, ob wir einen Rettungswagen erwarten. Gleich drei Meldungen, die einen chirurgischen Schockraum erfordern. Dabei platzt der Warteraum schon aus allen Nähten. Schwester Ellen zuckt mit den Schultern, bevor sie in einem der Schockräume verschwindet. Schwester Carina folgt ihr nickend.
Ich grinse. Vermutlich ist jeder Arzt und jede Ärztin unter den Schwestern ein Skandalobjekt. Auch wieder ein eigener kleiner Mikrokosmos. Aus Klatsch und Tratsch natürlich. Daher versuche ich, mich mindestens einmal pro Woche in den Pausenraum der Pfleger und Krankenschwestern zu schmuggeln. So kann ich die neuesten Gerüchte abgrasen. Wobei ich ihn meistens nach wenigen Minuten verlasse. Nicht nur, weil mir der Druck der wartenden Patientinnen und Patienten sonst über den Kopf wächst.
Ich öffne die Vorlage für den Eintrag in die digitale Patientenakte, und die Schiebetür Richtung Innenhof schwingt auf. Das metallene Rattern der Transportliege, die aus dem Rettungswagen geschoben wird, lässt mich sofort aufspringen.
»Was haben wir?«, frage ich, obwohl ich die nötigen Informationen auf meinem Piepser und dem Monitor längst gelesen habe.
Ich blicke in zwei große, kaffeebraune Augen, die die Notaufnahme für eine Millisekunde verschwinden lassen.
Eine neue Kollegin im Rettungswagen? Alles an ihr wirkt auf feminine Weise drahtig, wobei ihr Körper fast in der Sanitäterkluft versinkt.
»Verdacht auf Alkoholvergiftung mit Platzwunde an der Stirn. Patient, männlich, fünfundvierzig Jahre alt, knallte betrunken gegen eine Straßenlaterne«, sagt Notfallsanitäter Gabriel, und meine Sinne fokussieren sich auf das Wesentliche.
»Schockraum eins«, ordne ich an und überprüfe die blutverschmierte Platzwunde an der Stirn des Mannes. Mit zwei, drei Stichen dürfte die Wunde ordnungsgemäß vernäht sein. Meine Assistenzärztin Dr. März steht schon bereit, und Schwester Ellen schiebt den Verwundeten in den Schockraum. Später wird er in einer unserer Kabinen warten, bis es ein freies Bett auf der Station gibt. Um das ich mich erst mal kümmern muss.
»Hören Sie, mein Mann ist kein Alkoholiker. Ich versichere Ihnen, dass er heute noch keinen Tropfen Alkohol getrunken hat.« Die Frau vor mir schürzt die Lippen.
»Frau Brockmann, ich bin sicher, dass sich der ganze Unfallhergang aufklären wird«, versucht Gabriel, sie zu beruhigen. Die Falte auf ihrem Nasenrücken gräbt sich tiefer.
»Wenn ich es doch sage, mein Mann trinkt nicht.« Sie wirft die Arme in die Luft. »Überhaupt, warum wurden wir nicht wieder zur internistischen Notaufnahme gebracht?«
»Weil die Leitstelle uns hierher zur zentralen Notaufnahme verwiesen hat.« Gabriel runzelt die Stirn und wirft mir einen fragenden Blick zu.
»Dann glauben die, dass ich einen Trinker geheiratet habe? Das ist ja wohl die Höhe!«
Die neue Kollegin des RTW-Teams fasst die aufgebrachte Frau Brockmann sanft am Arm. »Die Leitstelle entscheidet anhand der Beschreibung des Notfalles, wohin der Patient gefahren wird. Vielleicht setzen Sie sich erst mal, bis die Wunde Ihres Mannes genäht ist? Es gibt nichts, das sich nicht klären lässt.« Die neue Kollegin lächelt mich abwartend an, und ich nicke. Ihre zarten Gesichtszüge mit der Stupsnase faszinieren mich, aber ich bin professionell genug, mir nichts anmerken zu lassen. Schnell wende ich mich der aufgebrachten Ehefrau meines Patienten zu.
»Ihr Mann ist in guten Händen, meine Assistenzärztin Dr. März kümmert sich um ihn.«
Frau Brockmann fährt sich durch die haselnussbraunen Locken. »Es ist immer das Gleiche. Niemand glaubt mir, geschweige denn meinem Mann. Mir ist durchaus bewusst, dass er wirkt wie ein typischer Alkoholiker, der das nur zu gerne leugnet, aber das ist er nicht. Diese ständigen Vorurteile sind beleidigend. Ich dachte, die Heidenwald Klinik ist ein Ort, an dem man sich nicht auf Indizien stützt, sondern herausfindet, was meinem Mann wirklich fehlt, und das ist sicher kein Entzug.« Sie verschränkt die Arme vor der Brust.
Ich atme tief durch. Diskussionen wie diese sind keine Seltenheit. Seit Dr. Google misstrauen uns viele Patientinnen und Patienten und drängen uns dazu, uns zu rechtfertigen, was ich strikt von mir weise. Immerhin habe ich, im Gegensatz zu Google, Medizin studiert und praktische Erfahrung gesammelt.
»Wir kümmern uns um Ihren Mann«, versichere ich der aufgebrachten Frau. »Wie Sie schon sagten, wir sind die Heidenwald Klinik, wir wissen, was zu tun ist.«
Es ist und bleibt noch immer die beste Taktik, das Gegenüber mit den eigenen Worten zu schlagen. Wobei ich den Ärger der Frau nachvollziehen kann. Alkoholabusus ist ein schwieriges Thema. Vielleicht sollte ich weitere Tests veranlassen, um andere Ursachen auszuschließen. Sicher wurde das alles schon zuvor erledigt, aber womöglich benötigt die Ehefrau noch mal einen Anlauf, um den Abusus zu akzeptieren, auch wenn es fürs stationseigene Budget nicht unbedingt zuträglich ist.
Ich winke Schwester Ellen heran. »Veranlassen Sie bitte ein großes Blutbild und die Verlegung auf die Innere.«
Schwester Ellen mustert mich irritiert. »Nicht in die Suchtambulanz?«
»Noch nicht. Ich möchte zunächst die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten. Anderenfalls wird uns die Ehefrau vermutlich köpfen.«
Schwester Ellen seufzt. »Na schön. Ich kläre das mit Dr. Schrode.« Sie schiebt eine blonde Strähne hinters Ohr.
» Ich habe noch einen gut bei ihr, erinnere sie daran. Falls das nicht klappt, rufe ich sie selbst an.« Ich zwinkere. Vor zwei Wochen habe ich ihr bei einem Patienten geholfen, der sich panisch über ein Jucken und Brennen im Ohr beschwerte. Angeblich, weil ein Käfer hineingekrochen sei. Weil ich schon einige unglaubliche Geschichten in der Notaufnahme erlebt habe, von Kämmen im Hintern bis zum Piercen mit einer Nagelpistole, ist mein Hirn mittlerweile meisterhaft darin, Zusammenhänge aufzudecken. Das Insektenspray in der Hand der Frau machte mich stutzig.
Dr. Schrode wollte mir zunächst nicht glauben, als ich den Herrn fragte, ob er Insektenspray im Ohr habe. Doch die feuerroten Wangen der Ehefrau bestätigten meine Vermutung. Sie hatte ihm Insektenspray ins linke Ohr gesprüht in der Hoffnung, der Käfer würde durch das rechte Ohr herausgespült werden. Geduldig erklärten wir ihr, dass die Gehörgänge durch das Hirn getrennt werden, und suchten das Ohr auf Schäden und den Käfer ab.
Den wir nicht fanden. Nur ein entzündetes Trommelfell.
»In Ordnung.« Schwester Ellen eilte davon.
Kapitel 2
Tiana
Eine Schwester schiebt die wild schimpfende Frau Brockmann auf einen der aufgereihten Stühle im Warteraum und reicht ihr einen Pappbecher mit Kaffee aus dem Automaten. Dabei redet sie beschwichtigend auf sie ein und erklärt ihr etwas zum großen Blutbild, das der Arzt veranlasst hatte.
»Es ist immer das Gleiche«, murrt Gabriel und schüttelt den Kopf. »Sucht ist scheiße.«
Er schiebt die Rolltrage aus dem Schockraum.
»Irgendwie klingt sie glaubwürdig.« Ich reiße meinen Blick von der verzweifelten Ehefrau los, die der Krankenschwester einen mitfühlenden Gesichtsausdruck abringt.
»Tun sie das nicht alle? Vielleicht trinkt ihr Mann heimlich.« Gabriel nickt dem behandelnden Arzt zu, der mich mit seinen waldgrünen Augen fixiert, bevor er Gabriels Abschiedsgruß stumm erwidert. Er scheint nur unwesentlich älter zu sein als ich, und dem aufgestickten Schriftzug auf seinem Arztkittel zufolge ist er kein Assistenzarzt mehr.
Dr. Hannes Abendroth.
Leitender Oberarzt zentrale Notaufnahme.
Anästhesist.
Mein Blick gleitet zum blauen OP-Shirt unter seinem Kittel, das einen ziemlich muskulösen Oberkörper vermuten lässt.
»Kommst du?« Gabriel tippt an meine Schulter, und ich reiße mich von Dr. Abendroth los, folge Gabriel durch die Schiebetüren nach draußen in den sonnigen Innenhof. Ich atme die warme Luft ein, doch meine Gedanken verharren in der Notaufnahme.
Fühlt sich Frau Brockmann schuldig, weil ihr Mann trinkt? Oder werden seine Beschwerden tatsächlich von etwas ganz anderem verursacht? Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Sehr gering.
»Und was, wenn er wirklich keinen Alkohol getrunken hat?«, spreche ich meine Vermutung aus.
»Dann wird Hannes das herausfinden.« Gabriel fährt die Liege in den Rettungswagen, in dem Leo wartet, und lässt sie einrasten.
»Es ist nicht das erste Mal, dass wir den beiden begegnen«, fügt er leise hinzu.
Ich schlucke. Das untermauert ein Suchtverhalten. Doch auch für einen erhöhten Alkoholspiegel gibt es Differenzialdiagnosen.
»Die brechen noch den Rekord. Das ist die dritte Einlieferung diese Woche! Jedes Mal das Gleiche, mindestens zwei Promille.« Leo checkt seine Armbanduhr. »Kaffee?«
Gabriel stimmt dem Kaffeeangebot zu. Sein aufmerksamer Blick findet mich. »Mach dir keinen Kopf. Hannes ist der beste Leiter der Notaufnahme, den die Heidenwald Klinik jemals hatte. Es ehrt dich, dass du über den Patienten nachdenkst, aber unser Job ist die Erstversorgung und die Übergabe an die Notaufnahme. In die vertrauensvollen Hände der Ärztinnen und Ärzte. Mehr können wir nicht tun, Tiana.«
Ich weiß, dass Gabriel recht hat. Trotzdem findet meine innere Kritikerin, dass etwas an der Situation um Herr Brockmann seltsam ist. Ich versuche, die Gedanken zu verdrängen, immerhin ist das heute mein erster Tag, und mit viel Erfahrung kann ich nicht aufwarten. Also schließe ich die Rettungswagentüren und setze mich auf den sporadischen Sitz neben der Liege. Der Motor startet röhrend.
Durch das kleine Fenster zur Fahrerkabine sehe ich Weiden und Eschen an uns vorbeiziehen. Dahinter das Spreeufer mit Anlegestellen, Kiesstränden und kleinen Cafés. Die seichten Wellen des Flusses glänzen in der Sonne, während die Enten ihre Schnäbel ins Gefieder senken. Das Touristenschiff stößt weißen Dampf aus. Eine Traube von Menschen steht an der Reling. Eine wundervolle Kulisse. Umgeben von den beeindruckenden Gebäuden des klinischen Heidenwald Campus, der Modernität und Historik zugleich versprüht.
Wir biegen in den Hof der Rettungswache ein, die nur wenige Minuten von der zentralen Notaufnahme entfernt liegt. Gabriel parkt den Rettungswagen in der Garage, und ich steige aus.
»Eine Runde Desinfektion gefällig?« Leo grinst und macht sich daran, die Liege zu säubern, während Gabriel die Medizinprodukte auffüllt. Ich schnappe mir den Mülleimer und leere ihn. Das oberste Gebot ist es, den Rettungswagen sauber zu halten.
»So, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen Zeit, um dich besser kennenzulernen.« Leo streift sich die Handschuhe ab und führt mich zum Pausenraum, in dem ich nach meiner Ankunft heute Morgen nur wenige Minuten verbracht habe, weil schon der erste Notruf einging. Ein Rasenmäherunfall. Mäher über Zeh. Warum man barfuß den Rasen mäht, erschließt sich mir nicht.
Gabriel befüllt die Kaffeemaschine mit Wasser, und der Duft von gemahlenen Kaffeebohnen übertüncht den Geruch des scharfen Desinfektionsmittels. Ich setze mich neben Leo auf die gepolsterte Eckbank, rechts von der Küchenzeile. Am anderen Ende des Raumes steht eine rote Couch neben einer deckenhohen Palme und einem Holzregal mit DVDs und Büchern. An der Wand hängt ein Flachbildfernseher neben Bildcollagen, Urkunden und der Magnettafel mit dem Schichtplan.
»Wichtigste Frage: Wie trinkst du deinen Kaffee?«, fragt Gabriel, der weiße Tassen mit dem roten Emblem der Rettungswache auf den Tisch stellt.
»Ich trinke ihn am liebsten mit einem Schuss Milch, danke«, sage ich, und Leo grinst.
»Sehr gut. Wir haben hier schon alles erlebt. Von fettreicher Dosenmilch über Erdbeersirup.« Er zieht eine Grimasse. »Sanitäter sind öfter mal unterzuckert, aber den Kaffee für irgendwelchen Sirup zu missbrauchen … Meine Großmutter dreht sich vermutlich jedes Mal im Grab um, wenn irgendwo auf der Welt Kaffee mit Fruchtsirup getrunken wird.«
»Dann war deine Großmutter Kaffeeliebhaberin?«, frage ich und schütte etwas Milch in meine Tasse.
»Liebhaberin ist noch untertrieben. Es war ihr Lebenselixier. Meine Familie hat über Generationen hinweg Tee- und Kaffeehandel betrieben, der schließlich mit einer kleinen Kaffeebar meines Vaters endete.«
»Puh, was bin ich froh, dass ich keinen Sirup in meinen Kaffee schütte.« Ich sinke tiefer ins Polster und genieße die lockere Atmosphäre. Gabriel setzt sich zu mir und verströmt den Duft nach Sandelholz.
»Wohnst du denn weit weg von der Wache?«, fragt er.
Ich schüttle den Kopf. »Ich wohne beim Heinrich-Zille-Park, ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß von hier. Und ihr?«
»Ich wohne fast um die Ecke, beim Naturkundemuseum«, sagt Gabriel.
»Dann bin ich wohl der Einzige, der auf der anderen Seite der Spree wohnt, was?« Leo lächelt. »Ich habe eine kleine Wohnung in der Nähe vom Hauptbahnhof. Purer Luxus, was die U- und S-Bahnanbindung angeht.« Er nippt am Kaffee.
»Wohnst du schon lange in Berlin?«
»Ja, ich bin sogar hier geboren. Wobei ich ein paar Jahre in Casablanca gelebt habe.«
»In der sinnlichen Metropole?«
Ich nicke. »Ja, mein Vater ist Gewürzhändler und wollte schon immer mal dorthin. Jetzt betreiben er und meine Mutter ein ausgesuchtes Spezereigeschäft in der Innenstadt. Sie vermissen die Stadt manchmal, aber die Wirtschaftslage in Deutschland ist aussichtsreicher als in Marokko.«
»Und du?« Leo mustert mich aufmerksam.
»Ich fühle mich in Berlin heimisch. Den größten Teil meines Lebens habe ich hier verbracht, trotzdem möchte ich irgendwann noch mal nach Casablanca reisen.« Marokko wird immer ein Teil von mir bleiben. Die Heimat, die mich fünf Lebensjahre prägte. »Das ist schön«, sagt Leo, bevor die Tür zum Pausenraum aufschwingt. Ein groß gewachsener Mann in Rettungskluft kommt herein. »Aaron, du bist spät.«
»Gott, ich weiß.« Der Mann bindet sein blondes, schulterlanges Haar zusammen. »Es tut mir leid. Ich habe dermaßen verpennt. Gestern Abend war so viel los im Schwimmbad.« Sein Blick bleibt an mir haften. »Bist du Gabriels neue Rettungssanitäterin?«
»Vermutlich, ja«, sage ich unsicher. »Ich bin Tiana.«
»Freut mich. Ich bin Aaron, Notfallsanitäter, wie Gabriel. Wobei er sich bereit erklärt hat, dich unter seine Fittiche zu nehmen. Auch wenn er dafür erst mal das Dream-Team zerreißt. Du musst wissen, dass er und Leo sich wortlos verstehen. Das ist teilweise schon gruselig.
Noch genießt du Welpenschutz, aber danach darf Leo mich durch die Gegend kutschieren.« Er zieht eine Grimasse, und Leo fasst sich theatralisch an die Brust. »Was für eine Ehre«, sagt dieser.
»Das tut mir leid, ich wollte euch keinesfalls trennen«, erkläre ich mit einem Seitenblick auf Gabriel.
»Ach, ist schon in Ordnung. Wir wechseln ab und zu, um voneinander zu lernen oder Herangehensweisen noch effektiver zu gestalten. Trotzdem kennt keiner meine Macken und Gedankengänge so gut wie Leo.«
»Außerdem ist Gabriel echt der Beste, bei ihm wirst du viel lernen«, sagt Leo.
»Danke vielmals!« Aaron gießt sich empört Kaffee ein. »Wehe, du heulst mir am Ende die Ohren voll, weil du Gabriel vermisst. Dann schmeiß ich dich aus meinem Rettungswagen oder lasse dich meine Bademeisterschichten im Schwimmbad übernehmen.«
Leo grinst verschmitzt. »Challenge accepted.«
Mir fällt ein kleiner Stein vom Herzen, weil sich hier offenbar alle sehr gut verstehen. »Dann werde ich mein Bestes geben, um Leo angemessen zu ersetzen«, sage ich.
»Och, ich bin mir sicher, das wirst du.« Gabriel zwinkert. »Es sei denn, du übernimmst Leos nervtötende Angewohnheit, in jeder Pause irgendwelche unwichtigen Zeitungsartikel oder schrecklichen Witze vorzulesen.«
»He, du wirst meine Witze noch vermissen«, sagt Leo. »Ich werde mir jetzt extra Schwimmbadwitze reinziehen.«
Der Alarm unserer Piepser beendet die amüsante Runde, und Gabriel, Leo und ich springen auf.
Hannes
»Ich bezahl doch keine fünf Euro für ’ne halbe! Wo gibt’s denn so was? Bei uns im Ländle kostet sie nicht mal auf dem Schützenfest so viel.«
Der bauchige Herr vor mir starrt mich wütend an, während ich vorsichtig die Glasscherbe aus seiner Handfläche ziehe.
»Dann empfehle ich Ihnen, das Bier im Supermarkt zu kaufen, dort ist es wesentlich günstiger als in den Restaurants rund um die Sehenswürdigkeiten. Wie lange bleiben Sie denn in Berlin?«, fragt Schwester Ellen.
»Das ist Touristenausbeutung!«, brüllt der Mann.
»Jetzt sollten Sie stillhalten, damit ich die Wunde sauber vernähen kann.« Ich ordne das auch an, damit er seinen Frust nicht weiter an Schwester Ellen auslässt.
Der Mann wirft mir einen skeptischen Blick zu und brummt.
Schweigend vernähe ich die klaffenden Hautschichten seiner Handfläche mit zwei Stichen.
»Geschafft.« Ich streife die Handschuhe ab. »Hoffentlich können Sie Ihren Aufenthalt in Berlin ohne weitere Bierunfälle genießen.«
Schwester Ellen lächelt verschmitzt und setzt sofort wieder eine ernste Miene auf, als der Patient Luft holt. Vermutlich, um zur fünften Schimpftirade über Berlins Bierpreise anzusetzen.
»Im Reiseführer stand nichts davon, dass sich die Preise schon wieder erhöht haben.«
Ich werfe Schwester Ellen einen vielsagenden Blick zu und verlasse die Behandlungskabine, um den letzten Bericht des Tages am PC einzupflegen. Dass der Kerl wegen eines zu hohen Bierpreises ausgeflippt ist und den Krug zerschmettert hat, ist beinahe schon ein unspektakuläres Ereignis verglichen mit den Menschen, die hier sonst eingeliefert werden. Der Mann kann froh sein, dass er nur eine Glasscherbe abbekommen hat und niemand anderen dabei verletzte.
Mit einem tiefen Atemzug tippe ich einen Fünfzeiler in die digitale Patientenakte und klicke das Datenblatt weg. Mein Blick schwirrt zum Monitor mit der Ankündigung zweier Rettungswagen.
Ob ich mir auch ein Feierabendbier genehmigen soll?
Ich war schon lange nicht mehr im Neo’s, der urigen Bar gegenüber. Stattdessen verbringe ich meine Abende mit Serien und schneller Küche. Dem Paradebeispiel für soziale Abstumpfung, wie Schwester Ellen mir regelmäßig predigt. Dabei sind diese Abende mein Ausgleich zur hektischen Notaufnahme, obwohl ich nach solchen Tagen keine zwei Folgen durchhalte und einschlafe.
Ich steuere in die Umkleide, hänge meinen Arztkittel in den Spind, werfe das OP-Shirt, das ich darunter trage, in die Wäsche und streife mir T-Shirt, Jeans und Lederjacke über. Dann gehe ich raus in die laue Nachtluft und betrachte die silbern funkelnden Sterne über dem Klinikdach.
Manchmal wünsche ich mir, dass zu Hause jemand auf mich wartet. Jemand, der mich umarmt und nach meinem Tag fragt. Mit dem ich über all die Schicksale und Geschichten reden kann. Jemand, der mich vergessen lässt, dass unter meinen Handflächen das Leben aus einem Körper gewichen ist.
Schon zweimal habe ich versucht, diesen Jemand festzuhalten. Doch immer war es mein Job, meine Berufung, an der die Beziehung zerbrach. Weil ich zu wenig da war. Zu wenig Hannes, zu viel Arzt.
Ich überquere den halb leeren Parkplatz und nähere mich den flackernden Leuchtstoffröhren des Neo’s. Es wird Zeit, dass ich mich wieder aktiver unter Leute mische.
Schon vom Gehweg aus erkenne ich durch das Fenster Gabriels blonden Haarschopf an der hölzernen Bar.
Entschlossen stoße ich die Tür auf, und der Geruch nach Bier und Buletten begrüßt mich.