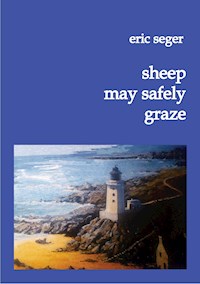2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Medizinstudent Simon Benz wird durch das Schreiben des Rechtsanwalts Thaker darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Kanalinsel Jersey der Bruder seiner Mutter verstorben ist und er zum alleinigen Erbe auserkoren wurde, was seine Anwesenheit erforderlich macht. Nichts Weltbewegendes, wenn nicht die Umstände der damaligen Zeit dieses Unterfangen zu einem Abenteuer der besonderen Art hätte werden lassen. Seine jugendliche Euphorie wird durch die Ereignisse auf der Fahrt zu seinem Ziel und dann auf der Insel jäh zerstört. Er wird mit einer Macht konfrontiert, die er bis dahin nur vom Hörensagen kannte und deren Umsetzung er am eigenen Leib erfährt. Getragen von der fixen Idee, Menschen in Gefangenschaft zu helfen, wird er von dem Sog der Emotionen, der Macht des Krieges und der Liebe zu anderen Menschen vorangetrieben und kämpft im Strudel der Ereignisse ums nackte Überleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Eric Seger
Schafekönnen ruhigweiden
© 2019 Eric Seger
Umschlag, Illustration: Eric Seger
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7482-9775-8
Hardcover
978-3-7482-9776-5
e-Book
978-3-7482-9777-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
War is the child of prideand pride the daughter of riches.
Jonathan Swift
Prolog
Jersey, 1943. Die See war stürmisch. Der Regen peitschte gegen den Aufbau des kleinen Fischerbootes. Der Scheibenwischer versuchte vergebens gegen den Sturm anzukommen. Auf dem Boot kämpften zwei Männer um ihren Halt, um nicht in die kochende See zu fallen. Kapitän Jules Vernon hielt sich krampfhaft am Steuerruder fest und versuchte verzweifelt seinen Fuss irgendwo abzustützen. Er verfluchte Gott und die Welt und am meisten sich selbst. Worauf hatte er sich bloss wieder eingelassen? Dieser verdammte Ausländer, der jetzt zwischen Angelzeug und Tauen hockte, triefnass gegen das Frühstück ankämpfte, das aus dem Magen wieder hochzukommen drohte, um am Ende sich dann doch dem Schicksal zu ergeben. Der Kapitän verstand die Welt nicht mehr. Was in drei Teufels Namen machte er hier? Nur sehr schwach konnte er sich an den Vorabend erinnern.
Er sass in der Kneipe Chez Delphin bei seinem Freund Jaques im Hafen von St-Malo. Nach dem dritten oder vierten Glas Cidre, er war eben in ein tiefes Gespräch mit seinem Tischnachbarn versunken, wollte gerade mit Vehemenz über die Regierung und die Boches herziehen, wurde er an seiner Jacke gezupft. Jaques stand vor ihm und deutete mit dem Daumen nach hinten. Jules schob seine Mütze auf den Hinterkopf, sah Jaques fragend an, stand von seinem Stuhl auf und folgte ihm ins Hinterzimmer. Die Tür stand einen Spalt breit offen. Hinter dem grossen und starken Jaques konnte er einen kurzen Blick auf den Mann werfen, der wartend am Tisch sass. Er zupfte seinen Freund am Ärmel, seine Augen versuchten die Seinen zu fragen: Was will der von mir? Jaques zuckte mit der Schulter, stiess die Tür auf und schob ihn hinein. Der Kapitän nahm seine Mütze vom Kopfe, stellte sich etwas linkisch vor und fixierte sein Gegenüber. Er überlegte fieberhaft, was er die letzte Stunde im Lokal politisch und so von sich gegeben hatte, denn der Kerl vor ihm sah aus wie einer von der Gestapo. Verdammte Sauferei, jedes Mal gab es deswegen Scherereien, nur weil er den Mund immer so voll nahm. Der Franzose nahm sich vor, nie mehr zu saufen, wenn er dieses eine Mal noch heil überstehen sollte. Der Mann am Tisch hatte noch kein Wort gesprochen, als der Kapitän auf ihn zustürzte und ihm sein Leid mitteilte. Er habe das nicht so gemeint und das Ganze sei sowieso ein Irrtum und er solle ihm doch noch einmal verzeihen und daran sei nur der Alkohol schuld.
Jules Vernon kannte sich selbst nicht mehr. Er hatte Angst vor einem Mann, den er noch nie gesehen hatte, er, der immer erzählte, dass er niemand fürchte und dass er es mit jedem aufnehme und so. Vernon stand winselnd wie ein Hund vor dem Mann, dabei lief ihm der Angstschweiss in Strömen aus jeder Pore an seinem Körper. Der Mann deutete ihm, sich zu setzen, worauf der Kapitän nur zögernd Platz nahm, er fühlte sich nicht wohl bei der Sache, er wollte lieber nach Hause, jedenfalls raus aus diesem Zimmer, weg von diesem Mann mit den Koffern und Taschen. Jetzt erst bemerkte Jules Vernon das Gepäck, das in der Ecke stand. Einer von der Gestapo mit Gepäck, dachte er, gibt es nicht, aber man weiss ja nie und dann sitzt man plötzlich im Gefängnis und fragt sich, warum. Er sollte lieber vorsichtig sein und zuerst sehen, was der Kerl von ihm wollte.
Er legte seine Hände auf den Tisch und sah dem anderen kurz in die Augen, dabei bemerkte er, dass dieser Mann noch sehr jung sein musste, denn er hatte helle und klare Augen und das tiefe Blau strahlte, als hätte es in seinem kurzen Leben wenig Ungemach gesehen. Die Hände, die der Fremde wie zum Gebet gefaltet von sich gestreckt auf dem Tisch liegen hatte, schmal und feingliederig, waren von harter Arbeit verschont geblieben.
„Monsieur“, sagte der Kapitän, dabei zerknüllte er seine Mütze zwischen den Händen, „Monsieur, was wünschen Sie von mir?“, nur um irgendetwas zu sagen, denn das dauernde Anstarren drückte auf sein Nervenkostüm. Der Mann im Trenchcoat räusperte sich und sagte:
„Spreche ich mit Kapitän Jules Vernon?“
Vernon konnte nur nicken, seine Mundhöhle war trocken, staubtrocken. Dabei versuchte er einen gleichgültigen Eindruck zu hinterlassen, was ihm aber nicht gelang. Vernon zitterte am ganzen Leibe und es sollte noch schlimmer kommen, als der Fremde ihm die nächste Frage stellte.
„Ist Ihr Boot klar, können Sie mich nach Jersey übersetzen?“
Die ganze Anspannung der letzten Stunde fiel in sich zusammen, er musste raus an die frische Luft, ihm war übel. Ruckartig stand der Kapitän von seinem Stuhl auf und rannte durch das Lokal zum Ausgang. Er flog schier auf die Strasse. An die Hauswand gelehnt, total ausser Atem, dachte er:
„Der Kerl ist verrückt, das ist unmöglich, nicht jetzt und nicht zu dieser Zeit.“ Die ersten Regentropfen fielen ihm auf den Kopf. Jules Vernon merkte von dem nichts. Ein alter, ausgemergelter Hund ging über die Strasse, sah traurig zu ihm herüber, trottete weiter und suchte sich einen trockenen Platz zum Schlafen.
Der Sturm hatte etwas nachgelassen. Der Himmel war dunkelgrau und der Regen fiel unaufhörlich auf das Boot, das den Weg durch die hochgehende See suchte. Der Kapitän fluchte leise vor sich hin und war damit beschäftigt, sich und sein Boot auf Kurs zu halten. In einem Gewirr aus Fischernetzen und Tauen sass sein Passagier unter einer Plane, halb versteckt, um sich vor dem Regen zu schützen. Die feuchte Kälte kroch in seine Kleidung bis auf die Haut, er versuchte, so gut es ging, sich davor zu schützen. Seine Augen verfolgten einen Wassertropfen, der von der Plane sprang, auf dem Boden des Bootes mit mehreren zusammentraf und als Rinnsal unter seinem Gepäck verschwand. Der April zeigte sich von seiner unangenehmen Seite.
Trotz seiner anfänglichen Euphorie fragte Simon sich, warum und weshalb er vor einer Woche seine Heimat verlassen hatte, um hier auf einem alten Kahn zu erfrieren oder zu ersaufen, je nachdem. Sein Leben verlief in geordneten Bahnen, bis zu dem Zeitpunkt, als er den Brief eines englischen Rechtsanwaltes gelesen hatte; damit begann seine Odyssee.
Er wurde 1915 in einer Ecke hinter Zürich als Simon Benz geboren und verbrachte seine Kinder- und Schuljahre dort, wuchs in einer intakten Familie auf und zog später nach Zürich, um sein Medizinstudium anzufangen. Sein Vater, der allzu früh verstarb, hinterliess ihm ein kleines Vermögen, damit er sein Studium fortsetzen konnte. Als dann Hitler seine Raubfeldzüge durch Europa durchzuführen begann und die Schweiz ihre Soldaten entlang der Grenze verteilte, meldete er sich bei seiner Kompanie. An der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich konnte er jeden Tag zuschauen, wie sich kleinere und grosse Dramen vor ihm abspielten, wie Ausländer, besonders Juden, von deutschen Soldaten in Empfang genommen, in ein Auto gestossen und dann in eine unsichere Zukunft geschickt wurden.
Die Tage wurden länger, der Frühling 1943 kündigte sich an und die alten grauen Schneereste verdampften in der Sonne. Die Schweiz versank in Lethargie, müde von den Kriegswirren um sie herum. Mit Gedanken an zwei Wochen Urlaub vom Soldatenleben kam er bei seiner Mutter an, die ihn mit dem Brief von dem Rechtsanwalt überfiel. Seine Mutter verstand die englische Sprache nicht, hatte nur den Absender gelesen und war daraufhin sehr neugierig, was ein Anwalt aus dem Ausland ihrem Sohn zu schreiben hatte. Als er den Briefumschlag umständlich aufriss, den Inhalt herauszog und gegen das Licht hielt, konnte seine Mutter sich nicht mehr beherrschen und trieb ihren Sohn zur Eile an. Der Brief enthielt keine guten Nachrichten. Wer zum Henker ist dieser Kerl, von dem im Brief die Rede war?
Als er seine Mutter danach fragte, gab sie ihm zur Antwort, dass er der Mann ihrer verstorbenen Schwester war und dass er nach ihrem Tode ins Ausland gezogen sei. Ein Onkel mütterlicherseits.
Er hatte keine Ahnung von seiner Existenz gehabt, erinnerte sich auch nicht, als sie ihm ein altes, vergilbtes Foto unter die Nase hielt. In dem Brief stand, dass er gestorben war und dass er, Simon Benz, als sein Erbe im Testament aufgeführt stehe und ob er sein Erbe antrete und dass seine Anwesenheit erforderlich sei.
Seine Mutter riet ihm davon ab, in diesen Zeiten eine Reise ins Ausland anzutreten, sie war von Haus aus ein bisschen ängstlich. Aber alles gute Zureden half nichts, er wollte sein Erbe antreten. So wurden die Koffer gepackt, gute Wünsche verteilt und wenig später sass er im Zug zur Schweizer Grenze.
In Genf angekommen, fragte er den Bahnhofsvorsteher, wie es denn nun weitergehe, der gab ihm darauf die Antwort, die ihn zum ersten Mal daran zweifeln liess, ob seine Mutter nicht doch recht hatte, als sie von den schlechten Zeiten sprach, denn er sagte:
„Überhaupt nicht.“ Was dann auch zutraf.
Er suchte sich ein Hotel für die Nacht und dachte an den nächsten Tag. Noch könnte er umkehren und wieder nach Hause fahren. Hätte er an diesem Abend gewusst, was auf ihn zukommen würde, wäre er zu Fuss nach Hause gegangen.
Er träumte und hatte keine Ahnung, wo er sich befand, als heftig gegen seine Zimmertüre geklopft wurde.
„Herr Benz. Sie wollten geweckt werden…, es ist sieben Uhr“, erscholl eine Frauenstimme hinter der Tür.
„Ja, danke“, murmelte er schlaftrunken, stand auf und schaute aus dem Fenster, direkt auf das Bahnhofsgebäude. Jetzt wusste er wieder, wo er war und was er hier wollte.
Schlurfend ging er ins Badezimmer, wusch sich und schlüpfte in seine Kleider, nahm sein Gepäck und ging hinunter an die Rezeption.
„Wann fährt der nächste Zug nach Frankreich?“, fragte er den Portier, dieser schaute ihn fragend an.
„Oh Monsieur, das ist schlecht, es fahren keine Züge nach Frankreich, und wenn, dann sehr unterschiedlich, vielleicht in einer Stunde, vielleicht heute Abend oder überhaupt nicht“, sagte er und verzog dabei seinen Mund zu einem schiefen Grinsen.
Simon stellte seine Koffer in eine Ecke und setzte sich an den Frühstückstisch. Wie kam er von hier weg? Diese Frage beschäftigte ihn, während er das Brot mit Butter und Marmelade bestrich. Als er gerade herzhaft zubeissen wollte, kam der Portier auf ihn zu.
„Sie wollten doch nach Frankreich?“, fragte er. „Vielleicht können Sie mit dem Herrn, der gerade bezahlt, mitfahren“, er zeigte mit dem Finger auf einen Mann, der an der Rezeption stand und seine Brieftasche umständlich in die Manteltasche verstaute. Simon Benz sprang so heftig von seinem Stuhl auf, dass er dabei die Kaffeetasse umstiess und rannte durch den Speisesaal zur Theke hin.
„Sie fahren nach Frankreich?“, fragte er den dicken Mann.
„Wer will das wissen?“, stiess der Dicke zwischen zwei Rauchwolken seiner Zigarre hervor.
„Entschuldigen Sie, mein Name ist Simon Benz und der Portier sagte mir, dass Sie nach Frankreich fahren… und ich möchte Sie fragen, ob Sie mich vielleicht mitnehmen würden?“, stotterte er. Irgendetwas an dem Kerl machte ihn nervös.
„Haben Sie Reisepapiere?“, fragte die Rauchwolke.
„Ja, natürlich!“ Er nickte mit dem Kopf.
Der dicke Mann packte seine Koffer und ging zum Ausgang, dabei rief er über die Schulter:
„Ich warte zwei Minuten, dann bin ich weg!“
Simon Benz bezahlte hastig seine Rechnung, nahm das Gepäck und stürzte auf die Strasse, wo der Dicke gerade dabei war, seine Koffer im Auto zu verstauen.
„Kommen Sie“, rief er, „stellen Sie Ihr Gepäck hier hinein“, dabei zeigte er auf den Kofferraum von seinem Wagen.
„Schöner Wagen, ein Mercedes?“, fragte Simon, um Konversation zu machen und stellte seine Koffer zu den anderen.
„Ja, ja“, sagte die Zigarre, „steigen Sie jetzt ein, ich habe es eilig“, dabei warf er den Motor an und die Autotüre zu. Simon Benz beeilte sich, er schloss den Kofferraum und setzte sich neben ihn.
Erst als sie die Grenze schon längst hinter sich hatten, begann der dicke Mann zu sprechen, vorher hatte er kein Wort gesprochen, nur auf seiner Zigarre herumgekaut und sie beide in stinkende Rauchwolken gehüllt. Obwohl sie an der Grenze kaum kontrolliert wurden, benahm er sich sehr nervös und zog noch heftiger an der Zigarre, dann drehte er das Fenster herunter und warf sie hinaus, um gleich darauf wieder eine neue anzuzünden. Simon verhielt sich ruhig und wartete erst einmal ab.
„Wohin wollen Sie… Ich meine, wo kann ich Sie absetzen?“, sagte der Dicke in die Stille hinein.
Simon Benz schluckte zuerst seinen Speichel hinunter, bevor er antwortete.
„Wenn Sie zufällig bei Lyon vorbeikommen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich dort beim Bahnhof absetzten.“
„Nach Lyon also, geschäftlich oder privat?“
„Privat“, sagte er. Mehr wollte er nicht verraten, er hatte kein allzu grosses Vertrauen zu ihm.
„Das Private ist wahrscheinlich eine kleine scharfe Französin…, richtig?“ Er sagte es so, als würde er einen besonders schmutzigen Witz erzählen. Er fing an, blöde zu lachen, verschluckte sich dabei und fuhr fast in den Strassengraben. Da mit dem dicken Trottel keine normale Diskussion zu führen war, betrachtete Simon die Landschaft, die am Autofenster vorbeizog. Der Frühling hatte die Natur in pastellene Farben getaucht. Kurz vor Lyon kamen sie in eine Strassensperre. Simon Benz bemerkte es erst, als der Wagen mit quietschenden Reifen zum Stehen kam. Der Dicke kurbelte das Fenster hinunter und hängte seinen Kopf hinaus. Zwei Soldaten, mit Gewehren bewaffnet, standen an der Strasse und dahinter ein Motorrad mit Beiwagen, in dem ein weiterer Soldat das darauf montierte MG auf sie richtete. Der Soldat, der ihnen am nächsten stand, kam auf sie zu, sah sie kurz an und sagte:
„Ihre Papiere!“ Als der Soldat die Papiere des Dicken sah, staunte er kurz, salutierte und sagte: „Weiterfahren!“ Der dicke Mann packte die Papiere weg, startete den Motor und fuhr den Wagen auf die Strasse zurück, dabei hatte er seine Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Simon schaute ihn von der Seite an, dadurch wurde er auch nicht sympathischer. Mit seiner gedrungenen Gestalt sass er hinter dem Steuerrad, sein grosser Kopf steckte übergangslos auf seinen Schultern, denn ein Hals war praktisch nicht vorhanden. Der Körper war eine Ansammlung, von Fett und Masse. Sie kamen auf die Stadt zu, der Verkehr wurde dichter und der Dicke schwitzte noch mehr als vorher. Er steckte sich eine neue Zigarre ins Gesicht, hielt in der einen Hand das Streichholz, in der anderen die Schachtel und mit dem grossen Bauch lenkte er den Wagen. Er fuhr um eine Häuserzeile herum, hielt den Wagen brüsk an und sagte:
„Hauptbahnhof Lyon, alles aussteigen!“ Dabei zeigte er mit seinen Wurstfingern auf die gegenüberliegende Strassenseite. Simon schaute sich um und sah das Eingangsportal vom Bahnhof.
„Auf Wiedersehen, Herr Benz…, nehmen Sie Ihr Gepäck aus dem Kofferraum und schliessen Sie den Deckel.“
„Auf Wiedersehen und herzlichen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben, Herr…, äh…?“ Simon streckte ihm die Hand hin, dabei kam ihm der Gedanke, dass er nicht einmal den Namen des Dicken wusste. Dieser schaute zum Fenster seines Wagens hinaus und meinte:
„Würden Sie sich bitte beeilen, Herr Benz, Sie wissen ja, ich habe es eilig!“ Damit wurde er entlassen.
Simon Benz stieg aus, warf die Tür ins Schloss, ging nach hinten zum Kofferraum, entnahm leise fluchend seine Koffer, warf den Deckel zu und klopfte mit der flachen Hand dreimal drauf. Der Dicke verstand sein Zeichen, legte den ersten Gang ein und brauste davon. Simon schaute hinter ihm her und dann sah er etwas, das ihm das Blut in den Adern gefrieren liess. Die Autonummer! Jetzt passte alles zusammen: das überhebliche Benehmen des Dicken, das Salutieren des Soldaten bei der Kontrolle, sein Mantel aus Leder, den er auch bei grosser Hitze nicht auszog und dass er ihm seinen Namen nicht verraten wollte. Simon stand auf dem Bahnhofsplatz in der Mittagssonne und fror. Der Wagen war aus Berlin und der Dicke von der Gestapo.
Er starrte dem Wagen, der längst um die Ecke verschwunden war, immer noch nach. Er konnte ja nicht ahnen, dass er den Dicken bald, allzu bald wieder treffen würde, unter anderen Vorzeichen, die für Simon Benz nichts Gutes verhiessen.
Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. Die Wellentäler hielten ihren immer gleichen Rhythmus bei, rauf und runter, rauf und runter. Die Wolken trugen viel Wasser in sich, ihre dunkelgraue Farbe deutete darauf hin, dass noch mehr Regen folgen würde. Simon sass unter der Plane, in Gedanken versunken, als eine Sirene heulte und sich ein Boot ihrem Boot näherte. Er kroch unter der Plane hervor und sah, dass sie wenige Seemeilen von der Küste entfernt waren. Die Silhouette von Jersey konnte man deutlich sehen. Der Kapitän streckte seinen Kopf aus dem Steuerhaus, um gleich loszufluchen, von wegen jetzt haben wir den Salat. Sie hörten einen Lautsprecher plärren.
„Stoppen Sie die Maschinen, wir kommen längsseits!“
Das Boot bewegte sich sehr schnell auf sie zu und drosselte seine Geschwindigkeit erst kurz vor ihrem Boot. Dann legte es sich längsseits neben sie. Durchgeschaukelt von den Wogen, die das grosse Boot verursachte, konnten sie sich kaum auf den Beinen halten und mussten hilflos zusehen, wie sie geentert wurden. Von drüben erscholl eine Lautsprecherstimme.
„Werfen Sie ein Tau herüber!“ Der Kapitän versuchte der Aufforderung nachzukommen, hatte jedoch grosse Mühe, dem Tau die richtige Richtung zu geben und so plumpste es zweimal ins Wasser, bevor es drüben an der Reling befestigt wurde. Ein Offizier der deutschen Marine setzte über und kam an Bord. Er sprach mit dem Kapitän und Simon konnte nur Wortfetzen verstehen, sah, wie Jules Vernon mit den Armen fuchtelte, dann mit den Fingern auf ihn zeigte und der Offizier auf ihn zukam. Das Boot schaukelte noch immer und der Offizier musste sich überall einhaken. Er tippte an seine Mütze.
„Kapitänleutnant Harmusen…, Ihren Ausweis und Ihre Reiseerlaubnis!"
Simon nahm die Papiere aus seiner Manteltasche und gab sie ihm. Harmusen blätterte Seite für Seite durch, sah ihn zwischendurch an, prüfte alles und behielt die Papiere in der Hand.
„Herr Benz, was ist der Zweck Ihrer Reise nach Jersey? Wie ich sehe, kommen Sie aus der Schweiz…“ Er sah Simons fragende Augen. „Nun, das ist eine weite und gefährliche Reise in Kriegszeiten, also was ist der Anlass?“
„Das steht doch alles in der Reiseerlaubnis“, verteidigte sich Simon. „Da“, er zeigte auf das Papier, „da steht es doch!“
„Ich möchte es aber von Ihnen wissen!“
„Eine Erbschaft…, der Notar meines verstorbenen Onkels hat mir geschrieben, dass meine Anwesenheit hier vonnöten sei.“
„Ist das der einzige Grund, oder gibt es noch andere?“
„Der einzige!“, sagte er. Simon verstand nicht, was er damit meinte, mit den anderen. Er wollte antworten, ob ihm dieser nicht reiche, hielt sich aber klugerweise zurück.
Der Kapitänleutnant steckte die Papiere des Kapitäns und die von Simon in eine Tasche, ging zu Jules Vernon, besprach sich mit ihm und kletterte über die Reling auf sein Boot zurück. Dann starteten die Motoren und das Tau flog auf ihr Boot zu. Vernon fing es auf, rollte es zu einem Kreis, ging in sein Steuerhaus und startete den Motor. Simon ging zu ihm.
„Was ist los, warum hat er unsere Papiere eingepackt?“, schrie er über den Motorenlärm.
„Was wohl, das sehen Sie doch!“, keifte er zurück. „Sie haben uns am Wickel, jetzt wird es hart für uns beide. Der Leutnant hat gesagt, ich soll in seinem Kielwasser bleiben, er bringe uns in den Hafen, es habe zu viele Treibminen in diesem Gewässer. Ha, die Mine ist an Land und nicht hier draussen.“ Dabei starrte der Kapitän finster nach vorne zum Heck der Küstenwache, auf dem ein Marinesoldat ein schweres Maschinengewehr gegen seinen Bug gerichtet hielt. Dem Kapitän wurde es ganz flau im Magen und er fluchte auf die Boches, auf den Ausländer, aber am meisten auf sich selbst. Die Hafeneinfahrt von Jersey kam immer näher auf sie zu. Sie fuhren einer ungewissen Zukunft entgegen. Wir werden die Heimat so schnell nicht wiedersehen, dachte er bei sich. Er konnte nicht ahnen, wie recht er hatte.
Schwüle Luft herrschte in Lyon, die Sonne war hinter dünnen Wolken versteckt. Bald kommt der Regen, dachte Simon Benz. Er stand noch an derselben Stelle, wo ihn der Dicke abgesetzt hatte. Als er sich umdrehte und seine Koffer suchte, waren sie verschwunden. Er blickte in zwei Knopfaugen, die unter einer Schirmmütze hervoräugten.
„Können wir, Monsieur?“, fragte der Kofferträger und wischte den Schweiss aus dem Gesicht. Simon sah ihn fragend an.
„Ich hab’ schon mal das Gepäck aufgeladen“, er deutete auf den Handkarren, der neben ihm stand. Da Simon ausser der deutschen auch die französische und englische Sprache beherrschte, wollte er ihm gerade erklären, dass er die Koffer lieber selber tragen würde, sah dann aber seine Angst, um das verlorene Geschäft im Gesicht stehen und überlegte es sich anders.
„Gehen Sie bitte voraus zum Fahrkartenschalter“, sagte er zu dem Mann mit den Koffern und ging hinter ihm her. Als sie in der Bahnhofshalle ankamen, hing eine Menschentrauben vor dem Fahrkartenschalter und sie mussten sich hinten anstellen. Der Kofferträger meinte, er schaue mal nach, was da vorne los sei und tauchte in der Menschenmenge unter. Simon lehnte an den Handkarren, schützend seine Hand über dem Gepäck. Die Menge bewegte sich sehr schleppend von der Stelle und Simon schob den Karren vor sich her. Plötzlich hörte er laute Stimmen am Eingang, Stiefelgetrampel und vereinzelte Schreie. In die Menge kam Bewegung. Unkontrolliert stob sie auseinander und jeder suchte sein Heil in einer anderen Ecke. Simon schaute dem Treiben mit starren Augen zu. Die Soldaten pflanzten sich vor jeden Ein- und Ausgang, somit war ein Entkommen unmöglich.
„Kontrolle!“, schrie jemand und: „Ausweise bereithalten!“ Zwei Männer in schwarzen Ledermänteln kontrollierten die Menschen in der Halle. Der Gepäckträger kam zurück und stellte sich neben seinen Karren. Simon hielt die Papiere in der Hand und wartete, bis es soweit war und er kontrolliert wurde. Vier Personen vor ihm zogen „Ledermäntel“ einen alten Mann aus der Reihe und knüppelten auf ihn ein, dabei schrien sie:
„Du Saujude, dir werden wir es zeigen…, mitkommen!“
Dann bekam er noch ein paar Fusstritte und noch einmal einen Schlag auf den Kopf. Der Alte sackte in die Knie, Blut lief ihm aus dem Mundwinkel, tropfte auf seine Hose und hinterliess dort einen hässlichen Fleck. Simon zog seinen Mantel aus, legte ihn auf den Karren und wollte sich auf die beiden Männer in Ledermäntel stürzen, aber der Kofferträger hielt ihn zurück.
„Oh, oh, Monsieur, sie wollen sich doch nicht unglücklich machen, das passiert jeden Tag ein-, zweimal“, er zog ihn am Ärmel. Simon sah, wie die Soldaten den alten Mann durch einen Menschenkorridor prügelten. So muss es gewesen sein, als Jesus auf seinem Kreuzweg nach Golgatha war, kam ihm der Gedanke. Er riss sich los und ging auf den Schalter zu, der jetzt verlassen dastand. Draussen auf den Geleisen rollten schrill pfeifende Lokomotiven unter gewaltigen Dampfstössen der Ausfahrt entgegen.
„Wann geht der nächste Zug nach St-Malo?“, fragte er am Schalter.
„Heute Abend, aber er ist schon besetzt! Oh, Sie haben Glück, Monsieur, eben ist ein Platz frei geworden!“ Er deutete mit dem Kopf auf den Ausgang, dort schleiften die Soldaten den alten Mann zum Ausgang. Simon hätte dem Schalterbeamten am liebsten eine gelangt, denn dieser Sitzplatz hatte einen zu hohen Preis, um darüber einen blöden Scherz zu machen.
Er nahm die Fahrkarte widerwillig entgegen, bezahlte und ging zur Gepäckaufbewahrung. Dort gab er seine Koffer für ein paar Stunden in Obhut. Als er dem Ausgang entgegenstürmte, hatte er das Gefühl, als ob er verfolgt würde. Er schaute sich um und sah den Kofferträger hinter ihm. Simon hatte vergessen, ihn zu bezahlen.
Auf der Strasse orientierte er sich an seiner Nase, er hatte Hunger und suchte ein Bistro. Simon ging die Häuserzeilen mit den Augen ab und sah, gar nicht weit weg, ein Lokal. Durch die Fenster erspähte er einen freien Tisch. Als er die Tür aufdrückte, wehte ihm der Duft von gekochtem Fleisch entgegen. Er wählte den Tisch am Fenster, so konnte er das Lokal und die Strasse beobachten. Der Wirt kam zu ihm an den Tisch und sah ihn fragend an.
„Haben Sie eine Karte, äh… Speisekarte?“
„Keine Karte, Monsieur, es gibt nur ein Gericht, mit Suppe!“ Er wischte mit dem Tuch den Tisch.
„Gut, bringen Sie es mir“, sagte Simon.
Der Wirt entfernte sich und sagte zu den zwei Kerlen, die an der Bar lehnten:
„Eine Karte will der feine Herr!“ Darauf sahen sie herüber und lachten.
Simon ignorierte sie und schaute aus dem Fenster dem Treiben auf der Strasse zu. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite kam ein schwarzer Citroën zum Stehen; die Tür ging auf und eine Frau stieg aus, überquerte die Strasse und kam in das Lokal. Sie blickte sich kurz um und kam geradewegs auf ihn zu.
„Darf ich mich setzen?“ Simon Benz schaute sich irritiert im Bistro um. Es hatte genug freie Tische, warum ausgerechnet zu ihm? Er sagte es natürlich nicht, sondern:
„Selbstverständlich, bitte nehmen Sie Platz!“ Er stand höflich von seinem Stuhl auf und bot ihr einen Platz an. Sie sah sehr gut aus mit ihren langen schwarzen Haaren und den blauen Augen. Hastig zog sie ihren Regenmantel aus und legte ihn über die Stuhllehne. Simon wartete, bis alles zurechtgerückt war und sah sie fragend an.
„Bitte entschuldigen Sie meine Störung, Herr Benz“, begann sie, „aber es lässt…“
„Woher kennen Sie meinen Namen?“, unterbrach er sie.
„Oh, das war nicht schwer herauszufinden, Sie haben ja überall kleine süsse Zettel an ihrem Gepäck.“
Das war seine Mutter, sie hatte die Angewohnheit, sämtliche Gepäckstücke mit Adressen zu versehen. Er hatte ihr schon öfters gesagt, sie solle es lassen, aber sie tat es immer wieder.
„Sie sind doch Simon Benz aus der Schweiz, oder etwa nicht?“
„Doch schon, aber was hat das mit Ihnen zu tun?“, wollte er wissen.
„Sie können mir einen Gefallen erweisen und diesen Brief mit nach St-Malo nehmen, Sie fahren doch nach St-Malo?“
„Und aus welchem Grund sollte ich das tun?“, stellte er eine Gegenfrage. „Ich kenne Sie ja nicht.“
Sie wollte gerade antworten, da kam der Wirt mit dem Essen vorbei.
„Was zu trinken?“, fragte er mürrisch und deckte den Tisch.
„Eine Flasche Roten und zwei Gläser.“ Der Wirt trottete zur Theke zurück und holte den Wein.
„Vielen Dank, Herr Benz, ich hoffe, ich störe Sie nicht bei Ihrer Mahlzeit, übrigens mein Name ist Yvette Vernon“, sagte die Schwarzhaarige. Simon betrachtete das Essen. Gerade einladend sah es nicht aus. In der Suppe schwamm irgendetwas Undefinierbares und im anderen Teller war Fleisch an brauner Sosse mit Kraut darüber.
„Also, wie war das mit dem Brief?“, fragte er über den Tisch, nur, um sich vom Essen abzulenken.
„Ach ja, der Brief“, sie verzog ihr hübsches Gesicht zu einer Grimasse als sie auf den Teller sah. „Könnten Sie ihn mitnehmen, er ist für meinen Vater.“
„Warum nicht mit der Post?“ Der Wein kam. Der Wirt füllte beide Gläser.
„Das dauert viel zu lange, es ist dringend und zensiert wird sie auch noch, manchmal.“ Simon nahm einen Löffel von der Suppe, sie schmeckte säuerlich. Er stocherte im Fleisch herum und stellte beides zur Seite.
„Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte?“ Er sah sie fragend an. Sie nickte und grinste.
„Hirn von irgendeinem Tier, ich weiss nicht, von welchem.“ Als sie sein Gesicht sah, das er zu einer Fratze verzog, brach sie in schallendes Gelächter aus. Simon dachte an das Hirn vom Juden, der im Bahnhof verprügelt worden war, das sah wahrscheinlich genauso aus, mit einer Ausnahme, die braune Sosse war Blut.
„Ich lade Sie zum Mittagessen bei mir zu Hause ein, ich habe nicht gerade üppig zu essen, aber für uns wird es reichen, dafür nehmen Sie den Brief mit zu meinem Vater. Kommen Sie, das Haus ist gleich um die Ecke!“ Sie hielt den Brief immer noch in Händen und strahlte übers ganze Gesicht ob ihrer guten Idee.
„Das ist Erpressung!“, sagte er lachend zu ihr. Der Wirt kam, um das Geschirr vom Tisch zu räumen. Als er die vollen Teller sah, wurde er noch unfreundlicher.
„Monsieur, Sie haben ja nichts gegessen, das ist nicht gut, das ist eine Spezialität von mir!“ Seine Augen funkelten. Simon dachte: Dann möchte ich das andere Essen nicht sehen und sagte zu ihm:
„Tut mir leid, ich kann das nicht zu mir nehmen, ich bin solche Spezialitäten nicht gewohnt, ich werde es aber trotzdem bezahlen.“ Damit gab sich der Wirt zufrieden und trottete davon. Als sie den Wein ausgetrunken hatten, bezahlte er und half ihr in den Mantel. Sie verliessen das Bistro und standen im Regen.
Die Einfahrt in den Hafen war nicht schwieriger als anderswo auch, also, was sollte die blöde Ausrede von dem Kerl? Vernon hatte keine einzige Mine gesehen, das war alles Lüge, die wollten ihn einkassieren, das war es, was sie wollten. Das Boot legte an der Nordpier an. Vernon setzte sein Boot umständlich daneben. Als das Anlegemanöver beendet war, schaute sich Simon nach allen Seiten um. Das war also St-Helier auf der Insel Jersey. Er wusste nicht, wo er zuerst hinsehen sollte, auf den Berg, der vor ihm lag mit dem Fort Regent, oder den lieblichen Häuserzeilen entlang. Obwohl alles noch fremd und unbekannt war, spürte Simon eine tiefe Zuneigung in sich, die ihn mit einem Schlag gefangen nahm.
Irgendetwas irritierte ihn und störte sein Blickfeld. Die ganze Pier war voller Soldaten, deutscher Soldaten.
Vernon kletterte vor ihm die Leiter hoch. Simon wollte sein Gepäck mitnehmen, der Leutnant gab ihm aber zu verstehen, er solle es im Boot lassen und erst mal selber hochkommen. Er tat, wie ihm gesagt wurde und stand neben Kapitän Vernon auf der Pier.
„So meine Herren! Sie werden sich jetzt trennen, Herr Benz geht mit mir und der Kapitän in die Zollbaracke da vorne“, Kapitänleutnant Harmusen deutete auf einen Schuppen ganz in ihrer Nähe. „Soldat Neske wird Sie begleiten, damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen“, setzte er nach. Vernon wurde der Gewehrlauf in den Rücken gedrückt und er begann, in Richtung Baracke zu gehen. Simon wollte sich noch bei ihm bedanken und sich verabschieden, aber dazu liessen sie ihm keine Zeit.
„Einsteigen, Herr Benz“, sagte der Leutnant zur See und schubste Simon in einen Kübelwagen. Sie fuhren den Kai entlang, bei Vernon vorbei und ihre Augen trafen sich für einen winzigen Moment. Simon hatte die traurigen Augen des Kapitäns zum letzten Mal gesehen, doch davon wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nichts.
„Wohin bringen Sie mich?“, wollte er wissen, aber er bekam keine Antwort, alle schauten geradeaus, wie Wachsfiguren. Plötzlich kam der Kübelwagen mit quietschenden Reifen vor einem grossen Gebäude zu stehen. Die Türe wurde aufgerissen und ihm wurde gedeutet, auszusteigen. Er schaute die Hausmauer hoch, an eine Tafel mit der Aufschrift Hotel Pomme d’Or und darunter Hauptquartier der deutschen Marine. Simon begann die Hoffnung an einen schönen Aufenthalt in Jersey zu verlieren, denn in diesem Hotel wurden schon lange keine Zimmer mehr vermietet.
Als sie aus dem Lokal traten, fing es zu regnen an. Ein Gewitter entlud sich über ihren Köpfen. Die schwüle Luft entfloh und Nässe machte sich breit. Simon Benz schlug seinen Mantelkragen hoch und schaute sich um. Sie standen immer noch unter dem Vordach des Bistros, keiner wollte den ersten Schritt tun.
„Wo steht Ihr Wagen?“, fragte er.
„Das ist nicht mein Wagen, der gehört meinem Bruder, er hat mich nur hergefahren, damit es schneller ging…, also los jetzt!“ Dann rannte sie los. Simon schaute ihr hinterher, dann rannte auch er. Zwei Minuten später hatte er Yvette Vernon eingeholt. Sie waren beide klitschnass.
„Warum rennen wir so?“, fragte er zwischen zwei Atemzügen.
„Ich habe Angst vor Gewittern“, schrie sie zurück und bog in eine Seitenstrasse ab, unter eine Arkade. Dort blieb sie stehen, um zu verschnaufen. Simon lehnte sich an einen Pfeiler und atmete hastig ein und aus.
„Ist es noch weit?“, keuchte er. Sie schüttelte ihr nasses Haupt und zeigte auf eine Haustüre. Dann öffnete sie und winkte ihm, einzutreten. Eine schmale Treppe führte steil nach oben zu der Wohnungstüre, die sie aufschloss und hinter ihm wieder zusperrte. Er schaute sie lächelnd an, als er dies bemerkte.
„Sie haben aber mächtig Angst vor Gewittern“, grinste er, dann schaute Simon an sich herunter, er war vollkommen aufgeweicht. Dort, wo er stand, bildete sich eine Pfütze und bei jedem Tritt schwappte Wasser aus seinen Schuhen.
„Dahinten ist das Badezimmer, ziehen Sie sich aus…, ich bringe Ihnen einen Bademantel von meinem Bruder“, sprach sie und verschwand hinter einer Türe. Er ging auf Zehenspitzen den Flur entlang, um weniger Wasserflecken zu hinterlassen. Als er ins Badezimmer trat und in den Spiegel sah, konnte er ein Lächeln nicht verkneifen. Die blonden Haare ins Gesicht geklatscht, den Mantel in der Eile falsch zugeknöpft, sah er aus wie ein nasser Fischotter. Simon zog sich aus und hängte seine nassen Kleider zum Trocknen auf eine Leine, die quer über der Badewanne hing. Es klopfte an der Türe, eine Hand streckte ein grosses Handtuch und einen Bademantel herein.
„Wenn Sie fertig sind, kommen Sie in die Küche, dann gibt es zu essen!“, rief sie beim Weggehen. Er trocknete die Haare, so gut es ging, schlüpfte in den Mantel und steckte seine Füsse in die Pantoffeln, die vor der Türe standen. Als er in die Küche kam, hantierte Yvette mit Pfannen und Geschirr herum. Sie hatte ihre nassen Haare in ein Tuch gewickelt und trug ebenfalls einen Bademantel.
„Mögen Sie ein Omelett mit viel Kräutern und Pilzen?“, fragte sie und schlug Eier in ein Gefäss.
Simon sass auf seinem Stuhl am Küchentisch und schaute ihr beim Kochen zu. Sie sieht zum Verlieben aus in ihrem Bademantel und dem Kopftuch, dachte er bei sich und dann kam ihm der Dicke mit seiner obszönen Bemerkung in den Sinn und der ganze Zauber war verflogen.
„Wollen Sie den Tisch decken?“, riss sie ihn aus den Gedanken. „Das Geschirr ist da oben.“ Sie zeigte auf einen Hängeschrank. Simon stand auf und holte die Teller, stellte sie auf den Tisch und nahm Messer und Gabeln aus der Schublade.
„Eine Frage beschäftigt mich schon die ganze Zeit“, er biss in ein grosses Stück Omelett und kaute darauf herum. „Wie sind Sie gerade auf mich gekommen, ich meine, irgendjemand muss Ihnen doch einen Tipp oder so…?“
„Das war mein Onkel…, er arbeitet am Bahnhof als Gepäckträger, Sie kennen ihn, er hat Ihre Koffer getragen.“ Sie schenkte ihm ein bisschen Wein nach. Er bedankte sich für das Essen und wollte sie noch etwas fragen, da klingelte das Telefon.
Yvette ging in die Diele und nahm den Hörer ab. Simon stand auf und stellte sich vor das regennasse Fenster, sah den Tropfen zu, wie sie von oben nach unten liefen. Dabei bemerkte er einen schwarzen Citroën, der vor einer Telefonzelle stand, der Mann, vermutlich der Fahrer, der bei offener Türe wild gestikulierend mit jemandem sprach. Von der Diele hörte er Yvette telefonieren.
„Nein, jetzt nicht…, ich habe Besuch…“, dann lauter: „Ich habe doch gesagt, jetzt nicht!“ Dann schmiss sie den Hörer auf die Gabel. Der Fahrer unten auf der Strasse tat dasselbe. Der Mann kam aus der Telefonzelle und schaute hoch, sah Simon am Fenster stehen, schaute noch einmal, stieg in sein Auto und fuhr davon. Yvette kam zurück.
„Wo waren wir stehengeblieben?“ Sie lächelte verkrampft.
„Ärger?“, stellte Simon eine Gegenfrage. Sie nahm das Tuch vom Kopf und schüttelte ihre Haare.
„Nein, es ist nur…, ach was, ich wollte nur nicht gestört werden…, ich möchte mit Ihnen reden…, und…“ Dabei kam sie ganz nah auf ihn zu und schaute ihm in die Augen. Simon kribbelte es unter der Haut.
„Und…, was wolltest du noch?“ Er schlang seine Arme um sie.
„Komm“, sagte Yvette und zog ihn bei der Hand aus der Küche, durch den Flur in das Zimmer nebenan. Simon dachte nicht mehr an Züge, nicht mehr an Krieg, Juden und Soldaten, er liess die Zeit für ein paar Stunden stillstehen.
Wenige Lichter brannten, als Simon Benz am Gare de Parrache ankam. Der Bahnhof machte einen verlassenen Eindruck auf ihn. Das änderte sich schlagartig, als er durch die Türe in die Halle trat. Ein Gewühl von Menschenleibern drängte sich auf dem Bahnsteig, um in die Wagons zu steigen, die schräg hinten auf dem Geleise standen. Simon holte seine Koffer und stellte sich an der Kontrollschleuse an. Ein Mann in Bahnhofsuniform kontrollierte seine Fahrkarte, wobei er von zwei finsteren Gestalten in Ledermänteln beobachtet wurde.
Simon kletterte in den Zug und suchte die Abteilnummer auf seiner Karte. Im Wagon herrschte ein Durcheinander von Menschen und Gepäckstücken, so dass er einige Zeit brauchte, um sich in das Abteil vorzukämpfen. Die Koffer verstaute er über seinem Haupt in der Ablage und setzte sich an den Platz bei der Abteiltüre. Mit einem Ruck fuhr der Zug an, um sich dann langsam über holperige Weichen aus dem Bahnhof von Lyon davonzustehlen. Simon zündete sich eine Zigarette an und dachte an Yvette. Sie wollte ihn nicht zum Bahnhof begleiten, sie hasse Abschiede, hatte sie gesagt, nachdem sie den Anzug aufgebügelt und ein paar Brote für die Reise eingepackt hatte. Bei der Rückfahrt in einer Woche soll er sie wieder besuchen, das musste er ihr in die Hand versprechen, bevor er sich unter Küssen von Yvette verabschiedete. Mit geschlossenen Augen versuchte er, ihren weichen, warmen Körper ins Gedächtnis zurückzurufen, was ihm auch halbwegs gelang, dann schlief er ein.
Mitten in der Nacht erwachte Simon. Es war stockdunkel und der Zug stand. Er öffnete die Abteiltüre und trat in den Gang, wo mehrere Personen bei offenen Wagonfenstern standen und sich leise unterhielten. Durch das Fenster hörte er von ferne ein Flugzeug, das auf sie zuhielt und dann wieder abdrehte. Simon lehnte sich aus dem Fenster und sog die frische Nachtluft tief in seine Lungen. Unter dem Fenster ging ein Zugbegleiter mit einer schwach leuchtenden Tranfunzel und klopfte mit dem schweren Hammer die Eisenräder ab. Weit und breit war nichts zu sehen, nur der Horizont wurde am oberen Rand etwas heller. Ein neuer Tag begann.
Die Notbeleuchtung im Wagon begann zu flackern, der Zug setzte sich wieder in Bewegung und nahm langsam Fahrt auf. Simon ging in das Abteil zurück, packte ein mit Käse belegtes Brot aus dem Papier und ass mit Genuss auch die Brösel, die ab und zu auf seiner Hose landeten. Beim Essen betrachtete er die alte Frau ihm gegenüber, die mit offenem Munde leicht schräg in ihrem Sitz kauerte und laut schnarchte.
Obschon er keine Ahnung davon hatte, wo er sich zurzeit befand, wusste Simon, dass die Fahrt nicht mehr lange dauern konnte: Der Geschmack von Salzwasser, Fisch und Tang stach ihm in die Nase. Er war heilfroh darüber, dass dieser Zug nicht über Paris fuhr, sondern über Nantes und Rennes, so entging er dem lästigen Umsteigen und war schneller am Ziel, so hoffte er wenigstens.
Die alte Frau erwachte mit einem Grunzen, streckte sich ausgiebig und fing in ihrer Tasche zu suchen an. Dann förderte sie einen Käse zutage, dessen Duft im Nu das ganze Abteil füllte.
„Möchten Sie auch?“ Mit einer Handbewegung hielt sie Simon den Stinkkäse unter die Nase. Er lehnte entschieden ab. Sein Nachbar steckte sich eine Zigarre ins Gesicht, riss das Fenster auf und ein Schwall frischer Meeresluft ergoss sich über ihre Häupter. Draussen war es schon ziemlich hell, er konnte die Landschaft in der aufgehenden Morgensonne erstrahlen sehen. Simon nestelte in seinen Kleidertaschen nach Zigaretten und fand den Brief von Yvettes Vater. Er holte ihn hervor, wog ihn prüfend in den Händen, hielt ihn gegen das Licht und sah, dass er nicht verschlossen war. Als er das Briefpapier herauszog, fiel ein kleiner Zettel zu Boden, auf dem die Mitteilung In Liebe, Yvette stand. Simon las den Brief, verstand aber dessen Inhalt nicht. Es war alles in ungereimten Versen geschrieben, die keinen Sinn ergaben.
Er legte den Brief in den Umschlag zurück, verstaute das Papier in der Tasche und dachte nicht weiter darüber nach.
Es war früher Vormittag, als der Zug in St-Malo einfuhr. Da der Bahnhof sich in der Nähe vom Meer befand, nahm Simon sein Gepäck unter den Arm und machte sich auf den Weg zum Hafen. Die Boote dümpelten träge vor sich hin, als er die Hafenmole entlangging, auf der Suche nach Auskunft. Endlich traf Simon einen Fischer, der seine Netze zum Trocknen aufhängte. Zwanglos versuchte er ins Gespräch zu kommen und fragte zwischendurch nach Kapitän Vernon. Der Alte wurde misstrauisch und erkundigte sich nach dem Grund seiner Anfrage. Simon erzählte ihm von dem Brief, von Yvette, seiner Tochter und langsam taute der Fischer auf, bekam Zutrauen zu dem Fremden und wies ihm den Weg zu einem Lokal mit dem Namen Chez Delphin. Er beteuerte hoch und heilig, dass er ihn da bestimmt finden werde.
Mit den Koffern unter dem Arm und ziemlich abgekämpft kam er beim Lokal an, das um diese Zeit hoffnungslos überfüllt war. Simon schaute sich nach dem Wirt um und fand ihn hinter dem Tresen beim Zapfhahn stehen. Nachdem er dem Wirt sein Anliegen erklärt hatte, kam er von seinem überhöhten Stand hervor und wies ihn ins Hinterzimmer. Simon wusste nicht, was er davon halten sollte, aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass er vor etwas versteckt würde.
Als er den Vater von Yvette zum ersten Mal sah, wie er durch die Tür geschoben wurde und dann voller Angst vor ihm stand, konnte er kaum glauben, dass dies der furchtlose Mann sein sollte, von dem ihm Yvette erzählt hatte. Dieses schlotternde Häufchen konnte niemals der Kapitän sein. Seine erste Frage galt somit seinem Namen. Er wusste nicht, welche Reaktion er damit auslösen würde.
Nach einiger Zeit kam der Kapitän wieder zurück, eine Flasche mit gelblichem Inhalt unter den Arm geklemmt und zwei Gläser in der Hand.
„Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie von meiner Tochter geschickt wurden!“, schnaufte er, dabei stellte er Flasche und Gläser auf den Tisch und schenkte ein. „Der alte Popaul hat es mir eben erzählt und…“ Er sah Simon fragendes Gesicht. „Na, der alte Fischer, den Sie nach mir gefragt haben…, Santé!“ Er lächelte verschmitzt. Simon nickte hob ebenfalls sein Glas und prostete ihm zu.
„Aber auf die Kanalinseln kann ich Sie trotzdem nicht bringen, viel zu gefährlich, unruhige Zeiten, Sie verstehen. Die Inseln sind von den Deutschen zur Festung ausgebaut worden, kein Rein- oder Rauskommen ohne ihre Erlaubnis. Tut mir leid, Monsieur!“
Mit Augen, gross wie Suppenteller, schaute er ihn an. Simon liess sich mit der Antwort Zeit, nahm einen Schluck Cidre, zog den Brief aus der Tasche und legte ihn vor sich auf den Tisch.
„Ich habe eine Mitteilung von Ihrer Tochter, vielleicht sollten Sie den Brief zuerst lesen?“
Zögernd nahm der Kapitän das Papier in die Hand, las darin, schaute zwischendurch kurz auf, faltete den Brief und steckte ihn mit zitternden Fingern in die Jackentasche.
„Woher kennen Sie meine Tochter?“, fragte er schroff.
„Ich habe sie in Lyon kennen- und lieben gelernt…! Das ist ein Code…?“ Er deutete auf die Jackentasche. „Nicht wahr?“
„Haben sie mit ihr…?“ Vernon sprach das Wort nicht aus.
„Was für eine Frage! Sie haben mir noch keine Antwort gegeben…, das ist ein Code! Sind Sie bei einer Widerstandsbewegung, etwa bei der Résistance?“
Der Kapitän antwortete nicht, sondern nickte bloss.
„Yvette auch?“ Wieder ein Nicken mit dem Kopf. Simon wurde vieles klar. Der schwarze Wagen, der komische Anruf, der Brief, der mit der Post zu lange dauert, die Anmache im Bistro und, und, und. Er war ein bisschen enttäuscht, er hatte geglaubt, wegen seiner Person hätte Yvette sich mit ihm eingelassen, derweil war er nichts anderes als ein privater Postbote.
„Also, wann ist Ihr Boot klar zum Auslaufen?“, fragte er hart. Er war darüber verärgert, dass er benutzt wurde. „Eine Hand wäscht die andere“, setzte er noch hinzu.
„Ich setze Sie an einer stillen Ecke ab morgen früh und schlafen können Sie bei mir. Abgemacht!“ Er streckte ihm die Hand hin. Simon ergriff sie und sagte:
„Das ist ein Wort.“
Daraufhin prosteten sie einander zu, tranken noch ein paar Flaschen Cidre und trotteten dann zur Bude des Kapitäns. Dort schlief er friedlich auf einem Kanapee, bis ihn eine raue Hand schüttelte und der Kapitän Zeichen zum Aufstehen gab. Simon klatschte sich in der kleinen Küche kaltes Wasser ins Gesicht, zog sich die Kleider an und ging mit Vernon zurück zur Kneipe, um sein Gepäck zu holen. Dann kaute er eine Scheibe altes Brot und spülte das Ganze mit durchsichtigem Kaffee hinunter. Als sie zum Hafen kamen, trieb der Wind den Regen vor sich her. Das Boot schaukelte wie eine Boje auf dem Wasser und Jules Vernon hatte alle Hände voll zu tun, um überhaupt aus dem Hafen zu kommen.
Erstes Kapitel
Das Pomme d’Or Hotel wurde von der deutschen Marine als ihr Hauptquartier auf der Insel ausgesucht. Den Charakter behielt das Hotel bei, nur seine Gäste wurden zwangsläufig gegen Soldaten ausgetauscht und der Eingang mit anderen Attributen versehen. Kapitänsleutnant Harmusen meldete sich und seinen Fang an der Rezeption an. Der Soldat hinter dem Tresen schrieb alles fein säuberlich in ein Buch, was ihm der Leutnant diktierte. Dann gingen Sie die Treppe nach oben und wurden von einem weiteren Soldaten, der sein Gewehr mit dem Bleistift vertauscht hatte, in Empfang genommen. Dasselbe Spiel wie unten an der Rezeption begann mit Eintragung von Namen, Zeit und Grund der Anwesenheit. Der Spiess kam hinter seinem Tisch hervor und verschwand durch eine der vielen Türen, um nach einiger Zeit wieder zu erscheinen. Er besprach sich kurz mit dem Leutnant, dann gingen beide in den Raum zurück. Simon wurde vor der Türe mit der Nummer zehn abgestellt, ihm wurde gedeutet, hier zu warten. Er setzte sich auf die Bank, die davor stand und suchte die Wände mit den Augen nach Zerstreuung ab. Das einzige, was er fand, waren Ständer und Fahnen mit Hakenkreuzen als Motiv. Irgendwo wurde eine Tür aufgerissen, er hörte Wortfetzen und Gelächter, dann schlug die Tür wieder zu. Der Spiess trat aus der Tür, kontrollierte ihn aus den Augenwinkeln, tat aber so, als wäre Simon nicht vorhanden. Dieser wollte es sich gerade bequem machen, als die Tür mit der Nummer zehn abermals aufging und der Leutnant ihn aufforderte einzutreten. Simon staunte über die luxuriöse Ausstattung der Zimmer. Hinter einem antiken Schreibtisch sass ein mit Lametta verzierter, uniformierter älterer Mann, der Simon durch nickelbebrillte Augen fixierte. Eine ausgestreckte Hand deutete ihm, sich zu setzen. Er zog sich einen Chippendale-Stuhl heran und setzte sich vor den Schreibtisch. Simon sah, wie der Uniformierte in einem Ordner suchte und offenbar nicht das fand, was er wollte, denn er bewegte sein ergrautes Haupt hin und her und schnalzte dabei mit der Zunge.
„Ich weiss nicht, ob ich Sie für besonders mutig oder überaus dämlich halten soll, hier auf der Insel anzukommen ohne Erlaubnis von den Militärbehörden. Sie halten sich illegal hier auf, Herr Benz! Übrigens, den Wisch können Sie sich an den Hut stecken!“ Er deutete auf das Gesuch an das deutsche Konsulat.
„Das wird hier nicht anerkannt“, fuhr er fort und nahm seine Nickelbrille ab, um sie zu säubern.
„Was machen wir jetzt mit ihm?“ Das war wie ein Hilferuf an den Kapitänleutnant. Der rückte seinen Stuhl zur Seite, schlug die Beine übereinander, sah beide eine Sekunde an, dann richtete er die Worte an Simon.
„Sie befinden sich in einer unangenehmen Situation, Herr Benz. Sie reisen in ein von der deutschen Wehrmacht besetztes Land ohne gültige Einreisepapiere, das kann für Sie ein böses Ende nehmen, indem wir Sie in das nächste Versorgungsschiff setzen und zurück an die Grenze stellen. Auf die Ankunft des Schiffes warten Sie im Gefängnis, was im Übrigen mehrere Tage dauern kann. Keine schöne Aussichten, Herr Benz, das können Sie mir glauben.“
Simon kam sich vor, als hätte ihm jemand eins über den Schädel gezogen. Er war wie betäubt. Völlig aus dem Tritt. Er musste die Worte zuerst verdauen, bevor er antworten konnte. Dabei hatte alles so gut begonnen und dann dieser Abschluss. Mit diesem Resultat konnte er nicht nach Hause, das wurde der Mutter das Herz brechen, davon war er überzeugt. Er musste sich seiner Haut wehren, aber wie? Simon versuchte verzweifelt nach einem Ausweg, um sich aus dieser scheusslichen Lage zu befreien. Er kam sich vor wie ein Ertrinkender und keiner war da, der ihm den Rettungsring zuwarf.
Jules Vernon war in einer ähnlich prekären Lage, als ihn Standartenführer Müller im Zollhäuschen unten am Hafen in die Mangel nahm. Fett und aufgeblasen sass er rittlings auf dem Schreibtisch und quälte Vernon seit einer Stunde, stellte Frage um Frage, machte sich eine Freude daraus, sie auch gleich selbst zu beantworten, indem er nur seine Antwort gelten liess. Als bei der Leibesvisite auch noch der Brief gefunden wurde, gebärdete sich Müller wie ein römischer Imperator. Er schrie mit seinen Untergebenen, dass er meilenweit gehört wurde. Der Code wurde in wenigen Minuten dechiffriert und das Triumphgeheul schwoll ins Unermessliche. Kapitän Vernon wurde klar, dass ihn nur noch ein Wunder retten konnte, nur waren Wunder zu der Zeit Mangelware. Er sass wie versteinert auf einem Stuhl vor seinem Peiniger. Dieser hatte sich, seines Sieges sicher, eine Zigarre angezündet und mit Genuss den Rauch ausgestossen. Dabei schaute er Vernon hämisch grinsend an.
„Ihre Zeit ist abgelaufen, Monsieur Vernon…, als Widerstandskämpfer, Vater und als Mensch. Wir werden Sie vor Gericht stellen und dann nach Kriegsrecht erschiessen. Sie können Ihre Lage nur dadurch ändern, dass Sie uns erzählen, was wir hören wollen…, Namen, Orte, Personen…, überlegen Sie sich das, es ist Ihre einzige Chance!“
Dann stand er auf, knöpfte seine Uniformjacke zu und rief nach einem Soldaten. Jules Vernon bemerkte die SS-Runen an den Rockaufschlägen, damit verliess ihn der Mut – er wusste, er war erledigt. Der Soldat kam, salutierte und bekam Anweisung, den Gefangenen in Arrest zu bringen.
„Bringt ihn ins HQ zu Schumacher. Er wartet auf Kundschaft!“
Standartenführer Egon Müller kugelte sich vor Lachen. Mit Handschellen gefesselt, wurde der Kapitän aus der Holzbarracke geführt und in ein Auto verfrachtet, das mit aufheulendem Motor über die Pier in Richtung St-Helier losfuhr.
Feldkommandant Oberst Leo Schumacher war im Hauptquartier der Wehrmacht, dem Metropol-Hotel. Er marschierte in seiner Kommandozentrale mit auf dem Rücken verschränkten Armen auf und hatte schlechte Laune. Die halbe Nacht brachte er damit zu, sich von einer Seite auf die andere zu wälzen. Alpträume störten seinen Schlaf. Wahrscheinlich hatte er gestern Abend wieder zu viel und zu scharf gegessen, das löste bei ihm Alpträume der übelsten Sorte aus. Das Problem mit dem Text für die Laudatio bei der Beerdigung von Oberleutnant Zepernick war auch noch ungelöst; er wollte schliesslich eine gute Figur bei der Grabrede machen, wenn General von Stülpnagel dem Zeremoniell beiwohnte. Dieser Oberleutnant Zepernick war nicht im Feld gefallen, das bereitete ihm ja den Kummer. Er war von den eigenen Leuten zusammengefahren worden, als er bei der nächtlichen Nachhausefahrt rechts um die Kurve fuhr und die Trottel von der Infanterie mit ihrem LKW links herum. Zepernick war sofort tot, stand später im Bericht. Diese unselige Umstellung der Verkehrsregelung hatte schon manches Opfer gefordert, weil keiner so recht wusste, welche Seite nun die richtige war. Und dann lag da noch ein Brief von zu Hause, seine Alte machte ihm Ärger wegen einer Lappalie. Dies alles trug nicht zur Verbesserung seiner schlechten Laune bei. Er ging zum Schreibtisch, zog an der unteren Schublade, nahm eine Flasche Cognac hervor und schenkte sich einen doppelten ein. Gerade als er zum Trinken ansetzen wollte, läutete das Telefon. Knurrend hob er ab.
„Ja, was ist denn schon wieder!“, schnarrte er in den Hörer. Es war die Wache am Eingangstor.
„Hier steht Standartenführer Müller, Herr Oberst. Er lässt fragen, ob Sie Zeit hätten…, es wäre sehr wichtig!“
„Ich habe ausdrücklich gesagt, keine Störungen! Er soll warten, ich melde mich wieder!“ Er legte den Hörer hin.
Das passte zu seiner Stimmung, der Staatssicherheitsdienst mit Standartenführer Müller. Dieser Wichtigtuer, bestimmt erzählte er wieder von seiner Observation, die sich anschliessend als Pleite herausstellte. Der kann warten, dachte Schumacher und schüttete das volle Glas in den Hals, hustete und fluchte zugleich.
Schon damals, als er in die NSAP eintrat, konnte er solche Typen nicht ausstehen, die nur mit ihrer grossen Schnauze Leistung erbrachten und wenn es hart auf hart ging, waren sie nicht zugegen. Er war überzeugter Nationalsozialist, fanatisch und seinem Führer Adolf Hitler total ergeben. Das Dritte Reich, davon war er überzeugt, war ein Teil von ihm. Er und seine Kameraden hatten unter der Leitung ihres geliebten Führers harte Arbeit geleistet. Schon lange vor der Reichskristallnacht schwor er den Eid auf den Führer und war einer der ersten, der in Polen einmarschierte. Damit begann seine steile Karriere, die, auch davon war er überzeugt, nach dem Krieg und nach der Neueinteilung von Europa für ihn noch lange nicht beendet war. Obwohl es am Anfang nicht danach ausschaute, dass er sich irgendwann einmal durchzusetzen vermochte.
Schon als kleiner Junge hatte er Mühe bekundet, seine Interessen zu vertreten und wurde durch Schläge seines Vaters oder von den Geschwistern immer eines anderen belehrt. Schuldig oder nicht, er bekam das Fett weg. Dieses Manko wollte er als Erwachsener ausmerzen und sah bei der braunen Partei die Möglichkeit, endlich Anerkennung und Bestätigung zu finden, nach der er sich seit seiner Kindheit sehnte. Als erstes lernte er sich zu wehren, ohne Grund zuzuschlagen und ein ganz neues, erhabenes Gefühl zu empfinden, ein Gefühl, das ihn süchtig nach mehr machte: Macht. Endlich konnte er seine erduldete Schmach zurückzahlen, auch wenn er nicht diejenigen traf, die sie ihm beigebracht hatten. Er brauchte diese Art von Ventil, um Juden, Zigeuner oder Geisteskranke, alles Menschen, die in seinen Augen nicht normal waren, nicht arisch, Menschen dritter Klasse, zu vernichten, um den Starken und Gesunden den Platz im Grossdeutschen Reich nicht streitig zu machen.
Als es 1940 darum ging, einen Kommandeur für die Kanalinseln zu finden, war Oberst Leo Schumacher zweite Wahl. Generalmajor Graf Rudolph von Schmettow wurde ihm vor die Nase gesetzt, was Schumacher als Beleidung empfand. Dieser vornehme Adelige aus Schlesien, butterweich in seinen Ansichten, lasch in der Ausführung von Drecksarbeit, wurde für Schumacher, der es von der Front her gewohnt war, im Dreck zu wühlen, zu einem Problem. Auf sein Geheiss hin wurden Verbrechen schwerster Natur begangen, er unterschrieb Todesurteile, Deportationen von Tausenden in die Gaskammern von Auschwitz, Sobibor und Treblinka, ohne mit der Wimper zu zucken. Für ihn war kein Verbrechen zu grausam und war es noch so perfide, bösartig und schmutzig, solange er es an Menschen dritter Klasse ausüben konnte. Gewissensbisse kannte Oberst Schumacher nicht, er tat ja alles auf Befehl seines euphorisch geliebten Führers. Er unterlag seinen direkten Befehlen, die für Schumacher zwingend waren, auch wenn sie noch so Verquertes aussagten. Seither befehligte er Jakob, Gustav und Adolf, wie Jersey, Guernsey und Alderney im Konstruktionsplan der deutschen Wehrmacht genannt wurden, wie ein Despot. Schumacher arbeitete wie ein Berserker, nur um den Wunsch, die Inseln in Festungen zu verwandeln, zu erfüllen. Viele Tausende von Zwangsarbeitern, Gefangenen, Deportierten aller Nationen, welche mit Deutschland im Kriegszustand waren, wurden mit Schiffen auf die Inseln im Kanal verschleppt, um sie in einen Verteidigungswall aus Stahl und Beton zu verwandeln.
Durch die Gründung der Organisation Todt kam Schumacher mit einem Freund und Kameraden aus der Anfangszeit zusammen. Fritz Todt, Munitions- und Bautenminister, ein Genie im Bau von militärischen Verteidigungsanlagen. Mit ihm bewältigte er die grösste Aufgabe, die sich ihm stellte. Unmengen von Mensch und Material wurden verbraucht, um ein Werk von dieser Grösse zu erstellen. Er war stolz auf sich.
Marineadmiral Moldke war ein höflicher und zivilisierter Mann, der gerne die Zuckerbrot-und-Peitschen-Taktik anwandte, wenn er ein Verhör führte. So auch bei Simon Benz, der immer noch wie vom Donner gerührt vor ihm sass. Zuerst drohte er, dann war er zuckersüss und dann wieder brandgefährlich. Simon wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand, von zwei Seiten wurde er attackiert, jeder hieb mit Fragen auf ihn ein. Admiral Moldke warf ein Wort in die Runde, was der Kapitänleutnant sofort aufgriff und vervollständigte. So ging das schon eine ganze Zeit bis sie endlich einen Konsens gefunden hatten, der für Simon doch noch ein wenig Hoffnung barg.
„Da wir mit der neutralen Schweiz keinen Krieg führen, im Gegenteil zeitweise sogar zusammenarbeiten, indem, dass sie uns Transporte kriegswichtiger Güter durch den Gotthard bewilligen und sie keine Spionagetätigkeit für ihr Land beabsichtigen, sind wir zu dem Entschluss gekommen, Ihnen eine befristete Aufenthaltsbewilligung für die Insel Jersey, für sagen wir einer Woche, auszustellen! Sollten Sie jedoch der Auffassung sein, Sie könnten uns hinters Licht führen, so würde das tödlich für Sie enden. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden!“
Der Rettungsring, dachte Simon, als er dem Admiral zuhörte und versuchte ein Nicken mit dem Kopf. Ihm wurde ein gelber Zettel in die Hand gedrückt, auf dem Datum und Aufenthaltszeit von Anfang bis Ende standen, unterschrieben und gestempelt von Marineadmiral Moldke. Für Simon war Weihnachten und Ostern zugleich, er hätte beide am liebsten umarmt, natürlich ging das nicht und so liess er es damit bewenden, ihnen zigmal Dank auszusprechen. Er bekam seine Papiere zurück, wurde verabschiedet und stand wieder auf der Strasse, so schnell konnte er gar nicht denken.
Als Simon unter dem Torbogen auf die Esplanade hinaustrat, flog ein Flugzeug der R.A.F. über sein Haupt hinweg, das ihn dazu veranlasste, einen Schritt rückwärts zu machen. Ein paar deutsche Infanteriesoldaten, die auf dem Gehsteig herumlungerten, hatten ihn beobachtet und fingen zu lachen an. Simon hörte, wie sie zueinander sagten: „Schau dir den an, der hat Angst vor einem Tommy. Wohl neu hier, was?“, riefen sie hinter ihm her.
Die Esplanade war eine herrliche Strasse, auf der es sich gut flanieren liesse, die Geschäfte rauf und runter, wenn man Zeit hätte, dachte Simon, als er an den Schaufenstern entlangging. Plötzlich bekam er Bauchschmerzen, er hatte ja seit ewiger Zeit nichts mehr gegessen. Bei einer Würstchenbude stellte er sich hinter eine Warteschlange von lauter Soldaten. Heiliger Strohsack, dachte Simon, hier hat es mehr Deutsche als in Deutschland selber. Nachdem das Loch im Magen gefüllt war und er sich wesentlich besser fühlte, überlegte er seinen nächsten Schritt. Zuerst wollte er den Anwalt aufsuchen, der hier in der Nähe seine Kanzlei hatte. Er schaute im Brief nach der Strasse und erkundigte sich beim Würstchenverkäufer nach dem Weg. Wie er vermutet hatte, war es nur zwei Querstrassen weiter, die er in wenigen Minuten erreichte. In dem Haus wohnten mehrere Parteien.
Simon suchte nach dem Namensschild, welches er dann in einer Türnische auch fand: T.+B. Thaker, Notary and Advocates. Er verglich nochmals mit seiner Briefadresse, stellte die Richtigkeit fest, bemerkte, dass es wieder leicht zu regnen anfing, drückte die Türe auf und trat hinein.
Der Fahrer fuhr, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Vernon musste sich am Türholm des Wagens festhalten, sonst flog er in der nächsten Kurve auf den Standartenführer. Als sie bei einer Würstchenbude vorbeirasten, glaubte er, Simon Benz unter den deutschen Soldaten gesehen zu haben, aber das konnte nun wirklich nicht sein, wahrscheinlich hatte er schon Halluzinationen von der blöden Fahrweise des jungen Schnösels am Lenkrad. Beim Hotel angekommen, zerrten zwei herbeigerufene Soldaten Jules Vernon aus dem Auto die Treppe hinauf durch die Eingangstüre in die Empfangshalle. Hinter ihnen eilte der Standartenführer Egon Müller zur Rezeption.
„Geben Sie mir den Feldkommandanten Schumacher an den Hörer“, raunzte er den Mann hinter der Theke an. Der liess sich viel Zeit, um sein Buch wegzulegen und schaute sich den Standartenführer zuerst genau an.
„Wen darf ich melden?“, fragte er scheinheilig.
„Standartenführer Müller und zwar ein bisschen plötzlich, sonst werden Sie mich kennenlernen“, dabei drehte er sich um, schaute auf Vernon und gab den Bewachern Zeichen.
„Schmeisst den in den Keller, bis ich ihn wieder brauche!“ Unter den Armen eingehakt, schleiften sie den Kapitän davon.
„Was ist los, Sie sollten mich doch anmelden?“, wandte Müller sich an den Telefonisten.
„Es meldete sich niem…, ah jetzt. Hier ist ein Standartenführer Müller, Herr Oberst, er lässt fragen, ob Sie Zeit hätten…?“
„Sagen Sie ihm, es wäre wichtig.“ Er tat es, dann wiegte er den Kopf hin und her.
„Sie sollen warten, er will jetzt nicht gestört werden, er meldet sich wieder!“
„Er meldet sich wieder, der hat Nerven! Und wann soll das sein, he?“
„Keine Ahnung, ich meine, er hatte nichts gesagt“, sagte der Wachhabende.