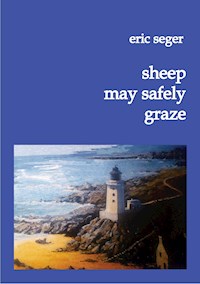2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salvatore Grimaldi führt mit seiner Familie ein beschauliches Leben im kleinen sizilianischen Städtchen Lavana. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich, wie bereits sein Vater, mit dem Fischfang. Höhepunkt dabei ist die alljährlich stattfindende Mattanza, eine traditionelle Thunfischjagd vor den Küsten Siziliens. Nichts scheint die paradiesische Idylle aus dem Gleichgewicht bringen zu können. Doch als sich Salvatores Bruder Angelo aus Amerika zu Besuch ankündigt, nehmen die Dinge eine ungeahnte und verhängnisvolle Wendung…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
eric seger
zug der lemminge
© 2019 Eric Seger
Autor: Eric Seger
Umschlaggestaltung, Illustration: Olivia Seger
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40 – 44, 22359 Hamburg
ISBN Paperback:
978-3-7497-2048-4
ISBN Hardcover:
978-3-7497-2049-1
ISBN e-Book:
978-3-7497-2050-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung
Dort, wo Italien sprichwörtlich am Ende war, dort an der äusseren Spitze von Sizilien lag ein kleines, altes Städtchen, eingebettet in eine pittoreske Landschaft sizilianischer Gegenwart. Auf der einen Seite die Häuser, verschachtelt und dicht an dicht mühevoll dem Berg abgerungen an den Felshang gekrallt, auf der anderen dem Meer ausgesetzt die offene Kulisse zur zerklüfteten Küste am Mittelmeer. Unter extremen Bedingungen geformt, hätte es dem Besucherauge eine unglaubliche Vielfalt an Gegensätzlichem geboten, wenn es den Besucher gegeben hätte. Nur, Besucher gab es keine, in einem Städtchen, das ausser Landschaft nichts zu bieten hatte. Sicher, es beherbergte ein Hotel, ein paar Kneipen und ein Kino, abgesehen von dem Schlachthof und dem Friedhof. Andere Sehenswürdigkeiten gab es nicht. Kein Museum, keine Statuen, keine Piazza Grande, jedenfalls keine vergleichbare mit anderen italienischen Städten, weder einen Tivolipark, noch einen sehenswerten Strand. Und doch empfanden es die Einwohner als den schönsten Flecken existierender sizilianischer Erde.
Die Heimsuchung des Zweiten Weltkrieges geradeso ein gutes Jahrzehnt überstanden, befand sich das Städtchen noch in dem lethargischen Dämmerzustand, den alle Dörfer und Städte sich zu Eigen machten, die mit heiler Haut davongekommen waren. Man hatte da und dort mit Aufräumungsarbeiten begonnen, sich aber der enormen Arbeit wegen, eines Besseren belehrt und das angefangene Werk der Jugend überlassen, um es zu vollenden. An den herumstehenden Ruinen halb verfallener Häuser gemessen, klappte die Kommunikation zwischen der Jugend und den Verursachern keineswegs und so blieb der Schutt nach alter italienischer Tradition liegen oder stehen, wo er sich gerade befand. Irgendwann würde irgendwer das Ganze einem Imperator zuschreiben und die Architektur dem Römischen Reich andichten.
Obwohl es Frühling war, die von den Einwohnern als beliebteste Jahreszeit gerühmt, nicht zu heiss und nicht zu kalt und die Natur in voller Blütenpracht stand, pfiff über die Mole ein eisiger Wind und trieb die schaumgekrönten Wellen des Mittelmeeres mit Vehemenz an die Kaimauer. Achtlos weggeworfenes Papier wirbelte durch die Luft und verfing sich an porösem Mauerwerk. Lichtleitungen schaukelten an den Masten wie ausgeblasene Luftschlangen an Sylvester und liessen die marode Stromversorgung zeitweise ganz zusammenbrechen, was einen vorbeifahrenden Kapitän eines Frachtkahns zu der Bezeichnung veranlasste, das Städtchen sehe aus wie eine blinkende Leuchtreklame.
Dazwischen fiel leichter Regen, vermischt mit stinkendem Rauch von unzähligen Kohlenfeuern, der aus halbverfallenen Schornsteinen aufstieg, vom Wind sogleich an der Austrittsöffnung erfasst, zerteilt, gedrückt, um dann kopulierend mit den Wassertropfen des Regens, aufgelöst, in alle Ecken zerstreut zu werden. Dieser wetterbedingte Zustand hinterliess bei den Bewohnern des Städtchens den Eindruck, sich im hohen Norden, in der Heimat der Lemminge zu befinden.
Um diese Jahreszeit lagen smaragdfarbene Lichter, von dunklen Schatten begleitet, über dem Meer. Am windstillen, späten Nachmittag, wenn die Sonne sich mit dem Horizont vereinte und ihr rötlich schimmerndes Licht auf eine dunkle, ölige Masse warf, am Himmel sich die ersten Sterne zeigten, das war der Moment, in dem sich Salvatore Grimaldi, Zeit seines Lebens ein Tonnaroti, ein Thunfischfänger von Beruf, über seine Arbeit wirklich freute. Der Fisch brachte der ganzen Insel Brot, Arbeit und Hoffnung, ein bisschen Freude und nicht wenig Schmerzen, genauso wie das Leben.
Über den Winter hatten sie die Boote bereitgestellt, Netz um Netz geflickt, zusammengelegt, sortiert und aufeinander getürmt. Jetzt waren die Fischer von Lavana bereit für diesen entscheidenden Tag im Jahr, wenn der grosse Fisch vom Norden in die warmen Gefilde zum Laichen kam. Mit dem Gesicht des Meeres, das einem Mann zu Eigen war, der den Stolz und die Tradition von vielen Tonnarotis aufrechterhielt, beendete Salvatore seine Arbeit am Hafen.
Er zog fröstelnd seinen Hals tief in den Mantelkragen, als er über die, nicht erwähnenswerte, Piazza Communale, einen mit Pflastersteinen besetzten, schäbigen Rundplatz, ging. Häuserzeile um Häuserzeile reihte sich um den Platz, um sich am Ende, gemessen an den prekären, wirtschaftlichen Verhältnissen der kleinen Stadt, an einer geradezu pompös ausladenden Treppe, als Aufgang zu einer alles überragenden, barocken Kirche, zu verlieren.
An einer grauen, sich vom Verputz trennenden Mauer blieb Salvatore kurz stehen, schielte mit halb zugekniffenem Auge auf eine überdimensionale Todesanzeige, die neben vielen, teils heruntergerissenen Anzeigen hing, da deren Ecken mit zu wenig Leim an die Mauer geklebt worden waren, wodurch sie, wie kleine Fähnchen im Wind flatternd, das Geräusch eines durchhängenden Segels von sich gaben. Um seine Füsse strich eine hungernde, streunende, im Fell leicht zerfledderte Katze, mit hochgestelltem Schwanz, die versuchte, durch intensives Miauen Aufmerksamkeit zu erregen. Erschrocken stiess Salvatore sie mit dem Schuh auf die Seite und knurrte Unverständliches in den hochgezogenen Mantelkragen. Der Ton seiner Stimme veranlasste das Tier, mit gesträubtem Nackenhaar um die nächste Ecke zu verschwinden. Salvatore fehlte das Einfühlungsvermögen für Haustiere, er betrachtete sie als nutzlos, deren Zweck allein darin bestand, seine Besitzer mit überzogenem Fressverhalten zu belästigen. Der Name auf der Todesanzeige veranlasste Salvatore mit der rechten Hand drei Kreuze auf seine Stirn zu schlagen und mit der linken, die auf seinem Rücken lag, den Mittelfinger mit dem Zeigefinger zu kreuzen, ein Aberglaube auf der Insel, mit dem man den Tod von einer Person, solange als möglich fernzuhalten versuchte. Andere behaupteten, der Zweck dieser Übung liege darin, den Tod jedem zu gönnen, nur nicht sich selbst. Nachdem er sich mit dem Gedanken über das Sterben und den Tod an sich, seiner Meinung nach, lange genug befasst hatte, überquerte Salvatore den Platz. Dabei stiess er beinahe mit der Alten, von allen als bösartig bezeichneten, Donna Luisa zusammen, die sich hinter einem vorgehaltenen Regenschirm versteckte und gegen den Wind ankämpfte, der an dem Schirm zerrte. Das schwarze Segeltuch wurde von der Seite erfasst, hoch aufgestellt, dann wieder in Falten gelegt und ihr dabei fast aus den Händen gerissen. Zwei Augenpaare… Verzeihung… drei Augen, Salvatore besass ja seit seinem Unfall, als ihm ein Schekel das linke Auge ausriss, nur noch deren eins. Drei Augen richteten sich also aufeinander und flammten kurzzeitig böse flackernd auf, bevor sie sich aneinander vorbeidrückten, nicht ohne, sich im Stillen zu beschimpfen.
Begleitet durch das Spektakel, das von innen an sein Ohr drang, betrat er das Lokal und sah sich nach einem freien Platz um. Er fand ihn an der Theke, hinter der ein feister Wirt mit finsterem Blick seiner Arbeit nachging. Salvatore kannte diese Kaschemme seit Kindesbeinen, wusste, wer sich in dem Lokal aufhielt und zu welcher Zeit. Er brauchte sich nicht einmal umzudrehen, um festzustellen, dass Mario am hinteren Ecktisch sass und trübsinnig in sein leeres Glas starrte. Seine Konkurrenz, Fischhändler Carmine Levante, der ihm gegenüber sass, das Weinglas in seinen dicken Fingern drehte und jede volle Minute seine popelige Nase, aus der büschelweise Haare hingen, an den Glasrand brachte, um kennerisch - vielleicht war es auch nur Angeberei - am Wein zu riechen. Um dann jeden, der sich in seiner Nähe aufhielt mit Vorträgen über Weinanbau und Weinkultur zu beglücken. Salvatore fand, er sollte sich lieber um die Fische kümmern, die in seiner „Fabbrica del Pesce“ verarbeitet wurden. Was da so in die Dosen wanderte, würde er nicht einmal der Katze vorsetzen, die ihm vorher um die Beine gestrichen war.
Mit seinen rauen, von der harten Arbeit an Tauen und Netzen, gegerbten Fingern fuhr Salvatore sich durch den Rest des frühergrauten Haares und streifte mit dieser Bewegung zugleich auch seine Wollmütze vom Kopf. Eine Geste, die zur lieben Gewohnheit geworden war und die ihm Zeit liess, den rauchgeschwängerten Raum zu überblicken, um nach einem Gesprächspartner Ausschau zu halten. Der Gemüsehändler Pepino Cappoli, kurz Pipo genannt, wurde auserkoren, sich mit seiner Gegenwart auseinandersetzen zu dürfen. Salvatores kaputtes Auge, begann zu tränen, als er sich zu Pipo an den Tisch bemühte. Manchmal juckte es auch wie verrückt und er versuchte es, mit seinem knorrigen Finger, durch sanftes Reiben zu beruhigen, was nicht immer gelang. Im Gegenteil durch die reibeisenartige Haut seines Fingers begann es erst recht zu jucken und er überlegte sich dann jedes Mal, ob er dieses verdammte, nutzlose Ding, das polypenähnlich in der Augenhöhle lag, nicht mit einem Messer aus seinem Standort kratzen und den Fischen vorwerfen sollte.
Pipo machte sich nicht einmal die Mühe, aus dem abgegriffenen, speckig anzusehenden Journal hochzusehen, in das er anscheinend so vertieft war, als sich Salvatore zu ihm hinsetzte. Ein kurzes, in stakkatoartigem, sizilianischem Dialekt Gesprochenes:
„Was gibt’s Neues?“, liess Pipo verträumt aus dem Papier hochblicken, um danach genauso tief wieder darin zu versinken. Nur ein leichtes Wiegen seines grossen, quadratartigen Schädels und ein tiefes Brummen aus der Kehle deuteten darauf hin, dass er die Frage wahrgenommen hatte und nicht daran dachte, in den nächsten Minuten darauf zu antworten. Salvatore war daran gewöhnt und liess sich von solchen Launen seines Tischnachbarn nicht aus der, allseits bekannten, sprichwörtlichen Ruhe bringen. Er sass an den Tisch gelehnt, wie angewachsen, geradeso, als würde er auf ein Ereignis warten, das niemals eintreten würde. Eine Rauchschwade bewegte sich an seiner Nase vorbei und animierte ihn, sich selber einen Glimmstängel in den leicht geöffneten Mund zu stecken. Das geräuschvolle Aufflammen des Schwefels seines Streichholzes und das anschliessende in sich Zusammenziehen der Flamme, betrachtete Salvatore mit der Inbrunst eines Pyromanen. Das intakte Auge verfolgte den Weg der Flamme vom Anzünder bis zu seinen Fingern. Kurz bevor er diejenigen verbrannte, führte er das brennende Holz zum Tabak, entzündete ihn und löschte den abgebrannten Rest mit wedelnder Hand.
Der Gemüsehändler blätterte in rascher Folge in dem Journal und seufzte dabei gleichzeitig. Er tat damit seinen Unmut kund, dass Salvatore ihm den Rauch direkt unter die Nase blies, was er als Belästigung empfand und nicht ohne bösartig klingende Beschwerde über sich ergehen liess. Der dicke Wirt trat an den Tisch, scheuerte mit einem schmutzigen Tuch über die Tischplatte, verhedderte sich im weissen Aschenbecher, auf dem in roten Lettern Cinzano stand und störte damit abermals Pipo bei seiner intensiven Lektüre, was einen weiteren, unschön anzuhörenden Ausruf zur Folge hatte.
Salvatores Wunsch nach einem Glas Rotwein ging im allgemein geführten Disput, mit verbalen Attacken auf die jeweiligen Unzulänglichkeiten, zwischen Wirt und Gemüsehändler unter, so dass sich der Wirt anschliessend ziemlich barsch bei Salvatore nach dem Gewünschten erkundigte. Salvatore bestellte noch einmal seinen Rotwein, was den Wirt zu der Bemerkung veranlasste, warum er das nicht gleich gesagt hätte. Eine Anmerkung, die er sich am besten verkniffen hätte, denn die Bestellung liess sehr lange auf sich warten, da er beim Gehen watschelte und den Weg zu der Theke dazu missbrauchte, mit jedem seiner Gäste einen kleinen Schwatz abzuhalten. Salvatore wurde das Gefühl nicht los, dass der Kneipier die Arbeit nur sehr ungern verrichtete, unter Zwang seines unförmigen Körpers dazu verurteilt war, die einzig mögliche Tätigkeit zu verrichten, die den Bewegungsablauf der tragenden Körperteile auf ein Minimum reduzierte und nur sein loses Mundwerk favorisierte, was ihm allerdings sehr entgegen kam. Er war das personifizierte, das alleinig seligmachende Lästermaul im ganzen Städtchen. Ausgenommen Donna Luisa, die ihm ohne Mühe Paroli bieten konnte, aber es nicht tat. Aus dem einzigen Umstand heraus, dass sie das Lokal sowieso niemals betreten würde, auch nicht am jüngsten Tag, wie sie meinte und es somit nie zu einer Konfrontation zwischen den beiden kommen konnte. Was, wenn es eines Tages doch passieren würde? Diese Angelegenheit würde als denkwürdiger Tag in die Annalen des Städtchens eingehen und mit Bestimmtheit von der Bevölkerung in den Status eines Feiertages erhoben.
Geliebt wurden sie von niemandem, geschätzt oder bewundert vielleicht, ob ihrem unerschöpflichen Vokabular. Dieser böse, unübertreffliche, von vielen als beleidigend und ehrverletzend eingestufte Wortschatz, der nie und zu keinem Zeitpunkt, zu versiegen drohte. Von einigen gehasst und zum Teufel gewünscht, von den meisten aber als Neuigkeitenerzähler geliebt. Vom Pfarrer jeden Sonntag von der Kanzel herab als schlechtes Beispiel verurteilt, liess es sich, als eine Art heimische Prominenz, denn sie waren jeden Tag mindestens einmal in irgendeiner Diskussion vertreten, als Hexe oder Lästermaul doch ordentlich leben.
Mit einem Seufzer bedankte sich Salvatore beim Gastwirt, als dieser endlich das volle Glas vor ihn hinstellte, auf das er schon eine Ewigkeit wartete. Pipo schielte mit einem Auge aus der bunten Welt des Journals hoch, beäugte den rötlichen Schimmer des Weines und bemerkte feindselig:
„Womit kannst du dir mitten am Tag ein Glas Roten leisten?“ Salvatore liess sich auf keine Konfrontation mit Pipo ein, schon gar nicht dann, wenn er vor sich kein Glas mit irgendwelchem Inhalt stehen hatte. Das hätte geheissen, einen schlafenden Löwen zu wecken. Das ganze Nest wusste darüber Bescheid. Hatte Pipo am Tag zu wenig Gemüse verkauft, so spendierte er sich auch keinen Wein und war dann den Rest des Tages ungeniessbar, ja geradezu unausstehlich. Heute schien wieder so ein Tag zu sein. Gab es etwas rumzumäkeln, Pepino Cappoli fand es heraus und weidete sich am Ungeschick Anderer, zelebrierte den Akt wie ein Jäger auf dem Hochsitz und versetzte rochierend wie ein Schachspieler den Dolchstoss, bis das Wild weidwund am Boden lag. Dann liess Pepino von ihm ab und konzentrierte sich auf das nächste Opfer, das er mit derselben Methodik zur Strecke brachte. Anscheinend interessierte Pipo das Journal aber mehr als Salvatore und dessen Rotweinglas, denn er liess augenblicklich von ihm ab und beschäftigte sich wieder mit der Welt, die ausserhalb Siziliens stattfand. Eine bunte, schöne heile Welt, mit lachenden Menschen, mit Geld im Überfluss, mit Hochzeiten, Festen und Feiern, mit Musik und Wein, mit Frauen, so schön wie es sie nur in Italien gab, vor allem in Rom.
„Rom, das wäre es“, dachte Pipo laut vor sich hin. So laut, dass Salvatore beim Trinken innehielt und Pipo entgeistert anschaute.
„Hast du etwas gesagt?“, fragte er gereizt. Der Lärm im Lokal hatte an Intensität zugenommen, nachdem Carmine Levante einen seiner berühmten Kneipenwitze an den Mann gebracht hatte.
„Wie? Was? Wer redet schon mit dir?“, raunzte sein Gegenüber. Für Salvatore wurde es Zeit zu gehen, liess sich doch mit Pipo kein vernünftiges Gespräch führen und zu alledem noch dieser Carmine Levante, mit seinen alten, verblödeten Geschichten. Er drückte die Zigarette im Aschenbecher aus, leerte sein Glas, stand auf, verabschiedete sich von Pipo, der irgendetwas in seine Richtung knurrte und verliess das Lokal, nachdem er die abgezählten Münzen in einem Teller am Tresen hinterlegt hatte.
Eine Windböe fegte durch sein Haar, kalt und unwirklich, sodass er sich gezwungen sah, die Wollmütze aus ihrem Versteck in der Manteltasche zu holen und sie auf seinem Haupt zu platzieren. Die Gassen waren immer noch menschenleer. Kein Wunder bei dieser Kälte, was Salvatore nicht weiter störte, brauchte er somit auch keiner Unterhaltung aus dem Weg zu gehen.
Mit schiefem Gang, einer Windböe ausweichend, schritt er durch den Eingang in den Vorhof eines im Quaderbau erstellten Hauses, das beim Betrachter den Eindruck hinterliess, nur von den unzähligen, von Wohnung zu Wohnung gespannten Wäscheleinen zusammengehalten zu werden. Salvatore stieg drei Stockwerke hoch und hörte durch die Eingangstüre den Krach in seiner Wohnung. Seine Familie zankte sich wieder um irgendwelche Kleinigkeiten, deren Anlass, wie schon so oft, aus Nichtigkeiten bestand. Mit dem Ausruf:
„Was ist denn hier schon wieder los?“, platzte er in die Wohnung, gerade rechtzeitig, um die beiden Kampfhähne auseinanderzutreiben.
Die Wohnung der Grimaldis bestand aus fünf Zimmern, von denen eines die unverheiratete Tante Marcelina bewohnte. Ein Ärgernis, das Salvatore seit seiner Heirat mit Teresa, seiner Frau, mit sich herumschleppte. Zuerst hiess es, nur für ein paar Monate, daraus wurden Jahre und nun begleitete ihn seine Schwester das ganze Leben. Bei jedem Kind, das neu in die Familie geboren wurde, hatte Marcelina versprochen das Zimmer zu räumen – also drei Mal. Nichts war passiert. Auf die Anfrage, was es denn nun mit ihrer Prophezeiung auf sich habe, wurde seitens der Tante an die Fairness jedes Einzelnen appelliert und von den Mitgliedern der Familie ein weiteres Jahr mit der Fragestellung zugewartet. Alle Jahre, zum Fest der Madonna del Lume wurde intensiv in der Familie Grimaldi zu der Heiligen gebetet, mit dem Wunsch, dass die Tante friedlich entschlafen möge, damit das Zimmer endlich von den Kindern genutzt werden konnte. Obwohl Salvatore von seiner Mutter am Sterbebett das Versprechen abgerungen worden war, auf seine ältere Schwester aufzupassen, wurde sie ihm langsam unerträglich. Gelöbnis hin oder her, die Familie Grimaldi brauchte das Zimmer, basta!
Pietro, der Jüngste und Piana, die Mittlere seiner drei Kinder lagen sich in den Haaren, als ihr Vater durch die Türe trat und ordnungshalber eingriff. Mimmo, der Älteste, arbeitete als Automechaniker in einer kleinen Autowerkstatt, trug dadurch jeden Monat seinen Teil zur Aufbesserung der Haushaltskasse bei, während Piana der Frau vom Bäcker Ceralfo beim Aufräumen der Backstube half. Das Nesthäkchen Pietro ging noch zur Schule.
Teresa kam aus dem Zimmer von Marcelina gestürzt und überraschte Salvatore mit der Nachricht über deren Tod. Darum das Gezanke der Kinder. Es ging um die Hegemonie, das freie Zimmer als Erster zu besetzen. Salvatore nahm die Nachricht emotionslos entgegen und dankte der Madonna, dass die Gebete endlich erhört worden waren. Er stellte sich unter den Türrahmen, starrte in ein dunkles Zimmer, auf die Schwester, die aufgebahrt im Bett lag, um sie herum alte Betfrauen, die leise murmelnd, zwischendurch laut aufheulend, Litaneien herunterleierten. Salvatore trat ans Bett, sah Marcelinas Gesicht, das mit geschlossenen Lidern auf ein mit venezianischen Spitzen verziertem Kissen gebettet war, suchte ihre Hand unter der Decke, fand sie und begann innerlich zu fluchen. Die Hand war weich und warm und wurde bei der Berührung augenblicklich zurückgezogen.
Er ging aus dem Raum in die Küche, stellte Teresa zur Rede, indem er ihr Vorwürfe darüber machte, dass sie immer wieder auf dieselben alten Tricks seiner Schwester hereinfallen würde. Marcelina spielte Theater.
„Nächstes Mal“, sagte Salvatore bestimmt, „…nächstes Mal, holst du zuerst Dottore Cantano und lässt den Tod feststellen, bevor du mit der Zeremonie beginnst!“
„Ach, diese Schande! Ich habe doch schon den Pfarrer bestellt!“, jammerte Teresa und beeilte sich, die Frauen um das Sterbebett über den neuen Sachverhalt aufzuklären.
Pietro wurde dazu auserkoren, dem Pfarrer entgegenzulaufen, um ihm die freudige Mitteilung der Auferstehung von Tante Marcelina zu überbringen. Die alten Frauen aus der Umgebung kamen murrend aus dem Zimmer und hielten in der Diele ihre, mit einem Rosenkranz umwickelten, Hände auf, darauf wartend, dass sich Salvatore grosszügig erweisen würde.
„Was wollt ihr? Meine Schwester ist nicht gestorben. Noch nicht!“, unterstrich Salvatore seine Worte. „Kommt ein anderes Mal.“ Damit waren sie entlassen und stiegen, mit bösem Dialog an Salvatore gerichtet, laut schimpfend die Treppen hinunter.
Mimmo Grimaldi stand in der Versenkung, über ihm der Boden eines Autos und hantierte mit dem Werkzeug, als er vor seinem Blickfeld ein Paar zweifarbige Schuhe wahrnahm. Den Besitzer dieser Schuhe, der in feines Tuch gehüllt war, erkannte Mimmo aus der Tiefe seiner Grube.
„Was willst du?“, fragte er rau, ohne die Arbeit zu unterbrechen.
„Das Angebot…“
„Nicht interessiert!“ Die Zange fiel genau vor die Füsse des Besuchers.
„Sollte dich aber interessieren, sogar sehr.“ Die Schuhe hatten sich in sichere Distanz zum Werkzeug zurückgezogen.
„Drohst du mir etwa?“ Mimmo konnte von schräg unten die riesige Sonnenbrille auf der Nase des Besuchers sehen.
„Drohen? Ich? Hast du schon jemals gehört, dass ich irgendwen bedroht habe? Ich unterbreite doch nur Angebote. Die Entscheidung, sie anzunehmen, oder zu lassen, steht jedem Einzelnen frei. So auch dir.“ Ein brennendes Streichholz fiel in die Grube, Mimmo setzte seinen Schuh darauf.
„Würdest du besser aufpassen, bevor du deinen Anzünder beseitigst? Hier hat es überall entflammbare Materialien!“
„Darauf wäre ich nie gekommen. Entschuldige! Aber da siehst du wieder, wie schnell ein Unfall geschehen und die schöne Werkstatt in Flammen aufgehen kann. Übrigens, deine Freundin, wie heisst sie doch gleich…?“ Von Mimmo kam keine Antwort. „Auch egal. Ich habe sie vor zwei Tagen unten am Meer angetroffen. Sie ging spazieren. Für meine Begriffe etwas zu nah an der Kaimauer. Du musst sie darauf aufmerksam machen, dass dies viel zu gefährlich ist… was könnte da alles passieren.“ Er polierte die Fingernägel am Revers seines Jacketts.