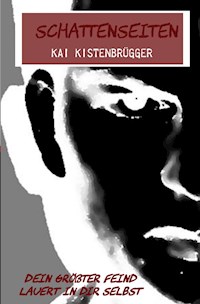
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein Unbekannter ermordet systematisch Straftäter, die für ihr Verbrechen vor Gericht freigesprochen worden sind. In ihren Ermittlungen stolpern die Kommissare Erik Bachmann und Robert Bukowski auf Hinweise, dass in diesen Fällen Bestechungsgelder geflossen sind. Sowohl Richter, als auch Rechtsanwälte scheinen die Hand aufgehalten zu haben. Der Mörder scheint als "Stiller Rächer" die Urteile zu sprechen, von denen sich die Angeklagten freigekauft haben. Doch bevor sie dem Mörder auf die Spur gekommen sind, nimmt der Fall eine schreckliche Wendung: Eriks Frau wird ermordet. Erik und Robert müssen sich die Frage stellen: Wer ist in diesem Spiel Jäger und wer ist Gejagter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kai Kistenbruegger
Schattenseiten
Dein größter Feind lauert in Dir selbst
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Über die Stunde Null
4 Stunden danach
21 Tage davor
77 Tage davor
12 Stunden danach
21 Tage davor
21 Tage davor
21 Tage davor
21 Tage davor
20 Tage davor
20 Tage davor
20 Tage davor
19 Tage davor
19 Tage davor
19 Tage davor
2 Tage danach
19 Tage davor
19 Tage davor
17 Tage davor
17 Tage davor
17 Tage davor
17 Tage davor
17 Tage davor
16 Tage davor
3 Tage danach
3 Tage danach
16 Tage davor
16 Tage davor
16 Tage davor
16 Tage davor
15 Tage davor
15 Tage davor
15 Tage davor
15 Tage davor
14 Tage davor
13 Tage davor
4 Tage danach
5 Tage danach
12 Tage davor
12 Tage davor
12 Tage davor
11 Tage davor
5 Tage danach
11 Tage davor
11 Tage davor
11 Tage davor
11Tage davor
11 Tage davor
8 Tage davor
7 Tage davor
7 Tage davor
7 Tage davor
6 Tage danach
2 Tage davor
8 Tage danach
1 Tag davor
8 Tage danach
8 Tage danach
30 Minuten davor
1 Stunde danach
8 Tage danach
12 Tage danach
Heute
Impressum neobooks
Über die Stunde Null
Meine Erinnerungen an die Nacht ihres Todes sind undeutlich und merkwürdig verzerrt, als wären die schrecklichen Ereignisse dieser Nacht lediglich ein Alptraum und Sandra in Wirklichkeit immer noch bei mir. Vielleicht ist es mein Verstand, der einen barmherzigen Schleier des Verdrängens vor diese entsetzlichen Bilder gezogen hat, um mir ihren Anblick im Todeskampf zu ersparen. Manchmal, in den seltenen Stunden, in denen ich versuche, mich an all die verstörenden Einzelheiten zu erinnern, bin ich froh über diese gnädige Geste meines Verstandes. Ich glaube, über kurz oder lang würden mich diese Bilder in den Wahnsinn treiben, würde ich sie tatsächlich immer noch in all der schmerzenden Klarheit sehen, wie in jener fernen Nacht ihres gewaltsamen Todes.
Auch wenn ich weiß, was in dieser Nacht tatsächlich passiert ist, ist es nicht allzu viel, an das ich mich wirklich erinnere.
Was sich mir jedoch in aller entsetzlichen Deutlichkeit ins Gedächtnis gebrannt hat, ist ihr markerschütternder Schrei, nur Sekunden vor ihrem Tod. Diesen Schrei kann ich immer noch in meinen Ohren klingen hören; ich habe ihn seit diesem schicksalhaften Tag nicht vergessen, und ich werde ihn auch nie vergessen. Dieser Laut hat sich in meinen Gehirnwindungen festgesaugt, unbarmherzig und blutrünstig wie eine Zecke, und verfolgt mich seither in meinen Träumen, anklagend, wie eine alte Schallplatte, die immer das gleiche Lied spielt.
Obwohl ihr Gesicht inzwischen langsam hinter dem Vorhang der Zeit verblasst, bohrt sich diese letzte Erinnerung an sie quälend in meine Träume und manchmal sogar in meine wachen Momente. Vielleicht wäre ihr Tod vermeidbar gewesen, hätte ich den Verlauf der schrecklichen Dinge vorhergesehen, die meine Frau aus dem Leben rissen und mich mit dieser schmerzenden Lücke in meinem Dasein alleine zurückließen. Aber ich habe die dunklen Gewitterwolken am Horizont meines Lebens nicht kommen sehen. Mit ihrem Tod starb ein Teil von mir selbst; und nichts danach sollte wieder so sein, wie es vorher war.
4 Stunden danach
Nur langsam drang das grelle Licht in mein Bewusstsein. Auch meine Ohren nahmen nur zögerlich ihre Arbeit wieder auf, als müssten sie das Hören erst wieder neu erlernen. Die Stimmen verschiedener Menschen drangen in meine sensiblen Gehörgänge, doch sie waren nicht mehr als sinnlose und zusammenhangslose Wortfetzen. Sie wirkten unerträglich laut, als würde eine Horde betrunkener Motorradfahrer direkt neben meinem Kopf eine wilde Party feiern. Ich stöhnte unterdrückt, unfähig, mich anders zu artikulieren. Mein Körper wurde von Kopf bis Fuß von betäubenden Schmerzen durchflutet und reagierte nur unwillig auf meinen vorsichtigen Versuch, meine gefühllosen Gliedmaßen zu bewegen. Mein Gehirn wirkte wie in Watte gepackt, kaum in der Lage, die undeutlichen Signale meiner betäubten Sinne zu verarbeiten.
Was ist hier los? Wo bin ich?
„Er ist noch am Leben!“, verkündete eine dumpfe Stimme irgendwo über mir und zog mit einer ruckartigen Bewegung die blendende Taschenlampe aus meinem Blickfeld. Ich kannte die Stimme nicht; sie vibrierte in einem unnatürlichen Klang, als würde ich der schlechten Vertonung eines uralten Filmes lauschen.
„Herr Bachmann, können Sie mich verstehen?“, fragte eine weitere Stimme fordernd, die ich ebenfalls keiner bekannten Person zuordnen konnte. „Herr Bachmann, hören Sie mich?“
„Ja“, murmelte ich schwach. Meine Zunge fühlte sich an, als hätte ich die letzte Nacht in einem wilden Rausch verbracht. Sie lag schwer und trocken in meinem Mund und machte es schwierig, klar artikulierte Worte über meine spröden Lippen zu bringen. Nur langsam nahmen die schwebenden Silhouetten über mir Konturen an, wie das sanfte Licht des beginnenden Tages nur gemächlich die Schatten der Nacht vertreibt.
Zwei Männer standen über mir. Sie trugen die roten Jacken des Rettungsdienstes, die in meinen vielen Berufsjahren so etwas wie ein ständiger Begleiter geworden waren. Ihre Anwesenheit bedeutete selten etwas Gutes. In den meisten Fällen zogen sie unverrichteter Weise von dannen und überließen die frisch Verstorbenen uns, um ihren unnatürlichen Tod aufzuklären und den Verursacher hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Nur langsam nahm ich auch Einzelheiten meiner Umgebung wahr. Ich lag auf dem Boden. In unserem Wohnzimmer. Der weiche Teppich schmiegte sich sanft an meinen Rücken und kitzelte meinen Nacken.
Als hätte die sanfte Berührung ein Fach in den unzähligen Schubladen meines Verstandes geöffnet, stürzten die Bilder der letzten Nacht ohne Vorwarnung auf mich ein und raubten mir für eine kurze Zeit den Atem. Ich stöhnte auf, aber nicht wegen der körperlichen Schmerzen, die sich meines Körpers bemächtigt hatten und ihn ihrer Tyrannei unterwarfen, sondern wegen des psychischen Horrors der Erinnerungen, die mich zwangen, die erschreckenden Stunden der Nacht wieder vor meinem inneren Auge erleben zu müssen. Die Bilder waren zwar verschwommen, konnten aber trotzdem nicht verbergen, was ich am liebsten verdrängt hätte.
„Sandra!“, schrie ich schwach. Den Protest meines Körpers ignorierend, versuchte ich, mich aufzurichten.
„Bitte bleiben Sie liegen“, befahl einer der Männer und packte mich am Arm. „Wir wissen nicht, ob Sie Verletzungen davongetragen haben.“
Er versuchte, mich sanft in die weiche Umarmung des Teppichs zu drücken.
„Nein!“, protestierte ich, während langsam wieder Gefühl in meine Arme und Beine kroch. „Ich will zu meiner Frau! Wo ist meine Frau?“
Ich schüttelte die helfende Hand unwirsch ab. „Lassen Sie mich!“, schrie ich. Ich versuchte, mich gegen den gutmütigen Druck der beiden Sanitäter durchzusetzen, aber eine sanfte Berührung an meiner Schulter ließ mich innehalten. Ich blickte auf und starrte in das Gesicht meines Vorgesetzten. „Bitte, Erik, bleiben Sie liegen“, brummte Walter Steinmann beruhigend, doch in dieser Situation hätte mich lediglich eine hohe Dosis Valium dazu bewegen können, liegen zu bleiben.
Walter Steinmann war der Leitende Kriminaldirektor, der Chef der Kriminalpolizei im Düsseldorfer Raum. Er hatte die Leitung in unserem Fall übernommen.
Er sah aus, als hätte er in einem aussichtlosen Kampf eine vernichtende Niederlage erlitten. Den Mund hinter dem grauen Schnurrbart hielt er zu einem dünnen Strich zusammengepresst; seine Augen blickten aus tiefen, müden Höhlen traurig unter den buschigen Augenbrauen hervor. In all meinen Jahren bei der Kriminalpolizei war er mir nie in einer derart desaströsen Verfassung gegenübergetreten. Von der Härte und Durchsetzungskraft, die ansonsten seine steinerne Miene dominierten, war nichts mehr zu sehen. Dabei war seine stoische Ruhe und Gelassenheit, selbst bei schwierigen Einsätzen, so etwas wie sein Markenzeichen geworden, und hatte ihm den wenig schmeichelhaften Spitznamen ‚Arnold’ eingebracht, in Anlehnung an den gefühlskalten Roboter, den Arnold Schwarzenegger in dem Film Terminator spielte. Doch in diesem Moment verriet eine tiefe Sorgenfalte auf seiner Stirn, dass er dieses Mal nicht in der Lage gewesen war, eine professionelle Distanz zu bewahren. Er fühlte sich persönlich betroffen; das war in seinen Augen so offensichtlich abzulesen wie der Mörder in einem billigen Groschenroman.
Ich kannte bereits die erschreckende Antwort auf die Frage, die sich unaufhaltsam in meinen Verstand drängte; aber ich fragte trotzdem, auch auf die Gefahr hin, durch seine dunkle Stimme die Bilder meiner Erinnerungen bestätigt zu sehen.
„Wo ist Sandra?“
Walter Steinmann blieb mir eine Antwort schuldig. Trotzdem ließen seine nächsten Worte keinen Zweifel daran, was mit meiner Frau passiert war. „Er hat sie erwischt“, murmelte er mit einem leicht angedeuteten Kopfschütteln, das die ganze Tragödie meines Lebens in einer simplen Geste zusammenfasste.
Ich stolperte auf meine Beine. Dieses Mal hielt mich niemand mehr auf. Steinmann drückte die beiden Sanitäter mit seinem Arm sanft zurück und ließ mich gewähren.
Nur ein paar Meter neben mir hatte sich eine kleine Traube von Sanitätern und Polizisten versammelt, die langsam zurückwichen, als ich näher torkelte.
In ihrer Mitte lag Sandra, ihr Körper in einer unnatürlichen Pose verdreht, die schmerzlich die Qualen ihrer letzten Minuten veranschaulichte und ihre frühere Schönheit hinter der schrecklichen Maske des Todes verbarg.
Ich sank neben ihr auf die Knie, während die Tränen in Strömen meine Wangen hinabliefen. Ich fing an zu schreien und hörte erst auf, als mich starke Arme von der Leiche meiner Frau wegzogen.
21 Tage davor
Mit einem sonoren Sirren kämpften die Scheibenwischer gegen den fortdauernden Strom von Regen an. Bereits seit drei Tagen regnete es unablässig wie aus Kübeln, und inzwischen kroch die Feuchtigkeit durch alle Ritzen und Fugen in die Häuser und Herzen der Menschen. An den Straßenrändern strömte das Wasser in reißenden Bächen in die Kanalisation und erweckt unwillkürlich den Eindruck, Düsseldorf wäre nicht auf festem Grund, sondern wie Venedig auf einem ständig schwankenden Untergrund aus Wasser erbaut. Selbst in dem wohlig temperierten Innenraum der Limousine, mit einem stetigen Zustrom warmer Luft im Gesicht, drang die klamme Kälte von draußen bis tief unter meine Haut. Die Scheiben waren beschlagen, so dass außerhalb des Wagens kaum etwas zu erkennen war. Selbst die Klimaanlage kapitulierte vor der Aufgabe, der Luft ihre überschüssige Feuchtigkeit abzutrotzen.
„So ein Scheißwetter!“, fluchte Bobby neben mir und schmierte mit seinem Jackenärmel ein winziges Guckloch in die Windschutzscheibe. „Seit meinem letzten Urlaub am Meer habe ich nicht mehr so viel Wasser auf einmal gesehen!”
Ich kannte Robert Bukowski, Bobby, bereits seit Jahren, seit unserer gemeinsamen Zeit auf der Polizeischule. Er war seit inzwischen beinahe vierzehn Jahren mein Kollege bei der Kriminalpolizei, oder vielmehr noch: Er war mein Freund. Seitdem wir beide zum Kriminaloberkommissar befördert worden waren, war unsere Freundschaft sogar noch enger geworden. Rückblickend betrachtet, schmerzt sein Tod am meisten. Sandra zu verlieren, war eine Tragödie; sie war mein Leben, mein Ein und Alles. Und trotzdem, mit Roberts Tod verlor ich endgültig alles, was mir von meinem alten Leben noch geblieben war. Wäre ich in der Lage, die Zeit zurückzudrehen, würde ich ohne zu zögern zu jenem trüben Novembertag zurückspringen, um die verhängnisvolle Kette an Ereignissen zu unterbrechen und das Leben meiner Frau und meines Freundes retten. Aber leider saß ich ahnungslos im Auto neben Bobby und ahnte nicht im Geringsten, welche Grausamkeiten mein Schicksal für mich bereithalten sollte.
Ich erinnere mich an all die kleinen Details, als wäre es erst gestern passiert. Der Geruch im Wagen; es roch penetrant nach alten Zigaretten, obwohl keiner von uns beiden rauchte. Das beige Sakko, das Bobby bevorzugt trug, war von dem kurzen Weg bis zum Auto durchnässt und schimmerte in einem dunklen Braunton. Im Radio lief irgendein Song, eine Eintagsfliege, deren Urheber längst von einer schnelllebigen Popkultur aus dem selektiven Gedächtnis der Radiosender gestrichen worden war. Seit jenem Tag habe ich das Lied nie wieder bewusst im Radio gehört, doch die nichtssagende Melodie dudelt immer noch in meinem Kopf, wenn ich an diesen Moment zurückdenke.
Bobby starrte mit finsterem Blick mürrisch auf die Straße und versuchte angespannt, unter der Wasserlache vor ihm den Asphalt ausfindig zu machen.
„Wir sollten anfangen, die verdammte Arche Noah zu bauen, um unsere Ärsche in trockene Gefilde zu verfrachten“, fluchte er, die Hände fest um das Lenkrad gekrallt.
Er ignorierte die nächste rote Ampel und schlängelte den BMW an ein paar parkenden Autos vorbei.
Ich lachte. „Im Gegensatz zur Arche Noah hat dieses Fahrzeug aber Bremsen, Bobby!”
Bobby warf mir einen warnenden Blick zu. „Da bin ich mir nicht sicher“, murrte er. „Im Moment schwimmt das Auto eher, als dass es fährt.“
„Dann pass wenigstens auf, dass du uns nicht direkt über den Jordan beförderst. Ich schwitze hier Blut und Wasser neben dir, bei Deiner wilden Fahrweise!“
Bobby grunzte. „ Jordan? Wasser, was? Hast du noch mehr kluge Witze auf Lager? Wenn ja, dann solltest du sie besser loswerden, solange ich vollends damit beschäftigt bin, diesen Kübel auf der Straße zu halten.”
Die nächste Ampel sprang auf rot und fluchend bremste er den Wagen ab. Der Wagen bockte ein bisschen, als das ABS steuernd eingriff, trotzdem ließ sich die schwere Limousine wie gefordert um die Kurve lenken. Das blinkende, mobile Blaulicht auf dem Dach erhellte für einen kurzen Augenblick den erschreckten Gesichtsausdruck einer Passantin.
„Ich hätte noch ein paar davon“, griente ich. „Aber zum Glück weiß ich, was gut für mich ist.“ Ich wechselte das Thema. „Was ist überhaupt mit dir los?“, rätselte ich. „Du bist doch sonst nicht so einfach aus der Ruhe zu bringen. Und jetzt macht dir das bisschen Wasser bereits zu schaffen?“
Bobby nahm nur für einen kurzen Augenblick die Augen von der Straße und warf mir einen nichtssagenden Blick zu. „Ich weiß auch nicht“, murmelte er. „Mir schlägt dieser Fall auf den Magen. Und dann die Sache mit Marie…” Er verstummte, als würde er es nicht wagen, seinen letzten Gedanken weiterzudenken.
Er brauchte nicht mehr zu sagen. Marie hatte ihn vor etwa drei Monaten verlassen, nur wenige Monate vor ihrer Hochzeit. Die ganze Geschichte klang, als wäre sie aus der Feder eines mittelmäßigen Autors von Schundromanen entsprungen, aber in Bobbys Fall war sie leider traurige Realität. Niemand wusste, warum sie nach sieben Jahren aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war. Sie hatte weder Bobby, noch ihren gemeinsamen Freunden jemals eine Begründung geliefert. Sie war aus unser aller Leben getreten, ohne einen Blick zurückzuwerfen oder sich mit uns aufzuhalten. Keinen von uns hat sie danach wieder kontaktiert.
Bobby war zurückgeblieben, ein Häufchen Elend, nur noch ein Schatten seines früheren Selbst. Seine Seele war gebrochen, auch wenn er äußerlich nach wie vor von beeindruckender Statur war. Bobby war ein Bär von einem Mann, mit breiten, muskulösen Schultern, wildem ungebändigten Haaren und mit einem Gesichtsausdruck, der potenzielle Gewalttäter innerhalb weniger Sekunden zu lammfrommen Christen bekehren konnte.
Als Marie ihre Koffer gepackt und in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Haus gelaufen war, hatte er jedoch irgendwie seinen Halt in der Welt verloren. An jenem Tag, als er mich völlig verzweifelt anrief und nach einem offenen Ohr suchte, habe ich Bobby das erste Mal in meinem Leben weinen gehört.
Morgen war der Tag, an dem sie hatten heiraten wollen.
Ich legte Bobby hilflos meine Hand auf die Schulter und hoffte, dass es irgendwie tröstend wirkte. Wir waren zwar gute Freunde, vielleicht sogar die Besten, hatten es bisher aber immer vermieden, über Gefühle zu sprechen. Ein Klaps auf die Schulter und ein gemeinsames, schweigsames Bier waren selbst in dieser Krise immer das Höchste der Gefühle gewesen. Manchmal wünschte ich, es wäre anders gewesen, aber selbst ich fühlte mich im Angesicht der tiefen Trauer, die Bobby empfand, einfach überrannt und überfordert. Ich hoffte, ihn durch meine Freundschaft wenigstens ein bisschen von seinem Unglück ablenken zu können. „Tut mir leid“, erwiderte ich ungelenk. „Daran hatte ich nicht gedacht.“
„Ach, Pustekuchen!“ Er machte eine Wischbewegung mit der Hand, als wollte er nicht nur die trüben Gedanken, sondern auch gleichzeitig die grauen Regenwolken beiseite wischen. „Das ist Vergangenheit! Und wir haben im Moment andere Probleme.“
Sein Gesichtsausdruck strafte seine Worte Lügen. Trotzdem sprang ich auf seinen kläglichen Versuch, das Thema zu wechseln, an.
„Was weißt du bereits?“, fragte ich.
„Nicht viel“, überlegte er. „Steinmann hat über das Telefon nicht allzu viel verlauten lassen, aber offensichtlich handelt es sich bei unserem toten Drogendealer nicht um einen Einzelfall.“
‚Unser toter Drogendealer’, Bruno Bauer, war ein Mordfall, mit dem wir uns bereits seit über zwei Monaten herumschlugen. Der Fall war ein einziges Rätsel. Bis auf die Spuren der Polizisten und Ermittler am Tatort waren keine weiteren Fingerabdrücke oder verwertbare DNA Spuren aufzuspüren gewesen. Der einzige positive Aspekt an dem Fall war, dass er uns über die letzten Monate genügend beschäftigt hatte, um Bobby ein bisschen von Marie abzulenken.
„Wie kommt er darauf?“, fragte ich irritiert. „Wir haben doch keinerlei Hinweise auf den Täter, oder nicht?“
„Das nicht“, bestätigte Bobby ungerührt. „Doch heute haben sie eine weitere Leiche gefunden. Interessant daran: Der Mörder hat die gleiche Visitenkarte hinterlassen.“
„Oh“, entgegnete ich und verstummte. Keiner von uns beiden wollte das Wort ‚Serienmörder’ offen aussprechen, aber wir beide wussten, in welche Richtung dieser Fall zu kippen drohte.
„Wir sind da“, unterbrach Bobby meine Gedanken.
Vor uns lag eine ruhige Seitengasse, in der die eng aneinander stehenden Häuser gespenstisch durch die hektisch blinkenden Blaulichter der Einsatzfahrzeuge beleuchtet wurden. Einige Schaulustige hatten sich bereits an der Polizeiabsperrung eingefunden und versuchten ein paar neugierige Blicke auf die vielen Polizisten zu erhaschen. Aber die Kontrollpunkte waren klug gewählt und ließen keinerlei Schlüsse darauf zu, was in diesem ruhigen Stadtteil passiert sein mochte. Steinmann hatte das Gebiet weitläufig absperren und ein enormes Polizeiaufgebot auffahren lassen. Mir wurde etwas flau im Magen. Steinmann war ein sehr besonnener Mann. Er würde niemals mit einer so großen Aktion die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf einen Tatort lenken, es sei denn, er war an einer wirklich großen Sache dran.
Zu diesem Zeitpunkt sollte ich noch nicht wissen, wie Recht ich mit dieser Einschätzung haben sollte. Genauso wenig war mir bewusst, dass dieser Moment der erste Tag vom Ende meines behüteten und glücklichen Lebens sein sollte. Doch ich hatte bereits den ersten Schritt auf einem Weg getan, an dessen Ende meine Frau sterben sollte.
77 Tage davor
In meinem Leben hatte ich bereits viele Tatorte und damit einhergehend weitaus mehr Leichen gesehen, als einem einzelnen Menschen zugemutet werden sollte. Doch die Jahre im Polizeidienst hatten es mit sich gebracht, dass jede weitere Leiche mich etwas weniger aufwühlte, etwas weniger verfolgte, bis der Tod seinen Schrecken verloren hatte und auf erschreckende Art und Weise Normalität geworden war. Trotzdem wurde mir leicht übel, als ich den verwesenden Körper vor mir auf dem schmutzigen Teppich liegen sah.
Bruno Bauer war selbst zu Lebzeiten kein besonders hübscher Anblick gewesen, aber in seinem jetzigen Zustand trieb mir der strenge Geruch die Tränen in die Augen. Er starrte aus tiefen, eingefallenen Höhlen an die Decke, den Mund leicht geöffnet, als würde er lediglich schlafen. Seine weiße, wachsartige Haut fing bereits an, sich zu zersetzen. Einige Fliegenlarven krochen träge über die hügelige Kraterlandschaft seines verwesenden Körpers, dick gefressen, im fahlen Licht der Fenster fettig glänzend.
Neben ihm kniete bereits ein Mann, eingehüllt in einen der weißen Schutzanzüge, die zu Mord und Verbrechen gehörten wie das dumpfe Gefühl, die Grausamkeiten der Menschen kaum noch ertragen zu können. Ich erkannte die eingehüllte Gestalt erst auf den zweiten Blick: Gregor Großkopf. Er war der leitende Gerichtsmediziner im Gerichtsmedizinischen Institut in Düsseldorf, das in den meisten Mordfällen der vergangenen Jahre durch die Staatsanwaltschaft mit der Ermittlung der Todesart, des Todeszeitpunktes und der Todesursache betraut worden war. Insofern handelte es sich bei Großkopf um einen bekannten, aber nicht unbedingt gerne gesehenen Gast im trüben Grau meiner Alltagsarbeit. In seiner Nähe fühlte ich mich unwohl. Das war zum einen dem Umstand geschuldet, dass er eine merkwürdig unangemessene Unbekümmertheit zur Schau trug, obwohl sein Job der Tod war, zum anderen, weil wir uns bereits bei unserem ersten Kennenlernen auf dem falschen Fuß erwischt hatten. Die alleinige Schuld an diesem Fehlstart unserer beruflichen Beziehung war Großkopf anzulasten, ohne Zweifel. Ich hatte als noch junger Polizist gewagt, ihn als Pathologen zu bezeichnen, was in seinen Augen einer ungeheuerlichen Beleidigung gleichgekommen war. Pathologen, wie er mir mit spitzer Stimme erklärt hatte, führten Obduktionen bei natürlichen Todesursachen durch, während er sich im offiziellen Auftrag der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte der Aufklärung von Straftaten widmete.
Diese Lektion hatte ich unter „Aha, wieder etwas gelernt“ verbucht und Großkopf gleichzeitig gedanklich in die Schublade „Idiot“ verschoben. Seitdem fühlte ich mich besser, solange ein paar Meter Luftraum zwischen mir und dem Nicht-Pathologen lagen.
Ich hielt mir ein Taschentuch vor den Mund, um einen kurzen, tiefen Atemzug nehmen zu können, und drehte mich von der Leiche und von Großkopf weg. Ich stand inmitten eines Wohnzimmers, bei dem der Begriff ‚wohnen’ selbst mit viel Großzügigkeit noch übertrieben war. Der ganze Raum wurde unter Bergen von Bierdosen, Bierflaschen und alten Pizzakartons geradezu erstickt. Lediglich auf dem Sofa deutete eine müllfreie Stelle auf den Platz hin, an dem Bruno wahrscheinlich abends vor dem Fernseher seinen täglichen Rausch ausgeschlafen hatte. Zumindest, bis er zum Opfer seines Mörders geworden war.
Es war eine Ironie des Schicksals, dass Bruno inmitten seines eigenen Mülls umgebracht worden war. Im Grunde war Bruno genau das, was umgangssprachlich als ‚Abschaum der Gesellschaft’ bezeichnet wurde. Seine Strafkartei glich einem Sammelsurium unterschiedlichster Delikte quer durch das Strafgesetzbuch: Hehlerei, Betrug, Körperverletzung, Drogenhandel, um nur ein paar zu nennen.
Erst vor knapp vier Wochen war er wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels verhaftet, aber kurz darauf wegen eines Formfehlers und mit Hilfe eines windigen Anwalts wieder auf freien Fuß gesetzt worden, trotz überwältigender Beweislast. Nach wie vor war es mir ein Rätsel, wie ein schmieriger Typ wie Bruno Bauer sich einen derart teuren Anwalt hatte leisten können. Doch wie sich die neue Faktenlage darstellte, hatte auch das ihm nichts genutzt. Offensichtlich hatte er sich nicht lange an seiner neu gewonnenen Freiheit erfreuen können.
„Wie lange liegt er hier schon?“, fragte ich näselnd, das Taschentuch immer noch dicht über meinen Mund gepresst. Großkopf, der immer noch prüfend über dem Leichnam kniete, schaute auf und zuckte mit den Schultern. „Schwer zu sagen. Ein paar Wochen. Genauer eingrenzen kann ich den Todeszeitpunkt erst nach der Obduktion.“
Ich seufzte auf und wendete mich dem jungen Polizisten zu, der mit bleichem Gesicht eng an die Wand gedrückt stand und die Szenerie mit angeekeltem Blick musterte. Ihm war die zweifelhafte Ehre zugefallen, den Toten zu entdecken. Nur ungern zog ich das Taschentuch vom Mund, um mit ihm sprechen zu können. Ich achtete darauf, durch den Mund zu atmen, um möglichst wenig des beißenden Gestanks an meine armen Geruchsrezeptoren zu lassen.
„Wer hat den Toten gemeldet?“, fragte ich, sorgsam darauf bedacht, selbst meine Haltung zu bewahren und dem jungen Mann nicht mein Mittagessen vor die Füße zu spucken. Das hätte mit Sicherheit kein gutes Licht auf meine Führungsqualitäten geworfen.
„Die Nachbarin über dieser Wohnung. Ihr ist der stechende Geruch im Hausflur aufgefallen.“
„Wurde sie bereits befragt?“
„Ja. Sie ist arbeitslos und ist deswegen nach eigenen Angaben die meiste Zeit in ihrer Wohnung. Trotzdem gibt sie an, nichts Verdächtiges gesehen oder gehört zu haben.“
„Nicht überraschend“, murmelte ich, leise genug, damit der junge Polizist meine Bemerkung nicht hören konnte. Diese Aussage verwunderte mich nicht. In einer Wohngegend wie dieser waren Polizisten nicht gerne gesehen. Die Gegend war ein Tummelplatz gescheiterter Existenzen, die zwar regelmäßig ihr Geld vom Staat bezogen, ansonsten aber jegliche Form staatlicher Autorität ablehnten und verachteten. Es war nicht zu erwarten, dass wir auch nur einen brauchbaren Hinweis von den liebreizenden Nachbarn unseres Toten erhalten würden. Und trotzdem würde es mir und den Kollegen nicht erspart bleiben, an jeder Tür persönlich zu klingeln und jeden einzelnen der Anwohner zu befragen. Polizeiarbeit war überwiegend Fleiß- und Beinarbeit, gepaart mit der Hoffnung auf das seltene Glück, den richtigen Hinweis zur richtigen Zeit geliefert zu bekommen.
Eine Hand auf meiner Schulter riss mich aus den Gedanken und ließ mich herumfahren. Großkopf! Etwas pikiert stellte ich fest, dass der Gerichtsmediziner immer noch seine blauen Handschuhe trug, mit denen er den Leichnam begutachtet hatte, und sich erst jetzt mit einer bedächtigen Bewegung des Latex entledigte. Sofort kehrte die Übelkeit zurück. Mein Jackett würde ich auf jeden Fall heute Abend noch in die Reinigung bringen müssen. Verbrennen war wahrscheinlich die bessere Idee. Gedanklich schüttelte ich mich und überlegte bereits, wie ich mich unauffällig meiner Anzugsjacke entledigen konnte, während ich versuchte, mit professioneller Miene den Ausführungen des Nicht-Pathologen zu folgen.
„Das Opfer wurde übel zugerichtet“, stellte er mit unbeteiligter Stimme fest. „Zahlreiche Hämatome am Kopf, am Oberkörper und an den Beinen deuten darauf hin, dass er vor seinem Tod brutal zusammengeschlagen wurde.“
„Vor seinem Tod? Was war die Todesursache?“
„Ohne Obduktion ist das schwer zu sagen. Keine der äußeren Verletzungen scheint mir schwerwiegend genug zu sein, um den Tod herbeizuführen. Allerdings scheint sein Martyrium mehrere Stunden gedauert zu haben. Wen auch immer er verärgert hat, der Täter hat sich viel Zeit genommen, seine Wut an dem Opfer auszulassen.“
Er zupfte mit spitzen Fingern an seiner Brille. Vielleicht hoffte er, durch diese Geste professionell oder intelligent zu wirken, allerdings verlieh sie ihm eher eine unbeholfene Note. Der Gerichtsmediziner war nicht mehr sonderlich jung, doch jeder Altersweisheit zum Trotz passte er durch seine schlaksige Art und durch seinen dürren, ausgemergelten Körper optisch nicht ganz in das stereotype Bild eines gebildeten wie belesenen Mediziners.
„Eine Sache ist mir allerdings noch aufgefallen“, ergänzte er, mit einem kurzen Blick auf die Leiche. „Unter dem Toten habe ich das hier gefunden.“
Er hielt eine Einwegspritze in die Höhe. „Er hat mit Sicherheit nicht regelmäßig Drogen oder andere Substanzen konsumiert. Ich habe nur eine Einstichstelle in seinem linken Arm gefunden, die allerdings von allerhand Hämatomen umgeben ist. Anhand der Verteilung würde ich vermuten, dass jemand Fremdes diese Spritze mit viel Kraft in den Arm gestoßen hat.“
„Also wurde er vergiftet?“
„Das werden die Blutuntersuchungen zeigen, aber ja, ich würde darauf wetten, dass der Tod durch die Spritze herbeigeführt wurde.“
„Interessant“, murmelte ich gedankenverloren, während meine Haut an der Stelle, an der mich der Gerichtsmediziner berührt hatte, anfing zu jucken. Das Jucken steigerte sich mit der Zeit zu einem kaum zu ignorierenden Schmerz. „Was war in der Spritze?“
Großkopf zuckte erneut mit seinen Schultern. „Heroin, würde ich vermuten. Das wird allerdings das Ergebnis der toxikologischen Untersuchungen zeigen.“
„Heroin“, murmelte ich. „Bauer war selbst Dealer, vielleicht ein verärgerter Kunde?“, überlegte ich laut.
„Der Kerl dürfte bei seinem Strafregister eine Feindesliste haben, die länger als das Düsseldorfer Telefonbuch ist“, warf Bobby brummelnd hinter mir ein. „Da kommen viele in Frage.“ Ich drehte mich halb zu ihm um. Er war nach mir am Tatort eingetroffen und hatte bisher noch kein Wort mit mir gewechselt. Er kam gerade aus der kleinen Küche des Apartments gestiefelt und wirkte etwas bleich um die Nase, aber das war bei dem Geruch in der kleinen Wohnung kein Wunder. „Die Küche ist ein einziger Dreckstall. Die Spurensicherung wird eine Heidenarbeit haben, den ganzen Abfall auszuwerten.“
Die Spurensicherung war bereits abgezogen. Besonders glücklich hatten die Kollegen angesichts dieser Herkulesaufgabe nicht ausgesehen.
„Nicht nur die Küche“, antwortete ich, als mich erneut eine Hand an meinem Arm herumfahren ließ. Im letzten Moment sah ich, wie Großkopf seine Hand zurückzog. Entsetzt starrte ich auf den weichen Stoff meines Jacketts.
Was war nur los mit dem Kerl!? Konnte er seine Finger nicht bei sich lassen!?
„Mir ist noch etwa aufgefallen“, bemerkte er mit seiner ruhigen Stimme, ohne auf meinen kaum verhohlenen Ekel zu reagieren. „Es ist mir erst ins Auge gestochen, als ich das Hemd des Toten beiseite geschoben habe. Ich denke, es ist besser, ich zeige es Ihnen persönlich.”
Er kniete sich neben Bruno Bauer, beziehungsweise vor das, was die Insektenmaden von ihm übriggelassen hatten, und zog vorsichtig, mit der Spitze seines Bleistifts im Knopfloch, das Hemd beiseite. Ein Teil einer eingefallenen, haarigen Männerbrust erschien mit einem ekelerregenden Schmatzen unter dem Stoff.
„Was zum Teufel?“, fluchte Bobby hinter mir. „Hält sich der Kerl für Zorro!?”
Er hatte nicht ganz Unrecht. Doch statt eines ‚Z’ als Markenzeichen, wie Zorro es in allen Filmen verwendet hatte, zeigte die freigelegte Brust ein tief eingeritztes ‚R’ aus schwarzem, geronnenem Blut.
12 Stunden danach
Mein Kopf dröhnte, als hätte ich Stunden eines außer Kontrolle geratenen Saufgelages hinter mir, aber das war auch nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt. Ich musste mich stark konzentrieren, um den Ausführungen des jungen Arztes folgen zu können, der vor wenigen Sekunden das Zimmer betreten hatte. Nach einem kurzen Studium meiner Krankenakte, die er seinem Gesichtsausdruck zufolge das erste Mal vor Augen hatte, teilte er mir in gehobenen Medizinerchinesisch mit, ich hätte nicht mit bleibenden Schäden zu rechnen. Zumindest, soweit es meine körperlichen Funktionen betraf. Mit routinierter Stimme und nur marginalem Interesse leierte er meine Wehwehchen herunter, während sein Zeigefinger der Liste auf dem Klemmbrett mit stoischer Ruhe folgte. Ich fragte mich, wozu er sich überhaupt die Mühe machte. Er hätte uns beiden diesen mühevollen Moment ersparen können, indem er mir die verdammte Liste einfach zum Lesen gereicht und sich auf dem Weg zum nächsten Patienten gemacht hätte.
Ich hätte keine schwerwiegende äußere Verletzung, murmelte er leise in endloser Monotonie, sowie keine Organschäden oder Frakturen. In meinem Blut fanden sich allerdings größere Mengen eines verschreibungspflichtigen Hypnotikums, was meine Ohnmacht und meine Schwindelanfälle erklärten.
Das waren allerdings keine Neuigkeiten für mich.
Er nickte mir jovial zu, steckte sich das Klemmbrett unter den Arm und empfahl sich mit einem kurzen Gruß. Als die Tür sich mit einem leisen Klicken schloss, kehrten die Einsamkeit und die Stille ins Zimmer zurück.
Wahrscheinlich hatte er mich bereits mit dem Schließen der Tür aus seinem Kurzzeitgedächtnis gestrichen. Von seinem medizinischen Standpunkt aus gesehen war ich vermutlich keine weitere Minute seiner kostbaren Zeit wert. Ich wies keine Verletzungen auf, die sofortige ärztliche Behandlung erforderten, so dass er sich aus seiner Sicht dringenderen Fällen widmen konnte.
Was er übersah, war, dass es nicht meine körperlichen Beschwerden waren, die in unerträglicher Qual meine Brust zu zerreißen drohten. Es mag der Stress des Krankenhausalltags gewesen sein, zwischen Patienten, Operationen, Spritzen und Krankenakten, aber seine Gleichgültigkeit brannte wie Zunder in dem Feuer meiner Seelenqual. Er ließ mich alleine im Krankenzimmer zurück, dazu verdammt, einen einsamen, vergeblichen Kampf gegen die Dämonen der Erinnerung auszufechten.
Ich versuchte es mit Verleugnung, versuchte mir einzureden, dass nichts von dem passiert war, an das ich mich erinnerte, dass Sandra lediglich zum Einkaufen gefahren war, spazieren, oder in ihrem Yoga-Kurs. Aber es gelang mir nicht. Mein Realitätssinn stellte sich jeglichen Bemühungen entgegen, die grausame Wahrheit zum Wohle meines Seelenheils ignorieren oder verdrängen zu können. So sehr ich auch versuchte, mir vorzustellen, Sandra jede Minute im Türrahmen stehen zu sehen; mein Verstand beharrte unnachgiebig darauf, dass sie tot war und nie wieder zu mir zurückkehren würde.
Ich würde sie nie wiedersehen. Niemals. Nichts würde meine Fehler und mein Versagen ungeschehen machen. So sehr ich es mir auch wünschte, sie würde nicht plötzlich in der Tür zu meinem Krankenzimmer auftauchen. Nicht so wie vor fünf Jahren, als ich von einem flüchtigen Verdächtigen angeschossen worden war. Sie hatte für einen Moment zögernd in der Tür gestanden, mit einem schiefen Lächeln auf ihren weichen Zügen, das gleichzeitig Sorge wie Vorwurf ausgedrückt hatte. „Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst dich von Ärger fernhalten!“, hatte sie tadelnd gesagt, doch eine kleine Träne im Auge hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Sorge ihren Ärger überwogen hatte. Aber diesmal würde es nicht so ablaufen. Es war alles anders, denn diesmal war sie es, der etwas passiert war. Sie würde nicht kommen. Nie mehr.
Mein Leben war schlagartig zu einer unerträglichen Seelenpein verkommen, als hätte jemand in meinen Brustkorb gegriffen und brutal Teile meines Gefühlslebens herausgerissen. Es gab kein Zurück mehr; in meinen Ohren konnte ich immer noch Sandras letzten Schrei widerhallen hören; ein Schrei, den ich für den Rest meines Lebens zu hören verdammt war und der mir jede Illusion nahm, sie irgendwann wieder in den Armen halten zu können. Ich fing an zu weinen, hilflos, ein wehrloses Opfer meiner persönlichen Hölle.
Ich hörte erst auf, als mich ein verlegendes Hüsteln aufschreckte. Steinmann und Bobby standen in der Tür und musterten mich mit versteinerter Miene.
„Tut mir leid, Mann“, murmelte Bobby, als er sich vorsichtig ans Ende meines Bettes setzte. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ Er verstummte schlagartig und fuhr sich fahrig durch die Haare, wie immer, wenn er nervös war.
„Wie geht es Ihnen?“, erkundigte sich Steinmann mit einer merkwürdig flachen Stimme, die ihre Kraft wahrscheinlich irgendwo in meinem Wohnzimmer verloren hatte.
„Keine schwerwiegenden Verletzungen“, antwortete ich. Ich vermied Worte wie ‚Gut’, oder ‚Den Umständen entsprechend’. Sie wären alle gelogen gewesen und hätte nicht annäherungsweise das ausgedrückt, was ich empfand.
Steinmann räusperte sich. „Es tut mir leid.” Er bedachte mit diesen Worten nicht nur meinen Verlust, sondern entschuldigte sich gleichzeitig für das, was jetzt unweigerlich folgen musste. Ich wusste, wie es ablief. Ich war selbst zu lange Polizist, um so ein Gespräch nicht bereits mehrere tausend Male geführt zu haben. Zuerst wurde der Zeuge nach seinem Befinden gefragt, verständnisvoll genickt und das persönliche Beileid ausgesprochen. Schema F, direkt aus dem Polizeihandbuch. Anschließend musste lediglich eine geschickte Überleitung gewählt werden, die nachsichtig aber mit Nachdruck die Wichtigkeit der Informationen betonte, die der Zeuge tief unter seinem Trauma verbarg. Sie würden so etwas sagen wie „So schwer es Ihnen fällt, bitte versuchen Sie sich an die letzte Nacht zu erinnern. Jedes Detail könnte von Bedeutung sein“ und ich würde traurig nicken und ihrem Wunsch nachkommen.
Ich ersparte ihnen die Pein, dieses Drama mit ihrem Kollegen und Freund durchspielen zu müssen.
„Ich kann mich kaum an etwas erinnern“, kam ich ihnen zuvor. „Nur ihr Schrei ist mir in Erinnerung geblieben…“, mir brach die Stimme weg, bevor ich fortfahren konnte.
„Weißt du, ob er es war?“, fragte Bobby. Mir entgingen nicht die leisen Zweifel, die in seiner Stimme mitschwangen.
Ich schüttelte den Kopf und flüsterte: „Ich weiß gar nichts! Es könnte genauso gut einer von euch gewesen sein, ohne dass ich mich daran erinnern könnte…“ Ich atmete tief ein. „Es hat an der Tür geklingelt“, fuhr ich mit mühsam kontrollierter Stimme fort. „Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Die Tür wurde unerwartet heftig aufgestoßen und ich ging zu Boden. Bevor ich reagieren konnte, beugte sich ein Mann über mich, spritzte mir etwas in den Arm…” Ich rieb gedankenverloren meine Armbeuge. „Er trug eine Skimaske, oder eine ähnliche Kopfbedeckung. Und dann hörte ich nur noch Sandras Schreie. Ich wollte ihr helfen, aber ich konnte mich kaum bewegen.“ Ich verstummte. „Ich habe es versucht, aber es ging nicht“, ergänzte ich leise. Meine eigene Stimme klang fremd.
„Ketamin“, sagte Steinmann. „Er hat Ihnen Ketamin gespritzt. Ein Narkosemittel, das auch als Partydroge verwendet wird und dementsprechend auf dem Markt leicht zu besorgen sein dürfte. Er hat ihnen genug verabreicht, um Sie auszuschalten, aber zu wenig, um Sie sofort das Bewusstsein verlieren zu lassen.“
„Ach, was!“, giftete ich. Auf die gut gemeinten Erklärungen des alten Haudegens konnte ich verzichten. Seine sachlichen Worte hörten sich in meiner gereizten Gemütslage wie der reinste Hohn an. Ich konnte es nicht verhindern, dass die Tränen zurückkehrten.
„Mein Gott. Ich habe zuhören müssen, wir Sandra starb! Dieser Mistkerl hat meine Frau vor meinen eigenen Augen umgebracht!“
Ich schluckte meine Wut und Tränen herunter. „Moment!“, murmelte ich und starrte Bobby an. Verlegen wich er meinem Blick aus. „Wieso kommt ihr auf die Idee, dass ‚Er’ es war? Hat er, ich meine, er hat doch nicht?“, stotterte ich und ließ das Ende unausgesprochen.
„Doch“, bestätigte Steinmann und nickte. Er sah in diesem Moment zu Tode betrübt aus. „Ein ‚R’, wie bei den anderen Opfern.“
„Ich weiß nicht“, brauste Bobby unerwartet auf. „Das ergibt überhaupt keinen Sinn! Die anderen Opfer waren alle Kriminelle! Sandra passt überhaupt nicht in das Opferschema!“
„Vielleicht sind wir ihm zu dicht auf den Fersen“, mutmaßte Steinmann. „Vielleicht will er uns eine Warnung zukommen lassen.” Er trat näher ans Bett und ergriff meine Hand. „Was immer seine Gründe auch sind, ich verspreche Ihnen, Erik, hoch und heilig; wir werden diesen Bastard zur Strecke bringen!“
21 Tage davor
Steinmann erwartete uns bereits im Flur des heruntergekommenen Mehrfamilienhauses. Vor der Haustür hatte er zwei Polizisten platziert, für den unwahrscheinlichen Fall, dass einige findige Journalisten einen Weg durch die zahlreichen Polizeisperren fanden und sich in Dinge einmischten, die Steinmann so lange wie möglich von der Öffentlichkeit fernhalten wollte. Sie nickten unverbindlich, als wir forschen Schrittes an ihnen vorbei in den dunklen, kühlen Flur schritten. Sie kamen mir vage bekannt vor, wahrscheinlich von der letzten Weihnachtsfeier unseres Reviers, allerdings konnte ich keine konkrete Erinnerung mit ihnen verbinden.
Noch bevor mein Blick auf Steinmann fiel, schlug mir der ranzige Geruch nach altem Fett und Schimmel entgegen. Die penetranten Schwaden aus dem nahe gelegenen Chinaimbiss vermischten sich mit dem uralten Mief der vergangenen fünfzig Jahre zu einer luftraubenden Herausforderung für unsere Nasen. Das Treppenhaus zeigte symptomatisch für die ganze Wohngegend die typischen Anzeichen stetigen Zerfalls, der sich seit Jahrzehnten ungestört ausbreitete und über die Jahre eine ehemals aufstrebende Wohnsiedlung zu einem Düsseldorfer Problemviertel hatte verkommen lassen.
„Wir stecken tief in der Scheiße“, brummelte Steinmann zur Begrüßung. Er hielt seine Hände tief in seinen Anzugtaschen vergraben und machte keine Anstalten, sie für einen Händedruck herauszuholen. „Eine Mordserie mitten in Düsseldorf.” Er schüttelte ungläubig den Kopf. „Wenn wir nicht bald mit ein paar brauchbaren Hinweisen aufwarten können, wird uns die Staatsanwaltschaft die Hölle heißmachen.“
„Der gleiche Täter wie bei Bruno Bauer?“, fragte ich.
„Sieht so aus. Entweder ein Einzeltäter oder eine Gruppe. Beides wäre übel. Düsseldorf als Schauplatz eines Bandenkrieges wäre der Super-GAU.“
Er blickte die Treppe hinauf. Von oben waren undeutlich die Stimmen mehrerer Männer zu hören. Wahrscheinlich die Spurensicherung, die Millimeter für Millimeter den Tatort absuchte. Geduld war die wichtigste Eigenschaft, die zu ihrem Beruf gehörte. Ich beneidete sie nicht darum.
Durch die mittlerweile zahlreichen, modernen Krimiserien war ihre Arbeit nicht einfacher geworden. Gerade amerikanische Fernsehserien vermittelten gerne den trügerischen Eindruck, jeder Mordfall wäre im Grunde nichts anderes als die Suche nach ein paar Faserspuren oder Blutstropfen, die mit Hilfe absonderlicher Wunderapparaturen sofort den gesuchten Verdächtigen mit Namen, Anschrift und Vorstrafenregister ausspuckten. Leider war die Polizeiarbeit im normalen Leben nicht so einfach. Selbst wenn sich Spuren des Täters finden ließen, führten sie nur in den seltensten Fällen zu einer Verhaftung. Dafür waren zu wenige Menschen genetisch erfasst oder die Spuren reichten für eine eindeutige Identifizierung nicht aus. Manchmal beneidete ich die Fernsehfahnder um ihre heile Welt der schnellen Fälle, die am Ende jeder Folge zweifelsfrei den Täter dingfest machen konnten. In der Realität blieben leider viel zu viele Verbrechen ungesühnt.
Bevor wir die baufällige Treppe zum Tatort erklimmen konnten, hielt mich Steinmann am Arm zurück. „Die Presse darf nichts davon erfahren, bevor wir nicht ein paar Fahndungserfolge vorweisen können“, stellte Steinmann das Offensichtliche fest. „Haben wir uns verstanden?“
Wir bestätigten unisono murmelnd unsere Zustimmung. Solche Ansprachen kannten wir von Steinmann bereits. Im Grunde war Steinmann Politiker, der auf dem schmalen Grad zwischen Polizei- und Öffentlichkeitsarbeit wandelte. Er hatte mit dem bemitleidenswerten Los zu kämpfen, die zahlreichen Interessensgruppen aus Politik, Justiz und Presse gleichzeitig zufriedenstellen zu müssen, ohne die aktuellen Ermittlungen durch ein ‚Zuviel‘ an Information zu gefährden. Gleichzeitig musste er gegenüber der Staatsanwaltschaft Rechenschaft über den Ermittlungsfortschritt ablegen, selbst, wenn es keinen gab. Auch um diese Aufgabe beneidete ich ihn nicht. Sein Leben war eine einzige Berg- und Talfahrt; der Stress ein ständiger Begleiter, gleichzeitig jedoch ein ein unangenehmer Mitreisender. So wie heute. Seine Haut wirkte aschfahl und er sah aus, als könnte er etwas Schlaf gut gebrauchen.
„Was wissen wir vom Opfer?“, warf Bobby fahrig ein. Unbewusst rieb er seinen Ellenbogen und starrte angespannt die Treppe hinauf.
„Tja“, brummte Steinmann. „Wieder ein alter Bekannter. Walter Merkmann.“
„Merkmann?“, fragte ich ungläubig. „Der Merkmann?“
Der Name brachte unangenehme Erinnerungen hoch. Vor etwa einem Jahr hatte Walter Merkmann in Düsseldorf traurige Berühmtheit erlangt. Sein Freispruch war über Wochen das vorherrschende Thema in der Presse gewesen. ‚Gericht spricht Kinderschänder frei’, hatte eine der großen Boulevardblätter getitelt. Doch der empörte Aufschrei in der Bevölkerung war nicht unberechtigt. Walter Merkmann war der Polizei aufgefallen, als er zufällig mit einem internationalen Kinderschänderring in Verbindung gebracht wurde, der nach langjähriger und mühevoller Ermittlungsarbeit zerschlagen werden konnte. Sichergestellte Schriftstücke deuteten darauf hin, dass Merkmann ein guter Kunde der Bande gewesen war. Der alte Fuchs, ein Kinderarzt im Ruhestand, hatte es jedoch ausgezeichnet verstanden, seine eigenen vier Wände sauber zu halten. Auf seinem Computer waren nur ein paar wenige, verschwommene Bilder zu finden gewesen, die dem Gericht auch mit der dubiosen Verbindung zu offiziell verurteilten Kinderschändern nicht für eine Verurteilung ausgereicht hatten. Auch die Anzeigen zweier Familien, die Merkmann sexueller Übergriffe gegenüber ihrer Kinder bezichtigten, waren kurz darauf aus unerfindlichen Gründen zurückgezogen worden. Es war dem Gericht nichts anderes übrig geblieben, als Merkmann aufgrund der dürftigen Beweislage freizusprechen.
Nach dem Urteil hatte Merkmann den Wohnsitz gewechselt und war in diese Gegend gezogen. Dieser Stadtteil konnte mit Fug und Recht als gesellschaftlicher Abstieg für einen wohlhabenden Rentner gewertet werden. Trotz gewaltiger Geldabgänge von seinen Konten konnte ihm jedoch nie zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass zwischen ihm und den anklagenden Familien Schmiergelder geflossen waren. Die Polizei war machtlos, doch auch der soziale Druck ebbte mit der Zeit ab. Nach ein paar Wochen hatte das mediale Interesse an Merkmann merklich nachgelassen und der Vorfall war im Grundrauschen der alltäglichen Berichtserstattung zur Randnotiz verkommen. Merkmann hatte sich danach aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er war nach diesen Ereignissen nicht wieder polizeilich in Erscheinung getreten, jedenfalls bis heute.
„Todesursache?“, hakte ich nach.
„Der Kerl ist anscheinend verblutet.“
„Und die Mordwaffe?“
„Ein Messer. Keine Fingerabdrücke.“
„Ein Messer!?“, mischte sich Bobby ein. „Das entspricht nicht unserem Täterprofil. Laut Obduktion ist Bruno Bauer gewaltsam eine Überdosis verabreicht worden. Erfahrungsgemäß ändert ein Serienmörder seinen Modus Operandi nicht. Das würde eher für mehrere Täter sprechen.“
Bobby hatte Recht. Die Erfahrung hat in den meisten Fällen gezeigt, dass ein Täter – gerade bei sexuell motivierten Morden - als Spielball seiner Triebe und seiner Phantasien immer einem gewissenhaften Ablauf folgt, der ihm den meisten Lustgewinn verspricht. Es ist absolut ungewöhnlich und selten bei einem Serientäter, dass er im Laufe seiner Taten seine Mordmethode wechselt. Im Grunde ist eher mit einer Verfeinerung seiner perfiden Gelüste zu rechnen.
„Dennoch sind wir sicher, dass es sich um den gleichen Täter handelt“, widersprach Steinmann. „Es ist nahezu ausgeschlossen, dass Bauer und Merkmann von unterschiedlichen Tätern umgebracht worden sind. Das ‚R’ spricht für sich. Wir können allenfalls von gemeinschaftlichen Morden ausgehen.“
Er nickte vehement, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Es war das Standardvorgehen der Polizei, eindeutige Merkmale eines Mordes, wie in diesen Fällen das ‚R’ als Visitenkarte des Mörders, gegenüber der Öffentlichkeit zu verschweigen. Auf diese Weise wird es vereinfacht, Morde des gesuchten Serientäters von Morden von Nachahmungstätern unterscheiden zu können. Es war im hohen Maße unwahrscheinlich, bei zwei voneinander unabhängigen Morden dieselben Spuren vorzufinden.
„Bei Bauer hat er sich viel Zeit gelassen. Der Obduktionsbericht hat eine Tortur von nahezu vier Stunden bestätigt“, warf ich ein. „Das ist ein Kernelement der Profilanalyse unseres Täters. Und diesmal soll er sich damit begnügt haben, Merkmann einfach abzustechen?“
„Das habe ich nicht gesagt. Er hat Merkmann ebenso gefoltert wie Bauer.“
Steinmann blickte sich misstrauisch um, ob jemand in Hörweite stand, und senkte seine Stimme zu einem Flüstern. „Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass es mindestens eine halbe bis eine Stunde gedauert hat, bevor Merkmann verblutet ist.“
„Eine Stunde?“, fragte ich. „Von was für Verletzungen sprechen wir denn?“
Steinmann schluckte merklich. „Merkmann wurde kastriert.“
21 Tage davor
Obwohl die Spurensicherung den Tatort bereits freigegeben hatte, blieb ich für einen kurzen Moment zögernd auf der Türschwelle stehen. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, was mich erwartete. Ich verspürte keinen Drang, auch noch das Bild Merkmanns zu meiner Bildersammlung menschlicher Grausamkeiten hinzuzufügen. Bereits jetzt hatte ich Probleme damit, die Schrecken des Tages ausblenden zu können, in der Dunkelheit der Nacht gefangen in einem sich ewig drehendem Gedankenkarussell der Schreckensbilder. Bilder, die endgültig waren, Bilder, die sich nicht mehr ändern ließen.
Allein beim Gedanken an Merkmanns unnatürlichen Tod verspürte ich ein unangenehmes Ziehen in meiner Leistengegend. Doch es gehörte zu meinem Job, mich mit den Abgründen der menschlichen Existenz auseinanderzusetzen. Mir waren schon viele Straftäter begegnet, die offenkundig in einem perfekten Lebensidyll lebten, während unter der bürgerlichen Fassade bereits der Wahnsinn gewütet hatte. Der menschliche Verstand ist nichts anderes als ein schmaler Grat in dem Kampf zwischen Gut und Böse; viele kommen vom rechten Pfad ab, getrieben durch alles verändernde Tragödien in ihrem Leben: Sei es der betrogene Ehemann, der gekündigte Arbeitnehmer, oder der unerwartete Verlust von geliebten Menschen. Niemand ist davor gefeit, urplötzlich vor dem Abgrund seiner Existenz zu stehen und sich zu Entscheidungen gezwungen zu fühlen, die man vorher niemals in Betracht gezogen hätte. Oftmals fand ich Trost in dem Gedanken, dass wir als Polizei Wächter vor dem weit offen stehenden Tor zur Anarchie waren, sozusagen die letzte Bastion der Vernunft. Die Ritter in der grünen Rüstung. Haha. Doch es sollte sich noch zeigen, dass auch Bobby und ich emotional ebenso instabil waren wie der Rest der Menschheit. Wie gesagt, es kann jeden treffen, das ist die bittere Lektion aus dieser Geschichte.
„Was ist los mit dir? Traust du dich nicht?“, fragte Bobby frotzelnd hinter mir. „Keine Eier in der Hose?“ Er lachte schräg über seinen eigenen Witz und klopfte mir von hinten auf die Schulter.
„Bitte!“, flehte ich und versuchte das zunehmend flaue Gefühl in meinem Magen zu ignorieren. „Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dir diese Art von Witzen verkneifen könntest.“
Bobby legte eine betroffene Miene auf. „Tut mir leid!“, versicherte er wenig glaubhaft. „Mir war nicht bewusst, dass du so hart an dieser Nuss zu knacken hast.” Er lachte erneut und drängte sich an mir vorbei in die Wohnung.
„Ich meine das ernst!“, beschwerte ich mich. „Sagt dir das Wort ‚Pietät’ etwas? Respekt vor den Toten?“
Schlagartig hörte Bobby auf zu lachen und drehte sich mit finsterer Miene zu mir um. „Respekt? Vor Merkmann?“, fragte er ungläubig. „Beim besten Willen kann ich kein Mitleid für dieses Monster aufbringen!“ Mit einem abfälligen Schnauben wandte er sich ab. „Dieser Kerl war ein Kinderschänder! Abschaum! Ich würde seinem Mörder einen Orden verleihen, wenn ich könnte.“
Ich war ehrlich überrascht über seinen Stimmungswandel. Normalerweise brachte ihn nichts so schnell aus der Ruhe. Aber was war schon normal, seit Marie ihn verlassen hatte?
„So war es auch nicht gemeint“, verteidigte ich mich halbherzig. „Es geht hier ums Prinzip! Ich würde es meinem ärgsten Feind nicht wünschen, die Eier abgeschnitten zu bekommen.“
„Ich weiß, dass du es nicht so meinst“, winkte Bobby ab. „Meine Nerven liegen im Moment ein bisschen blank. Sorry.“ Er sah aus wie ein begossener Pudel, als er so verloren in dem Flur zu Merkmanns Wohnzimmer stand.
„Wie wäre es, wenn wir uns heute Abend mal wieder ein Bier zusammen gönnen?“, schlug ich zur Versöhnung vor und boxte ihm spielerisch in den Arm. „Ein guter, zünftiger Männerabend! Etwas Ablenkung könnte dir bestimmt nicht schaden!“
„Ja, wäre cool“, murmelte Bobby. „Und du zahlst!“
Er erwiderte meinen Knuff mit einem kräftigen Schlag auf meinen Bizeps. Ich verkniff mir nur mühsam einen schmerzerfüllten Aufschrei und biss die Zähne zusammen.
„Und jetzt zu den unangenehmen Dingen!“, proklamierte er und folgte dem Flur ins große Wohnzimmer. Ich trottete leise fluchend hinterher und rieb meinen schmerzenden Oberarm.
Die Wohnung war nicht sehr groß und nur spärlich ausgestattet. Eine dreckige Küche, ein kleines Schlafzimmer und ein rustikales Wohnzimmer waren alles, was Merkmann dieser Welt hinterlassen hatte.
Die Spurensicherung war gerade dabei, ihre Ausrüstung zusammenzupacken.
Der Gerichtsmediziner, der sich mit prüfendem Blick über den Leichnam beugte, war derselbe, der mich schon bei Bruno Bauer ständig betatscht hatte. Großkopf. Schlagartig vergaß ich meinen schmerzenden Arm. Ich suchte hinter Bobbys schrankwandähnlichem Rücken Deckung vor den Händen des Mediziners und sondierte aus dieser relativen Sicherheit heraus den Tatort.
Merkmann hatte seit dem Kinderschänderskandal allzu offensichtlich an finanziellem Status eingebüßt. Seine Villa, die er damals bewohnt hatte, hatte über Wochen auf den Titelseiten der Zeitungen geprangt. Es war ein herrliches, herrschaftliches Haus aus der Jahrhundertwende gewesen, das mit Sicherheit auf dem Markt einige Milliönchen eingebracht hätte; zumindest, bevor bekannt wurde, dass der Vorbesitzer verdächtigt wurde, ein widerlicher Kinderschänder zu sein.
Dieses Drecksloch war der absolute Gegenentwurf zu dem Prunkbau, den Merkmann vorher bewohnt hatte. Die Tapeten hingen in Fetzen von den Wänden, die Luft roch muffig nach den Ausdünstungen von Generationen von Vormietern, und der Teppich war eine Komposition unterschiedlichster Grau- und Schwarztöne. Das wäre an sich nicht so schlimm gewesen, hätte ich nicht den starken Verdacht gehegt, der Teppich wäre irgendwann vor Jahrzehnten einmal weiß gewesen.
„Was wissen wir bereits?“, fragte ich, ohne mich hinter Bobby hervorzutrauen. Ich hatte es bisher vermieden, einen Blick auf das Opfer zu werfen, aber ich konnte es leider nicht vermeiden, dass meine Augen den riesigen Blutfleck auf dem Boden streiften, der in seiner Form verdächtig einem Rorschachtest ähnelte. Mir wurde leicht übel. Meine Verdauung setzte für einen kurzen Moment aus und überlegte angestrengt, welche Richtung mein Mittagessen einschlagen sollte. Zum Glück entschied sich mein Körper, es nicht wieder die Speiseröhre zurückzuschicken, sondern alles seinen natürlichen Weg gehen zu lassen.
Großkopf blickte träge auf und zeigte Merkmann demonstrativ zwischen die nackten Beine.
„Zwei glatte Schnitte“, stellte er emotionslos fest und deutete mit seinem Finger auf zwei große, verkrustete Wunden unterhalb von Merkmanns Geschlecht. Sein Gesicht war der Inbegriff der Professionalität. Offensichtlich war ich der einzige, der bei diesem Anblick unter Phantomschmerzen zu leiden hatte.
Merkmann lag mit ausgestreckten Armen und Beinen inmitten des Wohnzimmers. Hanfseile fixierten seine Extremitäten an der Couch und an ein paar Sesseln, die aussahen, als hätte Merkmann sie vom Verwertungshof seines Vertrauens bezogen. In seinem aufgequollenen Mund steckte ein Knäuel Socken, sorgsam mit doppelseitigem Klebeband fixiert. In dieser Position sah Merkmann aus wie der ‚Vitruvianische Mensch’ von Leonardo da Vinci, davon abgesehen, dass ihm zwei kleine Details im Vergleich zu der Anatomiestudie des großen Meisters fehlten.
„Die Tatwaffe wurde bereits von der Spurensicherung sichergestellt. Ein zweischneidiges Jagdmesser, mit langer Klinge. Es lag neben dem Opfer.“
Er musterte Merkmann unberührt. „Soweit ich es sagen kann, wurde das Opfer mehrere Stunden misshandelt.“ Er zeigte mit seinen mit Latexhandschuhen bewehrten Händen auf ein paar dunkle Flecken, die sich entlang der gesamten Leiche auf der bleichen Haut abzeichneten. „Diese Verletzungen sprechen eine klare Sprache.“
Er blickte zu uns auf und musterte uns durch seine dicken Gläser schief. „Um Ihre nächste Frage vorweg zu nehmen“, sagte er, „der Tod ist vor etwa 24 Stunden eingetreten. Es dürfte in etwa eine halbe bis eine Stunde gedauert haben, bis der Blutverlust zum Tode geführt hat. Allerdings vermute ich, dass er nicht die ganze Zeit bei Bewusstsein war. Die Schmerzen müssen atemberaubend gewesen sein.“
Mit einem Ächzen richtete sich Großkopf auf und stolzierte bedächtig zum Tisch, auf dem er seine Tasche abgestellt hatte. „Steinmann hat mir bereits zu verstehen gegeben, dass der Fall oberste Priorität hat“, verkündete er mit einem selbstgefälligen Grinsen. „Ich denke, ich werde Morgen Abend die Ergebnisse der Obduktion liefern können. Aber ich bezweifle, dass wir auf irgendwelche Überraschungen stoßen werden.“
Er hüstelte demonstrativ und raffte seine Sachen zusammen.
„Wenn die Herren mich jetzt entschuldigen würden, meine Frau wartet mit dem Abendessen auf mich.“
Im Türrahmen verharrte er für eine Sekunde. „Ich denke, Omelette wäre heute genau das Richtige.“ Er lachte kurz auf und verabschiedete sich mit einem überfreundlichen „Guten Abend, meine Herren!“
Bestürzt starrte ich ihm hinterher. Sollte das gerade ein Witz gewesen sein? „Der Kerl hat Humor“, bestätigte Bobby lachend meine Befürchtung.
Ich schüttelte entsetzt den Kopf. „Ich weiß nicht“, kommentierte ich pikiert. „Das war absolut nicht witzig! Es sollte Gerichtsmedizinern von Amtswegen verboten werden, Witze zu reißen. Das passt nicht zusammen, so wie…“, ich zögerte einen Moment auf der verzweifelten Suche nach einem passenden Vergleich, „…, Köln und Düsseldorf.“
Bobby grummelte etwas Unverständliches, etwas in Richtung „So viel Humor wie ein Stück trocken Brot“ und folgte dem Gerichtsmediziner in den Flur. „Ich schaue mich mal ein bisschen um“, verkündete er lautstark, als er das Zimmer bereits verlassen hatte, immer noch leise über den Witz des Nicht-Pathologen lachend.
Ich blieb unschlüssig im Wohnzimmer stehen und versuchte, mir den Leichnam nicht allzu genau bildlich einzuprägen. Für heute hatte ich genug Blut gesehen. So oder so, der Fall versprach, eine harte Nuss zu werden. Es gab im Haus keine Zeugen, die irgendetwas gesehen oder gehört haben wollten, das wussten wir bereits nach ersten Befragungen. Und das, obwohl einem Mann bei lebendigem Leib seine Kronjuwelen abgeschnitten worden waren. Ich bezweifelte, dass das lautlos vonstatten gegangen war, selbst bei dem überdimensionierten Knebel im Mund des Opfers.
Ich seufzte leise. Der Druck auf uns war bereits jetzt hoch; mit einem zusätzlichen Toten dürfte sich die Lage nicht vereinfachen. Doch leider konnte niemand von uns hexen und aus unserem Hut einfach ein paar auskunftswillige Zeugen oder Beweise zaubern. Es blieb uns in dieser Situation nichts anderes übrig, als die Ergebnisse der Spurensicherung abzuwarten. Auch unser Mörder würde irgendwann einen Fehler begehen, der uns letztendlich auf seine Spur bringen würde. Die Frage war nur, wie viele Morde würde er begehen, bis es so weit war?
Eine Hand an meiner Schulter riss mich aus meinen Gedanken. „Eine Sache habe ich noch vergessen“, sagte eine Stimme hinter mir. Großkopf! Ich zog mit einer panikartigen Bewegung meine Schulter unter seiner Hand hervor und drehte mich übellaunig um. War es denn wirklich so schwer für den Kerl, seine Hände bei sich zu lassen!? „Was denn?“, grummelte ich unfreundlich.
„Sie sollten den Wohnzimmerschrank genauer unter die Lupe nehmen“, erwiderte Großkopf, unbeeindruckt von meiner feindseligen Körperhaltung. „Wir haben etwas sehr interessantes entdeckt!“
Mit einem geheimnisvollen Nicken deutete er auf einen schlichten Wandschrank, der in der hinteren Ecke des Raumes in die alte Tapete eingelassen war.
Irritiert öffnete ich die abgenutzte Tür und schreckte sofort einen Schritt zurück. Ein unangenehmer Duft breitete sich im Zimmer aus. „Was zum …!“, fluchte ich und hielt mir die Hand vor dem Mund. „Was ist das?“
„Urin“, verkündete Großkopf stolz, als hätte er gerade den Nobelpreis gewonnen.
„Urin?“, fragte ich ungläubig. Ich kniete mich auf den Boden und untersuchte den Schrank. Großkopf hatte Recht. Der mit Teppich ausgelegte Schrankboden wurde durch einen großen, dunklen Fleck dominiert, von dem der stechende Geruch nach Ammoniak ausging. „Vom Opfer? Oder vom Täter?“, überlegte ich laut über meine Schulter.
„Schwer zu sagen. Wir haben eine Probe genommen. Aber wenn Sie meine persönliche Meinung wissen wollen, würde ich sagen: Nein, nicht vom Opfer. Die Kampfspuren lassen nicht darauf schließen, dass sich der Kampf bis zum Schrank ausgeweitet hat.“
Überrascht fuhr ich hoch und vergaß für einen Augenblick den strengen Geruch.
„Sie meinen also, …“, hakte ich vorsichtig nach.
„Ich meine, in diesem Schrank hat sich jemand versteckt.“
„Jemand, der sich nicht herausgetraut hat, um zur Toilette zu gehen“, ergänzte ich aufgeregt. „Vielleicht, weil es zu gefährlich war und es seine Anwesenheit verraten hätte.“
„Korrekt“, bestätigte Großkopf mit einem zufriedenen Lächeln. „Entweder, der Mörder hat unserem Opfer hier längere Zeit aufgelauert, was ich nicht für sonderlich wahrscheinlich halte, oder aber es gibt zumindest dieses Mal einen Zeugen für die Tat.“
21 Tage davor
Erschöpft lehnte ich mich gegen die Innenseite der Haustür, als ich mit einem erleichterten Seufzen die Welt hinter der Holzverkleidung meiner Tür zurückließ. Nach dem heutigen Tag sehnte ich mich nach stupider Fernsehunterhaltung und einem schönen Glas Bier. Ich hatte mich dagegen entschieden, dieses Bier mit Bobby zu trinken. Heute war mir nicht nach Unterhaltung zumute. Ich musste erst einmal die Bilder von Merkmanns unrühmlichen Dahinscheiden verarbeiten.
Ich streifte umständlich meine Schuhe ab, ohne mir die Mühe zu machen, mich zu bücken. Wir wohnten im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses, in einer kleinen, aber teuren Wohnung mit Blick auf den Rhein, der sich jedes Mal auszahlte, wenn ich mich auf dem Balkon weit über die Brüstung nach links lehnte, um mit zusammengekniffenen Augen und ein bisschen Phantasie die dunkle Oberfläche des Wassers zwischen den angrenzten Häusern sanft im Abendrot schimmern zu sehen. Bobby hatte bei seinem letzten Besuch in seiner typisch unverblümten Art vehement die Meinung vertreten, er könne nichts anderes sehen als Taubendreck und Mülltonnen, aber ich ließ mir den Ausblick nicht von ihm vermiesen. Der Blick auf das Wasser war mein Ausgleich für das Leben in der Stadt, das Sandra sich so sehnlich gewünscht hatte.
Da wir keine Kinder hatten, brauchten Sandra und ich nicht viel Platz. Wir hatten es uns in unserem kleinen Liebesnest gemütlich gemacht, als sicherer Hafen gegen die Außenwelt, die wir konsequent aus unserer Wohnung ausschlossen. In den vier Jahren, die wir mittlerweile in dem Gebäudekomplex wohnten, waren mir weder die Namen, noch die Gesichter unserer zahlreichen Nachbarn in Erinnerung geblieben. Sie ließen uns in Ruhe und wir ließen sie in Ruhe, in einer perfekten, friedlichen Koexistenz der Nichtbeachtung.
Sandra saß in unserem kleinen Wohnzimmer in der schmalen Ecke, die wir als unser Büro bezeichneten, und malträtierte die abgenutzte Tastatur ihres alten Notebooks. Sie war freie Journalistin und verdiente sich ihr Zubrot mit Gelegenheitsartikeln, die sie an die zahlreichen Fach- und Sensationsblätter der deutschen Medienlandschaft verkaufte. Manchmal war es sehr schwierig für sie, ihre Artikel überhaupt an die Zeitschriftenverlage bringen zu können. Ohne mein regelmäßiges Beamtengehalt hätten wir wahrscheinlich aus Düsseldorf wegziehen müssen, um die horrende Miete unserer Wohnung gegen eine günstigere Alternative irgendwo im Ruhrpott zu tauschen.
Ich beobachtete sie unauffällig aus dem Türrahmen heraus. Ich liebte sie für ihren unermüdlichen Eifer und ihren unerschütterlichen Glauben, irgendwann eine gefeierte Sensationsjournalistin zu werden. In ihrer eigenen Wahrnehmung war ihr gegenwärtiger, anhaltender Nichterfolg lediglich eine lange Durststrecke auf dem Weg zu Ruhm und Anerkennung.
Das warme Licht der Schreibtischlampe schimmerte golden in ihren braunen Haaren, während sie mit ihrer rechten Hand von Zeit zu Zeit inne hielt, um sich die störrische Locke hinter ihr rechtes Ohr zu klemmen, die sie so furchtbar störte. Ihr Blick schweifte ständig zwischen dem Computerbildschirm und einem dicken Wälzer neben ihr hin und her, während ihr Mund unermüdlich auf einem alten Kugelschreiber kaute, der von der permanenten Überbeanspruchung längst seine Fähigkeit eingebüßt hatte, Tinte aufs Papier zu bringen.
Ich schlich mich langsam näher und streifte mit meiner Hand ihre langen Haare beiseite, um zärtlich ihren Nacken zu küssen. Sie zuckte leicht zusammen und ließ ihren Stift fallen. „Hast du mich erschreckt!“, beschwerte sie sich und versuchte, mit ihren tiefblauen Augen möglichst finster in meine Richtung zu funkeln.
„Was machst du?“, fragte ich unverbindlich und umarmte sie von hinten, damit sie wenigstens für ein paar Minuten von ihrem Computer abließ. Nach dem heutigen Tag hätte ich etwas Nähe gut vertragen können, die nicht von den Grabschhänden unseres Gerichtsmediziners stammte. Ihre Haare verströmten einen sanften Geruch nach Kokosnuss.
Sandra schlängelte sich aus meiner Umarmung und drehte sich mit dem Bürostuhl zu mir um. „Ein neuer Artikel!“, brabbelte sie aufgeregt und setzte ihre Brille ab, die sie aus falsch verstandener Eitelkeit nur vor dem Bildschirm trug. Mir war es egal, in meinen Augen sah sie sowohl mit als auch ohne Brille absolut hinreißend aus. „Ich habe dir doch von dem Informanten erzählt, der sich letzte Woche bei mir gemeldet hat. Du weißt schon, der Mitarbeiter in der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft! Er hat mir heute eine E-Mail geschickt, um ein Treffen vorzuschlagen.“
„Ja und?“, brummelte ich und zog meine Stirn in Falten. Ich hatte die Diskussion mit ihr bereits mehrere tausend Male geführt und es inzwischen aufgegeben, mich weiter mit ihr zu streiten. Ich hatte meinen Standpunkt mehr als einmal deutlich gemacht, dass mir ihre Treffen mit fremden Männern Bauchschmerzen bereiten. Fast regelmäßig traf sie sich mit irgendwelchen dubiosen Gestalten, von denen sie nicht mehr als den Namen kannte, aber weder wusste, ob der Name stimmte, oder ob die Fremden tatsächlich lautere Absichten hegten. Ich hatte sie angefleht, mich zum Schutz mitzunehmen und ihr sogar angeboten, unauffällig im Wagen zurückzubleiben, aber sie war darauf nicht eingegangen. Sie konnte einen unglaublichen Sturkopf besitzen, wenn es um ihre Arbeit ging. Sie bezeichnete die Beziehung eines Journalisten zu seinen Informanten als ‚schmales Band des Vertrauens’, das durch jede unbedachte Geste ‚irreparablen Schaden’ erleiden konnte. Und sie war nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, immerhin war ein zünftiger Sensationsjournalist auf seine Quellen angewiesen. Was wiederum bedeutete, ich musste mit der Angst um sie leben lernen.
„Das ist die Sensation!” Sie lachte aufgeregt und wippte mit dem Bürostuhl vor und zurück. Sie zog das Wort ‚Sensation‘ endlos in die Länge. „Er hat nicht viel verraten, aber einiges angedeutet. Wenn das alles stimmt, dann ist das der Durchbruch für mich.”
Sie hob mit einem träumerischen Blick ihre beiden Hände und zeichnete einen Bogen in die Luft. „Ich sehe die Titelzeile schon vor mir: Korruptionsskandal in der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Von Sandra Bachmann.” Sie lachte überschwänglich.





























