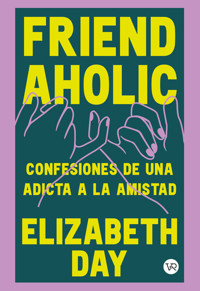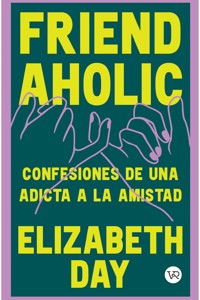7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jede Familie hat ihr Geheimnis. Und jedes Geheimnis kommt irgendwann ans Licht
„Seltsam, aber als man ihr eröffnete, dass ihr Ehemann mit dem Tod ringe, galt ihre erste Sorge nicht ihm, sondern dem Rindfleischeintopf.“ Es ist eine bestürzende Nachricht, die die Polizei den Redferns überbringt: Charles Redfern liegt nach einem Unfall im Koma. Ist es nur der Schock, der Anne so seltsam unbeteiligt reagieren lässt? Die Fassade bröckelt, und bald wird klar, dass der so charmante Charles ein zweites Gesicht hat: Ein Mann, der seine Frau verachtet – und die gemeinsame Tochter begehrt. Und ein Schicksalsschlag wird immer mehr zum Befreiungsschlag ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Elizabeth Day
Scherbenherz
Buch
»Seltsam, aber als man ihr eröffnete, dass ihr Ehemann mit dem Tod ringe, galt ihre erste Sorge nicht ihm, sondern dem Rindfleischeintopf.« Es ist eine bestürzende Nachricht, die die Polizei Anne Redfern überbringt: Ihr Mann Charles liegt nach einem Fahrradunfall im Koma. Doch statt sofort zu ihm in die Klinik zu fahren, widmet sich Anne weiter dem Abendessen, dann erst macht sie sich auf den Weg zum Krankenhaus. Ist es der Schock, der sie so seltsam unbeteiligt reagieren lässt?
Sobald Anne und ihre erwachsene Tochter Charlotte am Krankenbett aufeinandertreffen, bröckelt die Fassade, und schnell wird klar, dass der so charmante Charles ein zweites Gesicht hat: ein Mann, der seine Frau verachtet – und die gemeinsame Tochter begehrt. Wochenlang liegt der Schwerverletzte im Koma, eine Zeit, die die beiden Frauen verändert. Den Blick auf die Vergangenheit gerichtet, vertiefen sich zunächst die Konflikte. Doch Schritt für Schritt finden Mutter und Tochter wieder zueinander, weil sie sich nicht mehr fürchten müssen: weder vor Charles noch davor, seine Liebe und Anerkennung zu verlieren. Und so wird ein Schicksalsschlag mehr und mehr zum Befreiungsschlag.
Autor
Elizabeth Day schreibt als mehrfach ausgezeichnete Journalistin nach Stationen bei verschiedenen Medien heute für den Kulturteil des »Observer«. Sie ist in Nordirland aufgewachsen, hat in Cambridge Geschichte studiert und lebt in London.
Elizabeth Day
Scherbenherz
Roman
Aus dem Englischen
von Christine Frauendorf-Mössel
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel
»Scissors, Paper, Stone«
bei Bloomsbury Publishing, London.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung November 2011
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Elizabeth Day
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: plainpicture, Cornelia Hedinger
Redaktion: Martina Klüver
LT · Herstellung: Str.
Satz: IBV Satz- u. Datentechnik GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-06606-2
www.goldmann-verlag.de
Für Kamal
und meine Eltern,
die immer nur sie selbst gewesen sind:
Anne und Charles
Vorwort
Zuerst merkt er nicht, dass er blutet. Er kommt zu sich, wie benommen, gefühllos, ohne Orientierung. Es dauert Minuten, bis er die klebrige dunkelrote Flüssigkeit registriert. Er kann sich jedoch nicht erklären, woher sie kommt. Sie rinnt langsam, aber unaufhörlich an seiner Nase entlang und bildet eine kleine Lache neben seiner Fingerspitze. Sie riecht nach rohem Fleisch.
Seine Situation ist ihm unbegreiflich. Er scheint auf hartem grauem Stein zu liegen, sein Gesicht neben dem Metallgitter eines Gullydeckels. Seine linke Backe ist schmerzhaft gegen das Pflaster gepresst, und er kann ein Augenlid nicht öffnen. Das andere Auge ist verklebt und starrt wie durch einen Schleier auf einen schwarzen Kaugummi, der nur wenige Zentimeter neben seiner Nase plattgetreten auf dem Pflaster haftet.
Er rollt seinen Augapfel verzweifelt hin und her, um sein Blickfeld zu vergrößern. Aus dem Augenwinkel sieht er seinen Nasenrücken. Ein Arm liegt ausgestreckt unter seinem Kopf, unnatürlich verrenkt, als gehöre er nicht zu ihm. Er wundert sich kurz, wessen Arm es wohl sein mochte. Dann wird ihm mit einem Schlag bewusst, dass es sein Arm sein muss, und ihm wird übel.
Er kann sich nicht bewegen. Schmerzen hat er nicht. Nur jede Bewegung ist unmöglich. In seiner Mundhöhle kullert ein loser Gegenstand herum. Er tastet mit pelziger Zungenspitze darüber und stellt fest, dass es ein Zahn sein könnte.
Eine unbekannte Stimme, männlich und kehlig, sagt etwas. Nach einigen Sekunden erst machen die Worte Sinn.
»Alles in Ordnung, Kumpel. Bleib einfach ruhig liegen. Der Krankenwagen muss jede Minute da sein.«
In diesem Moment wird ihm klar, dass tatsächlich er zu bluten scheint. Eine Woge heißer, panischer Angst strömt durch seinen Körper. Er beginnt, aus einem Auge zu weinen. Lautlos tropfen die Tränen aus dem Augenwinkel, rollen über seine Nasenspitze auf das Pflaster, wo sie das Blut zu einer wässrigen Lache verdünnen. Er versucht zu sprechen, bringt jedoch keinen Ton heraus. Fragen beginnen Gestalt anzunehmen, überstürzen sich und werden schließlich konkret.
Was geschieht hier?
Wo bin ich?
Was mache ich da?
Er hat das Gefühl zu fallen, jeden Moment vornüber in endlose Tiefen zu stürzen. Müdigkeit droht ihn zu überwältigen, sein Augenlid beginnt herunterzuklappen und begrenzt damit sein Sichtfeld noch weiter. In dem schmalen Sehschlitz, der ihm verbleibt, erfasst er die abgerundete Kappe eines Lederstiefels. Es ist ein Schnürstiefel aus abgewetztem Leder mit dicker Gummisohle. Er kommt näher und tritt in die rote Farbfläche, die sich plötzlich weiter auf dem Pflaster ausgebreitet zu haben scheint. Als sich der Stiefel wieder entfernt, hinterlässt er Abdrücke auf dem Pflaster, eine gestochen filigrane Spur aus feuchtem Blut.
Er schnappt Fetzen eines Gesprächs auf, das sich über seinem Kopf abspielt.
»Richtig. Hat ihn von seinem Rad katapultiert! Das arme Schwein.«
»Sieht schlimm aus! Hatte er einen Helm auf?«
»Kann ich mir nicht vorstellen. Der Fahrer hat nicht mal gehalten.«
»Wo bleibt der Rettungswagen?«
»Ist unterwegs.«
Sein Augenlied klappt unweigerlich herunter, und er kann nichts dagegen tun, auch wenn er weiß, dass er wach bleiben, seine fünf Sinne zusammenhalten muss. Bald umfängt ihn wabernde Dunkelheit, die tintenschwarz gegen seine Schädelknochen brandet. Er hört die Sirenen und, kurz bevor er es sich gestattet, ins Nichts abzutauchen, hat er ein verblüffend klares Bild seiner Tochter vor sich. Sie ist zwölf Jahre alt, liegt mit Grippe im Bett, er hat ihr Toast mit Butter zubereitet, und sie ist so fiebrig und heiß, dass sie die Bettdecke zurückgeschlagen hat.
Als Letztes, bevor ihm die Sinne schwinden, sieht er die vollkommene Rundung ihrer Kniescheibe unter ihrer blassen Haut und ist vollkommen durchdrungen von Liebe.
Seltsam, aber als man ihr eröffnete, dass ihr Ehemann mit dem Tod ringe, galt ihre erste Sorge nicht ihm, sondern dem Rindfleischeintopf. Sie war mitten in der Vorbereitung des Abendessens gewesen, als es an der Tür klingelte, hatte Petersilienstängel abgezupft und im Schrank blind nach einer unauffindbaren Packung Lorbeerblätter gekramt. Sie ging in der Küchenschürze zur Tür, die Hände an der Sicherheitskette noch feucht. Ein undefinierbares grünes Blatt klebte an der Manschette ihrer geblümten Bluse. Sie war versucht, es fortzuschnippen, als ihr Blick auf die beiden uniformierten Polizisten auf dem Treppenabsatz fiel.
Sie waren zu zweit – ein hellhäutiger Mann und eine hübsche Asiatin, Schulter an Schulter unter dem Vordach –, wie aus einem Werbespot für gelungene Rassenintegration im Polizeidienst. Anne wappnete sich instinktiv gegen eine Offerte von Hochglanzbroschüren und Schlüsselanhängern als Gegenleistung für eine Spende, bis sie merkte, dass keiner der beiden Fremden lächelte.
»Mrs. Redfern?«, begann der Mann, und die silbernen Zahlen auf seinen Epauletten glitzerten im vormittäglichen Licht.
»Ja, bitte?«
»Es geht um Ihren Mann.« Er hatte rosa Hängebacken, kleine Knopfaugen und einen irgendwie liebenswürdigen Zug um den Mund. Er wirkte wie jemand, der eigentlich an der frischen Luft Trockensteinmauern baut und dicke Schinkenbrote isst. Anne bekam Mitleid mit ihm angesichts der Mühe, mit der er sich artikulierte. Es entstand eine kurze Pause. Offensichtlich erwartete er, dass Anne etwas darauf sagte.
»Ja und?«
»Tut mir leid, aber es ist etwas Schlimmes passiert.«
Anne fühlte, wie eisige Kälte in ihre Knochen kroch, blieb jedoch kerzengerade und reglos in der Türöffnung stehen. Der Polizist quittierte ihre Selbstdisziplin mit Erleichterung. Die hübsche Asiatin streckte die Hand nach ihrem Arm aus. Anne spürte die Berührung, und obwohl ihr körperliche Nähe dieser Art normalerweise zuwider war, empfand sie diese sofort als seltsam tröstlich.
Der Mann redete auf sie ein, berichtete, dass Charles auf dem Fahrrad angefahren und ins Krankenhaus gebracht worden und noch immer bewusstlos sei: Er lebte – sozusagen gerade noch.
Gerade noch. Sie ertappte sich bei dem Gedanken, wie seltsam es doch war, dass zwei karge Worte so bedeutungsschwer sein konnten.
Dann redete die Polizistin von den Vorzügen einer stärkenden Tasse Tee, davon, dass man sie ins Krankenhaus bringen würde, und ob es jemand gebe, den sie anrufen könne. Und Anne merkte, dass sie nicht an Charles oder seinen Zustand dachte oder wie besorgt sie hätte sein müssen, sondern sie hatte stattdessen das geradezu unsinnig klare Bild von vier ungeschälten Karotten vor Augen, die sie zum Abtropfen in einem Sieb im Spülbecken zurückgelassen hatte.
Sie entgegnete den Polizisten, dass sie mit ihrem eigenen Auto ins Krankenhaus fahren werde.
»Sind Sie sicher?«, erkundigte sich der Beamte mit sorgenvoll über der Nasenwurzel zusammengezogenen Augenbrauen.
Sie nickte und lächelte mit Nachdruck.
»Ist es nicht besser, wir kommen kurz rein und leisten Ihnen ein wenig Gesellschaft?«, fragte die Polizistin, und ihr Blick glitt über Annes Schulter hinweg in die Diele.
»Nein, wirklich nicht nötig. Mit mir ist alles in Ordnung«, entgegnete Anne bestimmt. »Vielen Dank«, und damit schloss sie die Tür, bevor die beiden noch etwas sagen konnten. Der Rindfleischeintopf. Sie musste sich wieder um den Rindfleischeintopf kümmern.
Auf dem Weg zurück in die Küche kam sie an dem hässlichen hölzernen Hutständer am Fuß des Treppenaufganges vorbei. Charles hatte ihn eines Abends vor etlichen Jahren kommentarlos dort deponiert. Auf ihre Frage, wo er her sei, hatte er kühl geantwortet, ein Kollege habe ihn loswerden wollen. Der Ton seiner Stimme hatte jeden Protest im Keim erstickt.
Anne sah in diesem Hutständer einen ausgemacht nutzlosen, überflüssigen Gegenstand. Trotzdem hatte er einen permanenten Platz in der Diele erhalten, wo er gleich einem krummwüchsigen Baum bizarre Schattenrisse auf die Fußbodenfliesen warf, die Äste knorrig und deformiert wie rheumageschädigte Gliedmaßen.
Sie hatte sich mittlerweile so an ihn gewöhnt, dass sie ihn normalerweise keines Blickes würdigte. Diesmal jedoch fiel ihr auf, dass Charles’ Fahrradhelm noch an einem der unteren Haken hing. Sie zuckte zusammen. Mit einem Mal tauchte ungebeten vor ihrem inneren Auge das Bild eines blutüberströmten, wie eine überreife Frucht verformten menschlichen Schädels auf. Sie drängte den Gedanken weit in den Hintergrund ihres Bewusstseins und kehrte zum Schneidebrett mit dem Gemüse zurück.
Zwanzig Minuten lang schälte Anne Karotten und würfelte Kartoffeln und schnitt das marmorierte rote Rindfleisch in grobe Stücke, das sich weich und kühl auf ihrer Haut anfühlte. Als sie die Plastiktüte beiseiteschob, in die der Metzger das Fleisch gepackt hatte, hinterließ diese eine Tropfspur wässrigen Blutes in den Rillen der Ablagefläche des Spültischs. Anne erschauderte und wischte alles hastig mit einem Lappen auf.
Sie gab sämtliche Zutaten in einen großen Topf, indem sie das Schneidebrett am Griff packte, es schrägstellte und das Gemüse mit dem Messerrücken in die simmernde Brühe schob. Sie ließ alles zusammen aufkochen, nahm dann ihre Schürze ab und ging in den ersten Stock, bürstete ihr Haar und strich es ordentlich hinter die Ohren zurück. Sie knöpfte ihre geblümte Bluse auf, legte sie ab und zog einen locker sitzenden und frisch nach Weichspüler duftenden Pullover mit V-Ausschnitt an.
Anne war sich klar, dass sie sich eigentümlich benahm, und fragte sich flüchtig, ob es der Schock sei. Aber Anne war nicht geschockt. Sie fühlte sich – ja, wie eigentlich? Sie fühlte sich wie in einem Kokon, fern jeder Wirklichkeit. Ihr war etwas bange, und sie hatte das unterschwellige Gefühl, dass die Dinge nicht so waren, wie sie sein sollten. Sie waren eher hyperreal denn unwirklich, so als könne sie bei einem Gegenstand plötzlich jeden einzelnen Farbpixel sehen. Es war wie die feinen Nadelstiche, die man in den Fingerspitzen bekam, sobald man die kalten Hände an die Heizung hielt und einem klar wurde, dass man lebte.
Der Duft des Rindfleischeintopfes zog in Schwaden von der Küche herauf, dampfig und erdig. Anne ging langsam wieder hinunter, setzte mit Bedacht einen Fuß vor den anderen. Sie war sich bewusst, dass jede ihrer Handlungen jetzt große Sorgfalt erforderte, denn was auch immer sie im Krankenhaus erwartete, sie musste irgendwie damit umgehen, und sie wollte den kleinen Rest Normalität, der ihr blieb, so lange wie möglich auskosten. Das Hier und Jetzt: Raum und Zeit vor der Gewissheit dessen, was geschehen war. Noch hatte sie keine Vorstellung davon, was von ihr erwartet wurde oder wie schwer Charles verletzt war.
Sie war sich noch nicht im Klaren darüber, wie betroffen sie war. Aber angesichts der Summe ihrer gemeinsamen Jahre schien sie der Gedanke an seinen Tod nicht übermäßig zu beunruhigen. Erst als sie sich eine flüchtige Vorstellung von dem Leben ohne ihn gestattete, wurde ihr doch ein wenig schwindelig.
Solange sie nicht dort war, musste sie ihm auch nicht gegenübertreten.
Also bereitete sie den Rindfleischtopf weiter zu. Erst danach wollte sie in den Wagen steigen und zum Krankenhaus fahren. Und erst von da an würde sich ihr Leben irgendwie verändern – inwieweit konnte sie sich noch nicht vorzustellen.
Aber noch war es nicht so weit.
Der Eintopf in der Kasserolle blubberte, und der Deckel klapperte sanft im Takt.
Auf dem Display ihres Handys blinkt der Name ihrer Mutter auf.
»Mum?«
»Kannst du reden?«
»Ja.«
Sie weiß sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein muss.
»Es ist wegen Charles … Ich meine, wegen Dad. Daddy.«
Böse Vorahnungen stellen sich mit einem hohlen Gefühl in der Magengrube ein. Die Stille der Verzweiflung erfasst ihr Herz. Für eine Sekunde glaubt sie, ihr Vater sei tot. Dieser Gedanke geht ihr unter die Haut, sie bekommt eine Gänsehaut. Kälte umfließt ihre Schultern.
»Lieber Gott, nein. Nein!«
Sie hört, wie ihr die Stimme versagt. Atemloses, trockenes Schluchzen steigt aus ihrer Kehle auf.
»Alles in Ordnung«, erklärt ihre Mutter am anderen Ende. »Hör zu. Er ist okay. Er lebt.«
Sie hört die Worte, ohne sie erst zu begreifen. Sie lässt sie auf sich wirken, formuliert langsam den Satz im Geiste nach.
Nicht tot.
Am Leben.
Noch am Leben. Noch ein Teil von ihr.
Und dann ist sie sich ihrer Gefühle nicht mehr sicher.
TEIL I
Anne
Als Anne noch ein Kind war und ihre Eltern spätabends von einer Party zurückkamen, stellte sie sich am liebsten schlafend. Teils, weil sie wusste, dass der Babysitter sie länger aufbleiben ließ, als es erlaubt war, und teils, weil sie liebend gern schauspielerte, simulierte, Erwachsenenstreiche spielte.
Dann hörte sie die Schritte der Eltern auf der Treppe, das schwerfällige und bedächtige Raunen aus beschwipsten Kehlen, Geflüster und unterdrücktes Gekicher. Sie knipste ihre Nachttischlampe aus, machte die Augen fest zu, zog die Bettdecke eng um sich. Ihre Eltern näherten sich ihrem Zimmer und blieben einen Moment draußen stehen, ermahnten sich gegenseitig übertrieben ernst, leise zu sein, bevor sie die Tür öffneten und die Köpfe hereinsteckten. Die Stimme ihrer Mutter rief leise ihren Namen, jede ihrer Bewegungen begleitet vom metallischen Klirren der Ohrringe und Armreifen.
Schließlich trat ihre Mutter auf Zehenspitzen lautlos an das Kinderbett und neigte den Kopf, um ihre Tochter sanft auf die Wange zu küssen, und Anne, die Sinne in der Dunkelheit geschärft, fühlte die trockene Puderschicht auf ihrer Haut und die cremige Konsistenz des Lippenstiftes, und atmete das aufregend erwachsen riechende Duftgemisch aus Nikotin und Alkohol ein. Und noch immer hielt sie die Augen geschlossen. Ihre Eltern mussten gewusst haben, dass sie wach war, gingen jedoch auf das Spiel ein, machten bei der harmlosen Kinderlüge mit.
An all das denkt sie jetzt, während sie ihren Mann betrachtet, der im Krankenhausbett liegt, an zahlreiche Schläuche und Infusionen angeschlossen. Er wirkt irgendwie gespielt, dieser erzwungene Schlaf. Seine Brust hebt und senkt sich. Seine Augen sind geschlossen, seine Mundwinkel nach unten gezogen. In den vergangenen Tagen hat sich ein dunkler Flaum Bartstoppeln über die bleichen Falten seines Gesichts gelegt, wie Adlerfarn über eine Böschung. Dieser Schlaf ist alles andere als überzeugend. Es hat den Anschein, als spiele er seine Rolle allzu bemüht. Gelegentlich beginnt sein linkes Augenlid leicht zu zucken, ausgelöst durch den elektrischen Impuls irgendeiner Synapse in seinem Inneren.
Sie kennt die Fakten. Die Ärzte hatten ihr erklärt, er läge im Koma, und sie hatte ernst genickt, überzeugend den Eindruck einer Frau Mitte fünfzig vermittelt, die weiß, was von ihr erwartet wird. Sie hatte alles Weitere in die Hand genommen, Personen informiert, sich am Telefon ruhig und vernünftig gegeben und das Nötige veranlasst. Sie war auf dem Polizeirevier gewesen, um sein Fahrrad abzuholen, das durch den Unfall seltsamerweise fast unbeschadet geblieben war, der graue Metallrahmen glatt, glänzend und kühl in ihrer Hand. Sie hatte Taschen gepackt und aufgeräumt, Formulare ausgefüllt und seine Verlegung in eine Privatklinik veranlasst, deren Kosten seine Versicherung übernahm. Sie hatte den Rindfleischtopf eingefroren. Sie hatte in dem Bewusstsein weitergemacht, dass alle genau das von ihr erwarteten.
Dennoch gibt es einen Teil ihres Unterbewusstseins, der das Ganze für einen ungeheuerlichen Scherz fern jeder Realität hält, der vermutet, dass ihr Mann sich in diesem Krankenbett nur schlafend stellt, sich wieder einmal in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drängt, wie er das auch im Alltag immer wieder geschafft hatte. Sie weiß, dass er eine Rolle spielt, sie etwas glauben macht, das reine Fiktion ist. Aber, denkt sie stumm, diesmal täuschst du mich nicht.
Und dann, während sie auf seinen ausgestreckten Körper herabsieht, wird ihr bewusst, wie absurd diese Gedanken sind. Sie registriert mit einem Mal entsetzt, wie gleichgültig der Zustand ihres Mannes sie lässt. Sie versucht, mit Zärtlichkeit an ihn zu denken, sich an eine liebevolle Geste oder ein herzliches Wort zu erinnern, die sie in den letzten Tagen ausgetauscht hatten. Stattdessen kommt ihr nur die letzte Unterhaltung in den Sinn, jener Wortwechsel kurz bevor Charles aus der Tür gestürmt war, in seinem Fahrradanorak mit Leuchtstreifen, den Reißverschluss offen, so dass die Jackenschöße beim Gehen im Wind flatterten.
Er hatte ihr nicht gesagt, wo er hinwollte, und als sie gefragt hatte, hatte er nicht einmal den Kopf gehoben, um zu signalisieren, dass er ihre Frage überhaupt gehört hatte. Stattdessen hatte er nur ungerührt seinen Frühstückstee geschlürft.
»Charles?«
Er sah auf. Sein Blick traf sie mit gewohnter Gleichgültigkeit.
»Ja?«
»Ich wollte nur wissen, wo du hingehst«, wiederholte Anne, hörte, wie verzagt ihre Stimme klang, registrierte den quengeligen Unterton und hasste sich dafür.
Er stellte seinen Teebecher stumm und mit Nachdruck ab. Der Becher landete mit einem dumpfen ›Plopp‹ auf der Tischplatte, und ein Teil der Flüssigkeit schwappte über den Rand auf das helle Kiefernholz. Anne starrte auf die kleinen braunen Lachen, die sich bildeten, und versuchte, jeden Augenkontakt mit ihm zu vermeiden.
»Warum sollte dich das was angehen?«, entgegnete er aufreizend gelassen. Vermutlich wäre die Sache damit erledigt gewesen, doch Anne hatte nach einem Geschirrhandtuch gegriffen und begonnen, den verschütteten Tee aufzuwischen. Dabei war bei Charles eine Sicherung durchgebrannt. Niemand sonst hätte es bemerkt, doch für Anne war die Veränderung umgehend sichtbar: Seine Pupillen wurden dunkel, seine Schultern nahmen demonstrativ eine entspannte Haltung an, wie bei einem Boxer, der sich für den Kampf im Ring vorbereitete, und sie hörte den feinen Pfeifton, mit dem er die Luft durch die Nase einsog.
Einen Augenblick später begann er mit betont modulierter, deutlich beherrschter Stimme zu sprechen.
»Weißt du eigentlich, was ich von dir halte?«, erkundigte er sich, und die Frage wirkte absurd und seltsam losgelöst von den banalen Gesprächsfetzen des Morgens. Für Anne das Zeichen, dass es einen Grund für seine Verärgerung gab.
Sie schwieg, ballte die Hände zu Fäusten, bis sich ihre Fingernägel in die Handflächen gruben. Sie konzentrierte sich auf den Schmerz, für sie ein Beweis, dass es sie überhaupt noch gab. Als sich ihre Finger entspannten, hatten die Nägel deutliche halbmondförmige Markierungen auf dem rosa Fleisch ihrer Handinnenseite hinterlassen.
Charles starrte sie an, den Blick voller Verachtung, den Kopf fragend leicht zur Seite geneigt. »Also?«, erkundigte er sich gedehnt, als spräche er mit einem begriffsstutzigen Kind.
Anne fühlte, wie all ihre Muskeln vor Anspannung zuckten. »Nein«, antwortete sie und merkte, wie sich ihre Stimme praktisch in Luft, in nichts auflöste, kaum dass das Wort heraus war. Sie stand bewegungslos da, gespannt und aufmerksam auf das wartend, was als Nächstes kommen würde, das feuchte Geschirrtuch krampfhaft in der Hand haltend.
Charles hüstelte sanft hinter vorgehaltener Hand. Er sah sie an, und sein Blick schien glanzlos, wie mit einem Belag überzogen – wie die Schmutzschicht, die auf einer Fensterscheibe sichtbar wird, in der das Licht sich fängt. »Du ekelst mich an«, erklärte er so tonlos, dass es wie ein Flüstern klang. Und sie fragte sich zum wiederholten Mal, wann es sie in den Wahnsinn treiben würde. »Wenn ich dich nur sehe mit deinen Geschirrtüchern, schmutzigen Schürzen und deiner verhärmten Miene. Wenn ich deine permanent weinerliche, nölende Stimme höre, mit der du mir sinnlose Fragen stellst.« Er hielt inne, trank einen Schluck Tee, und einen Moment lang dachte Anne, damit sei alles gesagt. Doch gerade, als sie sich abwenden wollte, setzte er den Becher übertrieben vorsichtig ab und fuhr fort: »Du!« Sein ausgestreckter Finger schnellte in ihre Richtung. »Du! Du mit deinen müden Augen, deinen Falten und deinen überquellenden, hausmütterlichen Speckröllchen, den dünnen Lippen und …« Er verstummte und schüttelte den Kopf, als könne er es selbst nicht begreifen. »Dabei bist du einmal so unglaublich schön gewesen.«
Anne trat an die Spüle und machte sich an den Wasserhähnen zu schaffen, um ihn nicht ansehen zu müssen. Sie war dem Weinen nahe und selbst erstaunt, wie tief er sie noch immer verletzen konnte. Sie hatte sich an seine Gemeinheiten gewöhnt, an seine willkürlichen Ausbrüche unterdrückten Zornes. Sicher hätte sie mittlerweile dagegen immun sein, in der Lage sein müssen, seine Grausamkeiten zu ignorieren. Warum ging sie nicht einfach raus aus der Küche? Warum ging sie nicht aus dem Haus, verließ diesen Mann für immer? Warum stand sie hier wie angegossen, nahm jeden verbalen Boxhieb hin, als habe sie ihn verdient?
Etwas hielt sie hier, ein seidener Faden, der sie an ihn band, der sich um ihre Hand- und Fußgelenke wand, um ihre Brust, so eng, dass er sie bewegungsunfähig machte.
Sie ertappte sich dabei, dass sie an ihre Jugend dachte, an ihre mittlerweile verwelkte Schönheit, an ihren einst so schlanken Körper, den Charles so bewundert hatte. Einmal, in jenen Anfangstagen, als sie nebeneinander im Bett gelegen hatten, hatte er ihren schmalen Arm hoch ins Licht gehalten, so dass die zart gespannte Haut zwischen ihren Fingern wie Perlmutt im Gegenlicht der Sonne geschimmert hatte.
»Fast durchscheinend«, hatte er bemerkt, bevor er ihren Arm wieder sanft auf die Laken gelegt und sich abgewandt hatte. Und sie erinnerte sich an das Glücksgefühl, das dieses kleine, leidenschaftslose Kompliment in ihr ausgelöst hatte. War sie wirklich so anspruchslos gewesen?
Aber das war Jahre her: Es war einer anderen Frau in einer anderen Zeit geschehen. Als sie sich an der Spüle umsah, der Blick verschwommen von aufsteigenden Tränen, merkte sie, dass Charles bereits nicht mehr da war.
Die Krankenschwester kommt herein, um die Infusionen zu kontrollieren, und lächelt mit kurzem Nicken in Annes Richtung, wie man das aus Krankenhausserien kennt. Dieses Verhalten verstärkt Annes Gefühl, in einem Film zu sein. Natürlich, überlegt sie, ist auch die Schwester Teil des Betrugs. Er hatte das ganze Krankenhaus bestochen, sie dazu gebracht, seine Komödie mitzuspielen. Typisch, überlegt sie, dass er sich solche Mühe macht, sie an sich zu fesseln. Sie registriert ein vertrautes Aufwallen in der Magengegend, ein Stechen zwischen Hunger und Schmerz, in dem sie den Beginn einer unterdrückten, aber gefährlichen Wut erkennt.
Sie hat sich an diese unvermittelten, unerklärlichen Wutausbrüche gewöhnt und beachtet sie kaum, wartet ab, bis sie sich verflüchtigt haben. Ihre tiefe Traurigkeit, ihr Selbstmitleid scheint dann in Minutenschnelle in wahnsinnige Wut umzuschlagen. Vor Kurzem, bei der Hochzeit der Tochter eines Freundes, hatte man ihr eine Wunderkerze überreicht und sie gebeten, sie anzuzünden und zu schwenken, sobald sich das glückliche Paar in die Hochzeitsreise verabschiedete.
»Statt Konfetti«, sagte die Brautmutter, eine umtriebige Dame, die keinen Hehl daraus machte, dass sie sich für ein begnadetes Organisationstalent hielt.
»Wie interessant«, murmelte Anne, als sie merkte, dass sie sich beeindruckt zeigen sollte. »Und so … einfallsreich!«
Die Wunderkerze brannte schnell nieder, versprühte glitzernde Funken wie Löwenzahnsamen. Die Hochzeitsgäste jubelten dem Paar zu und winkten, bis der Beifall hohl und leer klang und die Brautmutter die Gäste in Taxis verfrachtete. Anne blieb allein mit der zu einem formlosen Stück Asche abgebrannten Wunderkerze in der Hand zurück, das leicht nach Schwefel roch. Und in diesem Moment, nach zu viel Champagner, wurde ihr klar, dass genau das mit ihr passierte, wenn das Gefühl enttäuschter Erwartungen ihre Emotionen entzündete. Aber es war nur ein kurzes Strohfeuer, das schnell erlosch und von niemandem bemerkt wurde.
Sie hätte gern mit jemandem darüber gesprochen, über dieses Gefühl, dass ihr Leben allmählich immer sinnentleerter wurde, sich stets um dieselbe eintönige Achse drehte. Mit Charles allerdings konnte sie längst nicht mehr über derart persönliche Dinge sprechen, und ihr spießiger, alles andere als enger vorstädtischer Bekanntenkreis wäre angesichts ihrer Offenheit schockiert gewesen. Bis zu Charles’ Unfall hatte sie die Gleichförmigkeit ihrer Tage deprimiert. Es war, als stecke sie ausweglos im Kreisverkehr eines anonymen Provinznests wie Swindon oder Blandford Forum fest, wo sie einmal mit Charles gewesen war, weil es dem Namen nach vage eine römische Vergangenheit versprochen und sich nur als Ausbund an schäbigen Cafés und Outlets erwiesen hatte.
Das Schlimmste war, dass an alledem sie allein die Schuld trug. Sie hatte Charles geliebt, bedingungslos geliebt, und liebte ihn vermutlich gegen ihren Willen noch immer. Doch anstatt Erfüllung zu finden, hatte das Leben mit Charles sie in einen Zustand permanenter Unzufriedenheit gestürzt. Sie findet überall und immer ein Haar in der Suppe. Sie pflügt sich mit einer unerbittlichen Beharrlichkeit durch jeden Tag, die nichts und niemanden ungeschoren lässt. Sie weiß längst nicht mehr, was Glück ist, kann es nirgends mehr finden, so als sei es ein Gegenstand, den sie unwiederbringlich verlegt hat, wie eine Münze, die in den Polsterritzen eines Sofas verschwunden ist. Sie kann sich nicht mehr erinnern, wann sie zuletzt gelacht hat. Sie fühlte sich ausgehöhlt, kann sich selbst kaum noch leiden und trägt schwer an der Bürde, nicht mehr aus der Ecke herauszukommen, in die sie sich manövriert hat. Sie wünschte, sich ändern zu können, doch allein der Versuch erscheint ihr zu mühsam.
So war sie allerdings nicht immer gewesen. Als ihre Mutter im vergangenen Jahr alt, blind und dement gestorben war, hatte Anne das kleine Apartment im Seniorenheim ausgeräumt und war auf bündelweise Briefe gestoßen. Darunter auch ein paar, die sie aus dem Internat geschrieben hatte. Jeder Einzelne war amüsant geschrieben mit Zeichnungen und Scherzen versehen. Die jugendliche Anne war vor ihren Augen wiederauferstanden, und sie hatte erstaunt deren Ungezwungenheit und Natürlichkeit, ihr argloses Selbstbewusstsein erkannt. Die Sätze waren mit Ausrufezeichen nur so garniert. Aber in Ausrufezeichen dachte sie längst nicht mehr.
Die asthmatischen, mechanischen, kaum hörbaren Atemzüge ihres Mannes rissen sie aus ihren Gedanken. Er ist noch immer ein gut aussehender Mann, denkt sie, während sie die kantige, klare Linie seines wie aus Metall gegossenen Kinns betrachtet. In die Haut seiner Augenpartie hatten sich in den letzten Jahren zahlreiche haarfeine Fältchen gegraben, aber diese Krähenfüße taten seiner Attraktivität keinen Abbruch. Sie hatten ihm, zusammen mit dem sonnengebräunten, gesunden Teint, etwas ansprechend Joviales verliehen. Das war vor dem Unfall gewesen. Jetzt sind seine Lider geschlossen, zucken nur gelegentlich so, als schlüge das Herz eines kleinen Vogels schwach unter der Hautoberfläche. Geöffnet zeigten seine Augen das marmorierte Blau verwelkender Hortensienblüten: glanzlos, verblasst, entrückt.
Die Tür geht auf, und eine Krankenschwester – die sympathische mit den Lachgrübchen – steckt den Kopf herein. »Tasse Tee, Anne?«
Sie nickt erwartungsgemäß.
Anne; Charles
Charles Redfern war, wie ihre Mutter es nannte, »ein toller Fang«. Anne entdeckte ihn am ersten Vorlesungstag in den hintersten Reihen, wo er sich mit seinen schlacksigen Gliedmaßen und eingesunkenen Schultern in einen Sitz gezwängt hatte. Er hob kurz den Kopf, als sie den Vorlesungssaal betrat, und sie hatte gerade noch Zeit, den Schwung seiner spitz hochgezogenen Augenbrauen zu registrieren, bevor er seine Aufmerksamkeit erneut dem abgegriffenen Taschenbuch auf seinem Schoß zuwandte.
Den Titel des Buches konnte sie nicht erkennen. Später, viel später, fand sie heraus, dass es Ulysses von James Joyce gewesen war, ein Titel, den Charles nie zu Ende gelesen, die Lektüre stets nach einem Drittel des zweiten Kapitels aufgegeben hatte. Dennoch trug er es in jenen ersten Wochen an der Universität gern mit sich herum, gab sich den Anschein des rätselhaften Intellektuellen, um damit noch attraktiver und geheimnisvoller auf seine Kommilitonen zu wirken.
Und natürlich hatte er damit Erfolg. Am Ende der ersten Vorlesungswoche war Charles Redfern der Schwarm sämtlicher weiblicher Erstsemester. Ein unterdrücktes Raunen und Flüstern ging durch die Reihen, wenn er den Mittelgang des Vorlesungssaales entlangschlenderte. Die Mädchen drückten ihre Nasen an den Fensterscheiben ihres Wohntraktes platt, wenn er auf dem Weg zur morgendlichen Trainingseinheit der College-Rudermannschaft am Fluss vorbeijoggte. Es hieß, er habe eine Freundin an der Sekretärinnenschule, die irgendjemand mal auf einem Ball getroffen haben wollte und die offenbar fantastisch aussah und sich äußerst geschmackvoll kleidete.
Er sah unheimlich gut aus; der Typ Mann, bei dessen Beschreibung man sämtliche abgedroschenen Klischees bemühte: breitschultrig, groß gewachsen, mit einem entwaffnenden Lächeln, das sich langsam über eine Gesichtshälfte ausbreitete, bevor er in Lachen ausbrach. Sein Haar hatte die goldbraune Farbe von Karamellbonbons. Einmal hatte eine Freundin zu Hause in Kent sie gebeten, sein Profil zu beschreiben, und sie hatte sich sofort vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn er im Zwielicht der Morgendämmerung neben ihr liegen würde.
»Er sieht aus wie ein griechischer Gott«, hatte sie allen Ernstes geantwortet.
»Das darf ja wohl nicht wahr sein!«, kreischte die Freundin. »Wie ein griechischer Gott? Dich hat’s ja übel er-wischt!«
»Nein, wirklich! Er ist der schönste Mann, den ich kenne.«
»Und er ist dein Freund? Du bist wirklich ein Glückspilz!«
Die Freundschaft hatte diesen Dialog nicht lange überlebt.
Doch Charles hatte zugleich auch etwas an sich, das sie permanent verunsicherte. Sie fürchtete, seinem guten Aussehen nichts entgegenhalten zu können, nie interessant und charmant genug für ihn zu sein, hatte Angst, dass sein Blick nach ein paar Sekunden wieder zu dem Taschenbuch abschweifen würde, das er immer noch nicht fertiggelesen hatte.
Dennoch – es schien wie ein Wunder – behauptete er, in sie verschossen zu sein. Nach jener ersten Vorlesung begann er ihr aufzulauern, tauchte wie zufällig an der Pförtnerloge ihres Wohnheims auf, eine abgewetzte Büchertasche über der Schulter. Er war da, wenn sie irgendwo auf dem Campus einen Kaffee trank, saß an einem Ecktisch mit einer lärmender Gruppe in Rugbytrikots und warf von Zeit zu Zeit seinen musternden Blick in ihre Richtung. Oder er stand zwischen den Bücherregalen in der Unibibliothek, wo seine unverwechselbare Silhouette ihren Schatten über die staubigen Buchrücken warf. Er tauchte auf der Cocktailparty der Deutschen Gesellschaft auf, einer Veranstaltung, die Anne auf Drängen von Frieda, ihrer damaligen Freundin, besuchte. Frieda war eine selbstbewusste, exaltierte Sprachenstudentin, die alle gleichaltrigen Männer für hoffnungslos unreif hielt und die Gesellschaft von Examensstudenten oder Professoren suchte, wo immer sie diese entdeckte.
»Komm mit«, drängte Frieda in ihrem typisch ironischen Ton. »Wer weiß, wer einem da über den Weg läuft.«
Sie war mitgekommen, weil sie der dominanten Frieda ohnehin nichts entgegenzusetzen hatte. Als Lockmittel hatte Frieda ihr einen grünblaues, zauberhaft geschnittenes Etuikleid aus Rohseide geliehen, das diese von ihrer Pariser Großmutter geerbt hatte. Das Material hatte eine raue Oberfläche, die allerdings in abendlicher Beleuchtung einen schimmernden, changierenden Glanz bekam.
»Es steht dir«, bemerkte Frieda. »An mir wirkt es überhaupt nicht. Dafür habe ich zu wenig Busen.«
»Blödsinn«, entgegnete Anne und war nicht sicher, ob das als Kompliment oder als Spitze gemeint war. »Ich finde es jedenfalls toll. Vielen Dank, dass du’s mir leihst.«
»Keine Ursache. Bin froh, dass es getragen wird.« Frieda blieb vor dem Spiegel über dem Waschbecken in der Ecke ihres Zimmers stehen, wo sie Make-up auflegte – und hielt, das Mascara-Bürstchen in der Hand, inne. »Meine Großmutter ist verrückt geworden, musst du wissen. Sie ist in einem Irrenhaus gelandet. Sie hielt sich nämlich für Marie Antoinette.«
»Herrje«, entfuhr es Anne. Sie wusste nicht recht, welche Reaktion man von ihr erwartete. Frieda streute gerne hin und wieder das ein oder andere schockierende Detail ins Gespräch ein, um einer ganz normalen Unterhaltung etwas Würze zu verleihen, und die nüchterne Sachlichkeit, mit der sie das tat, überraschte Anne immer wieder. Solche Bemerkungen verschlugen ihr die Sprache, vermittelten ihr aber auch ein Gefühl von Frivolität, das sie genoss.
Eine halbe Stunde später hatten sich Frieda und Anne Arm in Arm aufgemacht, noch nicht vertraut genug, um echte Freundinnen zu sein, aber doch nicht so fremd, als dass ihnen die Geste unangenehm gewesen wäre. Wie Anne feststellte, wimmelte es an der Universität von solchen Zufallsallianzen. Sie hatte vor, höchstens eine gute Stunde zu bleiben, um anschließend an den Schreibtisch zurückzukehren und die Hausarbeit zu beenden, die ihr auf den Nägeln brannte.
Kaum waren sie durch die Tür getreten, verstrickte Frieda einen Professor in ein Gespräch, der auf den Zehenspitzen auf und ab wippte, sobald er sich mit Weltuntergangsmiene in Rage redete. Anne kreiselte unbeteiligt herum und kam sich reichlich überflüssig vor. Aus unerfindlichen Gründen hat sie auf dem Weg der Versuchung nicht widerstehen können, eine leuchtend purpurne Blüte aus einem Blumenbeet zu pflücken und sich ins Haar zu stecken. Frieda hatte dies sofort mit Missbilligung quittiert, und Anne wurde allmählich klar, wie recht sie gehabt hatte: Die neckische Blüte im Haar war hier in diesem düster getäfelten Raum mit all den ernsten Jungstudenten in Sportsakkos und randlosen Brillen völlig fehl am Platz. An der einen Wand war ein langer Tisch mit verloren wirkenden Tabletts voller labbriger Pasteten mit Champignonfüllung aufgebaut, daneben Schüsseln mit Salzgebäck. Jemand hatte versucht, eine Igelfigur aus Käse- und Ananasstücken zu kreieren, allerdings waren sie viel zu schwer für die Cocktailstäbchen, mit denen sie festgesteckt waren, so dass die Konstruktion rasch in sich zusammensackte. Aus einem schmalen Kassettenrekorder in der Ecke drangen vereinzelt die anachronistisch anmutenden Klänge einer Harfe.
Anne hasste Klubs und Gruppen und Gesellschaften aus Prinzip – hatte die meiste Zeit zu Beginn des Semesters damit verbracht, übereifrigen Anwerbern für Hockeymannschaften oder Filmklubs aus dem Weg zu gehen. Und ausgerechnet sie hatte sich breitschlagen lassen hierherzukommen! Sie fühlte sich unwohl und wurde wütend auf sich selbst, bereute es, schwach gewesen zu sein und nicht Nein gesagt zu haben.
Sie lächelte teilnahmslos in die Runde, steigerte sich immer mehr in ihre Wut, als plötzlich Charles Redfern vor ihr stand, ein bauchiges, bis zum Rand mit einer blutroten Flüssigkeit gefülltes Glas in der Hand.
»Ich würde dich gern zu einem Drink einladen«, sagte er schlicht.
»Du kennst mich doch gar nicht.«
»Doch, tue ich. Ich weiß, dass du Anne Eliott heißt. Ich weiß, dass du im ersten Semester Geschichte am Newnham College studierst. Ich weiß, dass du ungefähr eins siebzig groß bist und dass du …«, er hielt inne, beugte sich vor und sah sie aus zusammengekniffenen Augen durchdringend an. »… dunkelbraune, grün gesprenkelte Augen hast.«
»Die sind nicht grün gesprenkelt.«
»Doch, sind sie. Du solltest gelegentlich in den Spiegel schauen.«
Anne fiel keine passende Antwort ein. Er sah sie nur weiter lächelnd an. Obwohl sie normalerweise nie rot wurde, fühlte sie, wie ihr ungewohnte Wärme in die Wangen stieg.
»Ist viel einfacher, jetzt gleich Ja zu sagen. Andernfalls muss ich weiter hinter dir herhecheln, und du musst weiter so tun, als würdest du mich übersehen.«
»Wie kommst du darauf, dass ich nur so tue?«
»Keine Ahnung … vielleicht ist es deine Körpersprache. Wenn du dich auf eine Vorlesung konzentrierst, sitzt du ganz aufrecht. Wenn du mit Freunden plauderst, bist du ständig in Bewegung und dein Haar schwingt hin und her. Wenn du so tust, als würdest du mich geflissentlich übersehen, verharrst du absolut bewegungslos und starrst konzentriert in eine andere Richtung, aber da ist etwas … vielleicht ein kaum merkliches Zucken. Besser kann ich’s nicht ausdrücken.«
»Ein Zucken?«
»Ja. So als würdest du dich schlafend stellen, kannst es aber nicht ganz durchhalten. So eben.«
Im ersten Moment verschlug es ihr die Sprache. Er sah sie nur weiter an, ernst und so durchbohrend, dass sie sich der Wirkung nicht entziehen konnte. Er schien die Situation unter Kontrolle zu haben, schien sie unauffällig dorthin zu manövrieren, wo er sie haben wollte – mit Vorbedacht und unbeirrt. Sein ruhiges, zielgerichtetes Beharren war einschüchternd und schmeichelhaft zugleich. Die ausschließlich ihr geltende Aufmerksamkeit war entwaffnend.
Dann, gerade als sie seine Einladung annehmen und sagen wollte: »Okay, lade mich zu einem Drink ein, das finde ich nett«, lächelte er, hob die rechte Hand bis zu ihrer Wange und schob ihr – so schnell, dass sie hinterher nicht wusste, ob sie es sich nur eingebildet hatte – tatsächlich eine Haarsträhne hinters Ohr, wobei seine Fingerkuppe leicht über ihren Nacken strich. Anne sog scharf die Luft ein. Dann wandte er sich ab und ließ sie einfach stehen.
Nach diesem Vorfall war auch sie ihm unausweichlich verfallen. Eine Woche später traf sie ihn erneut in der Bibliothek. Er saß an dem langen Refektorium im Lesesaal und drehte sich eine Zigarette.
»Hallo, Charles.«
Er sah auf, und ein Lächeln glitt allmählich über sein Gesicht.
»Anne Eliott«, sagte er und leckte das Zigarettenpapier an. »Wann willst du auf einem Drink mit mir ausgehen?«
Sie radelten an einem windigen, grau verhangenen Tag übers Land, zwischen Weiden hindurch, die sich rechts und links wie feuchte Pinselstriche flach am Horizont verloren, zu einer Kneipe in Grantchester. Schwäne überzogen wie weiße Punkte das Ufer, die sich elegant vom schlammig braunen Wasser abhoben. Charles fuhr voraus. Anne folgte ihm atemlos. Sie starrte auf seinen Rücken, beobachtete, wie sich seine Schultern auf der Fahrt über den holprigen Untergrund hoben und senkten. Sein Haar war gerade so lang, dass sich der Wind darin fing. Er überzeugte sich ständig davon, dass sie ihm folgte, wandte den Kopf gerade weit genug in ihre Richtung, um ihren Blick aufzufangen. Alles war so, wie es sein sollte.
Später, nachdem sie ihr Alsterwasser getrunken hatte, küsste er sie flüchtig auf die Lippen und bemerkte, sie schmecke nach Brause. Noch etwas später begleitete er sie zurück zum Newnham College, wo er sie sanft gegen die rote Ziegelmauer drängte, ihr Gesicht in beide Hände nahm und sie wortlos auf Mund, Wangen und Augenlider küsste. Danach – Herrenbesuch war über Nacht nicht erlaubt – verabschiedete er sich, und sie ging in ihr Zimmer hinauf, prickelnd vor Glück wie Brausepulver.
Als sie Charles zwei Monate später bei ihren Eltern zu Hause in Kent einführte, waren diese erwartungsgemäß entzückt.
»Liebes, er ist wundervoll«, flüsterte ihre Mutter theatralisch, sobald ihr Vater Charles auf sein Zimmer im ersten Stock geleitet hatte. »Ein Glückstreffer! Absolut!«
Beim Abendessen hatte Charles Mrs. Eliotts auf den Punkt gegarten, innen rosa gebliebenen Lammbraten gelobt, so dass Annes Mutter vor Wonne fast die Soßenterrine aus der Hand geglitten wäre und sich der Inhalt beinahe über die gestickte Leinentischdecke ergossen hätte. Er verwickelte Mr. Eliott in eine lange, kompetent geführte Diskussion über die Menschenrechtsbewegung in den USA, ohne sich auf eine Meinung festzulegen, die übertrieben streitbar oder unangenehm radikal hätte erscheinen können. Er entsprach in jeder Beziehung dem Wunschbild des perfekten Schwiegersohns.
»Ein verdammt netter Bursche, Annie«, erklärte der Vater im Wohnzimmer am nächsten Morgen, faltete seine Zeitung zusammen und beugte sich vor, um mit einem langen Schürhaken das Feuer im Kamin anzufachen.
»Archie, bitte!«, mahnte ihre Mutter, die wie immer etwas gegen die lockere Ausdrucksweise ihres Mannes einzuwenden hatte.
»Ich wollte damit nur sagen, dass ich ihn mag. Der Typ hat Pep. Hätte schlimmer kommen können.«
»Ich bin sicher, auf Annie können wir uns in diesem Punkt verlassen.« Ihre Mutter sah mit ihren dunkelgrauen Augen von ihrer Näharbeit auf. »Stimmt’s, Liebes?«
Anne lächelte. Ja, das konnten sie. Sie wusste, was sie wollte. Wie sie jedoch feststellen sollte, hatte sie nicht die geringste Ahnung, was er wollte.
Charlotte
Charlotte kam wieder einmal zu spät, und auch wenn ihrem ständigen Zuspätkommen der Ruf des Unvermeidlichen anhaftete, war dies im Augenblick kaum tröstlich. Eigentlich hätte sie es besser wissen und diese alte Schwäche bei ihrer Zeitplanung einkalkulieren müssen. Diese Gedanken schossen ihr durch den Kopf, während sie ihr kleines blaues Auto in halsbrecherischem Zickzack durch den dichten Londoner Verkehr lenkte. Leider war ihr der entscheidende Sprung vom Vorsatz zur Umsetzung in die Tat bisher nie gelungen. Das Zuspätkommen war eine Eigenschaft, eine Seite ihrer Persönlichkeit, die von fast allen, die sie kannte, freundschaftlich geduldet und resigniert belächelt wurde. Charlotte hatte Freunde, die bei Verabredungen mit ihr eine Verspätung von einer halben Stunde gleich einkalkulierten. Für ihre Mutter galt das nicht: Sie bestand auf Pünktlichkeit.
Charlotte stand die Begegnung mit Anne bevor. Kalte, klamme Angst lastete auf ihrer Brust. Seit Kurzem war sie sich bewusst, dass sie nicht einmal mehr so tun konnte, als sei sie in der Gegenwart ihrer Mutter entspannt. Sie gingen in letzter Zeit so verkrampft und gestelzt miteinander um, dass die Essenz ihrer Dialoge vorwiegend aus dem bestand, was unausgesprochen blieb.
Schuld daran war jener Tag vor einigen Monaten, als ihre Mutter am frühen Morgen unangemeldet vor ihrer Wohnungstür aufgekreuzt war. Es war Charlottes dreißigster Geburtstag gewesen, ein Datum, das sie zu ignorieren fest entschlossen gewesen war. Sie erinnerte sich, wie sie die Wohnungstür geöffnet hatte und unfähig gewesen war, ihr Entsetzen zu verbergen. Unwillkürlich war sie einen Schritt zurückgewichen, so als scheue sie vor ihrer Mutter zurück, als wolle sie vor ihr davonlaufen.
»Hast du was?«, fragte die Mutter.
»Nein, nichts!«, entgegnete Charlotte und die falsche Fröhlichkeit in der eigenen Stimme schmerzte in den Ohren.
»Gut. Ich wollte dich überraschen. Alles Gute zum Geburtstag!« Und noch immer auf der Schwelle stehend hatte sie ihr ein viereckiges, sorgfältig verpacktes Schächtelchen mit einer Geste überreicht, die unnatürlich und aufgesetzt wirkte.
»Danke.« Charlotte bat sie nicht herein. Sie war noch im Schlafanzug, und ihr Freund Gabriel lag in ihrem zerwühlten Bett. Sie verspürte aus einem unerfindlichen Grund den Drang, ihre Mutter so schnell wie möglich loszuwerden. Hastig riss sie daher das Päckchen auf. Es enthielt ein glattes dunkelblaues Etui mit goldenem Verschluss. Charlotte öffnete es, und ihr Blick fiel auf einen allzu vertrauten Ring mit einem Rubin in einem Kreis von Brillanten.
»Mum …«
»Ich möchte, dass du ihn trägst.«
»Aber Mum!« Charlotte war flau in der Magengegend. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. »Was soll das?«
Ihre Mutter räusperte sich. »Er passt mir nicht mehr.« Sie lächelte undurchsichtig. »Außerdem, wem sonst sollte ich ihn schenken?«
»Es ist dein Verlobungsring.«
»Ja und?« Damit hatte sich ihre Mutter abgewandt und war ohne ein weiteres Wort aus der Haustür gegangen. Charlotte hatte keine Chance mehr gehabt, ihr zu sagen, dass sie den Ring nicht haben wollte.
Charlotte trat an einer Ampel abrupt auf die Bremse, und ihre Handtasche rutschte vom Beifahrersitz. Der Inhalt, eine Mischung aus Haarklammern, alten Briefmarken und anderem Krimskrams, ergoss sich in den Fußraum. Ein Armband mit gebrochenem Verschluss, das sie seit Monaten in der Handtasche mit sich herumtrug, hatte sich in seine Einzelteile zerlegt, und einige winzige purpurne Perlen rollten nun über die ausgefranste graue Fußmatte. »Schei …!«, entfuhr es ihr laut, aber es war niemand da, der sie hätte hören können. Sie bückte sich, um alle Gegenstände einzusammeln, als die Ampel auf Grün schaltete und der alles überragende Doppeldeckerbus hinter ihr zu hupen begann. »Schon gut. Schon gut.«
Gedanken an ihre Mutter hatten stets diese Wirkung auf Charlotte. Sie machten sie nervös und fahrig, lösten grundlos Schuldgefühle aus. Sie fühlte sich gewissermaßen für das Glück ihrer Mutter verantwortlich und ärgerte sich gleichzeitig, dass sie dies als Bürde empfand. Sie war wütend auf sich, weil sie Anne noch immer so sehr liebte, stets versuchte, die pflichtbewusste, treu sorgende Tochter zu sein. Immerhin hatte ihre Mutter kein einziges Mal gesagt, dass sie ihre Tochter liebe. Das war nicht ihre Art. Stattdessen schien sie permanent enttäuscht zu sein: von Charlotte, von sich selbst, vom Leben mit all seinen Frustrationen.
In Charlottes Elternhaus hatte es nie Zärtlichkeiten gegeben oder harmlose Diskussionen beim Abendessen oder gar die temperamentvollen Tumulte, die in großbürgerlichen oder adeligen Familien vorkamen, von denen sie in Romanen vergangener Zeiten las. Stattdessen hatte es unausgesprochene Dissonanzen gegeben, hatte permanent und unausgesprochen eine Atmosphäre geherrscht, die von erlittenen Kränkungen und unterdrückter Wut gezeichnet war.
Beim Abendessen war es am schlimmsten. Sie saßen an dem Küchentisch aus Kiefernholz, aufrecht und angespannt. Ihr Vater ergriff stets als Erster das Wort, gab seine Kommentare ab, begleitet vom rhythmischen Knacken seines Kiefers beim Kauen. Was er sagte, war dabei weniger das Problem als die Art und Weise, wie er es sagte. Es begann mit einer neutralen Bemerkung, die sich normalerweise an ihre Mutter richtete.
»Wieder mal ein neues Top, wie ich sehe.«
Es folgte stets eine Pause, elektrisch aufgeladen von der hohen Wahrscheinlichkeit bevorstehenden Unheils. Ihre Mutter sah dann demonstrativ an sich herunter, wie um sich zu vergewissern, was sie anhatte, bevor sie sich in gekünstelte Ungezwungenheit flüchtete.
»Ach das, meinst du? Ja, das habe ich neulich gekauft …« Sie verstummte angesichts seines starren, strafenden Blickes.
»Wie … verschwenderisch«, bemerkte er, und jedes seiner Worte fiel wie ein Tropfen Säure von der Pipette eines Chemikers.
»Nicht wirklich«, wappnete sich ihre Mutter ruhig. »War ein Sonderangebot.«
»Ah, verstehe.« Er grunzte trocken und wischte sich die Mundwinkel mit dem Zipfel der Serviette. »Du sparst mein Geld. Dafür muss ich wohl dankbar sein.«
Manchmal war die Angelegenheit damit erledigt. Manchmal trieb es ihr Vater solange weiter, bis ihre Mutter vom Tisch aufstand, ihren Stuhl so abrupt zurückschob, dass er mit schrillem Quietschen über den Fliesenboden schlidderte. Und immer war Charlotte gezwungen, schweigend bei Tisch auszuharren, bis der Vater die Mahlzeit beendet hatte.
War der Abendbrottisch abgeräumt, gab es kein Fernsehen. Abgesehen von den Nachrichten schien jedes andere Programm ihren Vater zu ärgern, seine Laune derart zu verschlechtern, dass die Luft in den Räumen knapp zu werden, durch sämtliche Fugen in den Wänden zu entweichen drohte. Er erhob nie die Stimme, doch die unterdrückte Wut, die sich in seinen kontrollierten Atemzügen ausdrückte, war schlimmer als alles andere.
Die Spannung war dann so unerträglich, der Drang bei Charlotte, sich für alles zu entschuldigen, was sie im Fernsehen sah, so übermächtig, dass jede Sendung zur Qual wurde.
Ungestraft fernsehen konnte sie nur, solange ihr Vater noch bei der Arbeit war, in jener goldenen Zeitspanne von zwei Stunden, in der sie sich nach der Schule auf einem Kissensack im Wohnzimmer mit einem Stück Battenbergkuchen in der Hand dem ungestörten Genuss einer Folge von Grange Hill oder Blue Peter hingab. Ihr Gehör war sorgfältig auf das Motorengeräusch des väterlichen Autos getuned. Sobald sie das erste dunkle Dröhnen seines BMWs hörte, sprang sie auf, machte den Fernseher aus und sprintete nach oben, schloss die Tür zu ihrem Zimmer und schlug ihre Schulbücher auf, damit sie nicht mit ihm reden musste.
Gelegentlich klopfte er auf dem Weg nach oben an ihre Tür.
»Charlotte?« Er wartete, bis sie antwortete, bevor er die Tür aufstieß, ohne jedoch die schmale Metallleiste zu überschreiten, die den dunkelroten Flurteppich von dem hellbeigen Teppichboden ihres Zimmers trennte. Es war stets beklemmend, wie er dort stand, einem Gefängniswärter gleich, und schweigend seine Blick über das gleiten ließ, womit sie beschäftigt war.
»Viel zu tun?«, fragte er.
»Geht so«, antwortete Charlotte einsilbig, wusste nicht, was sie sonst sagen sollte, und lächelte so unverbindlich wie möglich. Er stand auf der Schwelle, sah sie einige Augenblicke schweigend an, lockerte dabei mit einer Hand seine Krawatte.
»Gut«, bemerkte er. Er trat von einem Bein auf das andere, als zögere er die Schwelle zu überschreiten, sich ihr zu nähern. Sie sah es und straffte unwillkürlich mit steifem Rücken die Schultern. Es war eine kaum merkliche Bewegung, und doch registrierte er sie, wandte sich umgehend ab, zog sich in den Flur zurück und ging mit langen Schritten in Richtung Badezimmer. Minuten später hörte sie, wie der Wasserhahn aufgedreht wurde.
Charlotte hatte keine Ahnung, ob es normal war, wie es in ihrer Familie zuging. Sie hatte keine Freunde, denen sie sich anvertrauen konnte. Sie war ein sehr einsames Kind, hatte Angst vor Gleichaltrigen, und ihr graute vor allem, was neu war. Ohne Geschwister war sie im Umgang mit anderen Kindern unsicher. Nichts hasste sie mehr, als ihrer Mutter zuliebe auf eine Party gehen zu müssen, weil »die Tochter von Soundso auch dort sein wird, und sie ist im gleichen Alter wie du«. Ganz zu schweigen von den horrormäßigen Dinnerpartys, bei denen ihre Eltern mit den Erwachsenen um einen Tisch saßen und von sämtlichen Kindern erwartet wurde, dass sie sich um einen wackeligen Campingtisch mit Partyservietten und Papierkronen versammelten. »Da haben die Kleinen doch viel mehr Spaß, oder?«, sagte dann die Gastgeberin mit routiniertem Lächeln, während alle wussten, dass der einzige Grund für die Inszenierung für die Kinder der war, dass sich die Erwachsenen nicht um sie kümmern mussten.