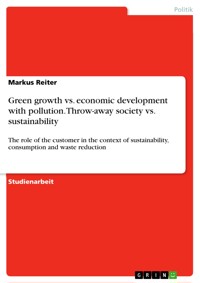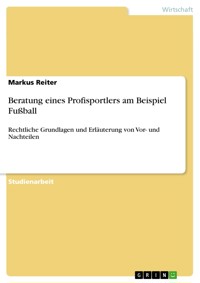8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unser Gehirn – wie es funktioniert und wie wir es auf Trab bringen
Was hat ein Affe in einem Labor in Parma mit Werbung für teure Autos zu tun? Warum sollten wir bei einem Autounfall niemals einem Zeugen glauben? Warum war Mutter Teresa auch nur eine Egoistin? Können wir unser Gehirn auf natürliche Weise dopen?
Die Hirnforschung ist die Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts. Doch was bedeuten ihre faszinierenden Erkenntnisse für meinen Alltag? Markus Reiter zeigt in seinem neuen Buch, wie uns die Neurowissenschaften klüger, erfolgreicher und wachsamer gegen Manipulationsversuche machen können. Mit ihren Erkenntnissen erfahren wir, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir sein intellektuelles Potential besser ausschöpfen und uns selbst und unsere Entscheidungen besser verstehen können.
- Klüger, erfolgreicher und wachsamer – der Hirnforschung sei Dank
- Ein informatives Buch mit vielen praktischen Tipps zum sofortigen Gebrauch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG: WIR SIND UNSER GEHIRN
So sieht es also aus. Vor mir schwimmt eine gelblich-weiße Masse mit ihren charakteristischen Windungen in einem Gemisch aus Formalin, Glyzerin und Wasser. Ein menschliches Gehirn. Um genau zu sein, stehe ich vor mehreren. Ich zähle in der Vitrine vor mir etwa drei Dutzend Exemplare. Seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Gehirn. Ich habe hunderte von Büchern und Artikeln darüber gelesen. Ich habe mir von Dutzenden Neurowissenschaftlern erklären lassen, was unser Gehirn zu leisten vermag, welche Schäden in welchen Arealen zu welchen Ausfallerscheinungen führen. In meinen Seminaren präsentiere ich den Teilnehmern ein Modell aus Kunststoff, das man in zwei Hälften trennen kann, um sich die Basalganglien, die Amygdalae und die Hippocampi näher zu betrachten. Das alles waren unbekannte, geheimnisvolle Namen für mich, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigte. Strukturen im Inneren meines Schädels, von deren Funktion und Wirken ich keine Ahnung hatte. Inzwischen kommen sie mir vor wie alte Bekannte.
Und dennoch: Als ich an diesem glühend heißen Frühsommertag in der Pathologischen Sammlung des Medizinhistorischen Museums der Berliner Charité stehe, überkommt mich ein Gefühl der Ehrfurcht. Wir sind nur wenige hundert Meter vom Ufer der Spree entfernt, auf der Ausflugsschiffe mit frohgemuten Touristen vorbeiziehen. Vom Hauptbahnhof mit all den hektischen kofferschleppenden, über die Deutsche Bahn fluchenden Reisenden sind es kaum zehn Minuten zu Fuß. Auf dem Weg hierher in den dritten Stock konnte ich einen kurzen Blick aus dem Fenster auf das gegenüberliegende Gebäude werfen. Im Garten hinter einer Mauer sitzen Menschen an einem Tisch, trinken Kaffee und unterhalten sich. Es sind Patienten der Neurologie der Charité, Berlins riesigem Universitätskrankhaus. Menschen, deren Gehirn nicht so funktioniert, wie es die Gesellschaft von ihnen erwartet. Die womöglich vor sich selbst geschützt werden müssen, weil irgendwelche Synapsen sich an der falschen Stelle verbinden oder weil bestimmte Neurotransmitter, Botenstoffe zwischen den Gehirnzellen, in zu geringer oder zu großer Menge ausgeschüttet werden.
Wenige Schritte entfernt stehe ich, unter den Augen des berühmten Mediziners Rudolf Virchow, dessen Statue in der Mitte des Raumes Platz gefunden hat, vor den Vitrinen mit den Gehirnen Verstorbener. Der große Arzt, Politiker und Wissenschaftler Virchow hatte das Pathologische Museum 1899, drei Jahre vor seinem Tod, nach langem Ringen mit den Behörden noch selbst eröffnet. Seine pathologisch-anatomische Sammlung mit 23.000 Exemplaren ging darin auf. Dann folgten die Wirrnisse zweier Weltkriege und die deutsche Teilung. Erst fast zehn Jahre nach der Wende eröffnete 1998 dieses Medizinhistorische Museum der Charité.
Rudolf Virchow maß seiner Sammlung höchste Bedeutung zu und nannte sie sein »liebstes Kind«. Nicht nur seine Studenten, auch die Öffentlichkeit sollten anhand der Präparate den Stand der medizinischen Wissenschaft kennenlernen. Das setzte voraus, dass sie sich mit dem kranken Menschen beschäftigten. Nur eines der präparierten Gehirne in der Vitrine vor mir ist deshalb gesund. Oder sagen wir besser: Sein ehemaliger Träger wurde so eingeordnet. Bei den anderen geben kleine Schildchen Auskunft über das Schicksal, das deren Besitzer vermutlich erleiden mussten. »Großer gekapselter Hirnabzess« heißt es dort. Das ist ein Eiterherd im Gehirn. Der Patient litt also an Fieber, Übelkeit und einem Druckgefühl im Kopf. Noch heute sterben trotz Antibiotika ein Fünftel der Betroffenen; wer überlebt, leidet oft an Epilepsie, Gedächtnisverlust und Lähmungen. »Enzephalomalazie (Gehirnerweichung)« lautet die Diagnose für das Gehirn daneben. Eine Form des Schlaganfalls, also eine Durchblutungsstörung, mit den entsprechenden Folgen wie Lähmungen, Ausfallerscheinungen, Sprachstörungen. »Fusiformes Glioblastom« ist das Schildchen neben einem dritten Gehirn beschrieben. Ein bösartiger, schnell wachsender Hirntumor – unheilbar.
Ich beuge mich vor und erkenne die dunklen Stellen und die Verformungen der Hirnmasse. Diese Gehirne waren einmal der Sitz eines eigenen Ichs, eines Menschen mit eigener Persönlichkeit. Sicherlich gehören auch die Lunge, das Herz, die Leber und die Nieren, die in den Nachbarvitrinen in ihrer Formalinlösung schwimmen, zum Menschen. Bei manchen Patienten werden diese Organe heutzutage auf der Intensivstation künstlich am Funktionieren gehalten. Aber die Mediziner glauben nicht, dass dieser Mensch noch lebt. Wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet, gilt der Mensch als tot. Wir sind unser Gehirn.
Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Ärzte heute viele Organe transplantieren oder, zumindest für eine gewisse Zeit, durch Maschinen ersetzen können. Die Transplantation des Herzens, der Lunge, einer Niere oder der Galle ist zwar eine aufwändige und gefährliche Operation, aber bis auf wenige Angehörige bestimmter religiöser Gruppen halten die Menschen sie für ethisch unbedenklich, ja oft für geboten. Eine »Gehirntransplantation« kommt uns wie ein bizarrer Gedanke aus einem Horror-Science-Fiction-Roman vor. Schon der Gedanke verursacht Schwindel. Verwirrt uns. Wir wüssten plötzlich nicht mehr, wer wer ist: Bildet das Gehirn die Persönlichkeit, die einen neuen Körper findet? Oder erhielte die Person, der der Körper gehört, nur eine neue Schaltzentrale? Eine Gehirntransplantation ist derzeit unmöglich, weil die Nervenzellen zu schnell absterben, und so wird es wohl auch bleiben. Allein das Gedankenexperiment lässt uns jedoch bereits schaudern. Wir sind unser Gehirn.
Das wurde nicht immer so gesehen. Die alten Ägypter öffneten die Leichen ihrer reichen und mächtigen Verstorbenen, um deren Organe zu entnehmen. Sie balsamierten sie ein und legten sie in den Leichnam zurück, damit der Mensch vollständig die Reise in das Totenreich des Unterweltgottes Osiris antreten konnte. Besondere Sorgfalt verwandten sie auf das Herz, das ihnen als Sitz des Denkens und des Fühlens galt. Das Gehirn hingegen zupften sie mit einem medizinischen Instrument, das einer Häkelnadel ähnelt, durch ein Nasenloch aus dem Schädel und warfen es weg. Es hatte für sie keinen Nutzen. Einige hundert Jahre später vermutete der griechische Philosoph Aristoteles immer noch, das Gehirn diene lediglich dazu, das Blut zu kühlen. Vermutlich haben ihn die Windungen des Cortex auf diese Idee gebracht. Der berühmte spätantike Arzt Galen, dessen Werk für gut eineinhalb Jahrtausende die maßgebliche Instanz in der Medizin war, wies dem Gehirn zwar eine Rolle beim Denken zu, konzentrierte sich aber auf die Ventrikel, kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, in denen er einen der vier Säfte des Lebens vermutete, das Pneuma psychikon. Er hielt es für einen Teil der Seele. Erst in der Renaissance begannen die Ärzte die eigentliche Bedeutung des Gehirns zu erkennen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sezierten Ärzte die Gehirne von Patienten mit bis dahin unerklärlichen Störungen. Dabei stießen sie zum Beispiel auf die Sprachzentren der linken Gehirnhemisphäre. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts stritten sich zwei hochangesehene Neurowissenschaftler, der Spanier Santiago Ramon y Cajal und der Italiener Camillo Golgi unerbittlich darüber, wie die Gehirnzellen miteinander kommunizieren. Ironischerweise hatten beide den Medizinnobelpreis 1906 gemeinsam erhalten.
Heute wissen wir unendlich viel mehr als die alten Ägypter über diese rund 1,5 Kilogramm schwere Masse aus Neuronen und anderen Zellen mit der Konsistenz eines hartgekochten Eis. Wir wissen auch unendlich viel mehr als Rudolf Virchow und Ramon y Cajal und ihre Zeitgenossen um die Jahrhundertwende. Wir glauben nicht mehr, dass Ausbuchtungen der Schädeldecke Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften und geistige Fähigkeiten zulassen, wie die Phrenologen im 19. Jahrhundert annahmen. Besonders die bildgebenden Verfahren erlauben den Wissenschaftlern, einigen der rund 100 Milliarden Neuronen und ihren 1014 Synapsen unseres Gehirns beim Denken und Fühlen zuzuschauen. Fast jeden Tag findet man in der Zeitung oder im Internet eine Meldung, welches Areal des Gehirns an welcher Fähigkeit beteiligt sei. Auch mich faszinieren die Computerbilder mit den roten und grünen Flecken, die dem Betrachter das Gefühl geben, Abbilder unseres Denkens und Fühlens mit eigenen Augen zu sehen. Wir sind unser Gehirn.
Dann aber, wenn ich mich mit Neurowissenschaftlern unterhalte, höre ich immer wieder die Sätze »Das wissen wir noch nicht!« »Was dabei genau im Gehirn geschieht, können wir noch nicht sagen.« »Wir müssen vorsichtig sein« mit dieser oder jener Aussage. »Näheres müssen wir noch erforschen.« Die Computersimulationen aus den bildgebenden Verfahren täuschen uns oft genug darüber hinweg, dass das Gehirn für uns Menschen zum größten Teil noch immer ein Rätsel ist. Diesem Rätsel sind die Männer und Frauen der Neurowissenschaft auf der Spur. Sie erkunden, was genau in dieser schwammigen Masse, die im Medizinhistorischen Museum der Charité vor meinen Augen in der wässrigen Formalin-Glyzerin-Lösung schwimmt, vorgegangen sein muss, als sie noch einem lebendigen, denkenden und fühlenden Menschen gehörte.
Ich habe bei meinem Besuch in der Berliner Pathologischen Sammlung ein Stück Demut zurückgewonnen. Die roten, grünen und blauen Flecken der Gehirnbilder aus dem funktionellen Magnetresonanztomografen lassen mich nunmehr an mittelalterliche Weltkarten denken. Ganz grob kann man darauf die Umrisse der Erdteile erkennen, wie sie uns heute vertraut sind. Die häufig befahrenen Küsten sind schon recht genau verzeichnet. Aber gewaltige Gebiete im Inneren der Kontinente werden noch als »terra incognita«, als unbekanntes Land, bezeichnet. Ganze Kontinente fehlen und der Mittelpunkt der Erde ist in Jerusalem lokalisiert. Irgendwo in den Weiten Asiens verzeichnen diese Karten das legendäre Reich des Priesterkönigs Johannes, wo Vampire, Zyklopen und hundsköpfige Menschen leben, wo Edelsteine wie Kiesel die Bachläufe säumen und das Quellwasser Unsterblichkeit verleiht. Vermutlich wird unseren Nachfahren die heutige Gehirnkartografie ähnlich vorkommen wie uns eine mittelalterliche Weltkarte.
Sie werden in diesem Buch die Antworten der modernen Hirnforschung auf einige Fragen finden. Sie werden erfahren, was ein Affe in einem Labor in Parma mit einem Thriller im Kino zu tun hat; warum wir niemals den Zeugen eines Autounfalls Glauben schenken sollten; warum wir uns nicht wünschen sollten, niemals wieder etwas zu vergessen; was es für unsere Wahrnehmung bedeutet, dass Menschen einen Gorilla übersehen, der in einem Video mitten durchs Bild läuft; warum Mutter Teresa auch nur eine Egoistin war; warum quicklebendige Menschen glauben, dass sie tot sind; warum manche Menschen Farben sehen, wenn sie Musik hören; warum wir wissen, was unsere Mitmenschen gerade fühlen und wie wir unser Gehirn auf natürliche Weise dopen können. Wir werden uns bewegen zwischen Philosophie und Praxis. Sie werden Wissenschaftlern begegnen, die sich mit den neurologischen Grundlagen der Sprache, mit Gefühlen, dem Gedächtnis und mit der Wahrnehmung beschäftigen. Sie werden einen Eisenbahnvorarbeiter kennenlernen, der zum Tunichtgut wurde, nachdem ihm eine Eisenstange das Vorderhirn zerfetzte; einen Patienten, der sich nicht mehr an Sie erinnern würde, wenn Sie nach zwei Minuten das Zimmer verließen und einen russischen Journalisten, der sich noch nach vierzig Jahren an jedes einzelne der Worte erinnert hätte, die Sie mit ihm gewechselt haben. Sie werden im Verlauf jedes Kapitels erfahren, was die neuen Erkenntnisse für Ihr Leben bedeuten und wie Sie Ihr Gehirn auf Trab bringen können. Vor allem aber werden Sie sich selbst kennenlernen. Denn wir sind unser Gehirn.
Um was geht es dabei? Unsere Tour d’horizon durch die Neurowissenschaften wird Ihnen helfen, Ihr Gehirn besser zu verstehen. Denn zum einen schöpfen wir unser Potential zum Lernen und Denken oft nicht aus, zum anderen werden wir von unserem Gehirn ständig getäuscht. Der Blick in unser Gehirn und darauf, wie es arbeitet, erlaubt uns, mit Hilfe unserer schlauen Zellen klüger und weiser zu werden.
Bei unserem Rundgang durch die Neurowissenschaften und ihren faszinierenden Erkenntnissen möchte ich Sie noch um Eines bitten: Bewahren Sie die Demut, die vermutlich fast jeder bei einem Besuch in der Charité verspürt. Die Demut vor dem noch immer geheimnisvollsten Organ des Menschen – seinem Gehirn.
»Manche Dinge will man gar nicht so genau wissen«, sagte die Tante meines Freundes T. gern. So geht es vielleicht auch Ihnen, dem Leser dieses Buches. Besonders auf der Ebene der Zellen wird es in den Neurowissenschaften sehr schnell verdammt kompliziert und vieles davon ist für jemanden, der sich mehr für Ergebnisse als für Prozesse interessiert, zum Verständnis nicht unbedingt notwendig. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, detaillierte Informationen in Kästen für »Genau-Wissen-Woller« auszugliedern. Wenn Sie ein vertiefteres Verständnis suchen, können Sie die Hintergrundkästen mit den Zusatzinformationen lesen, die allerdings noch immer in einer stark vereinfachten, anschaulich gemachten Form präsentiert werden. Wer noch mehr wissen will, sei auf die im Literaturverzeichnis aufgeführten Lehrbücher (und von dort auf die Fachbücher und Fachartikel) verwiesen.
An anderen Stellen werden Sie sich fragen: »Ist ja spannend. Aber was hat das mit mir zu tun?« Darauf gibt es zwei Antworten, eine simple und eine etwas komplexere, verschlungenere. Erst die einfache: Welche praktischen Erkenntnisse Sie aus den Ergebnissen der Hirnforschung ziehen können, habe ich in Tipps zusammengefasst, die an den entsprechenden Stellen im Text eingeführt und mit dem Symbol gekennzeichnet sind.
Nun die etwas komplexere: Wenn Sie dieses Buch lesen und sich dabei mit einer Materie beschäftigen, die Ihnen bislang nicht vertraut war, so können Sie genau das bereits als Gehirnjogging ansehen. Die Zauberformel für ein fittes Gehirn, auf die ich im Laufe des Buches und vor allem im letzten Kapitel noch einmal ausführlich zu sprechen kommen werde, lautet ganz einfach: Lernen, Lieben, Laufen. Dieses Buch will Ihnen beim Lernen helfen, es will die Neugier befriedigen, die allen Menschen angeboren ist. Ohne Neugier wäre dieses Buch nicht möglich: die Neugier der Wissenschaftler, die immer genauer und besser verstehen wollen, wie der menschliche Geist funktioniert; die Neugier des Autors, der diese Erkenntnisse recherchiert und zusammengefasst hat und die Neugier des Lesers, der sein eigenes Ich und sein Gehirn verstehen will.
HINTERGRUND FÜR GENAU-WISSEN-WOLLER: DIE ZELLE UND DIE SYNAPSE
Nehmen wir an, ein Ingenieur bekäme den Auftrag, etwas zu erfinden, um Informationen innerhalb des Körpers, innerhalb des Gehirns sowie vom Gehirn zum Körper und zurück zu transportieren. Keiner käme auf die Idee, so etwas wie Neuronen zu erschaffen. Die Dinger sind technisch einfach nicht ausgereift. Im Vergleich zu einem Computer ist die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen den Zellen quälend langsam. Sie liegt zwischen einem und 120 Metern pro Sekunde. Wenn Sie in Stuttgart in ein Telefon sprechen, würde der Ton bei der gleichen Übertragungsgeschwindigkeit ein und eine Viertelstunde später in Hamburg ankommen. Elektrischer Strom fließt zwei Millionen Mal schneller durch ein Kupferkabel. Außerdem konnte sich die Natur nicht entscheiden, ob sie lieber mit Strom oder mit Chemie arbeitet. Und die Schaltkreise sind wahnsinnig kompliziert und verwirrend. Aber die Evolution ist kein Ingenieur. Sie improvisiert mit dem Material, das sie irgendwann einmal hervorgebracht hat. Schließlich ist alles Leben aus Einzellern entstanden, die eines Tages begonnen haben, sich über die nächsten paar Millionen Jahre immer mehr miteinander zu vernetzen und miteinander zu kommunizieren.
Zumal sich das Gehirn nicht auf eine Zellenart beschränkt. Wir finden zwei Formen von Zellen: Neuronen und Gliazellen. Intensiv erforscht sind Neuronen (»intensiv« heißt, man weiß viel über sie, aber nur einen winzigen Bruchteil dessen, was man wissen könnte und möchte). Die Gliazellen machen zwar 90 Prozent aller Zellen im Zentralen Nervensystem (ZNS) aus, wurden aber dennoch lange Zeit von den Neuro(!)wissenschaftlern vernachlässigt. Man nahm an, sie seien so etwas wie Baugerüste und Dixi-Klos auf Baustellen – wichtig zwar, aber die eigentliche Arbeit wird von den Bauarbeitern, den Neuronen, gemacht. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie eine wichtige Rolle bei Gedächtnisfunktionen spielen, indem sie an der Bildung von Myelinschichten und Synapsen beteiligt sind. Was genau da vor sich geht, weiß man noch nicht. (Über Myelin und Synapsen kläre ich Sie später auf!)
Anfang des 20. Jahrhunderts kartografierte der deutsche Neuroanatom Korbian Brodmann Abschnitte des Gehirns nach der Struktur der dort vorherrschenden Zellschichten, ihrer Zytoarchitektur. Seine daraus entstandene Hirnkarte aus 52 Arealen ist nach ihm benannt und wird noch heute, leicht modifiziert, von den Medizinern und Neurowissenschaftlern benutzt.
Die Nervenzellen des Gehirns, die Neuronen also, variieren erheblich in ihrer Form, unterscheiden sich aber deutlich von den anderen Körperzellen. Wie alle Menschen zwar unterschiedlich aussehen, doch mehr oder weniger gleich mit Armen, Beinen und einem Rumpf aufgebaut sind, so ist das auch bei den Nervenzellen. Man findet bei (fast) jedem Neuron einen Zellkörper mit einem Kern, einen langen Ast auf der einen Seite, das Axon, und verzweigte kleinere Äste, Wurzeln ähnlich, auf der anderen Seite. Diese kleinen Verästelungen nennt man Dendriten. Der Zellkern, rund ein Tausendstel Millimeter groß, ist die Fabrik der Zelle. In ihm werden die Bauanleitungen des Lebens verwahrt, in Form von spiralförmigen Ketten von Desoxyribonukleinsäure (DNA), eingeteilt in Abschnitte – die Gene. Diese werden in einem biochemischen Prozess gelesen, und nach deren Anleitung bastelt die Zelle bestimmte Proteine.
Das Axon kann bis zu einem Meter lang werden und sich durch den halben Körper schlängeln – oder auch nur ein Zehntel Millimeter. Das Axon ist so etwas wie die Autobahn der Zelle. Auf ihr werden Signale in Form von elektrisch geladenen Teilchen transportiert. Es läuft in kleine Verdickungen aus, die man präsynaptische Endigungen nennt. Diese treten mit einem ähnlichen Endstück eines Dendriten, Anbindungsstraßen ähnlich, einer anderen Zelle in Kontakt. Die meisten Zellen verfügen über mehrere Tausend Dendriten. Die etwas unscharfe Formulierung »in Kontakt treten« ist mit Absicht gewählt. Die beiden Endigungen berühren sich nämlich nicht, zwischen ihnen bleibt ein kleiner Spalt bestehen. Dieser heißt, Sie ahnen es vermutlich schon, »synaptischer Spalt«. Vereinfacht gesprochen kann man sagen: Signale werden innerhalb der Zellen elektrisch, zwischen den Zellen chemisch weitergeleitet.
Nehmen wir an, ein Signal (Wissenschaftler sprechen vom Aktionspotential) kommt an einer präsynaptischen Endigung als Strom an. Für den Strom ist das End- und Sackgasse. Aber das Signal möchte gerne rüber zur nächsten Zelle. Es muss deshalb auf eine Fähre umsteigen, die durch den präsynaptischen Spalt schwimmt und am anderen Ende im Hafen des postsynaptischen Dendriten einfährt. Die Fähren heißen Neurotransmitter1, und Sie haben sicherlich schon von einigen von ihnen gehört, zum Beispiel Glutamat, Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin und Dopamin. Stellen Sie sich vor, die Häfen auf der postsynaptischen Seite sind wie Anlagestellen von Millionärsclubs an der Côte d’Azur. Dort lässt man nur ganz bestimmte Yachten einlaufen, nämlich wenn sie dem jeweiligen Club zugehören. Wenn die Neurotransmitter-Yachten auf der anderen Seite im Hafen des Dendriten, dem Rezeptorkanal, angelegt haben, laden sie ihre Fracht aus, und es fließt in der Nachzelle ein Strom. (Sie machen das, indem sie auf beiden Seiten Hafenarbeiter einsetzen, elektrisch geladene Calcium- und Natrium-Ionen. Im Hintergrund-Kasten auf Seite 64 ff. können Sie es genauer nachlesen. Wichtig dabei ist, dass die Neuronen nach dem Prinzip Alles-oder-Nichts verfahren. Es lässt sich also nicht nur ein bisschen Signal übertragen. Bestimmte Medikamente und Drogen übrigens verhalten sich wie Piraten. Sie tarnen sich wie die Millionärsyachten, transportieren Produktfälschungen und täuschen damit die Wächter an der Hafenanlegestelle.
Logisch, dass alles noch viel komplizierter ist. So sorgen bestimmte Neurotransmitter (zum Beispiel γ-Aminobuttersäure, kurz GABA) dafür, dass Signale nicht übertragen werden, das Aktionspotential also gehemmt wird.2 Und die Neurotransmitter-Yachten durchqueren den Spalt nicht einzeln, sondern in kleinen Flotten. Grundsätzlich aber gelten zwei entscheidende Regeln:
Erstens: Erst wenn eine ausreichende Anzahl von Neuronen ein Signal übertragen (man spricht davon, dass die Neuronen feuern), löst dies eine Reaktion aus.
Zweitens: Neuronale Verbindungen entstehen, indem Neuronen gemeinsam feuern. Auf Englisch reimt sich diese Aussage sogar: »Neurons that fire together, wire together.«
Wenn die Neuronen in Aktion treten, benötigen sie natürlich Energie. Und zwar eine ganze Menge. Obwohl das Gehirn mit knapp 1,5 Kilogramm nur zwei Prozent der Körpermasse ausmacht, verbraucht es rund 20 Prozent der Energie. Bei Kleinkindern, deren Gehirn sich noch entwickelt hat, sind es bis zu 60 Prozent. Wenn man den Energiezufluss in Form von Traubenzucker (Glukose) und Sauerstoff abschneidet, sterben die Neuronen innerhalb kurzer Zeit. Sie verfügen nämlich über keinen Energiespeicher. Deshalb erleiden Menschen, deren Gehirn länger als ein paar Minuten von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten wurde, unreparierbare Schäden.
Allerdings: Insgesamt betrachtet ist das Gehirn sparsam. Käme die Energie für Ihr Gehirn aus der Steckdose, beliefe sich die Stromrechnung für Ihr ganzes Leben auf weniger als 1.500,- Euro.
Zum Denken braucht Ihr Gehirn Energie, also Sauerstoff und Glukose. So simpel diese Tatsache erscheinen mag, so wichtig ist sie, und so oft wird im Alltag dagegen verstoßen: Frische Luft und eine ausreichende, kohlenhydratreiche Ernährung bringen Ihr Gehirn auf Trab! Es hat also keinen Sinn, die Mittagspause ausfallen zu lassen und stattdessen am Computer hungrig weiterzuarbeiten oder das Meeting durchzuziehen. Besser, Sie nehmen ein ausgewogenes Mittagessen zu sich und gehen danach eine paar Minuten an der frischen Luft spazieren.
HINTERGRUND FÜR GENAU-WISSEN-WOLLER: DEM GEHIRN BEI DER ARBEIT ZUSCHAUEN
Die Neurologen, die vom Ende des 19. Jahrhunderts bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts, also über einen Zeitraum von gut 100 Jahren, wissen wollten, wie das menschliche Gehirn funktioniert, mussten warten, bis deren Besitzer verstorben waren. Damit machten sie sich nicht unbedingt beliebt. Zumal es für sie erst so richtig interessant wurde, wenn die verstorbenen Gehirnbesitzer unter neurologischen Störungen oder Krankheiten gelitten hatten. So befasste sich der französische Neurologe Paul Broca um 1862 mit einem Mann, der nur noch »tan tan« sagen konnte, obwohl sein Sprechapparat nicht geschädigt war. Broca sezierte dessen Gehirn und bemerkte, dass an einer bestimmten Stelle, vermutlich durch einen Hirnschlag, die Gehirnzellen abgestorben waren. Broca schloss daraus: Diese Stelle mit den toten Zellen war für die Sprachstörung verantwortlich. Wir werden uns das Broca-Areal im Kapitel »Sprache und Verstehen« noch näher anschauen.
Darauf zu warten, dass Menschen mit bestimmten Störungen starben und ihr Gehirn der Wissenschaft vermachten, schränkte den Erkenntnisfortschritt erheblich ein. In den letzten ein, zwei Jahrzehnten hat die Neurowissenschaft jedoch aufgrund neuer technischer Methoden einen enormen Schritt nach vorne getan. Heute können wir dem Gehirn bei der Arbeit zusehen. Jedenfalls glauben wir das. Hier die wichtigsten Methoden, ihre Möglichkeiten und ihre Beschränkungen:
Elektroenzephalografie: Diese Methode, kurz EEG genannt, gehört zu den ältesten technischen Verfahren, die Arbeit des Gehirns quantitativ zu erfassen. Dabei werden mit hochempfindlichen Geräten die Gehirnströme gemessen. Um korrekt zu sein, handelt es sich um Spannungsschwankungen, die in den typischen Wellendiagrammen dargestellt werden. Das EEG hat den Vorteil, dass es kontinuierlich misst. Man kann also auf Tausendstel Teile einer Sekunde genau den Zeitpunkt einer Gehirnaktivität feststellen. Dafür lässt sich nur sehr grob sagen, an welcher Stelle das Gehirn aktiv wird, weil die Messbereiche ungenau sind.
Funktionelle Magnetresonanztomografie: Den Bildern, die von dieser mit fMRT abgekürzten Methode geliefert werden, sind Sie bestimmt schon einmal im Fernsehen, in einer Zeitung oder Zeitschrift oder im Internet begegnet. Sie sehen darauf einen Längsschnitt durch das Gehirn, auf dem rote, grüne, gelbe und blaue Flecken zu erkennen sind. Die Aufnahmen entstehen in einem Kernspintomografen, während die Probanden bestimmte geistige Aufgaben lösen oder mit sinnlichen Eindrücken konfrontiert werden. Oft wird behauptet, die Flecken zeigten an, wo das Gehirn bei den jeweiligen Aufgaben aktiv werde. Vielleicht haben diese Bilder mit dazu beigetragen, dass viele Menschen glauben, wir nutzten nur zehn Prozent unseres Gehirns. Diese Behauptung ist Quatsch! So einen Unfug würde sich die Natur niemals einfallen lassen. Schließlich muss sie das riesige Gehirn des Menschen mit Energie versorgen, was verdammt aufwändig ist. Außerdem hat der Mensch einen ungewöhnlich großen Dickschädel, der nur mühsam seinen Weg durch den Geburtskanal findet. Und nach der Geburt noch viele Jahre wächst. Hätte die Evolution das Gehirn auf zehn Prozent seines heutigen Volumens schrumpfen können, weil der Rest unbenutzt herumliegt – sie hätte es getan, weil das einen Überlebensvorteil dargestellt hätte. In Wirklichkeit sind alle Teile unseres Gehirns immer aktiv. Was längere Zeit nicht aktiv ist, stirbt ab. Die fMRT-Bilder zeigen vielmehr, welche Bereiche des Gehirns aktiver sind als gewöhnlich. Die entsprechenden Scanner messen, welche Stellen besonders stark mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Sie tun das mit hoch leistungsfähigen Magneten, da sauerstoffreiches und sauerstoffarmes Blut unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweist. (Dies wiederum hängt mit der Drehrichtung, dem Spin, von Protonen und Neutronen im Atomkern zusammen; daher der Name Kernspintomografie).
Dahinter steht die Überlegung, dass unser Gehirn zum Denken Glukose und Sauerstoff benötigt. Je mehr davon gebraucht wird, desto intensiver denken wir. An den Stellen, wo besonders viel Sauerstoff nachgefragt wird, denken wir also besonders intensiv. Leider ist aus biologischen und technischphysikalischen Gründen nur eine begrenzte Anzahl von Aufnahmen innerhalb einer Zeitspanne möglich. Deshalb erlauben fMRT-Aufnahmen zwar zu erkennen, wo die Gehirnaktivität stattfindet; sie geben jedoch nur unzureichend Auskunft, wann und wie schnell das Gehirn reagiert. Diese Langsamkeit stellt einen erheblichen Mangel dar, denn unser Gehirn zeichnet sich durch ein Netz aus Verbindungssträngen aus. Wir müssen also davon ausgehen: Selbst an Stellen, wo keine verstärkte Aktivität zu beobachten ist, finden Prozesse statt, die für die gerade im fMRT untersuchte Aufgabe unabdingbar sind. Selbst was die aktiven, im fMRT sichtbaren Areale angeht, gießen die Experten Wasser in den Wein. An den jeweiligen Stellen befinden sich 100 Millionen und mehr Neuronen. Von »präzise« mag man da nicht unbedingt reden.
Positronenemissionstomografie: PET-Bilder ähneln den Aufnahmen, die man im fMRT gewinnen kann. Das Verfahren war früher auch in der Grundlagenforschung verbreitet, spielt heute jedoch nur noch in der medizinischen Anwendung eine Rolle, zum Beispiel bei der Krebserkennung. Im Gegensatz zu den extrem starken Magnetfeldern des fMRT, die für den Körper nach heutigem Wissen völlig unbedenklich sind, wird bei der PET den Versuchspersonen ein sehr schwach radioaktives fluoreszierendes Molekül als Marker in den Blutkreislauf gespritzt. Der Marker reichert sich an den besonders aktiven Stellen des Gehirns an und lässt sich mit einer Spezialkamera sichtbar machen. Allerdings finden es Versuchspersonen nicht nett, radioaktiv gespritzt zu werden - daher der Popularitätsverlust der Methode.
Diffusions-Tensor-Bildgebung ist eine Unterform der fMRT, bei der vor allem die Nervenfasern der weißen Masse untersucht werden, indem es die Bewegung von Wassermolekülen entlang der Axone wiedergibt.
Zwei-Photonen-Fluoreszenzmikroskopie: Dieses Verfahren erlaubt es, die Aktivität von Gehirnzellen bis zu einem Millimeter tief im lebenden Gewebe abzubilden – allerdings nur bei Versuchstieren. Das geschieht indem man bestimmte Farbstoffmoleküle mit zwei Lichtteilchen (Photonen) beschießt. Die Moleküle strahlen wenige Nanosekunden später Licht einer anderen Frequenz zurück.
Neurostimulation: Wertvolle Erkenntnisse gewinnen Wissenschaftler zudem, wenn sie bestimmte Neuronenareale bei geöffnetem Schädel elektrisch stimulieren. Hört sich schlimmer an als es ist, da das Gehirn über keine Schmerzrezeptoren verfügt. Allerdings kann man Studenten der Psychologie oder Medizin, die für die anderen Verfahren als Versuchspersonen oftmals herhalten müssen, selten davon überzeugen, ihre Schädel öffnen zu lassen. Patienten, die vor einer Hirnoperation stehen, zum Beispiel wenn ein Tumor entfernt werden soll, müssen sich jedoch einer solchen Untersuchung unterziehen. Der Neurochirurg stellt dabei fest, wo bestimmte Hirnfunktionen im konkreten Fall angesiedelt sind, damit er nicht versehentlich ein Stück Gedächtnis oder Sprachvermögen herausschneidet. Übrigens funktionieren auch so genannte Hirnschrittmacher nach dem Prinzip der elektrischen Stimulation von Neuronen.
Transkranielle Magnetstimulation: Bestimmte Gehirnareale bei geöffnetem Schädel zu stimulieren, schränkt die Verwendbarkeit der Methode erheblich ein. Deshalb hat in den letzten Jahren diese neue Methode in der neurowissenschaftlichen Forschung an Bedeutung gewonnen. Die zu untersuchenden Gehirnbereiche werden dabei gezielt mit Magneten stimuliert oder gehemmt. Auf diese Weise kann man durch den Schädel hindurch (die Bedeutung des Wortes »transkraniell«) zum Beispiel den für die Finger zuständigen Bereich des motorischen Cortex anregen – und, schwupp, bewegt sich ein Finger der Versuchsperson – ohne dessen bewusste Entscheidung. Umgekehrt lassen sich Gehirnareale für einen Zeitraum von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten ausschalten. Man kann dann sehen, ob ein bestimmter Gehirnbereich bei einer Funktion eine Rolle spielt.
1. KAPITEL
GEDÄCHTNIS UND LERNEN
In diesem Kapitel lernen Sie einen berühmten Gedächtnisforscher kennen sowie putzmuntere amerikanische Nonnen, die Ihnen ihr Geheimnis geistiger Gesundheit enthüllen. Sie erfahren, wo genau im Gehirn sich Erinnerungen und Erfahrungen verstecken. Sie werden lernen, Ihrem Gedächtnis und dem Ihrer Mitmenschen gründlich zu misstrauen. Und Sie erhalten Tipps, wie Sie sich vor Alzheimer schützen und Ihr Gehirn fit halten können.
An den 9. November 1938 kann sich Erich Kandel noch gut erinnern. Zwei Tage zuvor hatte er, Sohn eines jüdischen Spielwarenhändlers, zu seinem neunten Geburtstag ein blaues, über ein Kabel ferngesteuertes Modellauto geschenkt bekommen, das er nun durch die kleine Wiener Wohnung steuerte – durchs Wohnzimmer, durchs Esszimmer, durchs Schlafzimmer und wieder zurück. Doch am frühen Abend dieses 9. November hämmert es gegen die Tür. Erichs Mutter öffnet. Zwei Nazi-Schergen drängen in die Wohnung. »Alles zusammenpacken! Raus hier!«, befehlen die Männer barsch. Erich und seine Mutter raffen ein paar Wäschestücke und Toilettenartikel zusammen. Der ältere Bruder Ludwig greift sich immerhin noch seine Münz- und Briefmarkensammlung und rettet sie so vor der folgenden Plünderung der Wohnung. Das blaue Modellauto bleibt zurück. Erich wird es nie wieder sehen.
67 Jahre später notiert Erich Kandel für seine Memoiren diese Erinnerungen an jenen Tag in Wien, der als »Reichskristallnacht«, später als »Reichsprogromnacht« in die Geschichte eingegangen ist. Außerdem wird er die Szene der deutschen Dokumentarfilmerin Petra Seeger berichten, die sich zusammen mit ihm und seiner Frau auf die Spurensuche in das Wien der Gegenwart begeben hatte. Der Film trägt, ebenso wie Kandels Memoiren, den Titel »Auf der Suche nach dem Gedächtnis«. Erich Kandel und sein Bruder wurden von den Eltern nach einigen Monaten der Angst und des Schreckens zu einem Onkel nach New York geschickt. Die Eltern konnten kurz darauf ebenfalls den Nazis entkommen. In den Vereinigten Staaten amerikanisiert Erich seinen Vornamen, indem er den letzten Buchstaben streicht. Als Eric Kandel wird er einer der bedeutendsten Gedächtnisforscher der Welt. Im Jahre 2000 erhielt er für seine Forschung darüber, wie Neuronen Gedächtnisinhalte speichern, den Medizinnobelpreis.
Kandels Erinnerungen führen uns mitten hinein in die entscheidenden Fragen, mit denen sich dieses Kapitel beschäftigt. Es geht um das Gedächtnis, und damit um eine jener Fähigkeiten, die uns von allen anderen Säugetieren unterscheidet. Nur der Mensch ist in der Lage, sich Ereignisse aus der Vergangenheit bewusst wieder vor Augen zu führen, ja sie in gewisser Weise in seinem Kopf nochmals zu durchleben. Diese Formulierung ist in zweierlei Hinsicht wörtlich zu verstehen. Zum einen spielt das Wörtchen »bewusst« eine große Rolle, denn ein Gedächtnis haben fast alle Lebewesen. Das gilt wohl, wie einige Wissenschaftler vermuten, sogar für Pflanzen. Sie können sich an bestimmte Stress-Reize wie Hitze, Kälte, UV-Bestrahlung oder Schädlinge erinnern und die Erfahrung in ihrer Erbsubstanz einlagern. Dieses »pflanzliche Gedächtnis« funktioniert allerdings völlig anders als bei Tieren und dem Menschen. Bei diesen beiden hingegen sind – evolutionsbiologisch naheliegend – die neurobiologischen Abläufe sehr ähnlich. Eine Tatsache, die letztlich Eric Kandel den Nobelpreis sicherte. Wir können die Formulierung vom »bewusst vor Augen führen« aber noch in einen zweiten Sinne wörtlich verstehen. Wie wir später noch sehen werden, geschieht auf der Ebene der Gehirnzellen, der Neuronen, genau dies: Wir erneuern, wenn wir uns an frühere Erlebnisse erinnern, die Aktivitätsmuster, die die Ereignisse zum ursprünglichen Zeitpunkt hervorgerufen haben. Es feuern die gleichen Neuronen – oder, genauer gesagt, fast die gleichen.
WIE WAHR SIND UNSERE ERINNERUNGEN?
Doch wie sicher können wir uns sein, dass unsere Erinnerung und die ursprüngliche Realität übereinstimmen? Schließlich sind wir oftmals felsenfest davon überzeugt, bestimmte Dinge genau so und nicht anders erlebt zu haben, wie sie in unserem Gedächtnis abgespeichert sind.
Viele Menschen glauben, das Gedächtnis sei so etwas wie eine DVD-Kamera, die die Wirklichkeit aufnimmt und die es uns ermöglicht, den Film jedes Mal gleich wiederzugeben. Wenn Sie sich Ihre Urlaubsvideos anschauen, dann werden Sie stets die gleichen Bilder sehen, egal, wie oft Sie den Film auch abspielen. Dank der modernen Digitaltechnik verlieren die Aufnahmen noch nicht einmal an Qualität. Unsere Erinnerung hingegen, das kennen wir alle, verblasst.
Ähnelt unser Gedächtnis also eher jenen Super-8-Filmen, auf die bei manchen Älteren unter uns die Eltern noch die eine oder andere Kindheitsszene gebannt haben? Deren Material wird porös und brüchig. Die Bilder werden von Mal zu Mal, bei jedem Abspielen, grobkörniger und unschärfer. Kratzer und Flimmern tauchen auf. Manchmal reißt das Material, und am Ende zerbröselt der ganze Film. Aber selbst diese Metapher stimmt nicht. Unsere Erinnerung wird mit dahinschreitender Zeit nicht nur undeutlicher, sie verändert sich auch. In manchen Fällen entsteht sogar eine vollkommen neue Erinnerung, ohne dass uns dies bewusst ist. Und die Erinnerung ist hochgradig manipulierbar.
Das haben zahlreiche Gedächtnisstudien nachgewiesen. So zeigten Wissenschaftler in mehreren Versuchen Collegestudenten Videoaufzeichnungen, auf denen sie den Ablauf eines Verkehrsunfalls verfolgen konnten. Die Studenten sollten sich so viele Details wie möglich merken. Später fragten die Forscher die Studenten nach diesen Einzelheiten. Sie stellten dabei allerdings suggestive Fragen, zum Beispiel »Hat der Fahrer des grünen Wagens das Stopp-Schild übersehen?«, obgleich in Wirklichkeit eine Ampel zu sehen gewesen war. Die Studenten antworteten darauf nicht nur falsch – sie bezogen die gefälschten Erinnerungsdetails auch in spätere Erzählungen ein und berichteten dann ganz von selbst, dass der Fahrer das Stopp-Schild missachtet habe. Dabei zeigten sie sich fest davon überzeugt, sich korrekt zu erinnern. Das Phänomen spielt eine wichtige Rolle bei Zeugenbefragungen. Durch suggestive Fragen in einem Verhör können nämlich Zeugen dazu gebracht werden, sich an Dinge zu erinnern, die sie nie erlebt, gesehen oder gehört haben. Elizabeth Loftus, Psychologieprofessorin an der Universität von Washington D.C., hat mit ihrem Team hunderte Experimente durchgeführt, die zeigen, dass eine Beeinflussung möglich ist. Dabei geht es in der Regel um Kleinigkeiten. So inszenierten Studenten einen Überfall, der von Versuchspersonen als Zeugen beobachtet wurde. Nachher wurden die Zeugen nach dem Kassettenrecorder gefragt, der bei dem Überfall geklaut worden sei. Sie ahnen es vermutlich: Es gab gar keinen Kassettenrecorder! Trotzdem konnten ihn einige Probanden bis ins Detail beschreiben. Damit ist klar: Zeugenaussagen in Gerichtsverhandlungen über Details des Geschehens sind notorisch unzuverlässig. Das gilt besonders, wenn sich die Zeugen bereits auf eine Haltung oder Interpretation festgelegt haben. Wir werden später dazu einige besorgniserregende Beispiele kennenlernen.
Ira Hyman, Professor für Psychologie an der Western Washington University in Bellingham, gelang es sogar, in mehreren berühmt gewordenen Experimenten Psychologiestudenten falsche Kindheitserinnerungen zu suggerieren. Die Wissenschaftler hatten bei den Eltern Informationen über Ereignisse aus der Kindheit der Studienteilnehmer eingeholt. Dann wurden die Studenten zu insgesamt drei autobiografischen Interviews eingeladen. Die Forscher befragten sie im ersten Gespräch zu mehreren echten Erlebnissen – und zu einem erfundenen. Zum Beispiel: Erinnern Sie sich, wie Sie bei der Hochzeit von Freunden der Familie so herumgetobt sind, dass Sie einen Tisch umgestürzt haben und die Festtagsbowle zu Boden stürzte? Im ersten Interview konnte sich keiner der Studenten an dieses Ereignis erinnern – kein Wunder, denn es hatte ja nie stattgefunden.
Im dritten Interview glaubte plötzlich ein Viertel der Teilnehmer, den verhängnisvollen Bowlensturz wieder vor Augen zu haben. Einige Studenten konnten das Ereignis sogar in den lebhaftesten Farben mit allen damals angeblich durchlebten Emotionen schildern, etwa wie sie selbst peinlich berührt gewesen und wie sie von den Eltern ausgeschimpft worden seien.
Ein Forscherteam um Elizabeth Loftus, der Washingtoner Psychologieprofessorin, konnte erwachsene Versuchspersonen (wie fast immer in diesen Experimenten handelte es sich um Psychologiestudenten) sogar so verunsichern, dass sie nicht ausschlossen, ein Ereignis erlebt zu haben, dass sie für höchst unwahrscheinlich hielten. Die Wissenschaftler fragten die Studenten, für wie wahrscheinlich sie es hielten, dass Menschen vom Teufel besessen sind. Vernünftig, wie man es von Jungakademikern erwarten darf, betrachteten die meisten von ihnen Besessenheit als eher unwahrscheinlich. Danach sollten die Probanden mehrere Artikel angeblich auf Stil und Rechtschreibung prüfen. Die Texte handelten unter anderem von Fällen der Besessenheit und behaupteten, Besessenheit sei ein gängiges Phänomen, und bei sehr vielen Kindern hätte man schon einmal Anfälle von Besessenheit beobachtet. Geraume Zeit später wurden die Studenten erneut befragt, und zwar auf bewusst suggestive Weise. Und siehe da: Die Probanden hielten Besessenheit nicht nur für wahrscheinlicher, einige waren sich zudem sicher, in ihrer Kindheit einen Besessenheitsanfall beobachtet zu haben.
Trauen Sie Ihren Kindheitserinnerungen nicht. Das gilt nicht zuletzt für Erinnerungen an die frühe Kindheit. Da sich die Einlagerung von expliziten Gedächtnisinhalten im Hippocampus langsam entwickelt, können wir erst ab einem Alter von etwa drei Jahren bewusste autobiografische Erinnerungen aufbauen. Alles, was vor diesem Zeitpunkt liegt, basteln wir uns aus den Erzählungen von Eltern und Verwandten nachträglich zusammen. Es kann natürlich wahr sein – aber es handelt sich auf keinen Fall um Ihre autobiografische Erinnerung.
Der Regisseur Paul Verhoeven hat die Idee der eingepflanzten Erinnerungen 1990 in seinem bekannten Science-Fiction-Film »Total Recall« (»Die totale Erinnerung«) weitergesponnen. Seinem Protagonisten, dem Arbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), werden darin Erinnerungen an einen Marsausflug eingepflanzt. Doch dann geraten Wirklichkeit und Erinnerung durcheinander…
Ist es wirklich möglich, erwachsenen Menschen zentrale falsche autobiografische Erinnerungen zu suggerieren? Zum Beispiel einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit? Diese Frage ist unter Experten heftig umstritten. Darum geht es seit den neunziger Jahren im »Gedächtnisstreit« unter amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten. Als sich in dieser Zeit in den Medien Berichte über Missbrauchsfälle häuften, glaubte eine Reihe von Menschen, selbst missbraucht worden zu sein, die Erinnerung daran aber viele Jahre oder Jahrzehnte verdrängt zu haben. »Verdrängung«, vor allem, wenn es um Sexualität geht, ist eine zentrale Idee Sigmund Freuds und der Psychotherapie. Als Elizabeth Loftus behauptete, Verdrängung sexuellen Missbrauchs komme in der Wirklichkeit so gut wie nie vor, stieß sie natürlich auf den Widerspruch einer ganzen Therapie-Industrie. Zeitweise sah sie sich Morddrohungen ausgesetzt, nachdem ihre Gutachten die Verurteilung von Beschuldigten verhindert hatten. Die Frage, wie häufig falsche