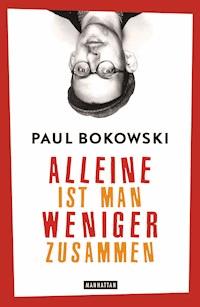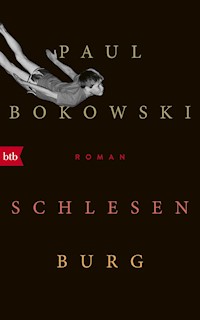
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wie Paul Bokowski uns rauslockt, zum Spielen in den Hof, in die Sehnsüchte und Abgründe der Kindheit, das ist großes Leseglück." Bov Bjerg
Schlesenburg wurde sie genannt, unsere Siedlung am Stadtrand, in der im Sommer 89 die Wohnung der Galówka brannte. Sechzig Familien waren wir, fast allesamt aus Polen. Und plötzlich ging die Angst um, jetzt würden hier bei uns Rumänen oder Russlanddeutsche einziehen. Die halbe Burg schaute mit Abscheu auf das Asylbewerberheim, wo sie alle wohnten, und mit zu viel Stolz darauf, dass man es selber hinter sich gelassen hatte. Es war das Jahr, in dem das neue Mädchen in die Siedlung zog, das Jahr, in dem Darius verschwand, in welchem Mutter nur Konsalik las und ich zu spät begriff, dass Vater mit der ausgebrannten Wohnung seine eigenen Pläne hatte...
„Schlesenburg“ erzählt von Flüchtlingen und ihren Hiergeborenen, von Heimweh und einer neuen Heimat. Ein so warmherziger wie bittersüßer Roman über den Traum von Anpassung und Wohlstand – und die Frage, wo man hingehört, wenn man nicht weiß, wo man hergekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch:
Schlesenburg wurde sie genannt, unsere Siedlung am Stadtrand, in der im Sommer ’89 die Wohnung der Galówka brannte. Sechzig Familien waren wir, fast allesamt aus Polen. Und plötzlich ging die Angst um, jetzt würden hier bei uns Rumänen oder Russlanddeutsche einziehen. Die halbe Burg schaute mit Abscheu auf das Asylbewerberheim, wo sie alle wohnten, und mit zu viel Stolz darauf, dass man es selber hinter sich gelassen hatte. Es war das Jahr, in dem das neue Mädchen in die Siedlung zog, das Jahr, in dem Darius verschwand, in welchem Mutter nur Konsalik las und ich zu spät begriff, dass Vater mit der ausgebrannten Wohnung seine eigenen Pläne hatte …
»Schlesenburg« erzählt von Flüchtlingen und ihren Hiergeborenen, von Heimweh und einer neuen Heimat. Ein so warmherziger wie bittersüßer Roman über den Traum von Anpassung und Wohlstand – und die Frage, wo man hingehört, wenn man nicht weiß, wo man hergekommen ist.
Zum Autor:
Paul Bokowski, geboren 1982, ist Autor und Vorleser. 2012 erschien sein erfolgreicher Kurzgeschichtenband »Hauptsache nichts mit Menschen«. Es folgten »Alleine ist man weniger zusammen« und »Bitte nehmen Sie meine Hand da weg«. »Schlesenburg« ist sein Romandebüt. Paul Bokowski lebt und arbeitet in Berlin.
Paul Bokowski
Schlesenburg
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die handelnden Figuren dieses Romans sind fiktiv. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
Copyright © 2022 btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Gallery Stock / Neal White
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-27947-9V001
www.btb-verlag.de
www.facebookcom/btbverlag
1
Precz
Bis zum Feuer in der Nummer 11, ich war gerade neun geworden, war die Schlesenburg eine makellose Wohnbausiedlung. Ein blütenweißer Sozialbaukomplex am nördlichen Ende des Breslauer Rings. Nimmt man es genau, war dieser Ring nichts anderes als eine schnurgerade Straße, die nach Süden hin abfiel. Die leichte Steigung machte den Gang zur Arbeit mühseliger als den Weg zu Aldi, was Vater seit jeher als kapitalistisches Kalkül betrachtete. Ich war zwei, als wir in die Schlesenburg zogen. An nichts davor kann ich mich erinnern. Schon gar nicht an das Flüchtlingsheim am südlichen Ende des Breslauer Rings. Eigentlich war es eine Asylbewerberunterkunft. Aber die Zeit, die es brauchte, das Wort in voller Länge auszusprechen, war so lang, dass es aufsummiert eine gut bezahlte Nachtschicht bringen konnte, das Ganze etwas abzukürzen. Außerdem fand es Mutter höhnisch, dass man den Neuankömmlingen gleich am Anfang einen Achtsilber abverlangte. Wir sagten also schlichtweg Lager dazu.
Wenn ich mich im vierten Stock der Schlesenburg in das Geländer presste und die Bäume am Ring keine Blätter trugen, war es mir im Schwindel so, als könne ich das Lager am Horizont erahnen. Aber so waghalsig ich mich später auch über die Brüstung beugte, mit fünf oder sechs oder sieben Jahren, nie wollte mein Blick weiter reichen als bis zum Hallenbad mit seinem führerlosen Sockel. Diesem meterhohen Sandsteinklotz, auf dem früher, vor dem Krieg und im Krieg, ein großer strenger Hitlerschädel in die Altstadt gestarrt hatte, bis er in den letzten Kriegstagen verschwand. Egal wie leichtsinnig ich meinen kleinen Körper auch über dem Abgrund der Erinnerung balancierte. Nur manchmal, ganz selten, konnte ich unten im zweiten Stock unseres Hauses zwei fahle Beine entdecken. Wir Kinder in der Burg gierten immerzu darauf, endlich einen Toten zu sehen. In der Hierarchie der Schlesenburg hätte es mich ein ganzes Stück vorangebracht, dahingehend der Allererste zu sein. Einmal, mit sechs, sah ich im zweiten Stock sogar Brüste, die aber zu rosig glänzten, um eine Tote zu sein. Umgehend verlor ich jedes Interesse und fand es, bis zuletzt, nicht wieder. Der Mehrwert zweier Brüste wollte sich mir damals wie heute nicht erschließen. Auch Vater stand sehr gerne am Balkon. Dass er nicht träumerisch die Aussicht genoss oder wehmütig Richtung Osten starrte, sondern jahrelang und immerfort auf junge deutsche Brüste hoffte, das kam mir erst mit Mitte zwanzig in den Sinn.
Die Nachricht vom Bau der Schlesenburg hatte im Lager wie ein Lauffeuer die Runde gemacht. Mein Vater scharwenzelte fortan wöchentlich um die Baugrube herum, und als der Rohbau endlich stand, schoss er uns bei der ersten Maklerin am Platz die beste Dreiraumwohnung, gleich im ersten Block. Vater hatte wenig Charisma, aber einen basslastigen slawischen Akzent und tiefe braune Augen. Ich muss nicht selbst dabei gewesen sein, um erahnen zu können, wie der Frau die Hitze an den Hals schoss, als sie ihn sah. So war das oft. Einen Mann, der schon zu Ostern eine beneidenswerte Sommerbräune annahm und erst nach Weihnachten wieder erblasste. Wie es ihr vorkam, als wäre da, neben dem Muff nach Heizkörperlack und frischem Estrich, ein zarter Duft von Nadelholz und herbsttrockenem Gras und in der Kopfnote ein braunes Fohlen. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass die Leute die Symphonie von Kernseife, Graubrot und Papierfabrik missinterpretierten, die Vater nach der Nachtschicht mit nach Hause brachte. Mutter sah die Maklerin, wie ihr die Augen glänzten, wie ihre Haut in Rottönen changierte, wie ihre Hemdbluse sich wölbte und wie sie Vaters leicht debiles Grinsen als Geschäker missverstand. Fortan hasste Mutter diese Wohnung. Aber hin und wieder, wenn sie vom Sliwowitz etwas angetrunken war, dann machte sie meinen Vater nach. Wie er einschlug, damals im Rohbau, mit der zarten toupierten Frau, die in Mutters herrlicher Scharade immer schwärmerischer wurde und kleiner, von Jahr zu Jahr, bis sie ihr irgendwann nur noch ans Kinn reichte. Wie er einfach einschlug, mein Vater, als hätte er soeben einem großporigen polnischen Bauern nach durchzechter Nacht die beste Kuh des Hofes abgeschwatzt. Wie er so plötzlich und grob und über jede Geschlechtlichkeit hinweg mit ihr einschlug, dass in Mutters nachahmender Einlage die Schulterpolster der Maklerin vor Schreck in die Luft sausten. Wie sogar die goldenen Seemannsknöpfe ihres Blazers rotierten, als wären sie besessen. Und Klein-Hannah lag, wenn sie denn schon existierte, auf dem Cordsofa und überschlug sich fast vor Lachen. Ich hatte diese Scharade schon hunderte Male gesehen, und als Mutter merkte, dass es mir zu doof wurde, mit zehn oder elf, da legte sie noch eins drauf. Dann machte Mutter das Gesicht. Sie machte das Gesicht der Maklerin in dem Moment, als Vater mit ihr einschlug. Als er die Spannung zwischen ihm und ihr durchbrach, wie ein Blitz, der sich durch ihre kleine behagliche Atmosphäre aus 8x4, Magie Noire und Haarlack bohrte. Mutter machte das Gesicht einer Frau, die nicht verstand, wie ihr geschah, weil eben nichts geschah. Das Gesicht einer Frau, der man ein leeres Glas ins Gesicht geschüttet hatte. Die vor nichts und wieder nichts ganz fürchterlich erschrak. Die bis ins Mark hinein überrumpelt worden war, von einem rehäugigen Mann, der nicht mal richtig deklinieren konnte, der nichts anderes von ihr begehrte, als einen Mietvertrag, und die sogleich begriff: ach, doch nicht.
Als Frau Mazurka an jenem Morgen im August ’89 den zarten weißen Qualm aus dem gekippten Fenster in der Nummer 11 steigen sah, bemerkte ich tief hinten in meinen Augenwinkeln, wie sie sich bekreuzigte. Ich lag auf den schattigen Garagen. Flach wie ein Seestern mitten auf den harten Kieseln. Von den betonierten Waben kroch mir eine frische Kühle in den Rücken. Zweimal bekreuzigte sie sich. Einmal in Höhe ihres Herzens und ein zweites Mal mittig über ihrem Nabel. Man konnte ihn ganz deutlich unter ihrem Blumenkleid erkennen, da er sich neuerdings nach außen wölbte. Weil das Kind dahinter langsam gar wurde. Es muss erwähnt werden, dass Frau Mazurka sich eigentlich immerzu bekreuzigte. Wenn sie einen Rettungswagen sah; eine schwarze, tote oder einäugige Katze; wenn ihr ein Messer zu Boden fiel oder die Milch kippte; wenn sie in der S-Bahn eine Roma sah; aber auch oft aus Dankbarkeit, wenn ihr Mann nach seiner Tour nicht nach andern Weibern, sondern käsig roch. Einmal, viele Jahre später, sah ich sie bei Aldi, wie sie sich mit einer demütigen Kreuzgeste über die Brust fuhr, nur weil sie im Kühlregal einen rabattierten Speisequark gefunden hatte. Folglich hätte Frau Mazurka keinen großen Unterschied gemacht, auch ohne die Zwillinge Baranowski, die wie jeden Tag um diese Zeit auf dem Bänkchen vor der 11 hockten und beteuerten, dass die Witwe Galówka keineswegs verbrennen, sondern nur die Kohlrouladen von gestern aufbraten würde.
»Wird’s ein Bub?«, fragte der rechte Baranowski.
Aber Frau Mazurka starrte noch immer auf die dünnen Rauchschwaden, die aus dem gekippten Küchenfenster stiegen.
»Wird es ein Bub?«, wiederholte er.
»Mädchen«, sagte Frau Mazurka. Ihr Gesicht glitt herum. Es war immer fahl und vom Warten auf die Niederkunft ermüdet.
»Sie müssen Graupen essen. Und Knoblauch«, sagte der linke Baranowski.
»Roh, sag ich. Immer roh. Dann kriegt das Kind ein Glied.«
Frau Mazurka aber hatte ihre schweren Beine längst wieder in Bewegung gesetzt und schritt mit ihrem fleischigen Tornister schwankend wie ein Pendel die Kiesplatten entlang in Richtung Nummer 15. Sie ging etwas eiliger als sonst, weil Darius, ihr Großer, schon verloren vor dem Wohnblock stand und sich aus Langeweile Ligusterbeeren in den Mund schob. »Ist noch nicht zu spät!«, riefen ihr die beiden Baranowskis hinterher.
Während der Rauch, der aus dem Fensterspalt nach draußen quoll, dicker und dunkler wurde, pulte sich der linke Baranowski mit einem Stück Staniolpapier eine Graupe aus dem Kiefer. Sie war vom Speichel aufgeweicht, also zerrieb er sie zwischen seinen Fingern. Ich war mir sicher, dass er sich jetzt schon darauf freute, die krustigen Reste, nach einer Stunde, vielleicht zwei, einem Ahnungslosen mit einem langen Handschlag mitzugeben.
Von den zahlreichen Weisheiten, die Mutter mir als Kind immer wieder eingebläut hatte, war es fast die eindrücklichste: den Baranowskis nie die Hand zu schütteln.
»Hände waschen!«, brüllte Mutter oft.
»Sind doch«, rief ich.
»Was hast du angefasst?«, rief sie durch die Wohnung.
»Nichts«, beteuerte ich.
»Die tote Ratte in der Einfahrt?«
Das war ein Test. Ganz sicher.
»Welche Ratte?«, rief ich ahnungslos.
»Die Zwillinge?«, erhöhte Mutter.
»Nein!«, brüllte ich.
»Sicher?«
»Ja, sicher!«
»Dann komm essen!«
Niemand in der Schlesenburg wusste zu sagen, wie den steinalten Baranowskis die Ausreise aus dem Mutterland gelungen war. Rein körperlich. Sie hatten jenes biblische Alter erreicht, in dem die Gesichter zu wuchern begannen. In dem Lider und Lippen so sehr an Spannung verloren, dass sie sich fast nach außen kehrten. In dem sich die Ohren nicht mehr darum scherten, was die Nase tat und alle Proportionen auseinanderströmten. Einmal sah ich eine Sendung über Hummer und hatte drei Nächte lang den fürchterlichen Traum, den Baranowskis würde die schuppige Haut quer über dem Kopf zerreißen und herausgeschlüpft aus der alten Hülle kämen zwei frische, rosige Fleischlinge. Gespenstische Kreaturen, die fortan leichtfüßig durch die Nachbarschaft spazierten, bis ihnen ein neuer Panzer wuchs. Aber die beiden Greise, die im Hochparterre der Nummer 9 wohnten, schälten sich nicht und brauchten, wie immer, einen halben Tag rüber bis zur Nummer 21 und am Nachmittag zurück. Vor jedem Eingang, an jedem Bänkchen machten sie Rast, und je nachdem vor welchem Haus sie saßen, konnte man mit einer erschreckenden Genauigkeit ablesen, wie viel Uhr es gerade war. So muss es zwölf gewesen sein, als hinter den Jalousien der Witwe Galówka die Scheiben zersprangen und ein dicker schwarzer Qualm und kleine Flämmchen durch die Löcher in den Sichtblenden über den Fenstersturz züngelten. Eben war ich noch in heller Freude von der Garage gestiegen, aber jetzt standen wir voll Ehrfurcht vor dem Haus, raunten und gafften. Erst nur Darius und ich, gleich danach auch seine Mutter und die Baranowskis, dann die ersten Kleinen und Größeren, zwei Mütterchen, vier Mütterchen, sechs Mütterchen und bald die halbe Siedlung.
Bevor die Schlesenburg gebaut wurde, war unsere Stadt am nördlichen Kopf des Breslauer Rings zu Ende. Nur zwei Dinge lagen südlich davon: das Asylbewerberheim und das Stadtbad West mit seinem Freiluftbecken. Oft habe ich mich in meiner Kindheit in diesem Hallenbad faul an den Beckenrand geklammert. Dort hing ich, während Mutter auf den beheizten Bänken lag und unauffällig las, während die anderen Kinder aus der Siedlung versuchten, sich gegenseitig ins tiefe Becken zu zerren oder zu ertränken. Verträumt lag ich im flachen Wasser und starrte auf das große Wandbild, das in einem breiten Fliesenspiegel die ganze Seitenwand bedeckte. Eine Luftaufnahme unserer Stadt, Ballonfahrerperspektive aus den späten 50ern. Das Panorama war groß gezogen und in braunstichigen Punkten auf die Kacheln gedruckt. Auf das stolze Fachwerk im alten Dorfkern folgte herrschaftlicher Sandstein, eine schmale Reihe hübscher Gründerzeitbauten, dann solider Backstein, hinter dem man die schmucklosen Wohnblöcke des Erbbauvereins verborgen hielt. Man hätte das blecherne Schild am Ortseingang mit jeder anderen westdeutschen Stadt vertauschen können. Keinem der 30 000 Einwohner wäre es länger als drei Tage komisch vorgekommen, dass die Schillerstraße nach links statt rechts abbog, oder dass der schmalbrüstige Pfarrer mit der Nickelbrille über Nacht ergraut war. Nicht einmal die sonderbar trügerische Erinnerung daran, dass die Albert-Schweitzer-Oberschule vorgestern noch den Geschwistern Scholl gewidmet gewesen war. Mit etwas Phantasie konnte ich auf dem Wandbild das Lager erkennen. Denn als die Vertriebenen kamen, aus Böhmen und Mähren und Pommern und Ostpreußen, da baute man ihnen, mit letzter Kraft und wenig Herzblut, ein schäbiges Flüchtlingsheim tief hinein in die flache Landschaft. Eine aschgraue, grob verputzte Kolonne, die auch auf dem Fliesenspiegel deutlich in die Felder ragte. Gebaut wurde die Unterkunft für fünf Winter, höchstens zehn, trotzdem sollte ich vierzig Jahre später darin liegen, sitzen, krabbeln, laufen lernen. Ein hässlicher Wurmfortsatz, von dem man tagtäglich überrascht war, dass er sich nicht entzündete. Und trotzdem hatte man die stumpfen Instrumente immerfort im Anschlag, um das septische Anhängsel bei erstbester Gelegenheit wieder aus dem Boden zu schaben. Auf dem Fliesenbild war auch die neue Grenze um die Westseite unserer Stadt gezogen. Eine Schnurgerade, die man in großstädtischem Hochmut den Breslauer Ring nannte. Mit meinen chlorgebrannten Augen folgte ich der zweispurigen Straße bis zu ihrem nördlichen Ende, in größtmöglicher Distanz zum Asylbewerberheim. Doch die Schlesenburg gab es noch nicht, dafür war das Bild zu alt. Nur drei unscharfe Trassen über eine Brache gab es, an denen Raupen und ein kleiner Baukran bereitstanden, um dem alten Reich, hier, im hintersten Winkel der Stadt, ein Denkmal zu setzen. Drei Denkmäler, um genau zu sein. Jedem Reich das seine: die Preußenzeile, den Pommernweg und die Sudetensiedlung. Und dort zogen sie hin, die Ersten aus dem Lager: die Pommern, die Ostpreußen und die Sudetendeutschen. Drei Dekaden lang zerfloss die romantische Silhouette unserer Stadt in einer Giebelzeile, je einem Kirschbaum, einer Wäschespinne, einer Laube, einem flachen Zaun und ab und zu den Löffeln eines Feldhasen. Bis im Frühjahr ’83 schließlich, für den dritten oder vierten Schwung im Lager, die Schlesenburg gebaut wurde. Sechzig Wohnungen, die makellos, aber wie ein irrläufiger Zahn aus der Landschaft ragten und auf dem Fliesenbild im Hallenbad vermutlich auch noch heute fehlen.
Sechs Jahre später war Frau Galówka tot. Das war uns allen klar, sogar Darius und mir und selbst den Kleinen. Allen, die wir vor der Nummer 11 standen und zuschauten, wie der schwarze Qualm, gleich einem umgekehrten Wasserfall, die Häuserwand hinaufplätscherte. Zu ihrem Glück war sie es schon, als sie verbrannte. Die Galówka war tot, als sich die filterlose Roth-Händle in ihrer auskühlenden Hand durch den synthetischen Überwurf ihres Bettes schmorte. Als die feine Glut die dankbare Matratze in Brand steckte. Als die Baranowskis ihre Runde drehten und ganz bestimmt auch, als der alte Gottlieb Doenhardt in der Sudetensiedlung kauerte und mit dem Feldstecher die Rauchschwaden observierte. Verborgen hinter seiner Bogengardine Valentina. Jede Wohnung in der Schlesenburg ging nach vorne wie auch nach hinten raus. So konnte sich das Feuer auch zur Straßenseite hin bemerkbar machen. Dass der alte Doenhardt einen Feldstecher besaß, wussten wir schon lange. Nicht zuletzt, weil wir selbst ein dunkelgraues Fernglas im Schränkchen stehen hatten. Etwas kleiner vielleicht, entwendet vor zwei Jahrzehnten aus der Polnischen Volksarmee. Ganze Nachmittage lang stand ich hinter unserer Wellengardine Barbarella und jagte mit sagenhaftem Tempo durch die Nachbarschaft.
»Mama! Die Deutschen! Die waschen ihre Autos sonntags!«, rief ich.
»Wahnsinn!«, rief Mutter.
»Mama! Die Deutschen baden wieder!«
»Nein!«, rief sie wie entrüstet.
»Doch!«, rief ich. »Zwei Mal in der gleichen Woche!«
»Du flunkerst doch!«, rief Mutter, wenn es passte.
»Und die Deutschen, die fahren Fahrrad, Mama! Mitten am Balkon!«
Wenn abends in der Sudetensiedlung die Balkontüren auf Kipp standen, konnte man in der Spiegelung der dunklen Scheiben die Fenster unserer Siedlung sehen. Das deutsche Pärchen aus der Nummer 11 konnte ich erkennen. Einen der Baranowskis, eine schmucklose Wohnung aus der 9, vielleicht die Neue mit den Pockennarben und der burschikosen Tochter und dann bei uns im Zweiten die Familie Akkaya. Alles mit dem Feldstecher von Vater. Und einmal, im Winter, sah ich im Haus vom alten Doenhardt zwei schwarze Rohre aus dem eingeschneiten Dach herauslinsen. In einem Spalt unter der Dachluke rutschten sie hin und her. Fuhren die ganze Siedlung ab, von der 17 bis zu uns. Dann prallten unsere Blicke aufeinander, die Rohre hielten inne, rauschten hinein und krachend flog die Luke zu, so dass vom Dach des alten Doenhardt eine makellose, dicke Schneedecke auf die Veranda rutschte.
Auch dieser Schnee damals hätte Frau Galówka nicht geholfen. So wie es nicht geholfen hätte, wenn der alte Doenhardt es mit der 110 ein bisschen eiliger gehabt hätte. Geschweige denn er hätte gleich die 112 gewählt. Das machte bei der verfluchten Wählscheibe seines kieselgrauen Fernsprechers jedes Mal einen nicht zu leugnenden Unterschied. Manchmal standen Vater und ich auf dem Balkon, während der alte Doenhardt mit dem Fernsprecher auf der Veranda hockte, wählte und wählte und wählte und Vater wusste: Ostpreußen. Vielleicht hatte er die 110 auch absichtlich gewählt und nicht nur aus Gewohnheit. Weil er sich insgeheim darüber freute, dass das städtebauliche Schandmal der Schlesenburg doch noch das Potential erkennen ließ, sich ganz von allein aufzulösen. Nachdem es ihm vor ein paar Jahren fristgerecht zur Frührente zwischen seinen Rattansessel und den wohlverdienten Lebensabend gemauert worden war.
Tatsächlich kam zuerst die Polizei. Ein leichtes Murmeln, halb anerkennend, halb feixend, ging durch uns Kinder und die Schar aufgescheuchter Anwohner. Weil beide Beamte Brüste hatten. Der älteste Sohn der Familie Akkaya rieb sich, müde oder ungläubig, die Nachtschicht aus den Augen, während Frau Mazurka sich bekreuzigte.
Die erste Beamtin holte die Baranowskis von ihrem Bänkchen. Der linke Baranowski streckte ihr grinsend die graupenkrümelige Hand entgegen.
»Vielen Dank, Fräulein Kommissar«, sagte er mit einer so sauber betonten Freundlichkeit, dass es spöttisch klang.
Die zweite Beamtin trieb uns Kinder und die weiter einströmenden Anwohner auseinander, um auf dem großen Parkplatz etwas Platz zu schaffen. Vom Ring aus war bereits die erste Sirene zu hören. Das Geräusch wurde immer lauter, verdoppelte sich schließlich, weil ihm ein zweites Fahrzeug folgte, und nach einer Minute bogen beide Löschfahrzeuge mit einem lauten Scheppern durch die Einfahrt. Dem ersten Zug war die halb offene Blechtür eines betonierten Müllhäuschens in die Quere gekommen.
Das ausklingende Martinshorn holte auch die letzten Männer aus dem Nachtschichtschlaf. Es zog die Greise ans Fenster, trieb die alten Mütterchen voller Sorge in den Hof und lockte die letzten Kinder aus dem Feld hinter der Siedlung heran, wo wir uns tagsüber herumtrieben, vom Frühstück bis zum Abendbrot, und das Dahinschmelzen unserer kostbaren Ferien beweinten. Nur die Frauen aus der Siedlung, die kein Kind unter dem Herzen oder an der Brust trugen, kamen nicht in den Hof der Burg, sondern standen weiterhin in dumpfer Glückseligkeit an den Walzen in der Papierfabrik und übten im Kopf das Plusquamperfekt, einen Druckverband oder Bilanzbuchhaltung.
Die Mannschaften der beiden Löschzüge ergossen sich wie das Ensemble eines wunderlichen Balletts über den Hof. Es war eine Routine unter ihnen und eine Geschäftigkeit, die ich heute, dreißig Jahre später, nicht mehr in das rechte Tempo rücken kann. Der erste Mann, der in voller Montur aus dem Einsatzwagen sprang, sprang wie in Zeitlupe. Die beiden Männer aber, die das Treppenhaus sicherten, stiefelten wie im Zeitraffer über die breiten Terrazzostufen hinauf bis unters Dach und gleich wieder zurück. Immer auf halber Treppe erschienen ihre exotisch-bunten Silhouetten hinter den großen Milchglasscheiben im Hausflur. Auch die drei grauen Druckschläuche entrollten sich wie verlangsamt, während sich Frau Mazurka im Kreuzgriff über die Brust fuhr wie ein flottes Metronom. Erst als ein Stämmiger in Kampfmontur mit Helm und Sichtschutz eine lange Spitzhacke in die Jalousien der Galówka schlug, da rückte sich die Zeit wieder ins Lot. Der erste Schlag zeigte keine Wirkung, weil das graue Plastik in der Hitze weich geworden war. Er zog es, zäh wie Knete, mit sich nach, als er am Griff der Hacke riss. Dann holte er aus und schlug mit Wucht, etwas höher, mitten in den Fenstersturz hinein. Einer der Jungen im Pulk vor mir, einer von den Großen, vier oder fünf Jahre älter, lachte laut und abfällig. Sofort kam eine Hand, wie im Reflex, von hinten angeschossen und peitschte ihm mit einem Klatscher gegen den Hinterkopf. Er verstummte, ohne sich danach umzuschauen, woher die Schelle kam, und ich wusste gleich: Der kennt das.
Dann aber kam der große Trick: Mit einem kräftigen Ruck zog der Playmobil-Mann in Lebensgröße den ganzen verschmorten Jalousienkasten aus der Wand, schräg nach unten hin, samt Putz und einem Viertel Fensterrahmen. Kurz sahen wir, wie der qualmende Brocken in die Ligusterhecke plumpste, da schlugen die fensterhohen Flammen aus der Wohnung der Galówka. Sie stürzten sich im Blutdurst auf den Brandmeister, der sich mit schnellem Schritt entwand. Mit einer Wucht drängten die Flammen heraus aus ihrem Käfig, einer Wut und einem Wahn, wie ein wildes Tier, fast von allen Fesseln losgemacht.
Noch immer war eine große Unruhe unter uns, die größte vielleicht. Ein chaotisches Gerede, das die Überlebenschancen der Galówka diskutierte und, etwas stiller, jene der Geranien im zweiten Stock. Noch quengelten die Kleinen um gute Sicht, bettelten um Schultersitz oder die erste Reihe, noch geizten die Männer nicht mit Halbwissen und Bewunderung. Auch wenn der Radius unseres Halbkreises aus eigener Vernunft heraus immer größer wurde, brüllte ein Jungspund von der Freiwilligen: »Zurückbleiben bitte«. Schon bald fand er Gefallen daran, wurde strenger im Ton und opferte zum Wohle der Verständlichkeit jede Form von Höflichkeit. Als ihn unsere Gleichgültigkeit zu wurmen begann, wechselte er in den Infinitivus rassisticus: »Du! Abstand halten! Du! Auseinandergehen! Du! Bleiben zurück!« Jetzt schlugen uns Wahrheit und Hitze gleichermaßen ins Gesicht und machten die Welt und die Zeit wieder synchron. Es wurde still unter uns. Nur vier Mütterchen in Morgenwäsche und Bademantel beteten einen Rosenkranz, einen zweiten, einen dritten, einen vierten um das Leben der Galówka. Als aber das Löschwasser das Feuer von beiden Seiten zähmte und erstickte, als Wasserdampf und Qualm sich rasch verzogen, da beteten sie einen fünften, letzten, für Nadia Wiktoria Galówka und ihre unsterbliche Seele.
Noch bevor die Feuerwehr die Wohnungstür im Hochparterre aufgehebelt hatte, begann der Pulk der Schlesenburger, an seinen Rändern zu zerfransen. Für alle war die Sache klar und der größte Spuk vorüber. Besonders für jene, die sich danach sehnten, ihre von der letzten Nachtschicht ausgelaugten Batterien mit einer zweiten Portion Schlaf oder einer Kanne Kaffee wieder aufzufüllen. Für die Mütterchen und Kinder blieb die Sache aber spannend. Eine Handvoll von den Großen kletterte auf die Garagenzeile gegenüber, um einen Blick auf die verkohlte Galówka zu erhaschen. Diese seltene Gelegenheit, eine Tote zu sehen, konnte man sich keinesfalls entgehen lassen. Auch ich schaute neidvoll hoch zum ersten Rang auf den Garagen, besonders als ich, etwas abseits, das neue burschikose Mädchen entdeckte: Apolonia. Mein Vater war dagegen, schüttelte den Kopf, fuhr mir nur beschwichtigend durchs Haar. Als aber einer der Baranowskis das gaffende Grüppchen auf der Garage sah und lauthals schnalzte, streng und böse, wie um ein unfolgsames Tier zu rügen, da wurde Vater zornig im Gesicht.
»Precz!«, bellte der rechte Baranowski.
»Na dół!«, der linke. Auch er mit einem harschen Ton, wie ein alter Kommandant.
Jetzt überkam es meinen Vater. Er packte mich, hob mich hinauf und hievte mich mit Schwung auf seine Schultern. Die Baranowskis hielten ihre Mienen mit Mühe beieinander, moserten und wendeten sich augenblicklich ab von uns. Ich spürte, wie meinem Vater eine stolze Größe in den Rücken stieg. Wie eine doppelköpfige Kreatur starrten wir jetzt in die ausgebrannte Wohnung. Es war, als blickten wir in einen düsteren Kessel. Einen Moment lang brauchte es, bis sich unsere Augen an die Schattierungen von Dunkelgrau und Schwarz gewöhnt hatten. Bis sich unser Blick bahnen konnte, vom verkohlten Wohnzimmer in den kleinen Flur zum Schlafzimmer hinein, durch die Glastür, halb zersplittert, halb zerschmolzen nach vorne raus auf den tropfenden Balkon. Ein schmaler, verkohlter Trichter, wie ein langer Schacht, eine Grube, an deren Ende die Sudetensiedlung glitzerte.
»Hoffentlich ziehen keine Rumänen ein«, sagte Frau Mazurka, bekreuzigte sich und wandelte davon. Ich beugte mich ein Stück nach vorne, um über Haare und die hohe Stirn hinweg den Blick meines Vaters zu erhaschen. Aber seine Augen waren weit und wach und folgten den beiden Brandmeistern bei ihrer behutsamen Begehung. Von oben sah es aus, als hätte mein Vater sein verschwörerisches Grinsen im Gesicht, das schelmische, das einem schnell debil vorkam, wenn man ihn nicht kannte. Und auch wenn mir mein Vater wohlvertraut war, recht gut sogar nach immerhin neun Jahren, wusste ich es nicht und konnte es nicht ahnen, dass er beim Anblick dieser ausgebrannten Zweiraumwohnung an seinen Bruder denken musste.
2
Czytaj
Es passierte nicht gerade selten, dass Herr Gałuszka aus der Nummer 17 Post für Frau Galówka aus der Nummer 11 bekam. Niemals war es andersherum. Weil der Postbote die Schlesenburg über den schmalen Trampelpfad aus der Königsberger Straße betrat, nicht über den Ring. So dass er folglich bei der Nummer 21 anfangen musste, nicht bei der Nummer 7. Wie jeden Morgen zog er dort zuerst das kleine schiefe Hakenkreuz nach, dass er damals, gleich nach dem Bau der Burg, ins weiche Aluminium der Klingelzeile gekratzt hatte. Es war ein kleines Geheimnis, das er spöttisch mit uns teilte, wenn wir Kinder ihn in unserer morgendlichen Apathie wie stumpfsinnige Kälber dabei anglotzten. Daran änderte auch der Brand im Hochparterre nur wenig. Erst das blassgelbe wuchtige Schreiben von der Staatsanwaltschaft Frankfurt machte dem Boten etwas Muffensausen. Jetzt ließ er das mit den Hakenkreuzen für ein paar Jahre sein, grüßte sogar freundlich. Aber nur so lange, bis in den 90ern die ersten Russlanddeutschen einzogen und reichsgemäß begrüßt werden wollten. Als Vater und ich, zehn Jahre später, für einen Fahrradkauf in die Schlesenburg zurückkehrten, lachte mir das Hakenkreuz noch immer frisch und breit entgegen.
Herr Gałuszka war ein wenig ratlos, was er mit dem gelben Schreiben anfangen sollte: »Zu Händen Herrn Galówka, Breslauer Ring 17«. Eine Angabe richtig, eine Angabe falsch. Solange Herr Gałuszka den Brief nicht öffnete, war dieses Schreiben für ihn und zeitgleich nicht für ihn. Schrödingers Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Wie es so bei ihm lag, auf dem Beistelltisch im Flur, dem gedrechselten, und sich kaum behaupten konnte gegen Nachtschicht, Puschkin und das Aktuelle Sportstudio, war, was auch immer darin stand, sehr wichtig und sehr unwichtig zugleich. Erst am sechsten Tag, so erzählte er uns, fasste sich Herr Gałuszka ein Herz und schlug im kleinen Langenscheidt nach, den er seinerzeit im Durchgangslager Friedland zur Begrüßung zugesteckt bekommen hatte. Endlich war er neugierig genug geworden, was das Wörtchen Staatsanwaltschaft denn eigentlich bedeuten mochte.
Keine drei Minuten später eilte er im Widerschein der Hauslampen durch die stille Siedlung, in Unterhemd, kaltem Schweiß und seinen falschen Adiletten. Es waren brüchige, unbequeme Gummilatschen, die wie Herr Gałuszka selbst aus Zielona Góra kamen, sie alle drei ohne viel Liebe in einem unscheinbaren Trakt der polymertechnischen Produktionsanstalt Petrasa Süd in Form gespritzt. Als Herr Gałuszka das verkohlte Maul in der Nummer 11 passierte, verfeuerte er die letzten verfügbaren Reserven, raste am nächsten Haus vorbei und fiel, pünktlich um halb elf am Abend, mit seinem dicken Daumen auf das Klingelschild. Das erste, oben rechts, unter der ausgestanzten Sieben in Futura. Auf unseres.
Die Amtssprache in der Schlesenburg war Deutsch. Zuallererst das antiquierte, bäuerliche, das die Alten in der Siedlung aus Oppeln, Posen oder Kattowitz herübergeschleppt hatten. Krumme Begriffe, sperrig und ausladend, mühevoll ins Handgepäck gezwängt. So wäre auch der trulle Herr Szallak aus der Nummer 15 in der Andacht für die Frau Galówka gehöckert, böse pumpsend, plotschig zurechtgemacht. Saftig wie eine Nudelkulle sei er gewesen, in Potschen und einem Binder seines Tatschik. Er hätte sogar, ob du es glaubst oder nicht, einen ganzen Blumenaschel dabeigehabt und ein Täschel voller Kreppel für den Pfarrosch.
Dem Kommunismus war es nicht gelungen, diese Sprache kleinzukriegen. Aber einen Makel daraus machen, das konnte man. Nicht einmal die großen Fabriken in Tułowice hätten einen eingestellt, wenn man Tillowitz gesagt hätte. Und als mein Vater mit zehn oder zwölf im Hof seines Internats einen Groschen fand, keinen grosz, einen Groschen, da hat ihm die Lehrkraft aus Warschau ihre Meinung über die erste deutsche Lautverschiebung nicht gesagt, sondern mit einer Rute eingeprügelt. Und man muss meinem Vater nur ein Bier geben, höchstens zwei, dann zeigt er einem die dünnen Narben handbreit über dem Gesäß. Dort hat die Haut ein besseres Gedächtnis, sagt er. Und erst, wenn man jede gewölbte Spur im Fleisch ausgiebig bestaunt hat, beklagt er sich, er habe den Groschen nicht einmal behalten dürfen.
Den Kindern aus der Schlesenburg war dieses sonderbare Paralleldeutsch zur Gewohnheit geworden. Weil wir die Nachmittage nach dem Kindergarten bis zum Schichtende der Eltern bei den Alten aus der Burg verbrachten. Wenn wir dort unter dem gekachelten Sofatisch hockten und mit einem Schraubglas voller Knöpfe spielten. Wenn die schwerbusigen Mütterchen uns mit Zuckernudeln oder Milchsuppe fütterten. Vor allem aber, wenn die krummen Väterchen in ihrer erzieherischen Not versuchten, uns mit vier oder fünf Jahren das Skatspielen beizubringen. Immerzu sickerten die sonderbarsten Vokabeln in unsere kleinen blonden Köpfe und mussten gleich am nächsten Morgen, drüben in der Sonnenblumengruppe, sorgsam aus uns herausgescheuert werden.
Würde man sich heute die Mühe machen, auf den Speicher meiner Eltern zu klettern, im kleinen Reihenhaus in ihrer Satellitensiedlung, und zwängte man sich durch die hüftbreiten Schluchten zwischen den Kartonagetürmen, man fände, ganz hinten an der unverputzten Wand ein kunstledernes Kassettenköfferchen. Und irgendwo darin, zwischen Katja Ebstein, den Flippers und Nicole, das älteste akustische Zeugnis meiner flüchtigen Existenz: das Krippenspiel der Sonnenblumengruppe 1985.
Die Geburt Christi war aus theatralischer Sicht ein etwas undankbares Ereignis. Von den fünfzehn Kindern aus der Gruppe hatten nur sieben eine Sprechrolle. Und während das heilige Ensemble für jede gewöhnliche Christmette ganz mühelos gestreckt werden konnte, um einen Baum, sechs Hirten, einen vom Arbeitsamt vermittelten Zensuszähler aus dem Hofe des Herodes, lebte unser Krippenspiel von einer äußerst bunten akustischen Kulisse. Es gab ein Windkind für das allgemeine Unbehagen, ein Rummskind, das die knallenden Türen spielte, ein Nieselregenkind, eines für das Glockenspiel der himmlischen Heerscharen und ein Tiergeräuschekind. Wobei aber die Huflaute der hineinwankenden Kamele an Darius Mazurka ausgelagert werden mussten, weil er auf dem Boden lag und sich in einem Heulkrampf voller Tobsucht wie ein Uhrwerk um die eigene Mitte drehte. Besonders lobend erwähnt sei allerdings das in unserer Familie noch immer viel zitierte »Ja, genau«-Kind! Eines der hiesigen, wortkargen Winzerkinder, deren Familie seit zu langer Zeit schon genetisch auf der Stelle trat. Es wurde von Anita, der Erzieherin, im Türrahmen zum Flur positioniert und spielte von dort aus eine Art halblauten mosernden Minivolkszorn. Jedes Mal, wenn das Heilige Paar an einer Herberge abgewiesen wurde, sollte das Winzerkind, wenn es ihm sinnvoll und passend erschien, aus dem Hintergrund hereinrufen. Weil der Junge sich aber keinen Text merken konnte und auch zu keiner vorzeigbaren Improvisation imstande war, wurden ihm zwei kurze Worte anvertraut. Nur zwei: »Ja, genau.«
Seinen sehr zögerlichen Auftakt hatte er bei »Geht zurück nach Nazareth. Niemand will euch haben.« – »Ja, genau!«, sprach er schüchtern aus dem Türrahmen und erschrak fast über das Rummskind, das überaus elanvoll ein dickes Bilderbuch auf eine Tischplatte pfefferte. Bei »Gehet schnell zurück, woher es euch verschlug!« wurde das Winzerkind selbstbewusster. »Ja, genau!«, rief es in den Turnsaal hinein. Rumms. Der Junge gefiel sich immer mehr in seiner überschaubaren Aufgabe. Spätestens bei »Kein Bett, kein Stuhl, für euch und euresgleichen!« brillierte er. »Ja, genau!«, donnerte es mit einem aufgesetzten Bass durch die offene Tür herein. Doch gleich darauf, bei »Glaubt uns wohl, wir würden, wenn wir könnten« war der Junge zu sehr abgelenkt vom Spiel der anderen. Er verpasste seinen Einsatz und wurde vom Rummskind und der fortlaufenden Handlung überrollt. Sofort stiegen dem Jungen Tränen in die Augen. Unbarmherzig eilten die Geschehnisse voran. Der Stall zu Bethlehem, die Hirten auf dem Feld, dann, aus dem Nichts, das Glockenspiel der Heerscharen. Plötzlich klang es glockenhell, wie aus einer von Licht erhellten Sphäre. Endlich sprach der Engel sauber intoniert in die Dunkelheit: »Fürchtet euch nicht!«
»JA, GENAU!«, brüllte das Winzerkind.
Nichts was danach kommt, ist mehr erwähnenswert. Wenn man die Kassette aber laufen lässt, bis zum Schluss, über das blecherne Weihnachtsoratorium hinaus, und geduldig die zwei Minuten knisternde Stille aussitzt, die sich anschließen, dann hört man uns: drei, vielleicht vier Kinder aus der Schlesenburg. Verschwörerisch. Als wären wir Anitas Obhut für einen Augenblick entwichen, denn wir sprechen wild in unserem zopfigen Altdeutsch miteinander, faseln mit großem Ernst aufeinander ein. In unserem sonderbaren Duktus klingen wir wie geschäftige Zeitreisende, anachronistische Fremdlinge, in den schlesischen Urwäldern in flüssiges Bernstein gegossen, sauber konserviert und tausend Jahre später, hier, im rheinhessischen Oberland, herausgefräst. Und man muss es drei- oder viermal hören, um zu erahnen: Es geht um eine große Schaufel und einen Nussbaum und ein Rattenloch im Zaun und eine Luhsche und die Sandka und um die Schnicke, die man kassieren würde, falls der Plan danebengeht. Und in dem Moment, in dem das Faseln abbricht, könnte man meinen, weit im Hintergrund hinter dem mechanischen Knistern einen strengen Blick und Anitas unendlich müdes Seufzen zu hören.
Unsere Eltern jedenfalls hatte man vor diesem altdeutschen Geschwafel ferngehalten. Auf dass sie es folglich einfacher hätten in der Schamottefabrik in Łódź, der Berufsschule in Breslau oder im Polytechnikum in Krakau. Und als sie Polen den Rücken kehrten, da nahm meine Großmutter es ihnen fast ein bisschen übel. Denn auch für sie war das Hochpolnische drei Jahrzehnte lang ein harter Kampf gewesen. Am Abend hätte man den Bälgern jedes Ung und Lich und Haft und Nis aus den Köpfen zupfen müssen wie Zecken aus dem Fell einer Mähre. Und dann floh die Brut, zwanzig Jahre später, ausgerechnet in die BRD. Das alte Land, dessen schnörkellose Sprache man ihnen ohne Mühe in die Wiege hätte legen können. Zur Not lag irgendwo im Kriechkeller noch eine Lutherbibel und ein kämpferischer Hitler. Aber nein. Und manchmal, an einem Sonntag, hockte Mutter im Flur, in der schmalen Nische zwischen Wand und dem Kommödchen für das Telefon und weinte. Sie hatte ihren Körper klein gemacht und in die Nische gefaltet und man musste schon frontal davorstehen, um sie zu erspähen. Um hinter dem Knoten aus Armen und Beinen einen gesenkten Kopf zu erkennen. Wenn ich nicht draußen war, in der Burg, auf dem Ring oder im Feld, dann kam mein Vater ins Kinderzimmer und spielte mit mir. Was er selten tat. Mit viel mehr Hingabe als sonst. Und irgendwann verstand ich, rückblickend vielleicht, dass jeder Moment seiner Hingabe bedeutete, dass ich nicht merken sollte, wie Mutter im Flur hockte und heulte.
Sie heulte durch den hellgrauen Telefonhörer und in den Ostblock hinein. Darüber, wie schwer sie es jetzt hätten, in der Papierfabrik in der Südstadt, der Abendschule in Frankfurt und jedem deutschen Amt, von denen es unendlich viele gab. Wir Kinder wussten nicht, dass unsere Mütter kauerten und heulten, und wir verstanden nicht, was es zu heulen und zu kauern gab, und weil sie wussten, dass wir manchmal lauschten, ich, aus meinem Bett heraus, flüsterten sie auf Polnisch in den Äther. Aber manchmal ertappten wir sie dabei. Wie sie nach einem falschen Genitiv unendlich schlechte Laune bekamen. Wie sie tief versunken und mit angestrengter Miene nach dem Tischgebet in den Kartoffelbrei starrten und das Wörtchen beten konjugierten. Und da dämmerte es mir. Aber es dämmerte nur. Ich bete, du betest, wir beten für Frau Galówkas unsterbliche Seele.
Es war halb elf am Abend, als Herr Gałuszka Mutter vom Balkon klingelte, wegen dem gelben Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Im Sommer war unsere Wohnung im vierten Stock so unerträglich heiß, dass Mutter, auch aus Eigennutz, die übliche Sperrstunde für ungültig erklärte und es sich selbst und mir erlaubte, den Tag auf dem Balkon ausglimmen zu lassen. Sie lag mit Konsalik auf ihrer schmalen Pritsche, den Rücken durch eine eingerollte Federdecke aufgebockt. Ich döste zu ihren Füßen, etwas tiefer, auf meiner alten Kinderbettmatratze. Mutter war die einzige Frau in der Schlesenburg, die las. Bücher, nicht die Kobieta oder die Frau im Spiegel. Mir kommt keine einzige Familie aus der Siedlung in den Sinn, bei der mir jemals ein Bücherregal aufgefallen wäre. Wenn man prahlte, dann mit einer VHS-Kassetten-Sammlung. Oder einer Cognac-Parade. Acht oder neun bauchige Flaschen, von denen aber keine einzige, so ehrlich muss man sein, tiefergehende Kenntnis der Materie offenbarte. Tatsächlich ließ das gesamte Konvolut weder in Preis noch Qualität überhaupt einen Unterschied erkennen. Das einzige Spektrum, das diese Flaschen abbildeten, war die breite deutsche Discounterlandschaft. Eigenmarken aller Supermärkte. Mühevoll ersammelt und ertauscht, wie Sticker in einem Panini-Album. HL gegen toom, zwei Flaschen Massa gegen eine Flasche Tengelmann, Edeka, Minimal und Plus, neuerdings ein beißendes hellgelbes Gesöff aus der ersten rheinhessischen Lidl-Filiale. Und ein halbes Jahr lang, ein ganzes halbes Jahr, rühmte sich mein Vater, neben Arc Royal von Aldi Süd auch eine Flasche Cognac von Aldi Nord zu besitzen.
Dass aber jemand nach einer Doppelschicht in der Papierfabrik noch irgendeine Sehnsucht nach Büchern in sich finden konnte, das hatte ein fast hochmütiges Geschmäckle. Auch Mutter prahlte nicht mit ihrem beeindruckenden Verschleiß. Überhaupt ging mir erst mit fünf oder sechs auf, dass sie sich nicht seit Jahren durch den gleichen Schinken von Konsalik kämpfte, sondern dass sich hinten im Bettkasten, oben auf der Schrankwand und auch im Sitzfach unter der Küchenbank dutzende verschämte Bücher versteckten. Einen stolzen Stapel gab es nicht, geschweige denn ein offenes Regal. Sie verbarg es nicht, aber sie hielt es wie ein unsinniges Laster von uns fern. Nie lagen der Konsalik oder seinesgleichen offen herum oder irgendwo anders als rücklings auf dem Nachttisch. Selbst wenn sie sommers auf dem Balkon eine Pause machte, um sich zu erleichtern oder ihren Instant-Eistee aufzugießen, verschwand das Buch unter der Pritsche.
Manchmal kroch ich aus Langeweile oder Neugier zu ihr hinauf und versuchte, einen Blick in den Konsalik zu werfen. Mutter aber griff in einer geschickten, fast automatischen Routine nach der durchsichtigen Plastikdose mit dem Zitronenteegranulat. Sie schüttete eine kleine Menge in den gelben Deckel, setzte ihn auf den Kunstrasen und schob das Näpfchen von sich fort, meistens mit dem Fuß, so weit es ging. Schon lag ich langgestreckt auf dem Balkonboden und führte, in maximaler Hingabe, mit meinem angeleckten Finger Körnchen um Körnchen dieses zuckersüß-sauren Mannas vom Deckel direkt in meinen Mund. Mutter lächelte mich an, ohne aufzuschauen, und hatte, für ein paar Minuten mehr, ein inniges Gespräch mit Heinz Konsalik. Im Lesen lag Mutters letzte Zuflucht. Nirgendwo sonst lief sie so wenig Gefahr, in einen verschmierten Popel zu greifen, einen klebrigen Ring einer River-Cola-Dose, in Kettenfett oder auf einen Legostein zu treten, und auf keiner Seite das surrende dröhnende Geschrei der ewigen Papierwalzen.
Dass Mutter gerne las, war in der Schlesenburg ein kleines wohlgehütetes Geheimnis. Folglich wusste jeder davon. Immer wieder kam es vor, dass irgendein Nachbar aus der Siedlung am späten Vormittag Sturm klingelte und mit einem einschüchternden Behördenschreiben bei uns vorstellig wurde.
Nur drei oder vier Familien waren sich zu fein und ließen ihre Korrespondenz, wenn überhaupt, über Mittelsmänner an meine Mutter weitergeben. Natürlich gab es auch zwei Analphabeten in der Siedlung, aber die hätten den Teufel getan, bei meiner Mutter, der Vorleserin, um eine Audienz zu bitten.
Das wirklich Verwunderliche an diesen Gelegenheitsbesuchen war, dass die meisten aus der Schlesenburg keinerlei Probleme mit der deutschen Sprache hatten. Hatte man sie doch in der Abendschule mit Ausdauer und Effizienz sanft in sie hineingeprügelt. Leichte rhythmische Schläge auf den Hinterkopf. Deklinationen und Konjugationen, auf Beugen und Brechen, die wie dicke wuchtige Tropfen auf alle aus der Burg herniedergingen. Immer auf die gleiche wunde Stelle, mittig auf die Stirn, knapp über die Augen.
Bis auf eine sehr schüchterne Frau aus Anatolien hockten nur Polen in der Abendschule. Natürlich wollte sich keiner von ihnen die Blöße geben. Immerhin kannte man sich doch, noch aus Polen damals oder Friedland oder dem Asylbewerberheim am Ring. Die größte Inbrunst aber gärte unter ihnen, als sich herumsprach, dass in der Seminarbaracke nebenan, die mit dem Nadelfilzteppich und den Sauerkrautplatten, ein seltsam stiller Mann aus Oberschlesien hockte. Es ging das Gerücht, dass dessen Schwester noch in Polen lebte, in einem Dorf namens Dąbrowa, und dass eben diese Frau bei der Poczta Polska arbeitete, als überaus geschwätzig galt und beruflich derart oft rotierte, dass sie im Endeffekt Briefe für halb Schlesien zustellte. Und weil es in halb Schlesien über fünfzig Dörfer mit dem Namen Dąbrowa gab, saßen sie alle ganz besonders brav auf ihren stapelbaren Seminarstühlen, in der tiefen, fast unerschütterlichen Furcht, es könne ihr Dąbrowa sein. Niemand wollte in der alten Heimat zum Geschwätz werden. Also warfen sie sich alle den Dozenten und ihrem Dativ an den Hals. Die vier lächerlichen deutschen Fälle waren den meisten eine willkommene Abwechslung zu den chronischen Schmerzen, die die sieben polnischen Kasus, drei Genera und der Dual im rechten oder linken Stirnlappen befeuern konnten. Und trotzdem: In den maschinell erstellten Schreiben, mit ihren Sichtfensterchen, die drohend knisterten wie Strom, lag eine Spannung, die viele aus der Siedlung versteinern ließ.
Auch Herr Gałuszka aus der Nummer 17 saß gebeugt an unserem Küchentisch, als hätte ihm ein sonderbarer Krebs die breiten Schulterblätter weggefressen. Er knetete mit seinen Daumen das Schreiben von der Staatsanwaltschaft und schwitzte, wie ich noch nie einen Mann zuvor hatte schwitzen sehen. Die polnische Geheimpolizei hätte ihre blanke Freude an ihm gehabt. Und was Vater mir am nächsten Tag erzählte: Sie hatte gehabt. Plusquamperfekt. Man kannte sich bereits. In Herrn Gałuszkas Nacken konnte man ein winziges Bächlein beobachten, das sich in seiner Nackenfalte staute, überquoll, und dann unter seinem Unterhemd versickerte. Der Brief von der Staatsanwaltschaft lag offen auf dem Tisch. Er war winzig, harmlos. Also traute ich mich aus dem Türrahmen, kroch unter die Eckbank, vorbei an den Adiletten und dem beißenden Geruch von frischem Schweiß und Puschkin, und stieg langsam hinter der Bank hervor, wie ein Krokodil aus seinem Tümpel. Vier hauchdünne Seiten lagen auf dem Tisch. Nur ein Hundertstel Konsalik. Aber Herr Gałuszkas Augen wanderten in einem panischen Zickzack über das Papier. Ein dicker Tropfen Schweiß landete auf dem Deckblatt. Er markierte eine Stelle. Und trotzdem mochte sich keines der Worte darin verfestigen. Formulardemenz nannte Mutter das.
»Czytaj!«, sagte sie, aber Herr Gałuszka reagierte nicht, also setzte sie fünf Finger auf das Schreiben und schob es quer über den Tisch in meine Richtung. »Möchtest du«, sagte sie. Wie eine Frage klang es nicht. »Herr Gałuszka kann noch nicht«, fügte sie hinzu. Verunsichert schaute ich ihr ins Gesicht. Manchmal konnte sie einen Ausdruck unter ihre Stirn pflanzen, der leer und unbehauen war, wie ein Stück Speckstein. Dann richtete ich mich auf, die Schultern gerade, wie Wilhelm Wieben in der Tagesschau oder Hallo Spencer, und mein Blick flog über das hauchdünne Papier. Ich konnte lesen, seit ich vier war. Es war ein Trick, den Vater gerne vorführte. Wenn er mich an der Wursttheke im Arm hielt und ich für eine dicke Scheibe Gelbwurst die Angebote rezitieren musste. Aus irgendeinem Grund war Mutter oft beschämt davon, griff eilig nach dem Wochenvorrat Rindfleisch. Zwei Stunden dauerte es, bis sie wieder mit uns sprach, und alles, was sie sagte, war: »Menschen können lesen, Affen können Tricks.«
Wenn ich den anderen Kindern in der Grundschule in unserem ersten und zweiten Jahr etwas voraushatte, dann, dass mir das Entziffern auch größerer Buchstabenkolonnen ganz mühelos gelang. Und auch jetzt, in den Sommerferien, hatte ich geübt, wie im Spiel mit mir selbst, indem ich jedes Wort, das mir unter die Nase kam, sauber in meinem Kopf aufreihte, nach gerade und krumm sortierte und heimlich in mich hineinflüsterte. Ich streifte aufgeregt durch das eng gesetzte Dickicht des Briefes auf dem Tisch. Auf der Jagd nach einem imposanten Wort, scheu und großgewachsen, einem Zwölfender. Ich mied, angeekelt, die kleine saure Tränke, die Herr Gałuszka mit seinem Kopfschweiß ins Unterholz gelassen hatte, und suchte, fieberhaft, zwischen den Wortstämmen nach meiner Beute.
Kleinwild ließ ich liegen: Bruchmann, Amtsarzt, Kennedyallee. Auch Rotten ließ ich ziehen oder in Ruhe äsen: ohne Nachweis, binnen 14 Tagen, Kopie für Ihre Unterlagen. Aus den Augenwinkeln sah ich, einsam grasend am Anfang einer Zeile, ein altes ausgezehrtes Rehwild: entgegenzunehmen. Dann das erste Damwild: Fremdeinwirkung. Ein Muttertier aber, an den langen Zitzen drei Kälber: kein, Hinweis und das kleine auf. Dann, endlich, weit oben, auf einer chlorgebleichten Lichtung thronend, prächtig und stolz, mein Fang des Tages. Also hob ich an, zielte kurz und wie ein Schuss drang es laut dröhnend aus mir heraus: Obduktionsergebnis. Mutter sprang in Panik auf und riss mir das Blatt Papier wie eine heiße Flinte aus der Hand. Der Rückstoß packte mich am Kragen, zog mich von der Bank, trug mich über das Linoleum und erst im Flur setzte er mich ab, wo ich wieder festen Grund unter meinen Füßen spürte. Mutter machte in einer eleganten Drehung kehrt und verschwand fast lautlos hinter der braunen Küchentür mit ihrer dicken Ornamentglasscheibe, die jede Hoffnung weiter mitzulesen wie im Keim erstickte.
In meinen vier Jahren in der katholischen Kinderkrippe habe ich leider nie etwas anderes gespielt als einen Hirten. Und trotzdem griff ich jedes Jahr aufs Neue, sobald Anita die heißbegehrten Rollen verteilte, voller Hoffnung und Elan in ihre hohle Hand, um einen der winzigen Loszettel aus dem knisternden Gewühl zu fischen. Anita war liebevoll und gut und voller Nachsicht mit uns, auch wenn wir oft mit unserem Kinderdeutsch, manchmal verschlafen nach der Mittagsruhe, manchmal in hellem Aufruhr nach dem Morgenkreis, ein oder zwei Jahrhunderte nach hinten durch die Zeit kippten. Dass Anita uns für das Krippenspiel losen ließ, begeisterte mich. Schon Wochen vorher war ich wie euphorisiert von der Aussicht, für etwas so Wichtiges wie das Krippenspiel die Fäden des Schicksals in der eigenen Hand zu halten. Ich verstand nichts von Stochastik, aber ich begriff das Konzept von Glück und Pech. Dass ich hier, diesmal, zum ersten, zweiten, dritten Mal in meinem Leben, einen direkten, nicht zu leugnenden Einfluss darauf nehmen konnte. Und wenn wir fortan in der Schlesenburg Verstecken spielten, wurde nicht bestimmt, nicht ausgezählt, es wurde jetzt gelost, und ich war der Zeremonienmeister. Wenn ich an einem regnerischen Nachmittag zu Hause am Küchentisch hockte und malte oder knetete, knetete und malte ich überhaupt nicht. Stattdessen übte ich, stundenlang und voller Hingabe, mit mir selbst etwas auszulosen. Erst riss ich unter großer körperlicher Anspannung winzige quadratische Zettel aus einem Schmierblatt, dutzende Schnipsel, die ich sauber aufreihte, und dann nach gerade oder krumm sortierte. Nur die Zettel, die sich am ähnlichsten waren, kamen in die zweite Runde und wurden jeweils mit einem bunten Kreis verziert. Jeder Zettel eine Farbe. Dann faltete ich sie einzeln und sauber zu winzigen Knötchen, mischte mit großer Geste und loste dann den nächsten Buntstift und die nächste Knete, die das Schicksal und mein Glück mir, Hand in Hand, erlaubten. Mein Vater stand oft stumm staunend daneben und naschte mit seinem Taschenmesser dünne Schnitte Pressfleisch aus einer Dose. Wenn er es gut mit mir meinte, war meine entrückte Art mich selbst zu beschäftigen ein Anblick, in dem mein Vater sich verlieren konnte. Er sah dann in mich hinein, träumerisch, wie in die knisternde Glut eines kleinen Feuers. Aber manchmal schaute er zu lange und zu tief, und dann fing das Feuer an zurückzuschauen. Und im Glanz seiner Augen sah mein Vater sich und seinen Vater und dessen Vater, und über allem lag die Wehmut und der stille Zorn, nie von diesem Feuer fortgekommen zu sein. Dann rief er durch die Wohnung, hinüber zum Balkon, wo meine Mutter lag und las: »Wir sollten noch ein Zweites machen. Nur für alle Fälle.«
Oft trug ich die selbstgemachten Lose wie die Fackel eines demokratischen Gebarens aus der Wohnung, führte sie wie ein ewiges Licht durch die heidnische Dunkelheit der Schlesenburg. Darius Mazurka konnte ich schnell dafür begeistern. Er fand an allem Freude. Selbst dann, wenn wir gemein zu ihm waren. Vielleicht lag es an seinem freundlichen Gemüt, vielleicht daran, dass er nach seiner Geburt ein kleines Stück zu lang das Atmen verweigert hatte. Auch der dünne Kuba erbarmte sich unser, ein hagerer Junge aus der Nummer 13. Selbst wenn er drei Jahre zu alt für uns war, spielte er gerne mit, auch so etwas Albernes wie Losen. Weil zu Hause nur seine unsichtbare Mutter auf ihn wartete und sein vom Nachtdienst ausgezehrter Vater, der einen schrecklich leichten Schlaf hatte und eine nervöse rechte Hand.
Zwanzig Jahre später habe ich den dünnen Kuba wiedergesehen. Die Statur und sein hängendes Auge haben ihn verraten. In einem Bordbistro kurz hinter Freiburg. Das hängende Auge war ein letztes trübes Andenken an seinen Herrn Papa. Im Winter ’91, nachdem die Netzhaut halbwegs wieder ausgeheilt war, sind der dünne Kuba und seine Mutter fortgezogen, als sein Vater in der Frühschicht war. Ich habe dem dünnen Kuba in meiner Rührung von Anita erzählt, unserer Erzieherin aus der Kinderkrippe. Er konnte sich noch gut an sie erinnern, sagte er. Immerzu habe er einen Hirten spielen müssen. Ich erzählte ihm, wie mich diese Frau in ihrer Fairness und Güte geprägt hätte. Wie heilsam es gewesen wäre, dass sie keinen Unterschied machte zwischen uns aus der Burg, den wortkargen Winzerkindern und allen anderen aus der Preußenzeile oder aus der Südstadt. Wie das etwas affige, überzeremonielle Losen in der Adventszeit einen guten standfesten Demokraten aus mir gemacht hätte. Kubas Lächeln kippte in eine mitleidige Schieflage. Wortlos friemelte er einen Kugelschreiber aus seiner Ledertasche. Dann zupfte er einen kleinen Fetzen Papier von einem Dokument, malte ein Kreuz darauf, faltete den Schnipsel und mischte das einsame Los mit großer Geste hinter seinem Rücken. Endlich hielt er mir die flache Hand, samt Zettel, vor die Nase. Ich griff danach, hielt es erst für einen merkwürdigen Scherz. Er aber wurde ernst in seinem Blick, also faltete ich den Zettel auf, langsam wie früher, wie ein Zeremonienmeister, bereit, mich über das Gewinnerkreuz überrascht zu geben. Aber das Stück Papier war von beiden Seiten blank.
Der dünne Kuba sah lange dabei zu, wie hinter meiner Schädeldecke ein kleiner Funken ziellos durch die Dunkelheit flimmerte. Dann legte er wortlos, aus seiner anderen Hand, ein zweites Los vor mir auf den Tisch. Dieses Mal das richtige. Das mit dem Kreuz darauf. »Niemand aus der Burg«, sagte er bitter, »hat jemals etwas anderes gespielt als einen Hirten.«
3
Przepraszam
Einen Tag nach dem Besuch von Herrn Gałuszka kursierten in der Schlesenburg schon vier Varianten, wie Frau Galówka in ihrer Wohnung zu Tode gekommen sei. Vier Varianten, eine grausamer als die andere. Weil sich niemand aus der Burg das Wörtchen Aortenaneurysma merken konnte. Und doch waren es allesamt gnädige Versionen. Immerhin setzte jede damit ein, dass die arme Frau Galówka schon lange vor dem ersten Flämmchen das Zeitliche gesegnet haben musste. Trotzdem waberten grausame Details durch die Burg, von Hauseingang zu Hauseingang. Sie hingen wie ein Schwarm Trauermücken in der Luft. Diese Wolken mikroskopisch kleiner Fliegen, in die man sommers immerfort hineinrannte.
Die Zwillinge Baranowski wachten wie zwei alte Sphinxe vor der Nummer 11. Sie ließen ihren Rundgang durch die Burg für zwei oder drei Tage ruhen. Stattdessen machten sie sich einen Spaß daraus, den vereinzelten Gaffern, die von beiden Endstücken des Rings in die Siedlung stießen, vom Todeskampf der Frau Galówka zu berichten. Am allerliebsten erzählten sie den jungen deutschen Frauen aus der Siedlung davon, die viel zu höflich waren, um sich dem geschwätzigen Sirenengesang der Baranowskis zu entwinden.