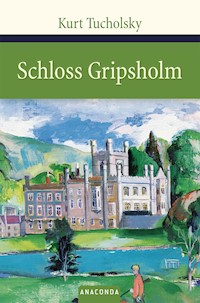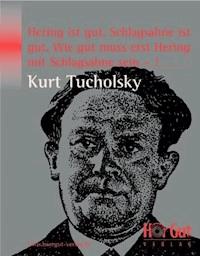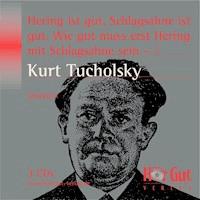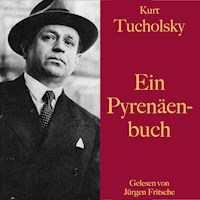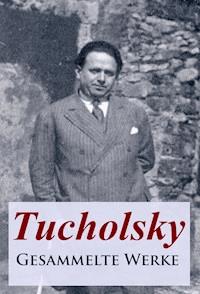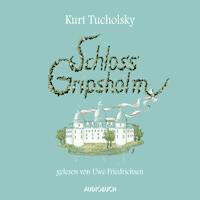
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Minis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Tucholsky veröffentlichte diesen leichten, erotischen Sommerreigen 1931. Offensichtlich autobiografisch gefärbt – wenn die geschilderte Ménage à trois laut Aussage der Geliebten von Tucholsky auch nur dem Wunschdenken des Autors entsprang. Tucholskys heitere Liebesgeschichte um einen Mann und zwei Frauen im Urlaub stellte einen kultivierten, sympathischen Gegenentwurf zum damaligen deutsch-nationalen Spießertum dar – so konnte Deutschland also auch sein. Als Chronist seiner Zeit war Tucholsky auch Leidender an derselben. Einer Zeit zwischen den Weltkriegen, die in Deutschland geprägt war von Militarismus, Obrigkeitsdenken und gnadenloser Ausbeutung der Unterschicht. Schloss Gripsholm wurde 2000 verfilmt; in den Hauptrollen Ulrich Noethen, Heike Makatsch und Jasmin Tabatabai. Null Papier Verlag
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Tucholsky
Schloss Gripsholm
Eine Sommergeschichte
Kurt Tucholsky
Schloss Gripsholm
Eine Sommergeschichte
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954188-11-6
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Werksammlung zu Kurt Tucholsky
Schloss Gripsholm
Nachwort des Verlegers zum Vorwort des Autors
Erstes Kapitel
1
2
3
4
5
6
Zweites Kapitel
1
2
3
4
5
Drittes Kapitel
1
2
3
4
Viertes Kapitel
1
2
3
Fünftes Kapitel
1
2
Werksammlung zu Kurt Tucholsky
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Werksammlung zu Kurt Tucholsky
Die erfolgreichste digitale Werksammlung zu Kurt Tucholsky
Schloss Gripsholm, Das Lottchen, Rheinsberg, Was darf Satire?, Einer pfeift sich einen, Jonathan’s Wörterbuch, Die fünfte Jahreszeit, u.v.a
978-3-95418-520-7 (Kindle) 978-3-95418-521-4 (Epub) 978-3-95418-522-1 (PDF)
0,99 €
null-papier.de/tucholsky
Schloss Gripsholm
Eine Sommergeschichte
Für IA 47 407
Wir können auch die Trompete blasen und schmettern weithin durch das Land; doch schreiten wir lieber in Maientagen, wenn die Primeln blühn und die Drosseln schlagen, still sinnend an des Baches Rand.
Storm
Nachwort des Verlegers zum Vorwort des Autors
Tucholsky wollte seine damalige Liaison mit Lisa Matthias nicht publik machen, daher widmete er die Geschichte nicht ihr, sondern ihrem Auto. Der Leser beachte das Nummernschild.
Erstes Kapitel
1
Ernst Rowohlt Verlag Berlin W 50 Passauer Straße 8/9
8. Juni
Lieber Herr Tucholsky,
schönen Dank für Ihren Brief vom 2. Juni. Wir haben Ihren Wunsch notiert. Für heute etwas andres.
Wie Sie wissen, habe ich in der letzten Zeit allerhand politische Bücher verlegt, mit denen Sie sich ja hinlänglich beschäftigt haben. Nun möchte ich doch aber wieder einmal die »schöne Literatur« pflegen. Haben Sie gar nichts? Wie wäre es denn mit einer kleinen Liebesgeschichte? Überlegen Sie sich das mal! Das Buch soll nicht teuer werden, und ich drucke Ihnen für den Anfang zehntausend Stück. Die befreundeten Sortimenter sagen mir jedes Mal auf meinen Reisen, wie gern die Leute so etwas lesen. Wie ist es damit?
Sie haben bei uns noch 46 RM gut – wohin sollen wir Ihnen die überweisen?
Mit den besten Grüßen Ihr (Riesenschnörkel) Ernst Rowohlt
*
10. Juni
Lieber Herr Rowohlt,
Dank für Ihren Brief vom 8. 6.
Ja, eine Liebesgeschichte … lieber Meister, wie denken Sie sich das? In der heutigen Zeit Liebe? Lieben Sie? Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine kleine Sommergeschichte.
Die Sache ist nicht leicht. Sie wissen, wie sehr es mir widerstrebt, die Öffentlichkeit mit meinem persönlichen Kram zu behelligen – das fällt also fort. Außerdem betrüge ich jede Frau mit meiner Schreibmaschine und erlebe daher nichts Romantisches. Und soll ich mir die Geschichte vielleicht ausdenken? Fantasie haben doch nur die Geschäftsleute, wenn sie nicht zahlen können. Dann fällt ihnen viel ein. Unsereinem …
Schreibe ich den Leuten nicht ihren Wunschtraum (»Die Gräfin raffte ihre Silber-Robe, würdigte den Grafen keines Blickes und fiel die Schlosstreppe hinunter«), dann bleibt nur noch das Propplem über die Ehe als Zimmer-Gymnastik, die »menschliche Einstellung« und all das Zeug, das wir nicht mögen. Woher nehmen und nicht bei Villon stehlen?
Da wir grade von Lyrik sprechen:
Wie kommt es, dass Sie in § 9 unseres Verlagsvertrages 15 % honorarfreie Exemplare berechnen. Soviel Rezensionsexemplare schicken Sie doch niemals in die Welt hinaus! So jagen Sie den sauren Schweiß Ihrer Autoren durch die Gurgel – kein Wunder, dass Sie auf Samt saufen, während unsereiner auf harten Bänken dünnes Bier schluckt. Aber so ist alles.
Dass Sie mir gut sind, wusste ich. Dass Sie mir für 46 RM gut sind, erfreut mein Herz. Bitte wie gewöhnlich an die alte Adresse. Übrigens fahre ich nächste Woche in Urlaub.
Mit vielen schönen Grüßen Ihr Tucholsky
*
Ernst Rowohlt Verlag Berlin W 50 Passauer Straße 8/9
12. Juni
Lieber Herr Tucholsky,
vielen Dank für Ihren Brief vom 10. d. M.
Die 15 % honorarfreie Exemplare sind – also das können Sie mir wirklich glauben – meine einzige Verdienstmöglichkeit. Lieber Herr Tucholsky, wenn Sie unsere Bilanz sähen, dann wüssten Sie, dass es ein armer Verleger gar nicht leicht hat. Ohne die 15 % könnte ich überhaupt nicht existieren und würde glatt verhungern. Das werden Sie doch nicht wollen.
Die Sommergeschichte sollten Sie sich durch den Kopf gehen lassen.
Die Leute wollen neben der Politik und dem Aktuellen etwas haben, was sie ihrer Freundin schenken können. Sie glauben gar nicht, wie das fehlt. Ich denke an eine kleine Geschichte, nicht zu umfangreich, etwa 15–16 Bogen, zart im Gefühl, kartoniert, leicht ironisch und mit einem bunten Umschlag. Der Inhalt kann so frei sein, wie Sie wollen.
Ich würde Ihnen vielleicht insofern entgegenkommen, dass ich die honorarfreien Exemplare auf 14 % heruntersetze.
Wie gefällt Ihnen unser neuer Verlagskatalog? Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Urlaub und bin mit vielen Grüßen
Ihr (Riesenschnörkel) Ernst Rowohlt
*
15. Juni
Lieber Meister Rowohlt,
auf dem neuen Verlagskatalog hat Sie Gulbransson ganz richtig gezeichnet: still sinnend an des Baches Rand sitzen Sie da und angeln die fetten Fische. Der Köder mit 14 % honorarfreier Exemplare ist nicht fett genug – 12 sind auch ganz schön. Denken Sie mal ein bisschen darüber nach und geben Sie Ihrem harten Verlegerherzen einen Stoß. Bei 14 % fällt mir bestimmt nichts ein – ich dichte erst ab 12 %.
Ich schreibe diesen Brief schon mit einem Fuß in der Bahn. In einer Stunde fahre ich ab – nach Schweden. Ich will in diesem Urlaub überhaupt nicht arbeiten, sondern ich möchte in die Bäume gucken und mich mal richtig ausruhn.
Wenn ich zurückkomme, wollen wir den Fall noch einmal bebrüten. Nun aber schwenke ich meinen Hut, grüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Sommer! Und vergessen Sie nicht: 12 %!
Mit vielen schönen Grüßen Ihr getreuer Tucholsky
Unterschrieben – zugeklebt – frankiert – es war genau acht Uhr zehn Minuten. Um neun Uhr zwanzig ging der Zug von Berlin nach Kopenhagen. Und nun wollten wir jawohl die Prinzessin abholen.
2
Sie hatte eine Altstimme und hieß Lydia.
Karlchen und Jakopp aber nannten jede Frau, mit der einer von uns dreien zu tun hatte, »die Prinzessin«, um den betreffenden Prinzgemahl zu ehren – und dies war nun also die Prinzessin; aber keine andere durfte je mehr so genannt werden.
Sie war keine Prinzessin.
Sie war etwas, was alle Schattierungen umfasst, die nur möglich sind: sie war Sekretärin. Sie war Sekretärin bei einem unförmig dicken Patron; ich hatte ihn einmal gesehn und fand ihn scheußlich, und zwischen ihm und Lydia … nein! Das kommt beinah nur in Romanen vor. Zwischen ihm und Lydia bestand jenes merkwürdige Verhältnis von Zuneigung, nervöser Duldung und Vertrauen auf der einen Seite und Zuneigung, Abneigung und duldender Nervosität auf der anderen: sie war seine Sekretärin. Der Mann führte den Titel eines Generalkonsuls und handelte ansonsten mit Seifen. Immer lagen da Pakete im Büro herum, und so hatte der Dicke wenigstens eine Ausrede, wenn seine Hände fettig waren.
Der Generalkonsul hatte ihr in einer Anwandlung fürstlicher Freigebigkeit fünf Wochen Urlaub gewährt; er fuhr nach Abbazia. Gestern Abend war er abgefahren – werde ihm der Schlafwagen leicht! Im Büro saßen sein Schwager und für Lydia eine Stellvertreterin. Was gingen mich denn seine Seifen an – Lydia ging mich an.
Da stand sie schon mit den Koffern vor ihrem Haus – »Hallo!«
»Du bischa all do?« sagte die Prinzessin – zur grenzenlosen Verwunderung des Taxichauffeurs, der dieses für Ostchinesisch hielt. Es war aber Missingsch.
Missingsch ist das, was herauskommt, wenn ein Plattdeutscher Hochdeutsch sprechen will. Er krabbelt auf der glatt gebohnerten Treppe der deutschen Grammatik empor und rutscht alle Nase lang wieder in sein geliebtes Platt zurück. Lydia stammte aus Rostock, und sie beherrschte dieses Idiom in der Vollendung. Es ist kein bäurisches Platt – es ist viel feiner. Das Hochdeutsch darin nimmt sich aus wie Hohn und Karikatur; es ist, wie wenn ein Bauer in Frack und Zylinder aufs Feld ginge und so ackerte. Der Zylinder ischa en finen statschen Haut, över wen dor nich mit grot worn is, denn rutscht hei ümmer werrer aff, dat deit he … Und dann ist da im Platt der ganze Humor dieser Norddeutschen; ihr gutmütiger Spott, wenn es einer gar zu toll treibt, ihr fest zupackender Spaß, wenn sie falschen Glanz wittern, und sie wittern ihn, unfehlbar … diese Sprache konnte Lydia bei Gelegenheit sprechen. Hier war eine Gelegenheit.
»Kann mir gahnich gienug wunnern, dasse den Zeit nich verschlafen hass!« sagte sie und ging mit festen, ruhigen Bewegungen daran, mir und dem Chauffeur zu helfen. Wir packten auf. »Hier, nimm den Dackel!« – Der Dackel war eine fette, bis zur Albernheit lang gezogene Handtasche. Und so pünktlich war sie! Auf ihren Nasenflügeln lag ein Hauch von Puder. Wir fuhren.
»Frau Kremser hat gesagt«, begann Lydia, »ich soll mir meinen Pelz mitnehmen und viele warme Mäntel – denn in Schweden gibt es überhaupt keinen Sommer, hat Frau Kremser gesagt. Da wär immer Winter. Ische woll nich möchlich!« Frau Kremser war die Haushälterin der Prinzessin, Stubenmädchen, Reinmachefrau und Großsiegelbewahrerin. Gegen mich hatte sie noch immer, nach so langer Zeit, ein leise schnüffelndes Misstrauen – die Frau hatte einen guten Instinkt. »Sag mal … ist es wirklich so kalt da oben?«
»Es ist doch merkwürdig«, sagte ich. »Wenn die Leute in Deutschland an Schweden denken, dann denken sie: Schwedenpunsch, furchtbar kalt, Ivar Kreuger, Zündhölzer, furchtbar kalt, blonde Frauen und furchtbar kalt. So kalt ist es gar nicht.« – »Also wie kalt ist es denn?« – »Alle Frauen sind pedantisch«, sagte ich. – »Außer dir!« sagte Lydia. – »Ich bin keine Frau.« – »Aber pedantisch!« – »Erlaube mal«, sagte ich, »hier liegt ein logischer Fehler vor. Es ist genauestens zu unterscheiden, ob pro primo …« – »Gib mal’n Kuss auf Lydia!« sagte die Dame. Ich tat es, und der Chauffeur nuckelte leicht mit dem Kopf, denn seine Scheibe vorn spiegelte. Und dann hielt das Auto da, wo alle bessern Geschichten anfangen: am Bahnhof.
3
Es ergab sich, dass der Gepäckträger Nr. 47 aus Warnemünde stammte, und der Freude und des Geredes war kein Ende, bis ich diese landsmännische Idylle, der Zeit wegen, unterbrach. »Fährt der Gepäckträger mit? Dann könnt ihr euch ja vielleicht im Zug weiter unterhalten.« – »Olln Döskopp! Heww di man nich so!« sagte die Prinzessin. Und: »Wi hemm noch bannig Tid!« der Gepäckträger. Da schwieg ich überstimmt, und die beiden begannen ein emsiges Palaver darüber, ob Korl Düsig noch am »Strom« wohnte – wissen Sie: Düsig – näää … de Olsch! So, Gott sei Dank, er wohnte noch da! Und hatte wiederum ein Kind hergestellt: der Mann war achtundsiebzig Jahre und wurde von mir, hier an der Gepäckausgabe, außerordentlich beneidet. Es war sein sechzehntes Kind. Aber nun waren es nur noch acht Minuten bis zum Abgang des Zuges, und … »Willst du Zeitungen haben, Lydia?« – Nein, sie wollte keine. Sie hatte sich etwas zum Lesen mitgebracht – wir unterlagen beide nicht dieser merkwürdigen Krankheit, plötzlich auf den Bahnhöfen zwei Pfund bedrucktes Papier zu kaufen, von dem man vorher ziemlich genau weiß: Makulatur. Also kauften wir Zeitungen.
Und dann fuhren wir – allein im Abteil – über Kopenhagen nach Schweden. Vorläufig waren wir noch in der Mark Brandenburg.
»Finnste die Gegend hier, Peter?« sagte die Prinzessin. Wir hatten uns unter anderm auf Peter geeinigt – Gott weiß, warum.
Die Gegend? Es war ein heller, windiger Junitag – recht frisch, und diese Landschaft sah gut aufgeräumt und gereinigt aus – sie wartete auf den Sommer und sagte: Ich bin karg. »Ja …«, sagte ich. »Die Gegend …« – »Du könntest für mein Geld wirklich etwas Gescheiteres von dir geben«, sagte sie. »Zum Beispiel: diese Landschaft ist wie erstarrte Dichtkunst, oder sie erinnert mich an Fiume, nur ist da die Flora katholischer – oder so.« – »Ich bin nicht aus Wien«, sagte ich. »Gott sei Dank«, sagte sie. Und wir fuhren.
Die Prinzessin schlief. Ich denkelte so vor mich hin.
Die Prinzessin behauptete, ich sagte zu jeder von mir geliebten Frau, aber auch zu jeder –: »Wie schön, dass du da bist!« Das war eine pfundsdicke Lüge – manchmal sagte oder dachte ich doch auch: »Wie schön, dass du da bist … und nicht hier!« – aber wenn ich die Lydia so neben mir sitzen sah, da sagte ich es nun wirklich. Warum –?
Natürlich deswegen. In erster Linie …? Ich weiß das nicht. Wir wussten nur dieses: Eines der tiefsten Worte der deutschen Sprache sagt von zwei Leuten, dass sie sich nicht riechen können. Wir konnten es, und das ist, wenn es anhält, schon sehr viel. Sie war mir alles in einem: Geliebte, komische Oper, Mutter und Freund. Was ich ihr war, habe ich nie ergründen können.
Und dann die Altstimme. Ich habe sie einmal nachts geweckt, und, als sie aufschrak: »Sag etwas!« bat ich. »Du Dummer!« sagte sie. Und schlief lächelnd wieder ein. Aber ich hatte die Stimme gehört, ich hatte ihre tiefe Stimme gehört.
Und das dritte war das Missingsch. Manchen Leuten erscheint die plattdeutsche Sprache grob, und sie mögen sie nicht. Ich habe diese Sprache immer geliebt; mein Vater sprach sie wie hochdeutsch, sie, die »vollkommnere der beiden Schwestern«, wie Klaus Groth sie genannt hat. Es ist die Sprache des Meeres. Das Plattdeutsche kann alles sein: zart und grob, humorvoll und herzlich, klar und nüchtern und vor allem, wenn man will, herrlich besoffen. Die Prinzessin bog sich diese Sprache ins Hochdeutsche um, wie es ihr passte – denn vom Missingschen gibt es hundert und aberhundert Abarten, von Friesland über Hamburg bis nach Pommern; da hat jeder kleine Ort seine Eigenheiten. Philologisch ist dem sehr schwer beizukommen; aber mit dem Herzen ist ihm beizukommen. Das also sprach die Prinzessin – ah, nicht alle Tage! Das wäre ja unerträglich gewesen. Manchmal, zur Erholung, wenn ihr grade so zu Mut war, sprach sie missingsch; sie sagte darin die Dinge, die ihr besonders am Herzen lagen, und daneben hatte sie im Lauf der Zeit schon viel von Berlin angenommen. Wenn sie ganz schnell »Allmächtiger Braten!« sagte, dann wusste man gut Bescheid. Aber mitunter sprach sie doch ihr Platt oder eben jenes halbe Platt: missingsch.
Das weiß ich noch wie heute … Das war, als wir uns kennenlernten. Ich war damals zum Tee bei ihr und bot den diskret lächerlichen Anblick eines Mannes, der balzt. Dabei sind wir ja rechtschaffen komisch … Ich machte Plüschaugen und sprach über Literatur – sie lächelte. Ich erzählte Scherze und beleuchtete alle Schaufenster meines Herzens. Und dann sprachen wir von der Liebe. Das ist wie bei einer bayrischen Rauferei – die raufen auch erst mit Worten.
Und als ich ihr alles auseinandergesetzt hatte, alles, was ich im Augenblick wusste, und das war nicht wenig, und ich war so stolz, was für gewagte Sachen ich da gesagt hatte, und wie ich das alles so genau und brennendrot dargestellt und vorgeführt hatte, in Worten, sodass nun eigentlich der Augenblick gekommen war, zu sagen: »Ja, also dann …« – da sah mich die Prinzessin lange an. Und sprach: »Einen weltbefohrnen dschungen Mann –!«
Und da war es aus. Und ich fand mich erst viel später bei ihr wieder, immer noch lachend, und mit der erotischen Weihe war es nichts geworden. Aber mit der Liebe war es etwas geworden.
Der Zug hielt.
Die Prinzessin fuhr auf, öffnete die Augen. »Wo sind wir?« – »Es sieht aus wie Stolp oder Stargard – jedenfalls ist es etwas mit St«, sagte ich. – »Wie sieht es noch aus?« fragte sie. – »Es sieht aus«, sagte ich und blickte auf die Backsteinhäuschen und den trübsinnigen Bahnhof, »wie wenn hier die Unteroffiziere geboren werden, die ihre Mannschaften schinden. Möchtest du hier Mittag essen?« Die Prinzessin schloss sofort die Augen. »Lydia«, sagte ich, »wir können auch im Speisewagen essen, der Zug hat einen.« – »Nein«, sagte sie. »Im Speisewagen werden die Kellner immer von der Geschwindigkeit des Zuges angesteckt, und es geht alles so furchtbar eilig – ich habe aber einen langsamen Magen …« – »Gut. Was liest du da übrigens, Alte?« – »Ich schlafe seit zwei Stunden auf einem mondänen Roman. Der einzige Körperteil, mit dem man ihn lesen kann …«, und dann machte sie die Augen wieder zu. Und wieder auf. »Guck eins … die Frau da! Die is aber misogyn!« – »Was ist sie?« – »Misogyn … heißt das nicht mickrig? Nein, das habe ich mit den Pygmäen verwechselt; das sind doch diese Leute, die auf Bäumen wohnen … wie?« Und nach dieser Leistung entschlummerte sie aufs neue, und wir fuhren, lange, lange. Bis Warnemünde.
Da war der »Strom«. So heißt hier die Warne – war es die Warne? Peene, Swine, Dievenow … oder hieß der Fluss anders? Es stand nicht dran. Mit Karlchen und Jakopp hatte ich der Einfachheit halber erfunden, jeder Stadt den ihr zugehörigen Fluss zu geben: Gleiwitz an der Gleiwe, Bitterfeld an der Bitter und so fort.
Hier am Strom lagen lauter kleine Häuser, eins beinah wie das andere, windumweht und so gemütlich. Segelboote steckten ihre Masten in die graue Luft, und beladene Kähne ruhten faul im stillen Wasser. »Guck mal, Warnemünde!«
»Diß kenn ich scha denn nu doch wohl bisschen besser als du. Harre Gott, nein … Da ische den Strom, da bin ich sozusagen an groß gieworn! Da wohnt scha Korl Düsig un min oll Wiesendörpsch, un in das nüdliche lütte Haus, da wohnt Tappsier Kröger, den sind solche netten Menschen, as es auf diese ausgeklürte Welt sons gah nich mehr gibt … Und das is Zenater Eggers sin Hus, Dree Linden. Un sieh mal: das alte Haus da mit den schönen Barockgiebel – da spückt es in!« – »Auf plattdeutsch?« fragte ich. – »Du büschan ganzen mongkanten Mann; meins, den Warnemünder Giespenster spüken auf hochdeutsch rum – nee, allens, was Recht is, Ordnung muss sein, auch inne vierte Dimenzion …! Und …« Rrrums – der Zug rangierte. Wir fielen aneinander. Und dann erzählte sie weiter und erklärte mir jedes Haus am Strom, soweit man sehen konnte.
»Da – da is das Haus, wo die alte Frau Brüshaber in giewohnt hat, die war eins so fühnsch, dass ich’n beßres Zeugnis gehabt hab als ihre Großkinder; die waren ümme so verschlichen … und da hat sie von ’n ollen Wiedow, dem Schulderekter, gesagt: Wann ick den Kierl inn Mars hat, ick scheet em inne Ostsee! Un das Haus hat dem alten Laufmüller giehört. Den kennst du nich auße Weltgeschichte? Der Laufmüller, der lag sich ümme inne Haaren mit die hohe Obrigkeit, was zu diese Zeit den Landrat von der Decken war, Landrat Ludwig von der Decken. Und um ihn zu ägen, kaufte sich der Laufmüller einen alten räudigen Hund, und den nannte er Lurwich, und wenn nu Landrat von der Decken in Sicht kam, denn rief Laufmüller seinen Hund: Lurwich, hinteh mich! Und denn griente Laufmüller so finsch, und den Landrat ärgerte sich … un davon haben wi auch im Schohr 1918 keine Revolutschon giehabt. Ja.« – »Lebt der Herr Müller noch?« fragte ich. – »Ach Gott, neien – he is all lang dod. Er hat sich giewünscht, er wollt an Weg begraben sein, mit dem Kopf grade an Weg.« – »Warum?« – »Dscha … dass er den Mächens so lange als möchlich untere Röck … Der Zoll!« Der Zoll.
Europa zollte. Es betrat ein Mann den Raum, der fragte höflichst, ob wir … und wir sagten: nein, wir hätten nicht. Und dann ging der Mann wieder weg. »Verstehst du das?« fragte Lydia. – »Ich verstehe es nicht«, sagte ich. »Es ist ein Gesellschaftsspiel und eine Religion, die Religion der Vaterländer. Auf dem Auge bin ich blind. Sieh mal – sie können das mit den Vaterländern doch nur machen, wenn sie Feinde haben und Grenzen. Sonst wüsste man nie, wo das eine anfängt und wo das andere aufhört. Na, und das ginge doch nicht, wie …?« Die Prinzessin fand, dass es nicht ginge, und dann wurden wir auf die Fähre geschoben.
Da standen wir in einem kleinen eisernen Tunnel, zwischen den Dampferwänden. Rucks – nun wurde der Wagen angebunden. »Wissen möcht ich …«, sagte die Prinzessin, »warum ein Schiff eigentlich schwimmt. Es wiegt so viel: es müsste doch untergehn. Wie ist das! Du bist doch einen studierten Mann!« – »Es ist … der Luftgehalt in den Schotten … also pass mal auf … das spezifische Gewicht des Wassers … es ist nämlich die Verdrängung …« – »Mein Lieber«, sagte die Prinzessin, »wenn einer übermäßig viel Fachausdrücke gebraucht, dann stimmt da etwas nicht. Also du weißt es auch nicht. Peter, dass du so entsetzlich dumm bist – das ist schade. Aber man kann jawohl nicht alles beieinander haben.« Wir wandelten an Bord.
Schiffslängs – backbord – steuerbord … ganz leise arbeiteten die Maschinen. Warnemünde blieb zurück, unmerklich lösten wir uns vom Lande. Vorbei an der Mole da lag die Küste.
Da lag Deutschland. Man sah nur einen flachen, bewaldeten Uferstreifen und Häuser, Hotels, die immer kleiner wurden, immer mehr zurückrückten, und den Strand … War dies eine ganz leise, winzige, eine kaum merkbare Schaukelbewegung? Das wollen wir nicht hoffen.
Ich sah die Prinzessin an. Sie spürte sogleich, wohinaus ich wollte. »Wenn du käuzest, min Jung«, sagte sie, »das wäre ein Zückzeh fuh!« – »Was ist das?« – »Das ist Französisch« – sie war ganz aufgebracht – »nu kann der Dschung nich mal Französch, un hat sich do Jahrener fünf in Paris feine Bildung bielernt … Segg mohl, was hasse da eigentlich inne ganze Zeit giemacht? Kann ich mi schon lebhaft vorstelln! Ümme mit die kleinen Dirns umher, nöch? Du bischa einen Wüstling! Wie sind denn nun die Französinnen? Komm, erzähl es mal auf Lydia – wir gehn hier rauf und runter, immer das Schiff entlang, und wenn dir schlecht wird, dann beugst du dich über die Reeling, das ist in den Büchern immer so. Erzähl.«
Und ich erzählte ihr, dass die Französinnen sehr vernünftige Wesen seien, mit einer leichten Neigung zu Kapricen,1 die seien aber vorher einkalkuliert, und sie hätten pro Stück meist nur einen Mann, den Mann, ihren Mann, der auch ein Freund sein kann, natürlich – und dazu vielleicht auch anstandshalber einen Geliebten, und wenn sie untreu seien, dann seien sie es mit leichtsinnigem Bedacht. Beinah jede zweite Frau aber hätte einen Beruf. Und sie regierten das Land ohne Stimmrecht – aber eben nicht mit den Beinen, sondern durch ihre Vernunft. Und sie seien liebenswürdige Mathematik und hätten ein vernünftiges Herz, das manchmal mit ihnen durchginge, doch pfiffen sie es immer wieder zurück. Ich verstände sie nicht ganz.
»Es scheinen Frauen zu sein«, sagte Lydia.
Die Fähre schaukelte nicht grade – sie deutete das nur an. Auch ich deutete etwas an, und die Prinzessin befahl mich in den Speiseraum. Da saßen sie und aßen, und mir wurde gar nicht gut, als ich das sah – denn sie essen viel Fettes in Dänemark, und dieses war eine dänische Fähre. Die Herrschaften aßen zur Zeit: Spickaal und Hering, Heringsfilet, eingemachten Hering, dann etwas, was sie »sild« nannten, ferner vom Baum gefallenen Hering und Hering schlechthin. Auf festem Land eins immer besser als das andere. Und dazu tranken sie jenen herrlichen Schnaps, für den die nordischen Völker, wie sie da sind, ins Himmelreich kommen werden. Die Prinzessin geruhte zu speisen. Ich sah ehrfürchtig zu; sie war essfest. »Du nimmst gar nichts?« fragte sie zwischen zwei Heringen. Ich sah die beiden Heringe an, die beiden Heringe sahen mich an, wir schwiegen alle drei. Erst als die Fähre landete, lebte ich wieder auf. Und die Prinzessin strich mir leise übers Knie und sagte ehrfürchtig: »Du bischa meinen kleinen Klaus Störtebecker!« Und ich schämte mich sehr.
Und dann ruckelten wir durch Laaland, das dalag, flach wie ein Eierkuchen, und wir kramten in unsern Zeitungen, und dann spielten wir das Bücherspiel: jeder las dem anderen abwechselnd einen Satz aus seinem Buch vor, und die Sätze fügten sich gar schön ineinander. Die Prinzessin blätterte die Seiten um, ich sah auf ihre Hände … sie hatte so zuverlässige Hände. Einmal stand sie im Gang und sah zum Fenster hinaus, und dann ging sie fort, und ich sah sie nicht mehr. Ich tastete nach ihrem Täschchen, es war noch warm von ihrer Hand. Ich streichelte die Wärme. Und dann setzten sie uns wieder über ein Meerwasser, und dann rollten wir weiter, und dann – endlich! endlich! – waren wir in Kopenhagen.