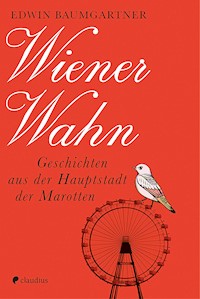Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wien gilt als Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Ein Grund dafür dürfte die mentale Infrastruktur ihrer (Ur-)Bevölkerung sein. Diese pflegt einen Humor, der als „Schmäh“ berühmt-berüchtigt ist. Aber Vorsicht: Schmäh ist nicht nur eine lokale Spielart des Witzes, sondern gelebte Philosophie. Der grantelnde Wiener, der die Todessehnsucht in den Genen hat, braucht den Schmäh, um in einer schmählosen, kalten Welt überleben zu können. Der Schmäh erleichtert das Leben, indem er dessen latenten Irrsinn herausschält und pointiert. Der – wie anders? – Wiener Feuilletonist Edwin Baumgartner traut sich als erster an das Phänomen des Schmäh heran und erkundet es ebenso witzig wie weise. Von Moser und Muliar bis hin zu den Schmähbiotopen Beisl und Würstelstand – nach dieser Lektüre sage niemand mehr, er kenne Wien nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE LEKTORIN MEINES VERTRAUENS GIBT ES WIRKLICH.
SIE IST FÜR MICH MEHR ALS NUR DIE LEKTORINMEINES VERTRAUENS.
IHR IST DIESES BUCH GEWIDMET.
SCHMÄHOHNE.
Copyright © Claudius Verlag, München 2018
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München
Layout: Mario Moths, Marl
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-532-60026-9
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Wie die Jungfrau zum Kind und ich auf den Schmäh kam
INTERMEZZO: Auf dem Gang im Stiegenhaus
Was der Schmäh ist
INTERMEZZO: Im Modegeschäft gegenüber
Woher der Schmäh kommt
INTERMEZZO: Beim Würstelstand
Wein, Wien und der Schmäh
INTERMEZZO: Im Stammbeisl
Der erste Schmähtandler
INTERMEZZO: Beim Gassi gehen
Ein ganzer, ein halber und ein doppelter Schmähtandler
INTERMEZZO: Im Freibad
Noch ein paar Schmähtandler, ein Pülcher und vielleicht der Kreisler
INTERMEZZO: Im Taxi
Aber jetzt! Ein ganz schwarzer Schmähtandler
Der Tod ist ein Schmäh
INTERMEZZO: Auf dem Friedhof
Schimpfen mit Schmäh
INTERMEZZO: Im Schrebergarten
Singen mit Schmäh
INTERMEZZO: Im Park
Lieben mit Schmäh
INTERMEZZO: Auf einem Bankerl im Park
Überall rennt der Schmäh
INTERMEZZO: Beim Altwarentandler
Theater mit Schmäh
Ein letzter Schmäh
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
WIE DIE JUNGFRAU ZUM KIND UND ICH AUF DEN SCHMÄH KAM
Das muss ich Ihnen jetzt erzählen:
Was der Schmäh ist, wirklich ist, also, was der Schmäh wirklich ist, das weiß keiner genau. Ich hoffe, Sie erwarten jetzt keine tiefschürfende Abhandlung, keine „Philosophie des Schmähs“, keine „Geschichte des Schmähs unter Berücksichtigung der Schmähführung in den ersten 17 Monaten der Regentschaft von Kaiser Franz Joseph“, keine Untersuchung „Der Schmäh als vor-postmoderne Dekonstruktion ernsthafter Erzähltechniken“. Es gibt keine Definition für Schmäh, zumindest keine zutreffende, keine, die sozusagen schmähumfassend wäre, die alles beinhaltet, was der Wiener unter Schmäh versteht.
Der grantelnde Wiener, der die Todessehnsucht in den Genen hat, für den die „scheene Leich“ zum Leben dazugehört, und der bei seinem Stamm-Würstelstand eine „Eitrige“ mit einem „Geschissenen“ bestellt, braucht den Schmäh, um in einer schmählosen Welt zu überleben.
Denn der Schmäh beseitigt seine Probleme. Der Schmäh nimmt nie den geraden Weg, sondern den, der das Leben ein bisserl besser macht. Wäre der Schmäh ein Bergsteiger, würde er nicht auf geradem Weg zum Gipfel keuchen, sondern den bequemsten Pfad suchen, und braucht er ein bisserl länger, dann ist das halt so. Der Schmäh hat Zeit, und wenn er sie nicht hat, dann nimmt er sie sich, wo er sie findet.
Wenn der Wiener eine seiner sowieso ungeliebten Entscheidungen treffen soll, bedient er sich des Schmähs, um in der Sicherheit des Ungefähren zu verharren. Der Schmäh erleichtert das Leben, weil er es nicht in Geschichten verpackt, sondern in G’schichterln und treffende Aussprüche, die der Franzose als Bonmots bezeichnen würde. Nur, dass der Schmäh kein Bonmot ist, sondern ein Schmäh.
Darum kann ich Ihnen bei bestem Willen nicht in einem Satz sagen, was der Schmäh ist. Allenfalls erzählen kann ich es Ihnen. Dazu gehört, wie ich selbst zum Schmäh gekommen bin. Wie die Jungfrau zum Kind nämlich, so war das.
Kennen Sie dieses Sprichwort überhaupt, zu etwas kommen „wie die Jungfrau zum Kind“? Die Jungfrau Maria, die mit mancherlei Stoßseufzern und Redewendungen in so vielen katholischen Mündern geführt wird, kam, ganz ohne eigenes Zutun im Umgang mit ihrem Verlobten Josef, durch den Heiligen Geist zum Kind. Wenn nun jemand meint, er sei zu etwas gekommen wie die Jungfrau zum Kind, dann heißt das, es habe sich so ergeben, durch höhere Fügung oder wie auch immer. Der Beglückte (oder fallweise auch Beunglückte) hat sich nicht darum gerissen.
So, genau so, kam ich zum Schmäh. Jetzt. Aber es war mir schon zuvor einmal passiert – das erzähle ich Ihnen am Schluss des Kapitels. Man fängt schließlich nicht mit den Niederungen der eigenen Vergangenheit an, sondern mit den Höhepunkten der Gegenwart. Wie war das vor ein paar Wochen doch gleich gewesen? Da erinnere ich mich gerne zurück: Der Verleger selbst meinte, nur ich, ich ganz allein von – sagte er fünfhundert oder fünftausend Autoren (immer diese Gedächtnislücken)? – käme für die Aufgabe in Frage. Also fuhr er von München nach Wien im verlagseigenen Rolls Royce, selbstverständlich mit dem Ersten Chauffeur des Verlags, seit 23 Jahren unfallfrei. Er holte mich von meiner Grinzinger Villa ab …
„Moment“, wirft die Lektorin meines Vertrauens ein, die mein guter Geist ist und mir immer dann über die Schulter schaut, wenn ich es gerade nicht merke. „Nein, warte“, sage ich und tippe weiter.
… holte mich von meiner Grinzinger Villa ab, fuhr mit dem vom Ersten Chauffeur des Verlags gelenkten Rolls Royce und ihm, dem Verleger, und mir im Fond über die Ringstraße, holte aus der Minibar eine Flasche Dom Perignon Vintage 2002 heraus, schenkte in die Waterford-Champagnerflöten ein und begann, seine Überredungskünste an mir zu erproben. Nur zu gut wusste er, dass Schmäh und meine äußerste Seriosität nicht zusammenpassen. (Weshalb mir die Lektorin meines Vertrauens auf die Schulter klopft und laut atmet, weiß nur sie selbst.) Aber ich ließ mich auf das Verkaufsgespräch ein, und nachdem er mir schließlich angeboten hatte, ich könne das Buch in der verlagseigenen Villa auf den Bahamas schreiben (Personal inklusive, Kosten übernimmt der Verlag), willigte ich, trotz gewisser Bedenken, ein.
In der nächstgelegenen Buchhandlung erstand ich Konrad Klönschnacks „Leitfaden zur Erlernung der humorvollen Erzählweise“ (Verlag am Misthaufen, Hühnergeschrei 2007), begann mit dem Selbststudium und strich gleich den zentralen Satz rot an, der lautet: „Bei einem Witz sparen Sie die Pointe bis zum Schluss auf. Erzählen Sie die Pointe am Beginn, könnten Sie nämlich unter Umständen Ihrer kleinen Geschichte die amüsante Note vorzeitig nehmen.“ Aber auf keiner der 376 Seiten findet sich etwas über das Schmähführen.
„Fängst du schon im Vorwort mit dem Schmäh an?“, fragt die Lektorin meines Vertrauens, die mir immer noch über die Schulter schaut und gleichzeitig auf sie, die Schulter nämlich, draufklopft. „Wieso“, frage ich. „Das glaubt dir doch keiner“, sagt sie. „Es war einfach ein Anruf, und die Sache mit dem ,Leitfaden zur Erlernung der humorvollen Erzählweise‘ …“, sagt sie weiter.
„Jo, eh“, sage ich. „Aber den Ort namens ,Hühnergeschrei‘ gibt’s wirklich im oberösterreichischen Mühlviertel, Postleitzahl 4121, und ich sehe gar nicht ein“, sage ich, „weshalb dort nicht ein ,Verlag am Misthaufen‘ einen ,Leitfaden zur Erlernung der humorvollen Erzählweise‘ herausbringen soll“, sage ich. „Jo, eh“, sagt die Lektorin meines Vertrauens.
„Jo, eh“ muss ich den ausländischen Lesern erklären. „Jo, eh“ ist der rechte Schmäh als Einstieg in den Schmäh. Und unter ausländischen Lesern verstehe ich all jene Beklagenswerten, denen das Unglück zugestoßen ist, außerhalb der Stadtgrenzen Wiens geboren worden zu sein. Ein Niederösterreicher zum Beispiel ist, wienerisch gesehen, ein Ausländer. Ein Salzburger noch mehr. Von einem Vorarlberger fang’ ich jetzt gar nicht erst zu reden an. Die Ausländischkeit wächst mit der Entfernung vom Nabel der Welt, nämlich von Wien. „Jo, eh“ also heißt soviel wie: „Ich gebe zu, dass du recht hast, und die Sinnhaftigkeit deiner Aussage leuchtet mir auch durchaus ein, aber ich denke, ich werde sie dennoch ignorieren.“ „Jo, eh“ – zwei Wörter; hochdeutsche Formulierung – fünfundzwanzig Wörter. Der Ausländer (eben der außerhalb der Stadtgrenzen Wiens Geborene) versteht „jo, eh“ nicht, während der Wiener bei der hochdeutschen Formulierung allenfalls mit einem halben Ohr zuhört und sich fragt, wozu der ganze Wortschwall dient, wenn man einfach „jo, eh“ sagen könnte.
Aber da bin ich jetzt beim eigentlichen Sinn dieses Kapitels. Ja, es hat wirklich einen, einen Sinn nämlich. Aber wenn ich ihn in der ersten Zeile darlegte und so weiterverführe im ganzen Buch, brauchte ich keinen einjährigen Arbeitsaufenthalt in der verlagseigenen Villa auf den Bahamas (jo, eh, oh Lektorin meines Vertrauens), da würde mir ein Wochenende in meiner Wiener Wohnung genügen. Und der Schmäh wäre auf sein Skelett abgemagert und somit kein Schmäh mehr.
Viele Orte, an denen der Schmäh gediehen ist, gibt es gar nicht mehr: Das Milchgeschäft, das nur Milch und einfache Milchprodukte und vielleicht noch Semmeln verkaufte, die Greißlerei, wo meine Mutter Wurst, Gemüse und Obst holte, der Fleischhauer und das Fischgeschäft zwei Häuser weiter – und natürlich das Modegeschäft von der Frau Schuller. Ja, die hat es wirklich gegeben, die Frau Schuller, und sie war eine begnadete Schmähführerin. Je länger ich an diesem Buch geschrieben habe (diesen Satz können Sie als Hinweis lesen, dass dieses Kapitel, zumindest in größeren Teilen, am Schluss entstanden ist – wie das oft vorkommt bei ersten Kapiteln), desto mehr ist mir aufgefallen, wie sehr es auch eine Reise in meine eigene Kindheit und Jugend ist, als der Schmäh noch wirklich rannte, weil die Menschen einander immer wieder begegneten im Grätzl1 und einander immer etwas zu erzählen hatten, die kleinen Dinge, die ganz groß sein können. Da kommt es nur auf den Blickwinkel an. Gelebtes Facebook war das, nur mit weniger Verbissenheit und Selbstbeschau.
Zurück zum Sinn dieses Kapitels, das so quasi ein Vorwort ist, das ich aber nicht Vorwort nenne, weil ich zu den Lesern gehöre, die Vorworte erst zum Schluss lesen. Bestenfalls. Doch dieser um Verzeihung heischende Hinweis ist lesenswichtig: Ohne Wiener Dialekt geht’s nicht, zumindest nicht immer. Leider. Ich hab’s versucht mit konsequentem Hochdeutsch, aber ich bin gescheitert. „Owa des woa nix“, wie man auf Wienerisch sagt. Wieso nicht, werde ich versuchen, an einem Beispiel zu erklären.
H.C. Artmann wird uns in diesem Buch noch öfter begegnen. Artmann war einer der größten Dichter, die Österreich in der Nachkriegszeit hatte. Außerdem war er ein begnadeter Schmähbruder, also einer, der seine Freunde und Leser am Schmäh halten konnte. (Was ein Schmähbruder ist und wie man am Schmäh gehalten wird und so weiter – nicht so ungeduldig, wir haben dazu ja ein ganzes Buch vor uns!) Jener Artmann schrieb 1958 seinen Gedichtband „med ana schwoazzn dintn“, in dem er die Dialektdichtung revolutionierte, auch im Schriftbild.
Schauen Sie, jetzt muss ich wieder was dazwischenschieben. Aber so ist das beim Schmäh. Was ganz geradlinig verläuft, ist kein Schmäh. Beim Schmähführen ergibt ein Wort das andere, und es kann da schon passieren, dass man bei einer G’schicht über einen vegetarischen Würstelstand anfängt und bei einer scheenen Leich’ am Zentralfriedhof endet, ohne dass, wider Erwarten, das eine mit dem anderen ursächlich was zu tun hätte.
So komm’ ich jetzt von H.C. Artmann auf den Dichter Ernst Kein, und das hat sogar etwas miteinander zu tun. Wenn Martin Luther seinerzeit dem Volk aufs Maul geschaut hat, so hat das Kein bei den Wienern gemacht. Und was dort herausgekommen ist, hat Kein aufgeschrieben. Oder er hat es so gedichtet, als wäre es dort herausgekommen. Für die Übertragung des gesprochenen Wienerischen in die Schrift hat Kein auf alle phonetischen Zusatzzeichen verzichtet. Das schaut ein bisserl komisch aus beim ersten Lesen, so, als wär’s gar nicht Deutsch, sondern irgendeine Fremdsprache, die keiner verstehen kann. Aber ich geb’ Ihnen einen Tipp: Lesen Sie’s laut, Sie werden den richtigen Klang schnell ins Ohr kriegen. Kleine Übung mit Kein gefällig? Also:
Da moozat
da schubeat franzl
da schdraus da heidn
und da derische
bedhoofn
sengs
des woan
ollas weana
so wia i
Wie ist es Ihnen beim Entziffern ergangen? – Keine Sorge, das wird schon. Ich verrate Ihnen einen Trick: Lesen Sie laut, was in diesem Buch an Mundart vorkommt. Dann ist alles klar. Obendrein werden Sie süchtig werden nach dem Klang – und nach dieser Schreibung obendrein. Abgesehen davon: Den Schmäh vom Ernst Kein haben Sie bemerkt? Ich meine, Ludwig van Beethoven, gebürtig im Dezember 1770 zu Bonn, als Wiener auszugeben? Und Wolfgang Amadeus Mozart ist doch eigentlich Salzburger. Oder täuscht mich meine Erinnerung? Und Joseph Haydn – ich sage nur: Rohrau, Niederösterreich. Ein Wiener ist, wen der Wiener – mit Schmäh, wohlgemerkt – zum Wiener erklärt.
Zurück zu Artmann. Was Kein erfunden hat in der Dialektschreibung, hat Artmann in der „schwoazzn dintn“ perfektioniert. Manchmal freilich geben die Buchstaben eher Artmanns eigene Sprechweise wieder, wenn er bei Lesungen die Gedichte zwischen seinen Zähnen zerquetschte. Aber er nähert sich dem gesprochenen Wienerisch wirklich gut an. Deshalb übernehme ich seine Schreibweise (oder die vom Ernst Kein). Ich versuche nur, allzu bewusst originelle Schreibungen auszugleichen und dadurch leichter lesbar zu gestalten.
Über Artmann und seine Schmähs werden wir, wie gesagt, später mehr erfahren. Jetzt aber zu einem Beispiel, das zeigen soll, warum ich in einem Buch über den Schmäh auf den Dialekt nicht verzichten kann. Zwei Verse aus einem Gedicht Artmanns sind zum Beweis völlig genug:
waun i amoe a bangl reis
zu deitsch: de bodschn schdrek
Wie, um alles in der Welt, soll ich Ihnen das übersetzen? „A bangl reis“ heißt „eine kleine Bank reißen“, die Bedeutung ist „sterben“. „de bodschen schdrek“ heißt „die Pantoffel ausstrecke“, wobei „bodschn“ (Pantoffel) aber als Synonym für „Beine“ steht, womit die Übersetzung richtig lautet: „Die Beine ausstrecke“. Die Bedeutung ist dieselbe: „sterben“. Wien und der Tod – diese Liebesbeziehung hat manch einen Ausdruck und manch einen Schmäh hervorgebracht. Auch dazu komme ich noch. Nua net hudln2.
Wir aber haben jetzt das Rüstzeug für die hochdeutsche Übersetzung dieses Artmann-Gedichts. Alsdann:
„Wenn ich einmal sterbe / auf Deutsch: sterbe …“ Das kann man gleich aufgeben. Versuch Nummer zwei: „Wenn ich einmal ein Bänklein reiße / zu Deutsch: Die Pantoffel ausstrecke …“ Unverständlich dünkt mich dies. Heraus mit den Synonymen. „Sterben“ darf man nicht verwenden, denn dieses Wort könnte Artmann benützen, wenn er’s denn benützen wollte. Er könnte schreiben: „waun i amoe stiab“. Aber er will umschreiben, und so muss man’s auch übersetzen, wenn man’s übersetzen muss. Dritter Versuch: „Wenn ich einmal von hinnen gehe / auf Deutsch: verscheide …“ Naa, des wiad aa nix (zu Hochdeutsch: Nein, das klappt auch nicht). Zu geschwollen für die Wiedergabe von Artmanns Diktion. Es muss beim Dialekt bleiben. Nur dann ist dieser Schmäh ein Schmäh.
Dass sich Dialekt nicht so einfach ins Hochdeutsche übertragen lässt, hat nicht mit dem Wienerischen allein zu tun. Es ist ein Charakteristikum des Dialekts. Wenn ein Bayer sagt: „Wea ko, dea ko“, dann mag man das zwar eins zu eins verhochdeutschen zu „wer kann, der kann“, aber die Aufmüpfigkeit bleibt unübersetzbar, denn gemeint ist ja: „Eigentlich ist mir mein Tun nicht gestattet, ich nehme mir dennoch die Freiheit, es gleichsam justament zu tun.“
Der Schmäh funktioniert manchmal schon auch auf Hochdeutsch, aber oft muss es eben Wienerisch sein. Ich werde in diesen Fällen eine hochdeutsche Lese- und Verständnishilfe beistellen. Versprochen. Nur die Übersetzung der Bedeutung, die kann ich nicht in allen Fällen garantieren.
Übrigens muss ich gleich eine Warnung aussprechen: Hüter der politisch korrekten Ausdrucksweise verzweifeln am Schmäh. Dem Schmäh ist es, Wienerisch gesprochen, wuascht, ob man und wie man etwas sagen darf. Zum Beispiel ist der Ausdruck „Neger“ für einen Schwarzafrikaner mittlerweile verpönt. Man soll „Schwarzer“ sagen.
Für das Schmähführen hat das freilich den Nachteil, dass die Verständigung mitunter massiv erschwert ist, was wiederum den beabsichtigten Schmäh erweitert, wie in diesem Fall, dessen Zeuge ich im Oktober 2014 im Café Frauenhuber wurde. Zwei Herren unterhalten sich über das Weltgeschehen. Der eine hat seine Ausdrucksweise politisch korrekt aufgerüstet, zumindest einen Moment lang. Er sagt: „Hosd g’head? – Bei de Schwoazn is a Seich ausbrochn.“ Der andere: „Naa, des is ma neu. Wos sogt’n da Kuaz dazua?“ Nun muss man wissen, dass Sebastian Kurz ein populärer Politiker der Österreichischen Volkspartei, der ÖVP, ist, der konservativen bürgerlichen Partei, die damals Schwarz als Fraktionsfarbe hatte3, womit sie bei den Wienern nur „de Schwoazn“ hießen. Der erste der beiden Männer hatte indessen den Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika gemeint. Das Missverständnis lieferte dem Schmäh und damit dem Dialog Nahrung. Der erste: „Wiaso da Kuaz? Dea hod jo nix mit de Schwoazn z’ tuan.“ Der zweite: „Ah geh! Dea is do a Schwoaza!“ Der erste, endlich verstehend: „Na, net bei unsere Schwoazn, bei de Bloßfiaßign.“ Der zweite: „Ah so, bei de Nega. Jo, daun …“
Das Schmähführen auf dem Rücken der Schwarzafrikaner hat übrigens den FPÖ-Politiker Andreas Mölzer seinen Sitz im EU-Parlament gekostet. Mölzer, der dem deutschnationalen Flügel der Partei zugerechnet wird, hielt am 18. Februar 2014 eine Philippika gegen die EU, in deren Verlauf er diese unter anderem als „Negerkonglomerat“ bezeichnete. Die Wogen gingen hoch, Mölzer versuchte, sich herausreden, es half alles nichts; schließlich verzichtete er auf seine Kandidatur. Mölzer war ein absichtlicher Verstoß gegen eine politisch korrekte Ausdrucksweise durchaus zuzutrauen. Aber wieso sollte er einen europäischen Staatenbund als Konglomerat von Schwarzafrikanern bezeichnen? Die Beleidigung hatte weder Hand noch Fuß.
Das Geheimnis liegt in der Unterbedeutung des Wortes „Neger“. Der Wiener Dialekt (hoffentlich nur) früherer Tage nennt Schwarzafrikaner auch „Bloßfüßige“ und „Nackte“. Mag ja für einzelne Stämme stimmen, wer will sich, in der Vorstellung von Bewohnern gemäßigter Zonen, bei 40 und mehr Grad im Schatten nicht am liebsten die Kleider vom Leib reißen? Keine Schuhe bzw. kein Gewand zu besitzen ist andererseits ein Zeichen für Armut. „Neger sein“ hat somit, über ein paar Ecken, wie es beim Schmäh so ist, die Bedeutung angenommen, kein Geld zu haben. Mölzer meinte also nicht, die EU sei ein Konglomerat von Schwarzafrikanern, sondern sie sei ein Konglomerat von Staaten, die „neger“ sind, also pleite. Vor lauter Schmähführen hat sich der Politiker um seinen Posten geredet.
Und wie ich jetzt auf den Schmäh kam? Ich meine, wie ich zum ersten Mal als Schmähtandler eingestuft wurde? Ich hab’ Ihnen ja versprochen, ich erzähl’s, und zwar ganz ohne Schmäh, also schmähohne, wie das auf Wienerisch heißt. Im konkreten Fall, also in dem, der Ihre Augen gerade von Buchstaben zu Buchstaben führt, wirklich durch einen Anruf des Verlags. Aber es gibt da noch das andere G’schichterl, von dem die Rede war. Ich erzähl’s ja ungern, aber vielleicht hab’ ich wirklich was halb Unseriöses an mir. Sie erzählen das aber bitte nicht weiter, auch nicht schmähhalber, einverstanden?
Es war zu Beginn meiner Tätigkeit als Musikkritiker der „Wiener Zeitung“. Dieses Blatt schreibt sich auf die Fahnen, die älteste noch erscheinende Zeitung zu sein. Sie existiert seit 1703, und eine Unterbrechung im Erscheinen gab es nur im Nationalsozialismus, als sie von 1. März 1940 bis 7. April 1945 durch den „Völkischen Beobachter – Wiener Ausgabe“ ersetzt wurde. Die „Wiener Zeitung“ ist eine sogenannte Qualitätszeitung, unbedingt seriös, alle Artikel recherchiert und überprüft, genaue Linienziehung zwischen Bericht und Meinung. Mittlerweile ist sie auch wirklich gut geschrieben. Als ich aber vor nun schon etlichen Jahren im damaligen Kulturressort anfing, verstand man unter gut geschrieben: je trockner, desto besser. Das galt, bis zu einem gewissen Grad, auch für die Theater-, Opern- und Konzertkritiken. Die Trockenheit jener lange zurückliegenden Jahre hatte damit zu tun, dass die „Wiener Zeitung“ noch keine GmbH war. Sie war rein staatlich, das „Amt der Wiener Zeitung“. Die Angestellten waren keine Redakteure, sondern Beamte. Zum Lachen stieg man hinab in den Keller, in dem Druckerei-Gefahrengüter lagerten wie Papier und Chemikalien.
Meinem ersten Chef, Norbert Tschulik, bin ich sehr dankbar, nicht nur, weil er mich unerfahrenen Jungspund überhaupt schreiben ließ, sondern, weil er nicht vom Versuch abließ, mir beibringen zu wollen, ein guter Kritiker zu sein, obwohl wir über den Einsatz von Humor unvereinbar unterschiedliche Meinungen vertraten. Tschulik war dagegen, ich war dafür. Dementsprechend war ich über die Versuche eines Pianisten mit beklagenswerter Tastentrefferquote ein Wortspiel losgeworden. Als ich Tschulik meine Kritik vorlegte, zog er, wie es seine Art war, wenn er etwas einzuwenden hatte, den Kopf zur linken Schulter und knurrte: „Net wern s witzig.“
Jener Norbert Tschulik schickte mich eines Tages zu einem Symposion über Denkmalschutz. Zumindest die Wörter kannte ich – nämlich sowohl Symposion als auch Denkmalschutz. Viel tiefer war ich zuvor in die Thematik nicht eingedrungen. In Vor-Google-Zeiten war das über einen Tag kaum möglich. Ich war zum Denkmalschutz gekommen wie zum Schmäh, also wie die Jungfrau zum Kind. Noch dazu sollte der Artikel der Seitenaufmacher werden. Ich wehrte mich, fürchtete, mich mit der fremden Materie zu blamieren und mir gleich am Anfang meiner vielversprechenden Karriere deren sofortiges Ende herbeizuschreiben. Es war sinnlos. Tschulik ließ nicht locker: „Sie werden da schon was G’schmackiges schreiben.“ Auf dem Gipfel meiner Verzweiflung entfuhr es mir: „Wieso ausgerechnet ich?“
Tschulik musterte mich mit einem verständnislosen Blick und sagte: „Weil Sie in meiner Abteilung der beste Schmähtandler sind.“
Und ich hatte mich bisher für einen völlig seriösen Kulturjournalisten gehalten. Schlimmer: Ich hatte geglaubt, auch die anderen würden mich dafür halten. Dabei war ich – ein Schmähtandler. Irgendwie muss da was dran sein an der Jungfrau, dem Kind, dem Schmäh und mir.
Schmähohne.
INTERMEZZO: AUF DEM GANG IM STIEGENHAUS
Auf dem Gang im Stiegenhaus an der der Stelle, wo früher die Bassena4 war.
- Ham s scho ghört von Hean Watzek?
- Wos denn?
- No, von eam und da Schwesta Eani.
- Naa. Sogn s jo net …
- Doch.
- Na sowas. Deaf s denn des iwahaupt?
- Sowieso. Sie is ja ka Schwesta net.
- Ah, net?
- Doo, owa hoed ka Schwesta net, oiso ka richtige. A Kraunkenschwesta is in AKH5, owa ka Schwesta, oeso ka Geistliche, vastengan s mi? Sie deaf.
Von unten ertönt eine Männerstimme: Aufzug bitte!
- Des is a eh, da Hea Watzek.
- Woens net de Aufzugtia zuamochn?
- Naa, I foa jo glei weida! I muaß eana des nua dazöön.
- Daun gschwind, Frau Schuller, sunst wiad a grantich. No, sogn s: Wean s heiradn? I maan, is ea scho gschiedn?
- Ah, gschiedn is ea do scho laung. Sie is ledig, hod a ma dazööt. Owa ob s glei heiradn? Wea waaß …
- Miassen s jo a net. I vasteh nua net … I maan, sie is a fesche Beason, und ea … Wüvü is sie jinga?
Von unten ertönt abermals die Männerstimme: Aufzug bitte!
- (laut nach unten gerichtet:) Kummt glei! Wo woa ma?
- Wüvü sie jinga is. Wos wiadn Sie schätzn?
- Zehn Joa.
- Mea. Zwanzg!
- Naa, sicha net. Sie schaut nua so jung aus. Die is guat heagricht. Goa so jung is die nimma. A guade Paatie is jedenfoes.
- Oes Kraunknschwesta?
- Eanare Ötan san gstopft wia de Ganseln, da Vota Primaa in ana Privatglinich, und sie is des anziche Kind. Zumindest hod ea mia des so gsogt.
- Schmähohne?
- Schmähohne.
In diesem Moment erscheint Herr Watzek schnaufend auf der Stiege.
- Griaß Sie, Hea Watzek!
- Grüß Gott, Frau Schuller, griaß Sie, Herr Kocourek. Da Aufzug …
- Net bees sein, Hea Watzek. Mia haum nua wos zu dischkutian ghobt, da Hea Kocourek und I.
- Am End die Gschicht von Herrn Professor Waiglein, wissen S eh, den Neuen aus m ersten Stock.
- Ah, wos wissen denn Sie do, Hea Watzek?
- Ich bitte Sie, Herr Kocourek, de Gschicht mit dem gstohlenen Mantel? Sogoa a Anzeige hod a gmacht. Und dann taucht da Mantl auf einmal bei da Frau Lidl auf.
- Schmähohne?
- Schmähohne, Frau Schuller.
- Wissen s am End de gaunze Gschicht?
In diesem Moment ertönt von unten eine Frauenstimme: Aufzug bitte!
- Jo, glei!
- Jössas, des is de Steputat, die hod s wieda amoe gnedich. Gschwind, sunst wiads grantich.
- Oeso, des woa r a so …
WAS DER SCHMÄH IST
Das muss ich Ihnen jetzt erzählen:
Jetzt wollen Sie von mir wissen, was der Schmäh ist? So quasi als Definition? Ich sag’ Ihnen gleich: Das ist aussichtslos. Das kann ich Ihnen nicht in fünf Worten sagen, und in einem schon gar nicht. Das kann ich Ihnen nur erzählen. Erzählen ist sowieso der halbe Schmäh. Um einen ganzen daraus zu machen, braucht es nichts als Schmäh. Warten Sie einen Moment (nua net hudln), Sie werden gleich verstehen, was ich meine. Die Sache ist die: Es gibt keine Definition für Schmäh, zumindest keine zutreffende, keine, die sozusagen allschmähumfassend wäre, die alles beinhaltet, was der Wiener unter Schmäh versteht. Die meisten, die sich an einer Definition versuchen, gehen über den Umweg zu erklären, was der Schmäh nicht ist. Da liest man dann in der Regel, der Schmäh sei kein Witz.
Jo, eh.
Weil der Schmäh ab und zu schon ein Witz auch sein kann. Aber eben nur „auch“ und eigentlich fast nie. Dem Witz geht es um die Pointe, dem Schmäh ums G’schichterl. Nicht um eine Geschichte, eine Geschichte ist für den Schmäh viel zu groß und viel zu schwer. Und weil der Schmäh die Leichtigkeit des G’schichterls betont, schert er sich nicht drum, ob da jetzt jedes Wort wahr ist, das G’schichterl verweht ja sowieso, Hauptsach’, es macht grad im Moment des Erzählens allen eine Freud’, den Zuhörern genauso wie dem Erzähler selbst.
Drum, glaube ich, haut sogar der Wehle daneben, wenn er den Schmäh definieren will.
Wer der Wehle ist? Das gehört zum Schmäh dazu – der Wehle sowieso, aber auch der bestimmte Artikel minus Vorname plus Nachname. Ich muss da jetzt auf das Kapitel mit der Titelvergabe bei der Anrede vorgreifen, dafür wird das dann ein bisserl kürzer. „Bisserl“ heißt übrigens „ein wenig“. – Aber Vorsicht, wenn Sie bei einem Fleischhauer zehn Deka6 Wurst verlangen. Wenn die Bedienung Sie dann nämlich fragt: „Deaf s a bisserl mea sein?“, und sie sagen „ja“, verlassen Sie womöglich mit der doppelten Menge Wurst den Laden.
„Deaf s a bisserl mea sein?“ ist somit ein typischer Fall von Schmäh, und das führt uns zurück zu dem Wehle, dessen Artikel ich aber zuerst noch erklären muss. Seit 1918 sind in Österreich die Adelstitel abgeschafft. Man wollte mit der Habsburger-Monarchie nichts mehr zu tun haben. Zumindest offiziell nicht. Inoffiziell gesteht man vor allem in Kaffeehäusern bisweilen Leuten Adelsprädikate zu, die sie nicht einmal in der Habsburger-Monarchie hatten. Dazu kommen wir noch. Dass ein Krieg, den das Haus Habsburg führt, verloren geht, das hätte man eigentlich gewohnt sein müssen. Aber das war nun doch etwas zuviel an verlorenem Krieg.
An die Stelle der durch und durch adeligen Adelsprädikate trat das Volksadelsprädikat. Um ehrlich zu sein: Es gab es auch schon zu monarchischen Zeiten. Das Volksadelsprädikat verleiht keiner offiziell. Einer fängt damit an, dann geht es von Mund zu Mund. Und gibt es jetzt kein „von“ mehr, so gibt es eine „die“ und einen „der“. Quasi Artikel statt Titel. Ist eine Österreicherin oder ein Österreicher also durch besondere Taten hervorgetreten, dann adelt ihn der Wiener in der Umgangssprache mit dem bestimmten Artikel. Aus der Schauspielerin Paula Wessely wurde „die Wessely“ und aus dem auch heute noch legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky wurde „der Kreisky“.
Das ist freilich auch eine Sache der Intonation. Auf dem Artikel muss, wenn er das Volksadelsprädikat ist, ein bisserl ein hochdeutscher Nachdruck liegen. Einen Namen mit dem geschlechtsspezifischen direkten Artikel zu versehen, pflegen nämlich alle österreichischen Dialekte. Da sagt man dann: „Gestan how i mi mi n Ferdl troffen“; wobei das „n“ die umgangssprachliche Verschleifung des „dem“ ist, das isolierte „n“ müsste eigentlich ein „m“ sein. Offenbar fällt das „n“ der Zunge leichter als sein alphabetischer Nachbarslaut. Der besagte Ferdl braucht in diesem Zusammenhang keineswegs eine herausragende Stellung in der österreichischen Gesellschaft einzunehmen.
Sagt man aber: „Gestern how i mi mit der Tobisch getroffen“, wäre das schon ein anderes Kaliber. Ein Treffen mit Lotte Tobisch, Schauspielerin, ehemalige Organisatorin des Wiener Opernballs und vielleicht letzte große Salondame Wiens, würde in der Sprache sofort abfärben: Im Umfeld von „der Tobisch“ herrscht Hochdeutsch. Niemand würde beim Schmähführen sagen: „Gestan how i mi mit da Tobisch troffen.“ Und wenn es einer doch so sagt, dann können Sie sicher sein, dass er schmähführt und die Tobisch vielleicht von Ferne gesehen hat, denn wenn er so spricht, dann gehört er gewiss nicht zu den Menschen, mit denen sich die Tobisch trifft.
Eigentlich wollte ich aber zu dem Wehle etwas sagen. Peter Wehle, nicht zu verwechseln mit seinem 1967 geborenen Sohn gleichen Namens, der sich als Krimi-Autor einen Namen macht, vorerst aber noch kein „der Wehle“ ist, der Wehle also, der Vater, war einer der brillantesten Kabarettisten Österreichs. Zu vielen seiner Texte komponierte er selbst die Musik, und einige erheben den Anspruch, Literatur zu sein. In einer Sammlung heiterer Lyrik würden sich seine grotesken bis absurden Verse so übel nicht ausnehmen. Zum Beispiel dieses Lied über die Schwierigkeiten eines Schüchternen in Liebesdingen, in dem es heißt: „Doch werf ich den Blick auf ein Mädchen / Und denk mir: ,Vielleicht wird die schwach!‘ / Dann wirft meinen Blick / Sie nur achtlos zurück / Und sehr oft was Kompaktes noch nach.“
Wehle brachte 1981 „Sprechen Sie Wienerisch?“, sein Lexikon des Wienerischen, in der überarbeiteten und definitiven Version heraus. In diesem Buch findet sich natürlich auch der Schmäh, und den definiert Wehle, obwohl er der Wehle ist, meiner Meinung nach falsch: „Schmäh: Gag, Pointe, Aufschneiderei, Unterhaltung.“
„Gag, Pointe“ – das würde auch zum Witz passen. Aber, wir erinnern uns, der Schmäh ist kein Witz. Eher besitzt der Schmäh Witz, nämlich den Witz im Sinn von „gewitzt“, und ich bin versucht, am Wort „bauernschlau“ entlang, das sich bei Wienern verbietet, bei denen Bauer höchstens noch ein Name ist, aber keine Berufsbezeichnung mehr (es sei denn, es ist der Weinbauer, wie wir sehen werden), das Wort „städterschlau“ zu konstruieren. Dann könnte man Schmäh und Witz, besser Schmäh und Gewitztheit, einander annähern. Annähern, sage ich; und nicht, dann wäre das Eine dem Anderen gleich.
Gerade fällt mir meine erste Begegnung mit dem Schmäh ein, zumindest die erste, an die ich mich erinnern kann. Bevor ich in die Volksschule kam, kümmerten sich tagsüber meine Großeltern um mich. Zu jener Zeit, ich rede von der ersten Hälfte der 1960er-Jahre, gab es bestimmte Statussymbole. Kindergärten zum Beispiel waren etwas für die ärmeren Leut’, für Familien, die es sich nicht leisten konnten, dass die Frau zu Hause blieb. Meine Eltern hätten es sich zwar finanziell mühelos leisten können. Meine Mutter jedoch arbeitete gern. Sie hatte gleich nach dem Krieg Landwirtschaft studiert, zu einer Zeit, als solch ein Studium für Frauen als völlig verrückt galt. Dementsprechend war sie die erste Frau Diplom-Ingenieur Österreichs in dieser Sparte. Sie dachte nicht daran, sich auf „Hausfrau und Mutter“ zu beschränken. Obendrein waren meine Großeltern selig, den Buben mit aller Zuwendung versorgen zu können, derer eine Großmutter und ein Großvater fähig sind, und das ist eine Menge, das können Sie mir glauben. So war alles gemäß der damaligen gesellschaftlichen Zeichensetzung in bester Ordnung.
Meine Großmutter liebte es, auf den nahen Brigittamarkt einkaufen zu gehen. Das bedeutete natürlich auch einen Austausch der Neuigkeiten aus dem Grätzl. Auf dem Brigittamarkt gab es eine Fleischhauerin namens Barischitz, ihr Vorname war, glaube ich, Helga, ganz sicher bin ich mir dessen nicht, wie gesagt: Ich war vier, fünf Jahre alt. Was ich indessen ganz sicher weiß, ist, dass bei Frau Barischitz Name, Beruf und Aussehen auf wunderbare Art übereinstimmten, zumindest in meiner Vorstellungswelt. Aber vielleicht ist die ja auch geprägt von der realen Frau Barischitz. Wer kann das wissen? Frau Barischitz war mittelgroß, lachende Augen hinter der dünnrandigen Brille, die Haarfarbe habe ich nie gesehen, denn Frau Barischitz trug stets ein weißes Häubchen, und um den rundlichen Leib gebunden hatte sie eine weiße Schürze. Dem eigentlichen Schmäh vorausschicken muss ich außerdem, dass in jenen Tagen viele Haushalte noch mit Holz, Koks oder Kohle im Ofen heizten.
Jetzt kommt meine erste Begegnung mit dem Schmäh. Es war ein später Wintereinbruch, wohl im März oder gar im April, jedenfalls lag Schnee, daran erinnere ich mich noch genau, weil mir meine Großmutter nach dem Marktbesuch erlaubte, vor der Brigittakirche ein paar Schneebälle zu werfen – vor der Kirche, sage ich, nicht auf die Kirche, wiewohl ich ungezogener Fratz das eine für das andere nahm, ohne mir Mamas Groll zuzuziehen. Ja, wirklich, bei uns war die Großmutter „Mama“, und meine Mutter war „Mutti“.
Doch zurück zu meiner Großmutter und der Frau Barischitz. Die beiden kamen auf winterliche Kälte zu sprechen. Jede überbot (oder sagt man da „unterbot“?) die Minusgrade der anderen. Roald Amundsen, der Entdecker des Südpols, hätte nicht mithalten können. Zuletzt triumphierte die Frau Barischitz: „Vor drei Jahren …“ Nein, das muss ich im Dialekt wiedergeben.
Frau Barischitz also sagte: „Vua drei Joa, do woa s en