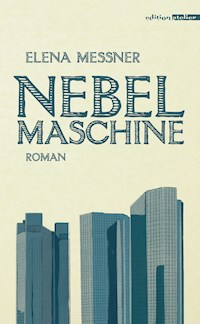Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Barbara Steindl im Bad ihres Krankenhauszimmers zusammenbricht, sind die stationsführende Ärztin Judit Kasparek und ihr Team ratlos. Während die Patientin auf der Intensivstation um ihr Leben kämpft, ist das Personal mit Schuldzuweisungen, Selbstzweifeln und Überforderung beschäftigt. Judit fühlt sich alleine gelassen, vom Pfleger Jovo, der für sie mehr als nur ein Kollege ist, ihrer Freundin und Anästhesistin Asja und ihrem Mentor Tom. Sie beruft ein Ethikkonsil ein, das den Fall aufklären und Frau Steindls weitere Behandlung ermöglichen soll. Denn nicht nur deren Tochter beginnt allmählich zu verzweifeln. Elena Messner zeigt in ihrem sprachlich brillanten Roman das komplexe System Krankenhaus zwischen Rentabilität und Patient:innenwohl und geht kompromisslos der Frage nach der Verantwortung in der Medizin auf den Grund.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tatjani, ljubljeni
Inhalt
I. KOLLAPS
Surren
Der Tag eins
Die Haltung zur Krankheit
Die Entscheidung zur Handlung
Mein alter Hase
Von Folgerichtigkeiten
Das neue Verhältnis
Start-up
Spur eines Menschen
Der Tag zwei
Nachmittag einer Anästhesistin
Der Knall, den wir haben
Der Tag drei
Warnung
Die gemeinsame Stunde
Das Nichtgeteilte
Spitzengespräch
Nächtliche Ereignisse
Knochen, die wiegen
Interpretation des Gestammels
Der Tag fünf
Suffixe
Als Nebenbei
Erregungszustände
Der Tag acht
Vor dem Spiegel
Abendlicher Anruf
Der Fall aus der Praxis
Der Tag vierzehn
Bettgeflüster
Die dringende Frage
Drang zur Forschung
II. KONSIL
Wieder kein Schlaf
Der Tag fünfzehn
Der Plastikvorhang
Heiler und Hebammen
Die Last der Träume
Der Tag sechzehn
Leasing
Bartschatten und Bizeps
Procedere
Die Haltung zur Krankheit II
Angehörig
Der Tag neunzehn
Erstgespräch
Die gut gemachte Arbeit
Der Tag zweiundzwanzig
Bodengrün
Anblick einer Patientin
Der notwendige Kontakt
Daten einer Krankenkasse als Existenzbeweis
Weisheit
Der Tag dreiundzwanzig
Belegung als Streitfrage
Die Unterbrechung
Mustermodelle
Die zweite Unterbrechung
Plastikhandschuhe
Eine Vorgeschichte
Auslastung und Hemmnis
Das Fossil
Fieber als Indikator
Der Tag zweiunddreißig
Sechs Ängste
Die kurze Auskunft
Der Tag sechsunddreißig
Bericht über eine Generation
Der nächste Knall (diesmal eine Tür)
Die Bonuszahlung
Kaffeepause kurz vor Schluss
III. KLINIK
Murks
Rosarot
Kurzer Moment der Stille
Der Tag vierzig, 07:18
Die Zufriedenheit
Noch Nähe
Söhne
Immer noch der Tag vierzig, 09:08
Im Zwiespalt
Kirschen und Knirschen
Immer noch der Tag vierzig, 13:03
Die Gründe
Das Aber
Operieren auf Rechnung
Immer noch der Tag vierzig, 23:46
Sich im Gespräch verlaufend
Oder auch: Solidarversagen
Zuständig
Hoffnungen
Der Tag einundvierzig, 11:02
Verlangen (Jovos)
Sternenhimmel
Die Kraft des Endes
Die Wolken, aus denen man fällt
Zaungäste
Überhaupt arbeiten
Cveto wiederum
Der Tag zweiundvierzig, 10:01
Notwendigkeiten
Im Trotzdem
Abschiede (kaum melancholisch, dafür kurz)
Einladung
Anpassbarkeit
Aufgabe
Der Tag dreiundvierzig
I. KOLLAPS
Surren
Morgendlicher Sonnenschein. Eine Ebene im Norden Chinas und darauf ein Werk, in dem Menschenketten Medikamente produzieren, die Fabrik so gewaltig, dass sie von einem eigenen Kohlekraftwerk betrieben wird. Asien, die Apotheke der Welt. Das Innere der Anlage bleibt unüberschaubar, kein Tageslicht, keine Wärme, ein kühles Vakuum, in dem Gestalten in Schutzanzügen wandeln. Die Ruhe ist rätselhaft, keine Stille, sondern ein unaufhörliches Surren und Summen. Im Grunde Lärm.
In den Untiefen des Werks packt man eine Flasche zusammen mit anderen in eine Schachtel aus Wellpappe, steckt diese daraufhin in einen Transportkarton, den man auf Stahlgittern und Regalen ans Licht befördert. Kurz danach steht der Karton in einem wasserfesten, stapelbaren Container, um zunächst auf einen Transportzug, später auf ein Frachtschiff gehievt zu werden.
Die Reise über das Meer dauert Wochen. Raserei. Schieflagen. Unwucht. Umschlossen von robusten, gerippten Wänden, von Schichten aus Stahl und Plastik, gut geschützt vom Schiffsgerüst fährt das Paket über eine Wasserlandschaft, auf der es nur Richtungen gibt, keinen Halt, eine blaue, sich selbst genügende Wirklichkeit, die Erdinseln voneinander trennt. In dieser flüssigen Weite eingebettet schaukelt das Medikament – selbst flüssig – im Rhythmus eines Wellengangs, der im Vergleich zu den botmäßigen Tourenregelungen, denen die Schiffsfahrt folgt, ungezügelt und unberechenbar wirkt.
Bei einem wochenlangen Stopp in einem Donauhafen gehen fünfzig Container in zwölf Richtungen auseinander, ein Teil der Ladung wird auf einen Zug umgestapelt, darin auch das Paket. Dann folgt eine mehrere Stunden währende Fahrt, schließlich ein weiterer, mehrere Tage andauernder Stopp.
Es ist kalt.
Unweit des Flusses, an der Bundesstraße gelegen, stehen Gebäude, in denen weitere Menschenketten arbeiten. Hier sucht man nicht nach dem besseren Leben, man sitzt fest bei einem Pharmaunternehmen, das einen deutschen Namen trägt, seine Angestellten aber in vollständigen Belegschaften aus einem Billiglohnnachbarland holt. Drei Tage lang wird das Paket zwischengelagert. Stilles Liegen zwischen über hundertfünfzig Millionen Arzneimittelpackungen, bis behandschuhte Hände den Karton in ein Gitterregal stapeln, das durch verdunkelte Gänge zu einem weiteren Laster rollt.
Auch die zweite Produktionsstätte des Unternehmens, nicht weniger banal als die erste, steht auf großem Gelände, der Platz ist berechnet für hundertzwanzig Millionen Medikamente, die an diesem Ort neu verpackt werden. Man klebt Etiketten mit dem Namen des deutschen Standorts auf die neue Kartonhülle, strichcodierte Kennzeichnung der Ladung, Zulassungsgenehmigungen, Name des Mittels, seine Stärke, seine Darreichungsform, sein internationaler Freiname, Angaben zu Packungsgröße, Verfallsdatum und Chargennummer. Auf den Verordnungsblättern strahlen maschinenlesbare Informationen zum Inhalt, zur Bestellung und Fakturierung. Der Hinweis auf die chinesische Herkunft ist verschwunden, der Preis immer noch günstig, ausverhandelt zwischen Lieferanten und Klinikkonzernen und Krankenkassen.
Das Paket wird wieder und wieder verladen, gleitet von Hand zu Hand und leistet nach Berechnungen eines Wirtschaftsinstituts einen wichtigen Teil der Wertschöpfung der heimischen Pharmaindustrie, es reist über eine Grenze, die unbewacht kaum an ihre einstige Funktion erinnert, liegt im stinkenden Frachtraum eines Fahrzeugs, das irgendwann endlich, seinem Antrieb widersprechend, langsamer wird und schließlich ganz stehen bleibt.
Stimmengewirr, Identifikation der gelieferten Ware, Zuordnung zum Lager des Hauses.
Die Lastertüren – an ihren Rändern alter Rost und Dellen – poltern beim Öffnen. Braune Handschuhe ziehen das Paket heraus, in dem die Flüssigkeit schaukelt, und Sonnenlicht hellt die grobe Verpackung plötzlich auf, die belebt wirkt und beim Tragen ständig ihr Aussehen ändert, an den Ecken werden immer wieder neue Falten und Schattierungen sichtbar. Nach einem abrupten Wechsel in finstere Gänge rollt der Karton auf Stahlregalen in den Lagerraum der Krankenhausapotheke, in dem die Dunkelheit alle Gegenstände wieder glättet und entfärbt, als gäbe es nur den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß.
Erneut wird die Lieferung abgelegt. Danach vereinzeltes Öffnen der Türen, darüber hinaus aber wochenlang nichts, bis man das Paket in künstliches Licht zerrt, um es zu einem Medikamentenkühlschrank auf der Station zu tragen. Tage später reißen weiß behandschuhte Hände mit knarrendem Laut den Karton auf, öffnen die Box, holen eine Schachtel hervor, entnehmen daraus die Flasche, tragen sie zu einem Bett und hängen sie an einen Schlauch, der in einen Venenzugang mündet.
Barbara Steindl spürt die Flüssigkeit im Schlaf, sie seufzt leise. Die Tropfen fühlen sich an der Einstichstelle noch kühl an, doch im Bruchteil der ersten Sekunde sind sie bereits in der Tiefe des menschlichen Körpers versunken und hier, in dieser neuen, brodelnden Umgebung, dem Blutkreislauf, reagieren sie sofort. Die flüssige Form, die ihren Zweck verborgen gehalten hatte, wird durch eine Intensität ersetzt, die sie aufsaugt. Wieder Raserei. Wieder Dröhnen. Kein echter Raum, nur ein Wirbeln durch Bah nungen und Kanalisierungen, Drehungen und Fluten von Transmittern und Enzymen. Kein Licht, nur blitzartige Signale von Zelle zu Zelle. Dazu die wütende Bluthitze, in der alles kippt, in der alles brennt, eine endgültige Auflösung, die zugleich eine Neuzusammenstellung ist. Der Mensch ist inwendig schwer überschaubar und dunkel, in ihm lärmt es – für das Außen unhörbar: Ich, Organ. Ich, Planet. Wer spürt es nicht? Das unverletzte, vielverbundene Eintauchen, das man Leben nennt, ein wildes Schlagen des Herzens, das wie alles, was ist, aus dem Nichts entstand und austauschbar bleibt, aber seiner Beliebigkeit zum Trotz lautstark und fröhlich widerhallt.
Der Tag eins
Aufnahme der Patientin wegen Ganzkörperschmerzen, keine Atemnot, kein Druck auf der Brust, Harn normal, Stuhl normal, Appetit mäßig. Pat. zeitlich, örtlich und zur Person orientiert, Allgemeinzustand reduziert, Ernährungszustand kachektisch. Vitalparameter stabil. Start mit intravenöser Schmerztherapie.
Die Haltung zur Krankheit
Judit fühlte sich bewegungsunfähig, und in dieser Bewegungsunfähigkeit überprüfte sie sich, spürte ihrem Körper von oben bis unten nach, registrierte jede Unruhe, nahm alles an sich selbst als Anhaltspunkt wahr: das Festklammern am Telefon, das leichte Zittern der Lippen, der Drang zu kichern, um den Druck rauszulassen, der Kopf schmerzend, darum schiefgelegt, der Wunsch, woanders zu sein, ihre Beine, die sie ärgerten. Sie versuchte, zu sich zu kommen, versuchte, den Vorfall zu begreifen.
War das die fünfte Ebene oder die sechste? Es fiel ihr nach fünf Jahren noch manchmal schwer, sich zu orientieren, die Wände in diesem Haus schienen immer gleich, die Stationen zu symmetrisch aufgebaut, das führte einen in die Irre.
Doch, das war die fünfte Ebene. Die Interne. Der Gang war entvölkert und die vorherrschende Leere wirkte, als wäre die Spannung, die sich gerade eben aufgebaut hatte, nie dagewesen. Nur hinter den verschlossenen Türen blieben aus den Krankenzimmern Stimmen zu hören, gedämpfter Trotz gegen die Einsamkeit draußen. Wohin war die angestaute Energie verpufft?
Ja, das war ganz sicher die Interne, deren Kunststoffboden wie gewohnt gräulich-gelb glänzte, erhellt von den Deckenlampen, die tagtäglich die Kranken ausleuchteten. Nichts als die übliche Schwermut und Grellheit um sie herum. Hier war eben noch die Hölle los gewesen, jetzt lag die Steindl beatmet auf der Überwachungsstation.
Ich brauche frische Luft.
Zum Lift waren es nur ein paar Schritte, vorbei an drei Plastikstühlen und am Spender für Desinfektionsmittel, einem Abstelltischchen, einem Regal mit Infobroschüren für Angehörige und einem hölzernen Jesuskreuz an der Wand – weniger Symbol einer Glaubensgemeinschaft als der Sehnsucht danach. Es schien schief zu hängen, aber das lag wahrscheinlich an ihrer Körperhaltung.
Sie hörte wieder Stimmen, drehte sich aber nicht um.
Im Lift der Blick in den Spiegel. Vielleicht lagen die Augen etwas zu tief, aber insgesamt: kein Unterschied zu sonst. Sie sah aus wie immer, fühlte sich nur komisch. Hunderte Einzelheiten, die in ihr widerhallten, und dazu das bohrende Gefühl der Niederlage.
Andererseits: Was heißt hier Niederlage? Ein allzu großes Wort, und falsch obendrein. Die Steindl ist stabil, sie wird heute noch auf die Intensivstation kommen, sobald dort ein Bett frei wird. Wir werden die Überstellung gut vorbereiten, man wird die Ursache klären müssen. Tonja könnte vieles bestätigen. Warum nimmt sie sich immer zurück, schweigt sich aus, schüttelt den Kopf? Ganz anders als Asja, die bleibt immer hart, blanke Oberfläche, ganz Anästhesistin. Dabei ist auf sie sonst Verlass. Aber anbrüllen hätte sie mich nicht dürfen. Ihre Haut ist eine Drohung, diese Straffheit gibt nicht einmal nach, wenn sie schreit. Was hat sie mitzureden, sie soll einfach ein Bett bereitstellen. Zum Glück habe ich die Steindl-Tochter erwähnt, eine Juristin. Tom wieder mal, zu lange schon Oberarzt in ein und demselben Haus, man weiß nicht, ob man ihn bemitleiden, übersehen oder ihn für alles verantwortlich machen soll. Ganz wie Asja. Keine Ahnung von der Patientengeschichte, trotzdem alles entscheiden wollen. Und mittendrin Jovo, ebenso hilflos wie unruhig, der sich wie Tonja ausschweigt, kein Wunder, er kann ja nicht einfach dazwischengehen als Pfleger und drängt sich ohnehin nie in den Vordergrund, dabei ist er noch wütender als ich. Nur liegt es bei ihm nicht derart obenauf. Was ist mit mir los, ich kann keinen Gedanken an Jovo verlieren, ohne an die Steindl zu denken, aber an die kann ich wiederum nicht denken, ohne an Asja, dann wiederum an die Steindl-Tochter, an Tonja und erneut an Tom zu denken. So dreht man sich im Kreis. Und ein Kreis hat erst ein Ende, wenn man ihn durchbricht, würde Tom jetzt sagen.
Nun blieben Judits Gedanken doch bei ihm, dem Oberarzt, stehen. Ungeordnete Szenen ihrer Freundschaft rückten in ihr auf, Bild auf Bild, Szene auf Szene: Das gespielt nachdenkliche Gesicht des Mentors, als sie ihn das erste Mal fragte, ob er mit ihr etwas trinken gehen könnte, um einen Fall zu besprechen, sein Grinsen danach, als er meinte: »Mit dir immer!«, das Fläschchen Wasser, das er in der Klinik ständig mit sich herumtrug und ihr anbot, wenn sie müde war; die Art, wie er in der einstigen Cafeteria Salz auf seine Nudeln streute, und zwar minutenlang; die langen Spaziergänge am Fluss nach der ersten vor ihren Augen verstorbenen Patientin; seine Gelassenheit, in der er sich so gut eingerichtet hatte, und die sie früher zu ignorieren versucht hatte, weil sie ihr funktionell erschienen war, na, man muss ja irgendwie da durch und dann weiter; ihre wachsende Irritation angesichts seiner zunehmenden routiniert-spöttischen Allgegenwärtigkeit, seiner zu gut geordneten, schwer widerlegbaren Argumente, die er allesamt in ironischem Ton und brillanter Rhetorik vortrug, früher in der Cafeteria, nachdem die geschlossen worden war, in den Pausenräumen, und als auch diese verschwanden, auf der Dachterrasse; sein Tänzeln am Gang; im Sommer die Schweißtropfen auf seiner Stirn, vom Haaransatz bis zu den dünnen Augenbrauen; oder sein Lachen, nämlich sein richtiges, das unkontrollierte, wirklich, wirklich fröhliche –
Grundgütiger! Wie er sie vorhin am Gang angesehen hatte. Ein kompletter Zerriss, die Erinnerung daran tat körperlich weh – er war zwar immer noch freundlich gewesen, immer noch höflich, aber vollkommen unberührt, wiederholte nur mehrfach, »Judit, beruhige dich!«, als gehe ihn das alles nichts an: »Judit, du weißt aber schon, Feigheit ist das, ein reines Abschieben von Verantwortung, die Juristerei, die Beraterei, die Absicherungsmanie, die uns jede Haltung zur Krankheit verlieren lässt, ja, Feigheit, Feigheit –
Wollen wir es nicht lieber sein lassen?«
Beim Aufstieg ohne weiteren Blick in den Spiegel fragte sie sich, ob er auf der Dachterrasse auf sie warten würde oder diesmal die Mittagspause ohne sie verbringen wollte. Ihre Hand klammerte sich immer noch fest ans Telefon, und sie betrachtete die weiß hervortretenden Handknöchel. Das Surren des Lifts half ihr, sich ein wenig zu beruhigen.
Erst mal: Konzentration auf das Wesentliche. Es liegt alles klar vor dir, muss nur benannt werden. Respektiere die Regeln. Baue an der Begründung. Ruf an. Argumentiere: Komplexe fachliche Entscheidung, belastende ethische Frage, schwierigere Behandlungssituation. Du weißt Bescheid und musst nur dafür sorgen, dass auch alle anderen Bescheid wissen. Jede deiner Entscheidungen ist ohnehin vorgeschrieben, steht seit Langem fest. Absichern, anrufen, anfordern – genau, absichern, anrufen, anfordern. Du bist nicht allein, nur keine Angst. Tonja und Jovo werden zu dir stehen, wenn es wirklich darauf ankommt, sie werden –
Was heißt zu dir –
Zur Patientin.
Die Entscheidung zur Handlung
Auf dem engen Gang hin zur Terrasse häuften sich halbherzig mit Plastikdecken verhüllte Schachteln, die man vor einem Jahr aus den Aufenthaltsräumen hochzuschleppen begonnen hatte. Sie standen unberührt, beklebt mit Etiketten: Teekocher, Geschirr, Dekoration. Beinahe verstellten sie die Glastür, die aufs leere, graue Plateau führte, über das Judit mit Riesenschritten stapfte, bevor sie nach dem Geländer am Terrassendach griff.
Die Stadt lag in goldfarbener Helligkeit unter ihr, während man im Haus hätte glauben können, es sei Nacht. Die gesamte Klinik wirkte wie eine Einladung an Geister, dieses ständige Halbdunkel, gegen das mit Grellheit angearbeitet werden musste, die Krankenzimmer mit ihren heruntergelassenen automatischen Jalousien, der Lift in dämmriger Beleuchtung, die Toiletten und Gänge ohne Tageslicht, auch die fensterlosen Abstellkammern, die mit Putzgegenständen und einem kleinen Hocker zum Ausruhen für die Raumpflegerin vollgeräumt waren.
Hier oben aber! Ein wunderbarer, milder Tag im Mai. Alles stand ungerührt und strahlend, von der Mittagssonne durchtränkt, dazu der leichte Wind und die nur leise Andeutung von Straßenverkehr.
Judit hob die Hand, in der sie immer noch das Telefon hielt, und suchte im Adressbuch nach der richtigen Nummer, ignorierte dabei das feinschlägige Zittern ihrer Finger, kniff die Augen zusammen, tippte und wartete danach ab, den Blick wieder auf die Stadt gerichtet, die vom Dach wie eine Ansammlung schwarzer Linien und farbiger Kleckse wirkte, endlose Strecken und Ecken, unterbrochen vom Grün der Bäume oder Parks und vom Blau des Flusses. Keine Details, keine Kinderbeinchen oder zerknitterte Kleidung, keine gebräunten Schultern waren von hier oben zu erkennen, überhaupt keine menschliche Form, alles blieb Farbpunkt oder bunte Bewegung. War das der Grund, warum ihr Team die Dachterrasse sonst mied? Weil hier alles zu fröhlich war, weil es das Auge reizte –
Du bist nicht müde.
Nur erschöpft.
Aber hellwach.
Und endlich erleichtert.
Als dringe das Licht des Himmels direkt in dich ein, als ginge es durch die Haut, in die Adern, bis ins Knochenmark, eine Kraft, die dich nährt, bis du nicht mehr weißt, ob du Teil dieses Lichts bist oder es vielleicht aus dir selbst entspringt.
»Ja?«
»Die Patientin Barbara Steindl.«
»Ja?«
»Heute im Bad kollabiert, liegt auf der internistischen Überwachungsstation, nachmittags Verlegung auf Intensiv geplant.«
»Ja, ja?«
»Ich möchte melden, dass es zu Fehlern gekommen ist, und dass deswegen –«
»Ja, bitte was?«
Mach einen langen Hals.
Streck den Kopf hoch zur Sonne.
Lass die Augen geschlossen.
Schneide jede Möglichkeit auf Widerspruch ab.
Bleib dabei und öffne bloß nicht die Augen.
»Ich bestehe darauf, dass vor der Entscheidung über die weitere Behandlung ein akutes Ethikkonsil abgehalten wird.«
Mein alter Hase
Das Geräusch der aufgehenden Glastür schreckte sie auf. Kein Mann, eher ein ungerader, ausfransender Strich betrat das Plateau. Die blasstürkise Hose flatterte an Tom, so dürr waren seine Beine.
Einige Sekunden lang schauten sie einander aus mehreren Metern Entfernung ungerührt an, dann lächelte er, kam auf sie zu, stellte sich ans Geländer. Na, die Mittagspause hier oben ließ er sich nicht nehmen, auch nicht nach dem Fiasko soeben.
»Du hast ein Konsil angefordert?«
Wie konnte er das schon wissen. Vier sich gegenseitig austestende Kugelaugen: Wir haben nichts voreinander zu verbergen, kennen uns lange, kennen uns gut. Du warst mein Halt. Jetzt bohrt der Argwohn. Wie auch nicht? Meine Entscheidung hat einen Abstand zwischen uns hergestellt, und wir wissen beide, einen so raschen Wechsel von Gemeinsamkeit hin zu Vorsicht, vielleicht sogar Misstrauen voreinander überlebt eine Freundschaft nur schwer. Schon gar nicht eine wie unsere.
»Ich hoffe, wir kriegen es in zwei Tagen zustande, uns rennt die Zeit davon.«
Das Problem mit Tom war, dass er als Freund zu gut wusste, wie er das Gespräch führen musste, um sie zu verunsichern. So wie er, als sie bei ihm in Ausbildung gewesen war, gewusst hatte, wie sie zu motivieren war – nur durch vernichtende Kritik, am besten in der Form eines Rundumschlags. Seine stundenlangen Erklärungen, wie falsch die Dinge liefen, lösten bei ihr sofort Aktivität aus, und sein damals noch fröhliches Mantra, seine wiederholte, bald zum Klischee gewordene Analyse nahm sie ständig zum Anlass, mehr zu tun: Wir müssen besser werden, es muss jeder mit jedem verbunden sein, lauter Ketten und Knoten und Kreuzungen: Ärzteschaft mit Pflege, der Primar mit der Physio, die Pflege wiederum mit dem Sozialdienst, aber auch mit Transport und Logistik, die allesamt mit dem Portier, zugleich mit Lager und Reinigung und Wäscherei, ebenso mit der Küche, wo dann wiederum die Ärzteschaft und die Logistik und die Pflege, die ja auch alle hungrig – du verstehst schon, jeder mit jedem, alle verbandelt, verkoppelt, auf Knopfdruck, und permanent, das müssen wir schaffen. Ich rede von besserer Teamleistung, wir müssen uns stärker koordinieren, ich rede von Zeitmanagement, wir brauchen mehr Unterstützung, ich rede von Wechselseitigkeit, keiner von uns kann’s allein, und nur wenn du das wirklich verstehst, kannst du es schaffen.
Aber jetzt? Kein Wort mehr davon.
Es traf ja auch nicht mehr zu, man zerfetzte das Netz, von dem er geschwärmt, das er als Ziel angestrebt hatte; seine so gerne zitierten Knoten wurden nicht enger, sondern lösten sich auf, die Ketten wurde gelockert, bis sie zerrissen, plötzlich kannte man einander nicht mehr im Haus, oder genauer: Niemand wollte die anderen kennen. Schlimmer noch, die, die sich kannten, ignorierten und misstrauten einander.
Tom, wenn wir nur ehrlich miteinander sein könnten.
Er wusste seit Wochen, was sie vorhatte, na, er wusste, dass sie schon vor dem heutigen Kollaps der Patientin Steindl ein Schreiben aufgesetzt hatte. Und sie wiederum wusste, dass ihm ihre Aktion peinlich war, und dass er diese zuallererst als Zeitverschwendung empfand. Vielleicht sollte sie versuchen, ihn trotzdem mit ins Boot zu holen? Das letzte Mal hatte er sie nur ausgelacht.
Der Rückruf der Direktion erreichte sie, bevor sie ein weiteres Wort zu ihm sagen konnte.
Von Folgerichtigkeiten
Seit der nicht mehr zu leugnenden Demontage seines Netzwerkphantasmas sah Tom in Ideen wie Ethikkonsilen oder Protestschreiben oder Feedbackanalysen nur die systemische Hilflosigkeit. Tief in ihm saß jemand, der nichts anderes erlaubte und jede Menge Geschichten als Belege dafür heranzog. Etwa diese:
Erinnerst du dich an die Patientin, die jede Therapie ablehnte, die sterben wollte, und erinnerst du dich an ihren Sohn, der das nicht zulassen und sie weiter behandeln lassen wollte? Er konnte es nicht und nicht akzeptieren. Da warst du schon im Haus, Judit. Jahre her. Damals dachte ich, man kann den Sohn nicht übergehen, der hatte außerdem Juristen eingeschaltet. Wir haben also ein Konsil einberufen, das Resultat war eindeutig: Rasche Entscheidung gegen jedes weitere Vorgehen, die Patientin ist todkrank und hat eine Verfügung. Sie will sterben, will nicht im Krankenhaus bleiben. Wird abgeholt. Juristisch geklärt, dafür macht man’s ja schließlich. Dann, im Rettungswagen, auf dem Weg nach Hause, auf Suche nach Ruhe fürs Ende: Ihr wird schlecht, der Sauerstoff zu niedrig, so schlimm, dass die Sanitäter sagen, sie können sie in dem Zustand nicht daheim abliefern, sie wollen nicht verantwortlich sein. Erinnerst du dich? Dabei hat sie sich so gut wie möglich abgesichert – aber sie haben sie zurückgebracht. Nach all dem Aufwand, den Telefonaten mit den Juristen, den Gesprächen mit der Patientin, bringen die sie einfach zurück, und es heißt: Entlassung nicht mehr stornierbar, Aufnahmepapiere neu ausfüllen. Die Frau musste alles noch einmal durchstehen. Sie bettelte darum, dass man sie in Ruhe ließ, wurde wieder aufs Zimmer verlegt, weil das Protokoll es so vorsieht, daran ist nicht zu rütteln: Wenn die Sanitäter in so einem Zustand jemanden bringen, kommt er aufs Zimmer. Weißt du? Und dann: nichts tun, stundenlang warten, nicht reanimieren, bis es eben vorbei ist. Das nenne ich mal Absurdität des Systems. Der Sohn beschuldigt uns bis heute, wir hätten sie ermordet.
Das neue Verhältnis
Während Judit telefonierte, lauschte Tom mit hochgezogenen Brauen der Stimme aus ihrem Gerät: Man habe die drei Ethikverantwortlichen benachrichtigt, nur einer habe überhaupt so rasch Zeit, er könne in zwei Tagen kommen, es sei ein Raum reserviert und ein Protokollführer ernannt, und weiter: Man erwarte ihre Vorschläge zur Befragtenliste, sie solle für das Konsil höchstens eineinhalb Stunden einplanen, mehr könne man den Menschen nicht zumuten, bezahlte Arbeitszeit sei es ja auch. Sie müsse außerdem bedenken, dass wahrscheinlich so kurzfristig nicht alle Zeit haben würden.
»Wir danken für Ihre Initiative.« –
»Selbstverständlich.« –
»Gerne.« –
»Machen wir.« –
»Ganz selbstverständlich.« –
Ein Anruf, schon war es in Gang gesetzt.
Sie legte auf, sah zu Tom, der stumm mitgehört hatte, weswegen sie ihn unumwunden fragte: »Hilfst du mir mit der Liste?«
Er war nach wie vor ein Bild der Gelassenheit, seine Zähigkeit die einer Schildkröte, und während er geordnet, beherrscht vor sich hinredete, wirkte die gesamte Situation, als sei sie ganz gewöhnlich, aber seine nüchterne Aufzählung war derart routiniert, dass ihr schon die ersten Sätze zu viel waren.
Sie notierte in ihrem Telefon die Namen, die er aussprach:
»Du und ich, wir beide sollten ständig anwesend sein, dazu auf jeden Fall Tonja, sie hat als Bereichsleiterin viel mit der Steindl zu tun gehabt, mit ihr gleich Jovo, der hatte viel Kontakt, oder? Wer hat die Aufnahme gemacht?«
»Erika Grosch, aber die springt immer nur ein, mal sehen, ob wir sie überhaupt dazu kriegen, aufzutauchen.«
»Doch, doch, sie ist seit einigen Tagen wieder bei uns eingeteilt, diesmal bleibt sie einen Monat, ich habe sie gestern getroffen. Sie sollte jedenfalls Stellung nehmen, einfach, um einen Anfang zu haben, was meinst du? Dann Kommerasch? Er wird nicht wollen, aber als Primar muss er ohnehin. Noch jemand?«
Judit zögerte, meinte dann: »Asja hat sich so dagegengestemmt, das soll sie mal begründen.«
Er nickte und zählte murmelnd, wie für sich selbst, weiter auf: »Domek, Mara und die Psychologin, wie heißt sie, ich kann mir ihren Namen nicht –!«
»Fatmeh, du meinst Fatmeh. Sie hat die Patientin begleitet, war in ständigem Kontakt mit ihr.«
Es folgten noch ein paar Fragen hintendrein:
»Wer hat die Kranke am Boden gefunden?« –
»Wer hat sie sonst noch betreut?« –
»Haben wir jemanden vergessen, der beleidigt wäre, nicht eingeladen zu sein?« –
»Gut, gut, ich denke, die Liste ist ausreichend, um den Verlauf zu rekonstruieren.«
»Gibst du es der Direktion durch?«, fragte sie ihn – eine Forderung, die das neue Verhältnis zwischen ihnen bestimmen sollte, aber in ihren Ohren zu bittend klang.
»Klar.«
Er machte einen überraschenden Schritt und ergriff ihre Schulter, wie leichthin und flüchtig, aber sie erstarrte. Seine Hand lastete als etwas Unerhörtes, angesichts der Situation Unangemessenes auf ihr, dann spürte sie seinen Atem am Hals, als er sich zu ihr beugte, einen Arm ausstreckte: »Ist das dort drüben der höchste Punkt der Stadt?«
Sie zuckte mit den Schultern: »Vielleicht nicht, aber zumindest einer der höchsten.«
Die Hand glitt wieder von ihr ab: »Und mit Jovo? Habe ich recht, dass da was läuft?«