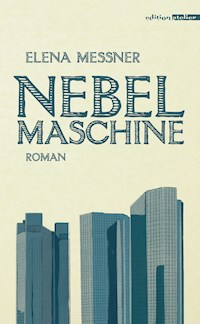Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein österreichisch-ungarischer Offizier im Ersten Weltkrieg, seit 1916 im besetzten Belgrad stationiert, erlebt in bitterer Verzweiflung den Zusammenbruch seines Reiches. Hundert Jahre später sitzen die Direktorin des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums und ihre Assistentin einander im Streitgespräch über Moral und Mitleid, Verbrechen und Verantwortung gegenüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elena Messner
DAS LANGE ECHO
Roman
warum
Sie wisperten schon wieder. Die Schatten in den Straßen, durch die er irrte, waren ein schwarz-graues Karussell, die Formen, die sie angenommen hatten, starrten immer wilder in ihn hinein. Eine Nacht mag dunkel sein, doch nicht dunkler als das, was der Milan Nemec in sich selbst vorfand. Man hätte meinen können, er sei ein schwermütiger Skeptiker geworden, wo er bislang ein besonnener Taktiker gewesen war. Wie sollte bloß alles, was er gesehen und gehört hatte, in seinen Kopf hineingehen? Sollte es wirklich der bloße Zufall sein, der die Geschichte lenkte? Der Zufall, das Chaos, sie waren ihm doch immer als gesetzlich vorgegebene Feinde aller Logik und Ordnung erschienen. Um ihn herum war kaum etwas zu vernehmen, nur vereinzelt eine Stimme, ein Kichern aus einem Innenhof, der Wind, und von irgendwoher, scheinbar, oder doch nicht?, fernes Flüstern.
Wieso glaubst du, die Schatten in diesen Gässchen seien Menschen, wo doch niemand da ist, nur du und die Luft, und in ihr das Wispern, das vielleicht doch nur dein lautloses Selbstgespräch ist? Da liegen dir plötzlich die Hände um den Hals, von dem du dir sicher bist, dass er bald durchgebissen sein wird. Du verfluchst es, in einem christlichen Land zu leben, in dem sie die Toten begraben, denn nur in diesen Ländern können die Begrabenen als Scheintote wiederauferstehen, während dort, wo man sie verbrennt, nur Geister und Schattenwesen existieren, existieren als Angst und als Vorstellung.
In dem christlichen Land, in dem er sein vorübergehendes Zuhause eingerichtet hatte und das seine Toten in der Erde bestattete, war es in den letzten Jahren oft zu einem Verbrennen, einem Auseinanderplatzen oder einem In-Luft-Auflösen von Menschen gekommen. Und daher musste man sich nun nicht nur vor den Aus-den-Gräbern-Gestiegenen fürchten, sondern man konnte auch vor keinem Schatten mehr sicher sein und vor keinem Licht, weil darin die Geister, die Echos festsaßen. Nein, das alles war keine bloße Nervenüberspannung, das konnte er nicht mehr glauben.
Von diesen Dingen hatte der Milan Nemec in den Kafanas in dieser Stadt die Menschen flüstern gehört, wenn sie sich sicher wähnten. Sie träumten von Geisterarmeen, die kommen würden, um sie zu befreien, wenn sie sich nur endlich aus den Schatten lösten. Sie träumten von Krankheitsdämonen, die sich in der neuen Verwaltung und der neuen Herrschaft einnisten würden. Und sie träumten von den Wiederkehrern, die im Schlaf einen jeden österreichisch-ungarischen Beamten einfach – zack, zack – in die Brust, warmes Blut und fertig. So träumte der Mensch, wenn ihm nichts mehr übrig blieb. Und zum Träumen hatte man in dieser unfreundlichen Gegend den Menschen viel Nahrung gegeben.
Als er eines Abends in einer dieser finsteren Kafanas saß, in ein dunkles Eck gedrückt, erzählte am Nebentisch eine alte Frau davon, dass Wiederkehrer immerhin Seelentiere seien, die jede beliebige Form annehmen könnten. Ungeheuer verkleinerte und ungeheuer vergrößerte Formen, sodass sie sich durch noch so kleine Ritze und Löcher in die Quartiere der Militärverwalter schleichen könnten, unsichtbar oder sichtbar, ganz wie es ihnen passte. Da wurde ihm ganz grau vor Augen, alles um ihn herum schien des Wahnsinns. Er stand auf, ging an den Menschen vorbei, die nicht wussten, dass er trotz seiner Uniform verstand, was sie redeten. Wie ein Falter, der sein Gleichgewicht suchte, weil man ihm mit einem Nagel ein paar Löcher in die Flügel geschlagen hatte, und dem seither die Luft durch die Löcher pfiff, schwirrte die Stimme der Frau ihm hinterher, bis er sie endlich in seinem Verwaltungsalltag vergrub. Aber nun war in einer finsteren, schlaflosen Nacht diese Stimme, oder ihr Echo, wiederauferstanden. Sie flatterte nah an seiner Nase, an seinem Ohr umher und war noch heiserer, noch unheimlicher als die echte, die er tatsächlich gehört hatte.
Kalt war diese durchwachte Nacht, die einem großen Skandal vorausging, von dem der Milan Nemec noch nichts ahnte, der jedoch so folgenschwer für ihn sein würde. Nachdem die wilden Schatten und Träume ihn in die Stadt vor seinem Fenster hinausgetrieben hatten, hing er schweigend und vor sich hinstapfend seinem Zorn nach. Zorn auf die Stadt, in der er leben musste [Belgrad], und auf die Stadt, aus der er vor einigen Jahren gekommen war [Wien], Zorn auf seine Umwelt, die schmutzige, gemeine, verräterische. Alles der gleiche Dreck, dort wie hier. Wozu war er eigentlich ausgezogen?
Es war ein halb blindes, taumelndes Rundenziehen durch die Gassen, an verbretterten Fenstern vorbei, weiter durch schlecht oder gar nicht gepflasterte Straßen und Gässchen, weiter über gerupfte Rasenstücke, immer noch weiter. Da, an einer kleinen Brandstätte kurz stehen geblieben, aus der noch Rauch aufstieg, beißender, eiskalter Rauch, der nichts von dem verstohlenen Feuer erahnen ließ, das hier vielleicht für kurze Zeit Wärme gespendet hatte. Ein Rauch, der nur Gestank verbreitete, den Blick vernebelte, im Hals kratzte. In den Rauchschwaden blieb allerlei zu erblicken, je länger er in sie hineinstarrte, aber bevor er sich an andere, größere Brandstätten, an tote Felder, Scheunen, Lehmhütten und kleine Dörfer in hellem Feuer erinnerte, war er schon daran vorbei, und vergib uns unsere Schuld, dein Reich und dein Wille, die Wiederauferstehung des Fleisches, das ewige Leben, und um die nächste Straßenecke gebogen.
Es trieb ihn in eine weitere Runde, höher, noch höher, ein paar Gässchen hinauf. Vielleicht zum Kalemegdan, vielleicht auch rechtzeitig abbiegend, um die beiden Flüsse nicht vor sich liegen zu haben, in denen er allerlei hatte verschwinden sehen, auch Menschen, die nur noch Haut, Venen und daraus hervortretendes Blut waren, zerquetschte Menschen, bläuliche, halbe und ganze. Er hatte die Vorstellung aufgegeben, dass in der hässlichen Stadt, die er zu besetzen und zu verwalten hatte, dass in dieser europäischen Welt, in der er leben musste, Logik und Anstand zu den Bürger- und Christenpflichten gehörten. Besonders nachts schien ihm die Idee, dass der Mensch auch moralisch leben könnte, geradezu verrückt.
Er betrachtete die ins Dunkel gedrückten weißen Leiber, die in den Straßen neben, hinter, vor ihm auftauchten und vor seinem erschöpften, aufgerissenen Auge zurückzuckten, als würden sie Scham kennen. Lüge! Ganz im Gegenteil strahlten diese Leiber trotz ihrer öffentlichen Entehrung so voller stolzer Lust, dass er bei jedem schweißperlenden Rücken, bei jedem nackten, weißen Bauch stehen bleiben musste vor Schreck, ja, sich mit immer weiter aufgerissenem Auge hier und da sogar eine Zeit lang nicht vom Platz rühren konnte.
Ein sündiger Mensch wäre bei diesem Anblick vor Scham vergangen. Doch er selbst hatte nur eine schmerzliche Ahnung, wie es wäre, in den öden Belgrader Nächten nicht seinen Besatzungs- und Verwaltungspflichten, sondern seinen Bürger-, nein, seinen Offiziersrechten nachzugehen. Auch wenn er selbst vor wenigen Tagen in eine Hütte spaziert war ohne anzuklopfen. Aber das schien ihm bereits wie ein böser Traum, entstanden aus übler Nachrede und Gerüchten, die ihn zu Fall bringen sollten. Das Geschrei oder das boshafte Geflüster und Gelächter, das von diesen Bäuchen, von diesen Schamhaaren, den im Mondlicht schimmernden Häuten, von den rosig-braunen Arschfalten und den Wirbelsäulen hungriger Körper zu ihm herüberschallte, nahm er nur als seltsame Deformierung einer Sprache wahr, die er nicht verstehen wollte.
Finstere Gesichter, weiße Leiber und Hände: Es sind mit Gewissheit Gespenster, Wiedergänger, dachte er, die ich da sehe, böse Kreaturen, die nachts nach frischem Fleisch jagen. Sie flüsterten, lachten, stießen ihn weg, wenn er in ihrem Anblick versank, verjagten ihn mit grellem Gelächter. Abgesehen davon taten sie ihm nichts, wie ihm auch die grinsend vorbeimarschierenden Uniformierten nichts taten.
Die nächtlichen Patrouillen machten ihm keine Angst. In der besetzten Stadt, in der noch immer für alle außer die Offiziere eine totale Ausgangssperre galt, obschon sich immer weniger Menschen an sie hielten, wie ihm schien, hatte man nachts ausschließlich Offizierspatrouillen aufgestellt. So sorgten bloß Offiziere für Ordnung unter Offizieren, man blieb unter sich, feierte ein großes letztes Fest. Der Befehl war klug: Konflikten vorbeugen und keine einfachen Streifenpolizisten einsetzen. Wo käme man da hin, wenn ein ins Dunkel gedrückter, schwitzender Offizier sich halb entblößt von einem rangniedrigeren Streifenpolizisten zurechtweisen lassen müsste.
Er lief an den Vergnügungssüchtigen vorbei, die sich den bleichen Gespenstern hingaben, ihnen ihre Hälse, Arme und Beine gegen die geröteten Münder drückten, gesellte sich nicht zu ihnen, beobachtete stumm. Um ihn herum die Nacht und alles andere, das ihm ganz ton- und sinnlos vorkam. In seinem Kopf, da flüsterten nur die Echos – Wispert ihr nur! –, dann endlich wurde er müde.
Es ging die Sonne über Belgrad auf, die schmutzigen Gässchen leerten sich rasch, Licht vertrieb das hungrige, räudige Pack. Vielleicht waren es doch nur Schatten gewesen, die in der Morgendämmerung vor der Sonne zurückwichen. Ein erschreckend weiter Himmel öffnete sich über ihm, die Stadt streckte sich ihm durch den weißen Nebel seiner müden Augen entgegen. Er konnte sie kaum noch ansehen, versuchte, ihrem Anblick, versuchte, den Stimmen, dem nachhallenden Gelächter mit halb geschlossenen Augen zu entkommen. Da stolperte ein Wahnsinniger, von all den Echos in ihm wirklich schon fast völlig wahnsinnig Gewordener, durch die Gässchen zu seinem Quartier. Zurück, zurück, solange du noch kannst! Erst kurz bevor er aufzustehen und sich für den neuen Tag anzuziehen hatte, wachte er, ohne sich erinnern zu können, wie er dorthin gekommen war, im breiten Lehnsessel in seinem Schlafzimmer auf. War das der versprochene Schlaf gewesen? Er war es und war es nicht.
Der Zufall, dass es an dem Tag, der dieser schrecklichen Nacht folgte, ausgerechnet seine Aufgabe war, Besuch aus Wien zu empfangen, nach vorgeschriebenem Protokoll durch die besetzte Stadt zu führen und danach gut zu unterhalten, dieser Zufall steht in starkem Widerspruch zu den Annahmen, dass große historische Ereignisse, etwa Kriege, aber auch private Karrieren, planbar seien, woran der arme Milan Nemec aber kraft seines Berufes glauben musste und unbedingt weiterhin glauben wollte. Wie sehr hatte er an die Planbarkeit, gewährleistet durch Ordnung und Moral, durch Strategie und Aufmarschplan, geglaubt, in seinem ersten Leben. Doch hier und heute, in diesem plötzlich angebrochenen zweiten Leben, da konnte er nicht einmal einen beliebigen Herbsttag ordnen, konnte sich der Unlogik allen Geschehens um ihn herum nicht entziehen.
Seine Gedanken wurden durch das Gespräch mit dem Besuch aus Wien nicht unbedingt klarer, dafür umso dringender. Er fand sich überrascht, übermüdet, überfordert, mit diesem Gesicht an einem gemeinsamen Tisch gefangen, über ein schimmerndes Gläschen gebeugt, aus dem es in goldgelben Sternenformationen funkelte, ein fratzenhaftes Gesicht ihm gegenüber, mit dem er nichts anzufangen wusste.
Dieses Gesicht aus Wien hatte er nach dem amtlichen Teil des Empfangens, Berichterstattens, Speisens durch die Stadt geführt, mit dem Plan, schließlich auf ein paar Schnäpse in eine Kafana im Zentrum der besetzten Stadt einzukehren, damit sich die Anspannung zwischen ihnen endlich löste. Die Sonne legte beim Spaziergang ein kaltes Licht auf ihre Wangen und ihre Umgebung. Ein nüchternes Licht, das die innere und äußere Verwahrlosung der Stadt noch verdeutlichte, weil es in demokratischer Manier den Straßenkot auf Fenstern, Türen und Pflaster ebenso hell und kalt beschien wie … hier, da: die einsam sich durch Kanäle oder an Häuserfassaden hervorkämpfenden Kletterrosen, was für ein hilflos wirkendes Giftgrün, und … dort, drüben: die vergilbten letzten Farne an den steilen Gässchen, ein noch hilfloser wirkendes Gelbbraun.
Mit roten Augen starrte er den Mann aus Wien an. Wer mochte wissen, welche Nächte der hinter sich hatte! Die Farben seiner Wangen und seiner Augen verrieten nichts darüber. Er war bleicher als bei seinem letzten Besuch im frühen Sommer, aber das musste nicht ausschließlich auf die politische Situation zurückgeführt werden [obwohl die schon bleich machen konnte, keine Frage]. Vier gerötete Augen, die einander aus weißen Gesichtern anstarrten: eine Warnung.
Das Gespräch nahm Wege, die das Protokoll nicht erlaubte. Es drehte sich um die Kriegssituation, um den deutschen Kaiser, die Verräter, die Verpflegungsengpässe. Dann sprach man über die Verbündeten, denen man misstraute, die Feinde, die man vernichten wollte, innere und äußere. Bald schon drehte sich alles um das große Schlamassel, den ersten Feldzug in diesem Weltkrieg, der nur ein mickriges Scharmützel hätte werden sollen und den man so kläglich verloren, bei dem man fast das Gesicht verloren hatte, dem dann all das gefolgt war, der Große Krieg und die Eiserne Zeit, und wohin jetzt und wie, um nicht nach dem Warum und Wozu zu fragen.
Entsetzen in den Worten des Gegenübers. Nachdem man im zweiten Feldzug vorläufig seine Ehre wiederhergestellt habe, dadurch wieder Herr der Lage, Herr dieser Stadt und neuer Ländereien sei, deute sich jetzt plötzlich an, dass der Kriegsausgang vielleicht doch kein erfreulicher, vielleicht sogar ein katastrophaler … War das alles noch in guter, alter Ordnung wiederherzustellen – die Ehre, der Sieg, das Reich? Das Bangen um die unsicher gewordenen Gewissheiten und um das ihm bislang zugesicherte Privileg, das war den immer zackiger werdenden Ausführungen seines Gegenübers deutlich anzumerken. Der Milan Nemec, bekannt für sein diplomatisches Schweigen, war mit zerstreutem Nicken beschäftigt, achtlosem Bejahen der Dummheiten, die der Besuch aus Wien vor ihm ausbreitete. Er ertappte sich immer öfter bei einem Kopfschütteln, wo ein Nicken besser, bei einem Hinhören, wo er nur weghören wollte.
Es scheint aus heutiger Sicht nachgerade unerklärlich, wie aus dem diplomatischen, schweigenden Milan Nemec innerhalb weniger Stunden ein Skandalmacher hatte werden können. Das Kopfschütteln, Nicken, das Murmeln – wie war es in den unglaublichen Disput übergegangen, der in die Geschichte der Okkupation Belgrads eingehen sollte?
Der Fall Milan Nemec sollte Jahrzehnte später, in einem neuen Jahrhundert, einem neuen Jahrtausend, Anlass dazu geben, dass die Direktorin des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, jene Direktorin, die es geschafft hatte, die Besucherzahlen des Museums zu verdreifachen, und zwar nicht auf dem Wege der Eintrittspreisreduzierung, diese Direktorin also und eine zwanzig Jahre jüngere Militärhistorikerin, die sich mit ihrer militärhistorischen Dissertation über den Fall Milan Nemec als Balkanexpertin ausgewiesen hatte, sich fiebrig in einem wehrwissenschaftlichen Disput keilten.
Die Direktorin des Heeresgeschichtlichen Museums – das ist ein Mensch, aber was für einer? – hatte bereits ihre zehn Karrieren und noch zehnmal mehr Erfolge hinter sich. Eine Frau der Ehrungen und Auszeichnungen. Das liest sich auf dem Papier fließend und kann in hundert Jahren nicht infrage gestellt werden: Vorstandsmitglied des Österreichischen Museumsbundes und der Österreichischen Gesellschaft für Heereskunde, stellvertretende Vorsitzende des Militärhistorischen Beirats der Wissenschaftskommission beim Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport sowie Großoffizier des Verdienstordens des Großherzogtums Luxemburg. Dekoriert. Hat erhalten: das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich, ein Jahrzehnt später das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich, außerdem das Großkreuz des Gregoriusordens, das Sportehrenzeichen ihrer Geburtsstadt und das Goldene Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um jenes Bundesland, in dem ihre Geburtsstadt lag. Zudem war sie Oberstleutnant des höheren militärfachlichen Dienstes im Österreichischen Bundesheer. Kein Mitglied bei angesehenen Verbindungen, weil diese – womit die Direktorin ganz einverstanden war – keine Frauen aufnahmen, dafür Mitglied bei einer Damenverbindung. Kunstmäzenin und private Sammlerin mittelalterlicher Schlachtengemälde. Freundin der Pferde. Erhalten hat sie auch wissenschaftliche Preise, dem Karriereverlauf entsprechend noch überschaubar. Darunter den deutschen Werner-Hahlweg-Preis für Militärgeschichte und Wehrwissenschaften, vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Deutschland vergeben, im Namen eines schon toten Militärhistorikers, der, was die Öffentlichkeit erst letztes Jahr durch das Fernsehen erfahren hat, ein bisschen zu sehr ins Dritte Reich, in den Nationalsozialismus, sagen wir, verwickelt gewesen war. Weswegen dieser Preis nicht unbedingt etwas Vorzeigbares in ihrer Karriere darstellte. Bloß, zurückgeben tut man so etwas nicht, wenn man es erst einmal erhalten hat. Denn – Zeichen zu setzen, das ist eher was für Druckereien und nicht unbedingt für Direktorinnen.
Sie setzte ja außerdem ganz andere Zeichen, stattdessen, in ihrem Museum. Das war ja kein Spontanmuseum auf Abruf, sondern ein großes zu verwaltendes Erbmuseum. Sie setzte Zeichen, die der Unterhaltung und der Wirtschaft, aber auch der Traditionspflege dienten. Tausende Besucher konnte sie mit ihrem Spektakel »Montur und Pulverdampf« in das früher in den Sommermonaten oft leere Museum locken. Die freundliche Einladung an ihre österreichischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, dem Alltag zu entfliehen, wenn schon nicht mit dem Pulverdampf, dann beim Anblick der Reitenden Artilleriedivision Nr. 2, die die Besucher und Besucherinnen im Juli und August mit dem zu Mittag ertönenden »K. u. k. Kanonendonner« immer wieder daran erinnerte, dass es in Wien noch Traditionsvereine gibt, falls es jemand vergessen haben sollte.
Pflichtbewusste Innovationsfähigkeit und kreativen Umsetzungsgeist, das hatte sie bewiesen, um das Museum, ein Zauberwerk aus glänzendem Staub in einer ehemaligen Kaserne, einladender zu machen. Da es um Ererbtes ging, sollte es zu modern dann doch nicht sein. Trotzdem verstand sie ihr Museum als ein zeitgemäßes, eines zum Angreifen, eines zum Zuschauen. Daher ein Sommerfestival wie »Montur und Pulverdampf« – Nutz’ doch die Gelegenheit! –, daher die Militärfahrzeuge in Bewegung, zum Anschauen, alles da, vor dir, zum Staunen, zum Glänzende-Augen-Kriegen. Komm mit auf die Zeitreise, auf das kleine Abenteuer, lass dich entführen, erlebe es hautnah, das Damals, in einem Frack des Kaisers, in voller Montur, auf einem Militärfahrzeug, ab in die Schlacht, im Kanonendonner, alles so schön, so schön ordentlich. Denn das, was nach dem Aufbruch in die Schlacht kam, musste man dann ja nicht mehr zeigen.
Für alle, die nicht persönlich vorbeikamen, machte das Museum schöne, farbige Bücher, da war alles drin: die Uniformen, die Waffen, die Fotos fescher Offiziere, für jeden Geschmack etwas. Die Direktorin: ein Leben im Staatsdienst. Dabei bekleidete die Wehrwissenschaftlerin, das war sie durch und durch, fast alle ihre Positionen als erste Frau – mit Charme, Esprit und Eleganz, wie es eine Wiener Illustrierte über die erfolgreiche weibliche Leitungskraft geschrieben hatte, sich der Sprache des Feindes bedienend.
Die ihr gegenübersitzende junge Kollegin wurde von ihr seit Jahren als Assistentin ausgebildet. Sie war ihr zur Seite gestanden, hatte sich nie böse über ihre jugendliche Aggression geäußert, sie freundlich, so war sie eben, wie die sprichwörtliche Schlange am Herzen herangezogen, sich ihre übervollen, dabei ganz leeren Floskeln angehört, ihr ein wenig Innenraum gegeben, in der Nähe des eigenen Büros, im Museum. Ein Innenraum, den sie nachts heimlich betreten hatte, um einen Büchervergleich anzustellen. Dabei war sie auf das ungehemmt vulgäre Moment dieser Person gestoßen.
Und nun das. Wenn solch ein Gespräch explodierte, da war der k. u. k. Kanonendonner der Reitenden Artilleriedivision Nr. 2. nichts dagegen. Beide suchten seit Stunden ihre weit auseinanderklaffenden Interpretationen der gemeinsam in einem Projekt erforschten Quellen zu verteidigen, indem die eine der anderen immer neue Nuancen aus dem Schlagabtausch zwischen dem Nemec und seinem Wiener Besucher verdeutlichte. Was einer inneren Logik folgend in einem Gespräch über die Frage von Sachzwängen endete. Zugegebenermaßen war der Schlagabtausch zwischen dem Nemec und seinem Besuch aus Wien nur in Auszügen aus den vorhandenen Akten und Dokumenten rekonstruierbar. Das machte die Interpretationsmöglichkeiten umso vielfältiger, die Analyse fantasiereicher, das Gespräch lebhafter und die Nacht so unglaublich lang.
Betonte die eine ständig, dass der Nemec bei Tatsachen geblieben war, hielt die andere alles, was er gesagt hatte, für Provokation, wofür sie seine Herkunft als Grund heranzog. Sah die eine die Aussagen des Nemec im Kontext eines Stammtischgeplänkels als eher irrelevant an, meinte die andere, gefährliche Agitation eines Slawen darin zu erkennen, die man früher hätte entdecken müssen, was eventuell den Kriegsverlauf geändert hätte. Was reichlich übertrieben war, bedachte man, dass es sich bei der Gegend, in der der Nemec stationiert gewesen war, nur um einen Kriegsnebenschauplatz gehandelt hatte, der ja, im Gesamtbild betrachtet, völlig irrelevant war für diesen Kriegsverlauf, den die Direktorin noch nachträglich gerne korrigiert hätte, und berücksichtigte man zudem, dass der Kriegsausgang zu diesem Zeitpunkt längst schon entschieden war. Die zwei Streitenden zogen jeweils unterschiedliche Aspekte aus dem Verwaltungsschriftgut zu Rate, zitierten im Gespräch aus den Akten des Armeeoberkommandos, des Kriegsministeriums, des Militärgouvernements. Und sie waren in ihrem Ringen um einen inhaltlichen Sieg im Gespräch bald auch richtig besoffen.
Die Meinungsverschiedenheiten fußten auf einer grundsätzlich unterschiedlichen Interpretation der Lage, in der sich der Nemec überhaupt befunden hatte. Während die eine der Meinung war, er sei Teil eines etablierten Systems totalisierter, repressiver Besatzungsherrschaft gewesen, hielt die andere mit dem Argument dagegen, dass diese damalige Besatzungsverwaltung in einem außerordentlichen Maße an Regeln und Normen gebunden blieb und dass es sich um eine der humansten Besatzungen der menschlichen Besatzungsgeschichte überhaupt gehandelt habe, von der die Belgrader und Belgraderinnen nur profitieren konnten. Solchen Ansichten konnte sich ihr Gegenüber wiederum nicht anschließen.
Jedenfalls – da waren sich beide einig – hatte sich der Nemec in einer zwiespältigen, verunsichernden Situation befunden, deshalb hatte er an jenem Abend so überreagiert und sich ungebührlich verhalten. Ja, sie waren sich einig, dass es diese zwiespältige, verunsichernde Situation gewesen war, die ihn durcheinandergebracht haben musste, den Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, der mit dem vom k. u. k. Armeeoberkommando im Jahre 1916 errichteten Militärgeneralgouvernement in Belgrad stationiert worden war, mit der Aufgabe, die Unterstützung der Kriegsmaschinerie zwischen Front und Heimat aufrechtzuerhalten. Das bedeutete nämlich, dass er in einem Etappengebiet festsaß und nicht mehr in Kampfhandlungen eingesetzt wurde, wodurch ihm zu viel Zeit blieb, über seine Situation und die seines Reiches nachzudenken. Nicht ungefährlich. Zu berücksichtigen blieb außerdem, dass der Nemec seine Anwesenheit in Belgrad nur als demütigend empfinden konnte.
Denn was sonst als demütigend war es schließlich, dass er und sein militärisches Personal hier meist mit unmilitärischen Aufgaben beschäftigt waren. Auf Schlachten hoffend, waren sie in Belgrad in der k. u. k. Wetterstation gelandet, mussten nun als Lehrer des k. u. k. Internats-Realgymnasium oder im k. u. k. Versatz- und Versteigerungsamt arbeiten, oder, im schlimmsten Falle, sogar im k. u. k. Fiakerbetrieb. Ein gebildeter Mann von Welt konnte von Glück reden, wenn er für die Belgrader Nachrichten schreiben durfte, eine von Offizieren herausgegebene Zeitschrift, die offizielle Besatzungszeitung mit Amtsblattcharakter, in der auf Deutsch, Serbokroatisch und Ungarisch Befehle veröffentlicht wurden oder Benachrichtigungen von Todesstrafen. Bei dieser Arbeit konnte er sich zumindest damit trösten, dass er militärisch sinnvolle Propagandaarbeit machte. Dennoch – Schreibarbeit! Eine Demütigung für den militärisch ausgebildeten Mann. Da war das Wacheschieben schon fast ein ehrenvoller Akt, der am nächsten an die militärische Arbeit, die er auszuüben ausgezogen war, herangekommen wäre. Aber für so etwas durfte ja ein Offizier wie der Milan Nemec nicht mehr eingesetzt werden, dafür war er schon zu weit aufgestiegen, da gab es kein Zurück zum Wachpostendasein, dem glücklichen! Nein, er war zum Unterschreiben abkommandiert worden, eine ratternde Signiermaschine.
Die Verwaltungsarbeiten langweilten Milan Nemec entsetzlich. War er einst ein Führer von Kompanien gewesen, musste er sich nun mit Dingen herumschlagen wie der zentralen Übernahmestelle für Milch in Belgrad, in der die gesamte Milch gesammelt und ein einheitlicher Fettanteil festgelegt wurde. Oder er hatte Briefe an das Reservespital Brčko zu schreiben, das eine Meierei, Schweinezüchterei, einen Hühnerhof, eine Schlachtbank und 40.000 Quadratmeter Gemüsegarten in Eigenregie betrieb, Dinge, die auch er haben wollte, für sein militärisches Verwaltungspersonal, Dinge, die auch die zu verwaltende Zivilbevölkerung haben wollte, aber nicht bekam, weshalb mit Konflikten zu rechnen war, was sich wiederum in neuen Unterschriften für neue Vorschriften niederschlug. Schreibarbeit, Lesearbeit, verfluchte!
Das alles hast du mir angetan, Belgrad. Du üble Halbstadt, mit der ich nicht Freund werde, warum braucht es mich bloß hier?
wir
Der Offizier Milan Nemec war in der Stadt, um im Rücken der Front für Ruhe und Ordnung zu sorgen, um zu helfen, die Landesressourcen bestmöglich auszunutzen und um die Kommunikationslinien, die immer unüberschaubarer wurden, am Laufen, sei es auch am Irrlaufen, zu halten. Glücklich machte das einen Mann nicht. Seit Kinos und Schwimmbäder extra für Offiziere eingerichtet worden waren, war alles etwas leichter auszuhalten. Aber nein, glücklich, das konnte man nicht behaupten, dass er das war, der Nemec.
Warum er jedoch in diesem Ausmaß überreagierte an jenem Herbsttag, bleibt bis heute zu einem gewissen Grad unerklärlich. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass es der trommelnde Einsatz des Wortes Wir gewesen war, der ihn irritiert hatte, oder, noch wahrscheinlicher, das ebenso schlagende Wort Palatschinken, weil ihm sofort der Geruch von verbranntem Fett in die Nase stieg, wenn er dieses Schreckenswort hörte.
Wir, meinte dieser Besuch etwa, wir haben unsre militärische Niederlage ja bloß eing’steckt, weil wir den Frieden geprobt haben, in den letzten Jahrzehnten. Unsre Armee: ein depperter Lipizzaner, der nur für Paraden taugt, unsere Truppen, die man erst niederpeitschen muss, damit sie lernen, was Galopp ist. Das konnte ja wohl kein Erfolg werden, nicht wahr, wenn wir die Herrn Soldaten schlafend an die Front transportieren müssen, anstatt dass sie selbst dahinfinden, auf ihren zwei Beinen. Diese Soldaten, die wir erst von ihrem weißen Kaffee und ihrem Guglhupf entwöhnen mussten, bis sie kapiert haben, was das heißt, Krieg. Und als wir sie aus allen Teilen unseres Reiches zusammenmobilisieren mussten, von ihren Feldern holen, mitten aus der Ernte: Was wir ihnen da nicht alles mitgegeben haben auf die schöne Reise: neues Schuhwerk und sauberes G’wand, Brotsäcke, Tornister, Taschenlampen und Kompasse. Wie für eine Abenteuerexpedition, eine kleine Entdeckungsreise ausgerüstet haben wir sie, samt ihren Backhenderln und dem Paprikasch und den Palatschinken, lauter Herren, die vor dem Krieg nichts waren und nichts gehabt haben, und dann auf einmal, im Krieg, haben sie Zahnbürsterl im Sackerl. Wer weiß, ob die überhaupt schon jemals ein Zahnbürsterl in der Hand gehabt haben vor dem Krieg. Na, da haben sie sich dann ang’schaut, die Herren Soldaten, wie’s aus war mit den Henderln und den Palatschinken und dem Tabak und den Zahnbürsterln. Da war die Moral am Anfang noch hoch, bei der Truppe, aber die Moral, die ist gleich mit bergab, mit der Verpflegung. Weil als sie im Dreck gelandet sind und die Decke feucht und plötzlich, Überraschung, die Sackerln alle leer war’n im Krieg – aus mit den Palatschinken, mitten im Schlamm und im Graben –, da sind sie aufg’wacht, die Herrschaften. Natürlich hat er sie überrascht, der Krieg, der sie ihr Leben hat kosten können, der schon ihre Kameraden das Leben gekostet hat. Und dann, als sie das verstanden haben, unsere Soldaten, die vor dem Krieg nichts waren und nichts gehabt haben, und erst recht, nachdem sie zurückgejagt wurden vom Feind, nur zum Teil zurückgejagt, der andere Teil war im Graben geblieben, da war die Überraschung groß. [Hüsteln] Ja, zugegeben, auch unsre Überraschung war recht groß, so haben wir den nicht vorberechnet, den Feldzug. [Abermaliges Hüsteln] Aber dafür war dann die Vorbereitung für den zweiten Feldzug umso besser, und da war’s dann vorbei mit sauberen Sackerln voll mit Zahnbürsteln, darum geht’s. Ein Krieg ist keine Hochzeit, zu der man mit sauberen Zähnen hingeht. Dann aber haben wir den Feldzug, den zweiten, gewonnen, von dem wir nicht gedacht hätten, dass er nötig sein würde, bei diesem blöden Feind. Bloß, das kommt eben davon, wenn wir die Soldaten mit Würschteln und Palatschinken in so einen Feldzug schicken. Aber! Beim zweiten Ins-Feld-Ziehen, da war klar: Nichts ist’s mehr mit Palatschinken an der Front. [Schlag auf den Tisch, zufriedenes Zurücklehnen] So haben wir endlich unsre und die Ehre unsres Kaisers wiederhergestellt, und nur darauf kommt’s an, ob man das kann.
Der Milan Nemec war in seinen nicht sehr begeisterten Gedanken gefangen. Er murmelte unvorsichtigerweise vor sich hin, anstatt zu schweigen, wie er immer geschwiegen hatte, wenn es sein musste. Sein Murmeln blieb jedoch unverständlich für sein Gegenüber. Es waren ganz unwirkliche Gedanken, die ihn gefangen hielten, in etwa solche:
Ja, aber. Das ist ja ein seltsames Gesicht. Was schaut mich dieses nach Seife riechende Gesicht so an und schaut dabei so blöd aus? War das Gesicht da denn überhaupt an der Front? Hat es denn auch den Dreck nicht mehr aus den Stiefeln gekriegt? Welche Ehre? Ja, welche Ehre denn bitte wiederhergestellt? Gesiegt! hätten wir doch niemals! Ohne die Preußen und diese seltsamen Balkanpreußen dazu. Das kommt jetzt davon, diese Balkanpreußen teilen sich das ohnehin zu kleine Gebiet mit uns, das ganze östliche Land und das mazedonische daneben mussten wir abtreten an sie. Schaut denn so überhaupt ein echtes Gesicht aus oder ist es nur eine eingecremte, ölig glänzende Maske, die mich da so blöd anschaut? Ob der wohl glaubt, dass diese ganze Einseiferei und Eincremerei ihm einen himmlischen Wohlgeruch verpasst, der ihm dann, sollte er doch mal krepieren, was im Krieg ja schneller passieren kann, als man glaubt, die Unverweslichkeit garantiert? Deshalb das ganze verfluchte Fett und Öl in seinem Gesicht, während er von unseren großen Eroberungen spricht? Wo uns doch nur Belgrad bleibt, dieses Loch, das nur dazu da ist, den lausigen Rest der westlichen und südlichen Landesteile zu verwalten und Etappenaufgaben zu erledigen, die eine Demütigung sind für unsere Offiziere und Soldaten. Ja, welche Ehre denn bitte, bei so einem ganzen und großen Schlamassel? Du dummes Gesicht; da möchte ich bloß wegschauen, mich bloß wegdrehen von dir, bei so viel Seife und Creme und öligem Grinsen.
Hinter diesem unhörbaren Murmeln war ein noch ungehörigeres Denken zu erahnen, eines, das den Milan Nemec seit einigen Tagen nicht mehr verlassen wollte. Ein zweifelndes, verzweifeltes Denken, das mit dem Galgen zu tun hatte, an dem er vor wenigen Tagen vorbeispaziert war. Dabei war er schon an vielen Gehängten vorbeispaziert, nicht nur in Belgrad, auch in den nördlichen und nordwestlichen Sümpfen dieses Landes. Keine dieser Gestalten hatte einen Platz in seinen Erinnerungen beansprucht, keiner dieser Toten wollte ihm im Gedächtnis hängen bleiben. Das blieben nur kleine schwarze Fragezeichen, ganz unauffällige, die sich in den scheinbar endlosen Weideflächen wie überflüssige Vogelscheuchen ausmachten. In seinen seichten Erinnerungen an die Maisfelder und kleinen Dörfer, durch die er mit den Truppen gezogen war, waren diese Vogelscheuchen untergegangen, ganz wie die kleinen Dörfer selbst, die sich so tief in diese Maisfelder hineinduckten, als wollten sie sich vor den herannahenden Truppen verstecken. Da war wohl nach ihrem Abzug das eine oder andere struppige Dorf inmitten der wüsten, weiten Landschaft gewesen, im Dorf ein paar verkohlte Scheunen und Hütten, davor ein paar Bäume mit Gehängten, manchmal noch ein Feuer, ein Rauch, der aufstieg, durch die Baumkrone, und dann übers Land zog. Ein Land, das eine Zeit lang ganz bissig und verkohlt wirkte, bis sich all das legte, bis sie endlich vorbeigezogen waren und alles Gesehene in beißendem Nebel verschwand, wie nie da gewesen. Dinge, vor denen ihm grauste, als er sie sah und hörte, die er aber in nicht deutbare Traumbilder hatte zerrinnen lassen. Was sie niederbrannten, konnte wieder aufgebaut werden. Als es später um die Landesressourcen ging, die sie ausnutzen mussten, sah alles ganz anders aus, da trauerten sie um jedes tote Feld, das ihre Truppen hinterlassen hatten, das schon. Die Galgen und das Hängen in den Bäumen jedoch … nur kleine schwarze Fragezeichen in einer fremden Gegend, einer unfreundlichen. Nichts, woran tagsüber zu denken Zeit blieb, wenn man, wie der Milan Nemec, mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt war, nichts, woran in hundert Jahren zu denken Zeit bliebe.
Genauso undeutlich waren ihm die späteren Belgrader Galgen in Erinnerung, die so häufig seinen Weg versperrt hatten. Sehr verschwommen war zum Beispiel – in Grauschattierungen wie eine alte Fotografie – eine kleine Darstellung in seinem Kopf haften geblieben: ein Mann in der Mitte, an einem Strick, Schaulustige drumherum positioniert, ein Offizier verliest das Urteil, ein zweiter hält mehrere Schlingen in der Hand, daneben der Priester wie eine lustige Erscheinung in einer Komödie, hinter ihm der Henker, rechts zwei neugierige Sanitäter, schau, wie lustig, alle starren sie dich an, starren aber eigentlich den Fotografierenden an, der sich ihnen gegenüber aufgestellt hat und hinter dem du stehst, sodass alle scheinbar dich anvisieren, während sie für die Kamera posieren. Der da am Strick hängt, das merkst du beim Vorbeigehen, wird nicht wirklich hingerichtet, hier wird geprobt. Du verstehst: Diese Szene bietet sich dir nur dar, weil dringend neue Henker ausgebildet werden müssen. Man kam zu diesem Zeitpunkt, in dieser Anfangszeit der Besatzung, mit der großen Anzahl an Todesurteilen schon nicht mehr hinterher, und da musste die Militärverwaltung für den Henkersnachwuchs sorgen.
Aber kein Bild, keine Szene hatte sich auf solch eine Weise in seine Hirnritzen eingekratzt wie das Bild des Galgens im Herbstbelgrad 1918, der nur für ihn … oder doch nicht, wer weiß. Nicht weil es ein besonderer Galgen gewesen war, keineswegs, noch weniger wegen des jungen Mannes, der gehängt worden war, auch nicht wegen des Mütterchens, das sich da so klagend an die Füße des Gehängten klammerte. Sondern nur aufgrund des leise gejammerten Namens, den dieses Mütterchen dabei vor sich hinmurmelte: Milane! Milane! In unaufgeregter Monotonie murmelte es den Namen, der unglücklicherweise … ausgerechnet! … der seinige sein musste. Dieses murmelnde Jammern hatte sich bis in seine Schläfen vorgearbeitet, drückend, pochend, andauernd, das Echo dieser Stimme blähte ihn innerlich auf. Als nun der Mann vor ihm so überzeugend sprach, machte sich in seinem Kopf undeutlich die Vorstellung breit, dass es ein großes Wir gab, das er nicht mehr ganz fassen konnte, seit das Mütterchen am Galgen seinen Namen gejammert hatte, und dass es dann noch ein kleines Ich gab, das er zwar besser fassen konnte, an das er aber kraft seines Ranges und seiner Moral nicht glauben durfte. Es war eine ganz primitive Todesangst, die ihn stutzig gemacht hatte. Seit damals murmelte es in ihm immer mal wieder, ein auf das andere Mal, tage- und wochenlang, besonders wenn jemand das Wort Wir in den Mund nahm, leise, aber immerzu, es murmelte wiederholt seinen Namen, Milan, Milan, hör her, hör doch mal, hör zu, du!