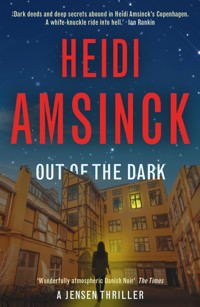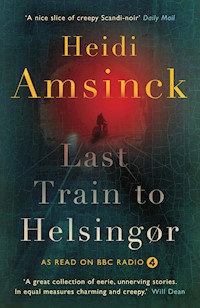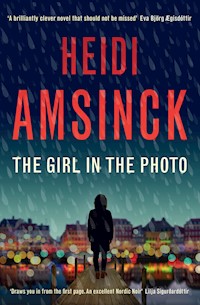4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jensen ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Wintermorgen in Kopenhagen. Eine Leiche mit einem Schild: »Schuldig«. Und eine Journalistin auf der Suche nach Antworten: So beginnt der atmosphärische und fesselnde dänische Thriller »Schneeflockengrab«. »Schuldig.« Nur dieses eine Wort steht auf dem Pappschild des jungen Mannes, der in Kopenhagen unter einer Straßenlaterne sitzt. Am nächsten Morgen liegt er leblos im Schnee, ermordet. Jensen, Journalistin bei der Zeitung Dagbladet, stolpert fast über seine Leiche. Sie ruft Kommissar Henrik Jungersen zum Tatort, ihren besten Kontakt bei der Kopenhagener Polizei - und ehemaligen Liebhaber. Es ist schon der zweite Mord an einem Obdachlosen innerhalb von zwei Wochen, und als kurz darauf eine dritte Leiche auftaucht, gehen alle von einem Serien-Mörder aus. Doch Journalistin Jensen zweifelt an dieser Theorie: Warum sollte jemand reihenweise Obdachlose ermorden? Warum saß der Junge stundenlang an genau dieser Stelle im Schnee? Und wer ist wirklich »schuldig«? Ein atmosphärischer Schauplatz im verschneiten Kopenhagen, eine manchmal schlecht gelaunte und trotzdem sehr sympathische Journalistin in der Hauptrolle, und ein Mord-Fall, bei dem nichts ist, wie es scheint: Dieser dänische Thriller ist einfach perfekt für spannende Winternächte! »Schneeflockengrab ist ein brillantes Debüt. Heidi Amsinck ist hoffentlich gekommen, um zu bleiben.« - Yrsa Sigurdardóttir
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Heidi Amsinck
Schneeflockengrab
Thriller
Aus dem Englischen von Ulrike Clewing
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Schuldig. Nur dieses eine Wort stand auf dem Pappschild des jungen Obdachlosen. Jetzt liegt er tot im Schnee, an einem Wintermorgen in Kopenhagen. Die Journalistin Jensen stolpert fast über seine Leiche. Sie ruft Kommissar Henrik Jungersen zum Tatort, ihren besten Kontakt bei der Kriminalpolizei - und ehemaligen Liebhaber. Es ist schon der zweite Mord an einem Obdachlosen innerhalb von zwei Wochen; als kurz darauf eine dritte Leiche auftaucht, gehen alle von einem Serienmörder aus. Doch Jensen zweifelt an dieser Theorie: Warum sollte jemand reihenweise Obdachlose umbringen? Warum saß der Junge stundenlang an genau dieser Stelle im Schnee? Und wer ist wirklich »schuldig«?
Inhaltsübersicht
Widmung
Erste Woche
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Zweite Woche
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Dritte Woche
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
Danksagung
Für Frederik und Jules
Erste Woche
1
Jensen sog die kalte Luft tief in sich hinein, sah zum Himmel hinauf und ließ die letzten umhertanzenden Schneeflocken auf ihrem Gesicht schmelzen. Nur wenige Fenster in den Wohnhäusern um sie herum waren erleuchtet. Die Bettwärme noch in sich tragend, tasteten sich die Menschen auf dem Weg zur Arbeit vorsichtigen Schrittes über das rutschige Kopfsteinpflaster. Sie sahen sich um, als würden sie ihre eigene Stadt nicht wiedererkennen. Dass es schneien kann, war ihnen wohl entfallen, und auch, wie der Schnee die Geräusche der Schritte schluckt, als spannte der Himmel eine riesige Decke über Kopenhagen. Nicht einmal mehr die vor sich hin grölenden, herumtorkelnden Schnapsnasen hatte es auf ihren Schlafplätzen neben dem Supermarkt auf dem Christianshavns Torv gehalten. Der heftigste Blizzard seit Jahren hatte dafür gesorgt, dass sie sich in irgendwelche Innenräume verzogen. Schon bald würden die Schneeräumer anrücken und die weiße Pracht beiseiteschieben. Die Normalität würde wieder Einzug halten. Solange aber hielt die Stadt den gefrierenden Atem an.
Jensen fuhr die gewohnte Strecke, am Borgen vorbei, dem Parlamentsgebäude mit der majestätischen, von Grünspan überzogenen Krone, über die Knippelsbro nach Holmen, und zog mit den Reifen eine Schlangenlinie in den Schnee. Das Heck eines gelben Busses brach in einem großen Bogen zur Seite aus. Die Fahrgäste hinter den beschlagenen Fenstern muteten nahezu geisterhaft an. Jensen beschloss, die Stadt zu mögen, so still und menschenleer, wie sie sich ihr jetzt mit ihren imposanten alten Bauwerken präsentierte. Ohne den Bus hätte jeder Bewohner aus dem neunzehnten Jahrhundert das Stadtbild sofort erkannt.
Das rutschige Kopfsteinpflaster in der Snaregade zwang sie zum Absteigen. Sie schob das Rad zwischen den großen, schiefen Stadthäusern der Altstadt hindurch.
Es sah ihr ähnlich, dass sie ausgerechnet an diesem Morgen schon früh in den Zeitungsverlag zur Arbeit fuhr. Keine zwanzig Minuten war es her, dass sie den Vorhang neben ihrem Bett aufgezogen und die bläulich weiße Welt draußen entdeckt hatte. Gleich aufzustehen und rauszugehen verlieh ihr ein Gefühl von Pflichterfüllung, wobei sie sich jetzt allerdings fragte, ob es nicht klüger gewesen wäre, zu Hause zu bleiben.
Sollte ihr entfallen sein, was es hieß, Journalistin zu sein? Waren ihr die Hartnäckigkeit und die Neugier abhandengekommen, mit denen sie ihre Brötchen verdient hatte, seit sie denken konnte?
Seit ihrer Rückkehr nach Kopenhagen spürte sie, wie die Leidenschaft aus ihr heraussickerte wie bei einem schleichenden Platten, sodass sie kaum noch einen Satz, geschweige denn einen Artikel zusammenbrachte, den zu lesen sich lohnte. Nichts funktionierte, nichts war mehr von Bedeutung.
Als Reporterin für das Dagbladet gehörte es zu ihren Aufgaben, hinter die Kulissen zu schauen und die dänische Gesellschaft unter die Lupe zu nehmen. Aber was wusste sie noch von der dänischen Gesellschaft, nachdem sie fünfzehn Jahre fort gewesen war?
Schon seit Wochen stand sie mit einem Feature über die Kürzungen in der psychiatrischen Versorgung im Wort und redete sich immer wieder mit dem erschwerten Zugang zu Dokumenten heraus. Die Wahrheit war, dass sie mit der Recherche für die Geschichte noch nicht einmal angefangen hatte. Sie hatte den Eindruck, dass sie sich in einer Art Selbstfindungskrise befand.
Ihre Chefin, Margrethe Skov, eine Frau, der es an Selbstvertrauen noch nie gemangelt hatte, zeigte dafür kein Verständnis. (»Journalismus ist reines Handwerk und keine Kunst; man sitzt nicht einfach herum und wartet, bis einen die Inspiration packt.«)
Margrethe hatte natürlich recht. Jensen musste sich einfach an die Arbeit machen. Wenn es gut lief, brachte sie bis zur Redaktionssitzung am heutigen Vormittag schon eine brauchbare Einleitung für ihren Beitrag zustande. Es wäre bestimmt erhebend und äußerst zufriedenstellend, ihn denjenigen unter die Nase reiben zu können, die ihr weniger gewogen waren (und davon gab es so einige). Eine Menge arbeitsloser Journalisten würde einen Mord begehen, um für das Dagbladet schreiben zu dürfen, sinnierte Jensen, während sie ihr Fahrrad weiterschob. Ihre entschlossenen Schritte knirschten im Schnee.
Ein Stück nachdem sie in die Magstræde eingebogen war, sah sie es.
Vor dem roten Gebäude mit der grünen Tür.
Einen hüfthohen Schneehaufen.
Etwas Unförmiges.
Sie sah die Straße rauf und runter und wünschte, es würde gleich jemand auftauchen. Sie wusste, was dieses unförmige Etwas war, wollte es aber nicht wissen. Einen Moment lang erwog sie, einfach weiterzugehen. Aber wie hätte sie das jemals fertigbringen können?
Ihr Herz hämmerte in der Brust. Ihre Hände in den Handschuhen wurden schweißnass. Sie lehnte das Fahrrad an eine Straßenlaterne, beugte sich zu dem unförmigen Haufen hinunter und schob den Schnee vorsichtig beiseite.
Vor Schreck wich sie zurück.
Es war ein Mann, das Gesicht zum Himmel gerichtet, die Augenhöhlen mit Schnee gefüllt.
Sie erkannte ihn wieder. Letzte Nacht hatte er genau an dieser Stelle gesessen. Im Schneidersitz. In denselben roten Schlafsack gehüllt. Allerdings war sie sich ziemlich sicher, dass er da noch gelebt hatte. Sie erinnerte sich, wie sie noch gedacht hatte, was für ein seltsamer Ort zum Betteln das war, im Schatten zwischen zwei Straßenlaternen, während um ihn herum ein Schneesturm tobte.
Die Handflächen des Mannes waren nach oben gerichtet, als wollte er im Sterben seine Unschuld beteuern oder beten. Beides schien ihm nicht viel genützt zu haben. Er wirkte ein paar Jahre jünger als sie. Anfang zwanzig vielleicht. Fast noch ein Junge.
»Nicht schon wieder«, entfuhr es ihr laut, und sie begriff erst in diesem Moment, was das bedeutete.
Passierte das hier wirklich?
Sie wischte noch ein wenig mehr Schnee weg und erstarrte, als sie plötzlich auf einen himbeerfarbenen Brei stieß. Die Daunenjacke des jungen Mannes hatte einen Riss; man hatte ihm in den Bauch gestochen.
Der andere Tote, war der nicht auch erstochen worden?
Auf dem Boden neben dem Mann stand ein Pappbecher mit Kaffee. Daneben lag eine Pizza im Karton. Sie war mit Salami belegt, die sich hochgebogen hatte, ganz steif gefroren war und die Hautfarbe des Toten angenommen hatte.
Jensen musste sich einen Moment auf den Knien abstützen. Speichel lief ihr aus dem Mund und schmolz ein Loch in den Schnee. Sie musste würgen. Ihr Oberkörper krampfte, ohne dass etwas kam.
Ihre Hände bebten; sie zitterte. Die Kälte kroch ihr tief in die Knochen. Wie lange ist der Mann schon tot? Ein paar Stunden höchstens. Sonst hätte ihn bestimmt schon jemand gefunden? Trotz, vielleicht aber auch gerade wegen des Schnees war die Magstræde eine dieser urigen alten Straßen, in die es die Touristen in Scharen zog. Ein wahres Postkartenidyll von Kopenhagen.
Der Himmel über den großen bunten Stadthäusern färbte sich an den Rändern türkis. Der Sichelmond verblasste in der Morgendämmerung. Der Schnee war, von ihren eigenen Spuren abgesehen, unberührt.
Sie warf einen Blick auf ihr Handy und spürte ein flaues Gefühl im Magen. Seit ihrer Rückkehr hatte sie Henrik nicht mehr angerufen. Seine Nachrichten hatte sie ebenfalls ignoriert. Er dürfte wissen, was hier zu tun war.
Der Tod war sein Geschäft.
Ihm war es wichtig, immer als Erster informiert zu werden.
Außerdem würde es ihr helfen, wenn sie Henrik anrief. Das Dagbladet hatte den letzten Mord weidlich ausgeschlachtet. Tote Obdachlose schafften es in London eher selten auf die Titelseite. In den Straßen von Kopenhagen aber, der Hauptstadt der glücklichsten Nation der Welt, sorgte so etwas für Schlagzeilen.
Warum war der junge Mann hier? Wer war er?
Von Henrik konnte sie eher Informationen erwarten, wenn es so weit war, als von einer normalen Streife, die über den Notruf 112 herbeigerufen wurde.
Und Henrik schuldete ihr etwas.
Er schuldete ihr so viel, dass sie nie quitt sein würden, was immer er jetzt auch für sie tun mochte.
Er saß im Auto auf dem Weg zur Arbeit, als sie ihn anrief, und versuchte, mithilfe der Freisprechanlage die Nachrichten aus dem Radio zu übertönen. Die Klangfarbe seiner Stimme trübte sich ein, als er begriff, dass der Anruf nicht privater Natur war. Sie hörte, wie das Heulen der Sirene einsetzte und er den Wagen beschleunigte.
»Bleib, wo du bist«, wies er sie mit der rauen Stimme an, die er allem Dienstlichen vorbehielt. »Und fass nichts an.«
Zu spät.
Sie machte ein paar Fotos von dem Toten, auch wenn sie bezweifelte, dass die Zeitung etwas so Grausames bringen konnte. Der geöffnete Mund des Mannes ließ ihn verletzlich aussehen, der Flaum an seinem Kinn reichte nicht ganz für einen Bart. Schneeflocken hatten sich in seinen Wimpern verfangen und sie weiß gefärbt. Er war so mager, dass sich unterhalb der Wangenknochen schattenhafte Vertiefungen abzeichneten.
Nachdem sie ein wenig Schnee mit dem Fuß beiseitegeschoben hatte, sah sie, dass er sich aus einem platt getretenen Pappkarton einen Sitzplatz gemacht hatte. Seine Daunenjacke und die Wollmütze waren von guter Qualität. Er hatte sich der Witterung entsprechend angezogen. Um nicht zu frieren, musste sie auf dem Bürgersteig hin und her laufen und sich immer wieder in die Hände hauchen. Mit jedem ihrer rasch aufeinanderfolgenden Atemzüge stieß sie kleine weiße Dampfwolken aus.
Ein Mann kam vorbei, seltsamerweise jedoch ohne von ihr oder dem Toten Notiz zu nehmen. Er trug Kopfhörer und diesen leeren Gesichtsausdruck geschäftiger Stadtmenschen auf dem Weg zu etwas Unaufschiebbarem vor sich her.
So ist das also, dachte sie, wenn ein Mensch auf offener Straße stirbt und niemand davon Notiz nimmt.
Richtig belebt war die Magstræde nie. Eher eine seltsame Wahl für jemanden, der in einer schneereichen Nacht auf die Mildtätigkeit von Passanten hofft. Vielleicht hatte ihn das in belebteren Straßen geltende Verbot, zu betteln oder ein Lager zu errichten, hierher verschlagen. Im Dunkeln und halb von abgestellten Fahrrädern verdeckt, hätte ihn die Polizei nur schwer entdecken können.
Sie ging in die Hocke, um sich den Toten genauer anzusehen. Zugleich versuchte sie herauszufinden, warum eine innere Stimme ihr sagte, dass etwas nicht stimmte. Etwas mit den leeren Händen. Hatte sie gestern Abend nicht ein Schild gesehen, als sie an ihm vorbeiging? Ein Stück Pappe oder so etwas, auf das er etwas gekritzelt hatte? Wie wäre sie sonst auf die Idee gekommen, dass er ein Bettler war? Natürlich hatte sie nicht genau hingesehen und gelesen, was darauf geschrieben stand, sondern gleich weggesehen wie die Pendler an diesem Morgen. Was stand darauf? Dass er Hunger hatte vielleicht? Das Schild war jedenfalls nicht mehr da. Außer der Pizza und dem Kaffee war nichts zu sehen. Keine persönlichen Gegenstände.
Sie sah auf die Uhr.
Ihr Vorsatz, heute schon früh ins Büro zu gehen, um an ihrer Story zu arbeiten, erwies sich gerade als ebenso fruchtlos wie die Versuche des toten Bettlers, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
In diesem Augenblick blieb ihr Blick an etwas auf dem Schoß des Toten hängen. Die Ecke eines Zettels spitzte aus dem Schnee hervor. Sie zog die Handschuhe wieder an und zupfte behutsam daran.
Handschriftlich stand darauf:
Fuglereden (Vogelnest), Rysensteensgade
Sie machte ein Foto von der Notiz, bevor sie sie wieder an ihren Platz legte. Dann gab sie die Adresse auf ihrem Handy ein. Sie gehörte zu einer Obdachlosenunterkunft. Der junge Mann hätte dort vielleicht ein Bett, warmes Essen und ein Dach über dem Kopf haben können. Stattdessen lag er hier vor ihr, starrte in den Himmel zu etwas empor, das außer ihm niemand sah.
»Warum bist du dort nicht hingegangen?«, fragte sie laut. Ihre Stimme klang hauchdünn in der eisigen Stille.
Das Heulen der ersten Sirenen näherte sich. Mit der behandschuhten Hand strich sie dem Toten den restlichen Schnee aus dem Gesicht und schloss ihm die Augen.
2
Und? Was hast du jetzt vor?«, wollte Jensen von Henrik wissen, als die Sanitäter hinter dem von der Gerichtsmedizin aufgebauten Sichtschutz wieder hervorkamen. Sie schoben den Toten auf einer Bahre in den Krankenwagen, wobei die Leute verstummten, die hinter dem Absperrband am Straßenrand neugierig die Hälse reckten. Seltsam, dass nicht einer von ihnen hier gewesen war, um dem Jungen zu helfen, als er noch lebte.
Der Innenraum von Henriks zivilem Dienstwagen verströmte den Duft seiner Lederjacke. Er ließ den Motor laufen, damit ihr wieder warm wurde. Ganz allmählich kehrte das Gefühl in Jensens Finger zurück. Beide sahen zur Windschutzscheibe hinaus, während er ihr mit der Hand über die Innenseite des Oberschenkels strich und ein elektrisierendes Kribbeln in ihr erzeugte.
Sie ließ ihn gewähren.
So wirkte er auf sie.
»Was soll ich deiner Meinung nach denn tun?«, brachte er mit heiserer Stimme hervor.
Sie war sich darüber im Klaren, dass es unweigerlich zur Katastrophe kommen würde, wenn sie sich zu ihm umdrehte und ihn ansah. Der kurze Blick, den sie erhascht hatte, als er zum ersten Mal auf der Bildfläche erschien und sich in der prahlerischen Pose eines Footballspielers in Szene setzte, hatte ihr gereicht. Er hatte sich in den letzten drei Jahren nicht verändert. Dieselbe schwarze Jeans, dasselbe weiße Hemd. Außer ein paar identischen Hemden und Jeans gab sein Kleiderschrank vermutlich nichts her. Die Ärmel wurden im Sommer hochgekrempelt, im Winter heruntergelassen.
Statt ihn anzusehen, konzentrierte sie sich auf einen gelben Spielzeugtraktor, der zu ihren Füßen lag. Henrik beugte sich vor, hob den Traktor auf und schleuderte ihn auf die Rückbank. Sein Gesicht war knallrot.
»Ich meinte, was machst du jetzt mit dem Jungen?«
Sie saßen einen Moment lang schweigend da, während der Krankenwagen langsam davonfuhr und die Menschenmenge sich aufzulösen begann.
»Ich habe dich vermisst«, sagte er schließlich, als, von ein paar uniformierten Polizisten abgesehen, alle gegangen waren.
Er fuhr ihren Oberschenkel weiter hinauf. »Warum hast du auf meine Nachrichten nicht geantwortet?«
»Henrik, du hast mich in einem Hotelzimmer zurückgelassen.«
»Ich musste nach Hause zu meinem Sohn. Komm schon, Jensen, du weißt, wie es läuft.«
»Du hast gesagt, du wärst in fünf Minuten zurück. Wolltest dir nur einen Kaffee holen. Drei Jahre ist das jetzt her.«
»Ich habe dich angerufen.«
»Ja, nach sechs Monaten. Und dann fragst du, warum ich nicht abgenommen habe?«
Sie schob seine Hand weg. Ihn anzusehen fiel ihr leichter, wenn sie sauer war.
»Verdammt noch mal, Henrik! Zwei Bettler ermordet. Innerhalb von zwei Wochen. Was gedenkst du zu tun?«
Er rieb sich den kahlen Kopf. »Möglich, dass die beiden Fälle gar nichts miteinander zu tun haben. Vielleicht ist es nur ein Zufall.«
»Und wenn nicht?«
Er nahm seine Hand von ihrem Oberschenkel und seufzte gedehnt. »Du hast gehört, was die Gerichtsmediziner gesagt haben. Wir müssen die Obduktion abwarten. Vorher können wir nur spekulieren.«
»Und damit gehst du einfach zur Tagesordnung über?«
»Nein, aber ich habe gelernt, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Und dir würde ich dasselbe empfehlen.«
»Er sah aber nicht aus wie ein Obdachloser oder ein typischer Bettler.«
»Ach ja? Wie sieht denn so jemand deiner Meinung nach aus?«
»Für jemanden, der auf der Straße lebt, waren seine Klamotten zu sauber, zu gut.«
»Warum übernimmst du nicht gleich meinen Job?«, schlug er ihr lachend vor, aber sie hatte die Spitze verstanden.
»Er war weder Alkoholiker noch irgendein Junkie«, setzte sie nach. »Er trug saubere Klamotten, hatte gesunde Zähne und eine gesunde Haut. Kein Körpergeruch, keine herumliegenden Flaschen.«
»Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir das Ergebnis der Obduktion abwarten müssen. Erst dann wissen wir, was ihm zugestoßen ist. Vielleicht war er in einen Streit verwickelt, der aus dem Ruder gelaufen ist.«
»Du weißt doch gar nichts über den Toten. Junger Mann, weiß, keine Papiere, kein Handy, keine persönlichen Gegenstände. Es könnte jeder sein.«
»Vermutlich aus Rumänien oder einem anderen osteuropäischen Land. Das Bettelverbot hat zwar schon einiges bewirkt, aber manche gehen trotzdem immer noch auf die Straße.«
»Er hatte die Adresse einer Obdachlosenunterkunft bei sich. Warum ist er nicht dorthin gegangen?«
»Vielleicht war er dort.«
»Wie?«
»Letzte Nacht wird eine Menge los gewesen sein. Vielleicht war alles belegt. Oder sie haben ihn aus einem anderen Grund nicht reingelassen.«
»Und der wäre?«
Er hob die Hände in gespielter Kapitulation. »Woher soll ich das wissen?«
»Also gut. Halten wir fest: Du hast keine Ahnung, wer er war und was passiert ist.«
Henrik antwortete nicht, und sie hatte nicht die Absicht, sich weitere banale Spekulationen anzuhören.
»Ruf mich an, wenn du etwas weißt.« Mit diesen Worten öffnete sie die Beifahrertür, stieg aus und schlug die Wagentür hinter sich zu.
Er kurbelte das Fenster herunter und bat sie eindringlich, zurückzukommen. Aber sie ignorierte ihn. Sie wollte so schnell wie möglich weg.
Er hatte einfach diese Wirkung auf sie.
Während sie zu ihrem Fahrrad ging, fuhr von hinten ein Lieferwagen, der in der schmalen Einbahnstraße nicht überholen konnte, an Henriks Auto heran. Der Fahrer beging den Fehler zu hupen. Henrik riss augenblicklich die Wagentür auf, marschierte wutentbrannt auf den Lieferwagen zu und hielt dem Fahrer die Polizeimarke vor das Gesicht, sodass der Mann auf der Stelle zurücksetzte und dorthin zurückfuhr, woher er gekommen war.
Jensen konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Henrik hatte sich wirklich kein bisschen verändert.
3
Aus dem Eckbüro der Chefredakteurin des Dagbladet heraus hatte der Rathausplatz etwas von einem abstrakten Gemälde mit von weißem Matsch überzogenen Bürgersteigen, gelben Bussen, roten Rücklichtern und Menschen, die sich beeilten, dem Schmuddelwetter zu entfliehen. Jensen beobachtete eine Gruppe von Fußgängern, die geduldig darauf wartete, dass die Ampel auf Grün wechselte, obwohl sie die Straße bequem auch zwischen den Autos hätte überqueren können. In London kannte man einen solchen Respekt vor den Regeln nicht, dieses Widerstreben, sich von der Masse abzuheben.
»Entschuldige bitte, ich bin spät dran«, begrüßte Margrethe sie, als sie mit einer Ledertasche um die Schulter und einem Kaffee zum Mitnehmen in der Hand in den Raum gestürmt kam.
Ächzend ließ sich die hochgewachsene, breitschultrige Frau in den Drehstuhl hinter ihrem Schreibtisch fallen. »Hatte noch einen Termin mit der Premierministerin«, fügte sie hinzu.
»Ach ja?«
»Aber bevor du fragst … reine Zeitverschwendung.« Sie setzte die beschlagene Brille ab und wischte sie an ihrem Pullover blank.
Dankbar für die Gelegenheit, das Gespräch, von dem sie wusste, dass es unausweichlich war, noch etwas hinauszögern zu können, wollte Jensen gerade etwas sagen, als Margrethe sie mit einer knappen Handbewegung unterbrach. »Spar es dir für gleich auf«, sagte sie, setzte ihre Brille wieder auf und griff nach dem Kaffee.
Jensen versank in ihrem Stuhl. Margrethe gehörte zu den wenigen Menschen, auf deren Meinung sie etwas gab. Damals, sie war gerade erst achtzehn und ohne Schulabschluss, hatte Margrethe sie aus der Lokalzeitung geholt und ihr einen Job beim Dagbladet gegeben. Zwei Jahre später hatte sie Jensen als Korrespondentin für die Zeitung nach London geschickt. Keine unumstrittene Entscheidung, aber Margrethe hatte sich durchgesetzt.
Seelenruhig kippte sie drei Tütchen Zucker in den Kaffee. An der Wand hinter ihr prangten die Fotos ihrer ausnahmslos männlichen Amtsvorgänger, die bis in die Anfänge des Dagbladet im 19. Jahrhundert zurückreichten. Verglichen mit Margrethe mit ihrem langen, grauen Haar, dem fleischigen Gesicht und dem durchdringenden Blick hinter dicken Brillengläsern, nahmen sie sich aus wie ein Haufen freundlicher Onkel.
»Jensen, ich werde aus dir nicht schlau«, sagte Margrethe, während sie mit einem Bleistift in ihrem Kaffee rührte.
»Ich habe für dich gekämpft. Ich wollte dich unbedingt behalten, als wir das Londoner Büro aufgelöst haben. Alle haben mir abgeraten. Sie halten dich für schwer verdaulich. Ich habe sie ignoriert, weil ich dich immer für eine großartige Journalistin gehalten habe. Einen alten Kollegen, der noch fünf Jahre bis zur Rente hatte, habe ich sogar entlassen, nur damit du hier wieder arbeiten kannst. Ich habe meine Hand über dich gehalten, dich vom Tagesgeschäft abgezogen, um dir Zeit für deine sogenannte Recherche zu geben. Und das ist jetzt der Lohn?«
Sie hielt inne, nippte an ihrem Becher, ohne Jensen aus den Augen zu lassen, die sich hütete, ihrer Chefin ins Wort zu fallen.
»Wie lange bist du schon wieder zurück? Drei Monate? Und wie viele Artikel hast du in der Zeit geschrieben?«
Jensen schob die Hände unter ihre Oberschenkel, schaute zum Fenster hinaus auf den Platz hinunter und sah zu, wie ein Mann, der sich zu dicht an die Bordsteinkante gewagt hatte, von einem vorbeifahrenden Taxi mit gräulich schwarzem Schneematsch bespritzt wurde.
»Ich weiß nicht genau. Zehn vielleicht?«, versuchte sie es zögerlich.
»Vier.«
Margrethe kramte in einem Papierstapel auf ihrem Schreibtisch und zog schließlich einen dünnen Ordner heraus. »Mal sehen. Ach ja, deine Reportage über Dänemarks Randgemeinden.«
»Für die habe ich ewig gebraucht.«
»Die Geschichte ist ganz großer Mist. Vollkommen ohne Seele«, sagte Margrethe und schleuderte die Mappe zur Seite.
»Dann hier, dein Bericht über den tragischen Flugzeugabsturz in Schweden vor Weihnachten.«
»Die hat mir eine Menge positiver E-Mails eingebracht.«
»Schwachsinn. Selbst sechzehnjährige Praktikantinnen haben mir schon Spannenderes geliefert. Möchtest du über die anderen beiden auch noch sprechen?«
»Nein«, sagte Jensen.
»Gut, dann raus mit der Sprache. Was ist los?«
»Ich brauche noch Zeit, um mich einzuleben.«
Margrethe gab vor, einen Computerausdruck auf dem Schreibtisch zu prüfen. »Du hattest drei Monate Zeit. Und während du es dir gemütlich gemacht hast, haben wir, lass mich sehen, 2870 Abonnenten verloren. Wenn wir noch mehr Personal abbauen, können wir das Licht gleich ganz ausmachen.«
Jensen nickte. Sie kannte die Zahlen. Allen verzweifelten Versuchen zum Trotz, die Zeitung auf digital umzustellen, lag das mittlerweile 120 Jahre alte Blatt im Sterben. Von ein paar überforderten Korrektoren abgesehen, waren die freien Mitarbeiter gegangen, sodass den Ressortredakteuren nichts anderes übrig blieb, als ihre Seiten selbst zu layouten. Den wenigen verbliebenen, ausgelaugten Journalisten blieb kaum Zeit für mehr, als einer Reihe sogenannter Experten das Mikrofon vor die Nase zu halten, geschweige denn sich auf die Suche nach Storys zu machen. Bei der Lektüre des Dagbladet konnte man nicht mehr darauf bauen, das zu erfahren, was sich, geordnet nach Wichtigkeit, in den letzten vierundzwanzig Stunden in der Welt ereignet hatte. Die Zeitung war zu einem personalisierten »Erlebnis« mutiert, mit Geschichten, die in regelmäßigen Abständen über den Tag verteilt online gestellt wurden, Clickbait voran. Onlineleser hatten sie viele, aber eine ganze Handvoll musste auf den Clickbait klicken, um an Ertrag das reinzuholen, was ein einziger Zeitungsabonnent brachte. Das traditionelle Geschäftsmodell war unwiderruflich zerstört, und das Dagbladet hatte noch kein neues gefunden, das funktionierte.
»Gib mir eine Chance …«
»Das habe ich«, blaffte Margrethe. »Glaub mir, jemand anderen hätte ich schon vor Monaten vor die Tür gesetzt.«
Jensen ließ den Kopf hängen.
»Also, was auch immer mit dir los ist, bring es in Ordnung.«
»Ja.«
»Und jetzt geh«, sagte Margrethe. »Ich habe zu tun. Es hat wieder einen Mord gegeben. Twitter ist voll davon.«
Das Spiel der Glocken im Rathausturm zeigte in der gewohnten Klangfolge zwölf Uhr mittags an. Jensen fühlte sich an die Mittagsnachrichten im Radio erinnert, die sie in der Küche ihrer verstorbenen Großmutter immer gehört hatte. Genau das war das Problem. Die Glocken, die Magstræde, der Rathausplatz, das Dagbladet: Auf den ersten Blick war alles so wie immer, aber Kopenhagen hatte sich verändert, während sie fort gewesen war. Sie fühlte sich wie eine Fremde in der eigenen Stadt. Aber das würde sie Margrethe niemals erklären können. Für derlei Sentimentalitäten fehlte ihrer Vorgesetzten gänzlich der Sinn.
Margrethe interessierte nur eins: eine gute Story.
»Immer noch da?« Sie starrte Jensen gereizt an.
»Einen Moment noch. Es gibt da noch etwas.« Jensen hatte einen raschen Entschluss gefasst.
»Hoffentlich nicht noch eine Hiobsbotschaft.«
»Der Typ, heute Morgen in der Magstræde. Ich habe ihn gefunden.«
»Du hast was?«
Sie berichtete Margrethe, was sich zugetragen hatte, ohne Henrik zu erwähnen. Margrethes Gesichtszüge entspannten sich, bis sie sich schließlich auf die Ellbogen stützte und den Kaffee neben sich kalt werden ließ.
»Das ist ja eine Superstory«, entfuhr es ihr. »›Zweiter Obdachloser tot auf Kopenhagener Straße gefunden. Leiche von Reporterin des Dagbladet entdeckt.‹«
»Möglich. Ich will nur …«
Margrethes Stimme wurde härter. »Ich sagte, es ist eine Superstory. Diese Witzregierung ist endgültig zu weit gegangen. Jetzt werden Bettler schon auf offener Straße umgebracht. Diese grausame, herzlose, ruinöse Politik ist eine Schande für das ganze Land. Das hat Dänemark nicht verdient.«
Mit einer unmissverständlichen Handbewegung signalisierte sie Jensen, dass die Unterhaltung beendet war. »Schreib eine Reportage. Einen Augenzeugenbericht mit allem Drum und Dran. Und die Parlamentsreporter sollen die Regierung um Stellungnahme bitten. Das Thema ist gesellschaftlich hochbrisant. Die Opposition wird sich die Hände reiben.«
»Aber wir wissen doch noch gar nicht, ob …«
»Tu es einfach, Jensen!«
Margrethe hatte sich bereits wieder ihrem Schreibtisch zugewandt. Das Telefon unter das Kinn geklemmt, tippte sie eine Nummer in das Tastenfeld. Das Gespräch war beendet. Jensen ging zur Tür und bereute bereits, den Bettler gefunden zu haben. Aber was blieb ihr übrig?
»Einen Moment noch«, rief Margrethe ihr nach. »Du hast nicht zufällig die Geistesgegenwart besessen und ein paar Fotos gemacht, bevor die Polizei kam?«
Jensen drehte ihr weiter den Rücken zu und umschloss das Handy in ihrer Faust, als wollte sie die Fotos umklammern, die sie von dem Toten gemacht hatte.
»Tut mir leid«, sagte sie und kniff die Augen fest zusammen. »Es muss der Schock gewesen sein, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen.«
4
Fabelhaft. Einfach fabelhaft.«
Polizeioberrat Mogens Hansen, liebevoll, wenn auch zu seinem Verdruss, von allen nur »Monsen« genannt, bugsierte seinen massigen Körper um den Schreibtisch herum. Dem Keuchen entnahm Henrik, dass es sich um seine erste körperliche Betätigung seit längerer Zeit handeln musste.
Es verblüffte ihn immer wieder, mit wie wenig Arbeit der Leiter der Ermittlungsabteilung den Tag zu verbringen vermochte. Der Schreibtisch, an dem er zwischen zwei Fenstern saß, die ihn von hinten beleuchteten und für Besucher imposant in Szene setzten, war stets frei von Papierkram. Henrik konnte sich auch nicht erinnern, den Computer jemals eingeschaltet gesehen zu haben.
An der Wand zwischen den beiden Fenstern hing ein Porträt von Königin Margrethe II. Henrik kannte es noch aus Mogens’ Büro auf dem Polizeirevier, bevor sie alle in das moderne Gebäude auf dem Teglholmen umgesiedelt worden waren. Wie sein Besitzer hatte auch das Bild in seine frühere Umgebung besser gepasst.
Henrik widerstand der Verlockung, über die Rücksichtslosigkeit des Magstræde-Mörders zu sticheln, ausgerechnet in dem Moment zuzuschlagen, in dem die Regierung ihrer Dienststelle besondere Aufmerksamkeit zukommen ließ. Es war Monsens Lieblingsthema, und wenn Henrik jetzt damit anfing, wären sie noch stundenlang hier.
Monsen umrundete weiter den Schreibtisch. »Zwei Messerattacken in zehn Tagen, Obdachlose, nicht weit voneinander entfernt? Da kann man wohl kaum von Zufall sprechen.«
»Möglich. Wir wissen es nicht.«
»Ist bekannt, wer das erste Opfer war?«
»Noch nicht.«
»Und dieses neue?«
»Auch nicht. Bisher gehen wir davon aus, dass es sich um Osteuropäer handelt. Rumänen vielleicht.«
Unvermittelt unterbrach Monsen seine Schreibtischrunde, ließ sich in seinen Schreibtischsessel fallen und verzog das Gesicht zu Munchs Der Schrei.
»Finden Sie heraus, wer es getan hat, und machen Sie dem ein Ende. Es muss sich doch zumindest feststellen lassen, ob diese Morde von ein und derselben Person begangen wurden?«
»Nicht, solange wir keine Obduktionsergebnisse haben.«
»Soll das heißen, dass wir gar nichts haben?«
Henrik hob die Hände. »Wir tun, was wir können.« Er wollte aufstehen. »Apropos, eigentlich sollte ich …«
Henrik nahm den Geruch von Monsens Aftershave wahr, den Schweiß in den Achselhöhlen, der dabei war, eine dumpfe Note anzunehmen. Die Verzweiflung im Gesicht des Mannes ließ ihn innehalten.
»Das reicht nicht. Ich hatte gerade die Polizeichefin am Telefon. Sie sagt, dass die Ministerpräsidentin innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden Fortschritte sehen will oder sonst persönlich vorbeikommt, um mir den Arsch aufzureißen.«
Henrik musste sich bei der Vorstellung, dass die zierliche Person seinem Schrank von Chef den Marsch blasen würde, ein Grinsen verkneifen, auch wenn Monsens Sorge nicht ganz unbegründet war. Die Polizeichefin gehörte zur alten Garde des Apparats, deren Zeit in den Augen der Premierministerin abgelaufen war. Sie stand im Feuer. Ein falscher Schritt, und Monsens Tage wären gezählt.
Henrik jedenfalls würde es sehr bedauern, wenn das passierte. Mochte Monsens Nase auch der Vorstellung der Premierministerin von stringenter Führung nicht entsprechen, gehörte er dennoch zur alten Schule pflichtbewusster Polizisten, die keinen Sinn für jene Gefühlsduseleien hatte, die Henrik zum Fluch geworden waren. Zudem hegte Monsen, auch wenn er es nie zugeben würde, tief in seinem Inneren eine gewisse Zuneigung zu Henrik und zog ihn Henriks unmittelbarem Chef, Polizeirat Jens Wiese, vor, der, darin waren beide sich einig, nichts als ein muffiger Bürohengst war.
Monsen war fast eine ganze Generation älter als er, aber Henrik wusste, dass sie aus demselben Holz geschnitzt waren. Jungs aus der Arbeiterklasse, die sehr leicht auch auf die falsche Seite des Gesetzes hätten geraten können. Gesprochen hatten sie darüber nie (Monsen gehörte nicht zu der Sorte Männer, mit denen man gern in Erinnerungen schwelgte), aber er war überzeugt, dass es für beide beim Eintritt in die Polizei eher um die Verlockung des persönlichen Abenteuers gegangen war, um Räuber und Gendarm, als darum, die Welt zu retten. Niemand konnte das, auch nicht die Premierministerin mit all ihrem scheinheiligen Getöse. Die Welt war nicht zu retten, sie war über und über voll von bösartigen Menschen, die nur von Lust und Gier getrieben wurden. Henrik und Monsen wussten das besser als jeder andere. Alles, worauf man noch hoffen konnte, war, das Böse einzugrenzen, und in diesen Zeiten vielleicht nicht einmal das. Wenn man genau hinsah, gewann das Verbrechen die Oberhand.
Mit einem Mal fiel Henrik auf, wie stark der Polizeioberrat gealtert war. Er erkannte Anzeichen von Schwäche, und das gefiel ihm nicht. Es erinnerte ihn an seinen Vater, dem die Millionen Enttäuschungen des Lebens alle Energie regelrecht herausgesaugt hatten. Monsens stärkste (wenn nicht sogar einzige) Charaktereigenschaft war immer sein unerschütterliches Selbstvertrauen gewesen. Außerdem, wenn er ein Auslaufmodell war, was bedeutete das für Henrik?
»Schon gut«, sagte er. »Mach dir keine Sorgen. Unsere besten Leute sind dran. Habe ich dich jemals im Stich gelassen?«
Monsen beäugte ihn einen Moment lang prüfend, als zählte er im Geiste die Tausende Male, die Henrik die Grenze überschritten hatte. Aber sie wussten beide, dass er recht hatte. Im Großen und Ganzen, und nur das zählte, hatte er es immer hinbekommen.
Mit einer theatralischen Geste sah Monsen auf die Uhr. »Spätestens bis Mitternacht hast du mich angerufen. Mit guten Nachrichten. Verstanden?«
»Ja, Monsen, ist klar.«
»Und jetzt zurück an die Arbeit.«
Erleichtert steuerte Henrik auf die Tür zu.
»Noch etwas, Jungersen.«
»Ja?«
»Nennst du mich noch einmal Monsen, dann bist du es, dem der Arsch aufgerissen wird.«
5
Ruhe jetzt und hört bitte zu«, sagte Henrik und sah sich in seinem Ermittlerteam um. Lisbeth Quist und Mark Søndergreen, gestandene, solide Ermittler, beide mindestens zehn Jahre jünger als er, waren den ganzen Vormittag unterwegs gewesen und hatten sich noch in ihren Mänteln und mit Mehrweg-Kaffeebechern in der Hand am Tisch im Besprechungsraum niedergelassen. Den niedergeschlagenen Gesichtern war unschwer zu entnehmen, dass ihr Einsatz erfolglos gewesen war.
An der Tür drängten sich sechs uniformierte Polizisten, als erwarteten sie den Beginn einer Show. Er würde sie enttäuschen müssen.
»Eine Mitbürgerin (ha!) hat heute Morgen in der Magstræde die Leiche eines bisher nicht identifizierten Mannes entdeckt«, verkündete er und deutete auf die Tatortfotos, die an der Tafel hingen. »Vorläufig deutet alles darauf hin, dass der Tod bereits vier bis sechs Stunden zuvor eingetreten war. Als Todesursache ist mit ziemlicher Sicherheit von einem Messerstich auszugehen. Zeugen gibt es bisher keine.«
Er zeigte auf die Fotos in der zweiten Reihe, die wesentlich grauenvoller waren als die ersten.
»Ein Zusammenhang mit dem Mord vor zehn Tagen an einem anderen, ebenfalls bisher nicht identifizierten Mann in der Farvergade ist nicht auszuschließen. Beide Opfer waren vermutlich obdachlos, beide wurden ohne persönliche Gegenstände oder Ausweis aufgefunden und wiesen mehrere Stichwunden durch ein bislang noch nicht gefundenes Messer auf. Jedoch können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob die beiden Morde tatsächlich miteinander in Verbindung stehen. Beim ersten Opfer finden sich Hinweise auf eine deutlich brutalere Vorgehensweise als beim zweiten.«
Er machte eine Pause und überlegte. War das von Bedeutung? Eine Messerstecherei war eine Messerstecherei, und beide Verbrechen wiesen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf.
»Mark, gibt es neue Erkenntnisse zum ersten Opfer?«
»Nein. Immer noch keine Spur. Weder von persönlichen Gegenständen noch von der Tatwaffe. Wir suchen nach Zeugen, bisher aber ohne Ergebnis. Aufnahmen von Überwachungskameras gibt es leider auch nicht.«
»Das Gleiche in der Magstræde«, berichtete Lisbeth. »Mehrere Personen haben das Opfer gestern am Tag auf der Straße sitzen sehen. Von dem Mord aber hat niemand etwas mitbekommen. Es muss um die Zeit passiert sein, als der Schneesturm am heftigsten tobte.«
»Ausgezeichnet«, sagte Henrik. »Ich fasse zusammen: kein Ausweis, keine persönlichen Gegenstände. Beim zweiten Opfer keine bestätigte Todesursache. In beiden Fällen keine Mordwaffe, keine Zeugen und keine Videoüberwachung. Noch irgendwelche Fragen?«
Mark hob zögernd die Hand.
Henrik seufzte. »Ja bitte?«
»Könnte es sich um einen Serienmörder handeln? Jemand mit rechtsextremistischem Hintergrund vielleicht, der Ausländer attackiert, die im Freien übernachten?«
Henrik spürte die neugierigen Blicke der Polizisten auf sich ruhen.
»Hüten wir uns vor Spekulationen, solange wir keine Beweise haben.«
Für Spekulationen sorgte einstweilen die Presse. Allein was er bisher an Schlagzeilen gelesen hatte, würde schon reichen, um ein riesiges Fass aufzumachen.
»Eine einzige Spur gibt es. Beim zweiten Opfer wurde ein Zettel gefunden. Darauf stehen der Name und die Anschrift des Fuglereden, einer Obdachlosenunterkunft in der Rysensteensgade. Die übernehme ich. Lisbeth und Mark, ihr klappert die anderen Obdachlosenheime der Stadt ab. Sucht nach Personen, die unsere beiden Opfer gekannt oder die letzten Wochen mit ihnen zu tun gehabt haben könnten. Nehmt Dolmetscher mit, wenn es sein muss. Dann geht ihr noch mal in die Magstræde und klingelt an jeder Tür. Irgendjemand dort muss doch etwas gesehen oder gehört haben.«
Er wandte sich an die anderen Polizisten.
»Ihr sucht die Mordwaffe oder meinetwegen auch Waffen. Haltet Ausschau nach Brieftaschen, Rucksäcken oder anderen persönlichen Gegenständen, die in den letzten vierundzwanzig Stunden gefunden oder bei der Polizei abgegeben wurden. Ihr dreht jeden Stein um und kommt mir nicht mit leeren Händen zurück.«
Henrik sah zum Fenster hinaus und beobachtete zwei Polizistinnen, die vom Parkplatz aus über die Straße gingen. Er beneidete sie um ihre Zielstrebigkeit. Eine von ihnen, Henriette, hatte mal ein Auge auf ihn geworfen. Sie hatten eine Weile miteinander geflirtet, bis sie es ernst meinte und er sich aus dem Staub gemacht hatte. Seitdem behandelte sie ihn wie einen Aussätzigen, ein Verhalten, das auch seine Frau bis zur Perfektion beherrschte. Genauso wie Jensen.
Das Fehlen persönlicher Gegenstände bei den Opfern beunruhigte ihn. Selbst unterstellt, dass beide sowieso nichts besaßen, was zu stehlen sich gelohnt hätte (was sehr wahrscheinlich war), dann müssten doch wenigstens die leeren Rucksäcke oder Geldbörsen irgendwo in der Nähe auftauchen. Der einzige Grund, der ihm einfiel, warum jemand die Sachen mitgenommen haben könnte, war der, dass die Ermittlungen verzögert werden sollten. Oder dass es jemandem darum ging, die Identität der Opfer zu verbergen. Aber warum? Über kurz oder lang würde die Polizei ohnehin alle benötigten Informationen zusammenhaben.
Als er aufsah, strebten die Kollegen bereits, schwatzend und mit einem Auge auf ihre Handys schielend, aus dem Raum.
»Halt, eine Sache noch«, rief er ihnen hinterher. »Kein Wort über den Fall jenseits dieser vier Wände, verstanden? Partner und Ehegatten eingeschlossen.«
Natürlich war ihm klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis das passierte. Zwei Morde an Obdachlosen innerhalb von zehn Tagen. Das war zu verlockend. Informationen aus den Ermittlungen fänden alsbald häppchenweise ihren Weg in die Zeitungsspalten. Das Dagbladet würde mit seiner Berichterstattung als Erstes auf den Putz hauen, angeführt von der großartigen Margrethe Skov, die mit dem größten Vergnügen die Regierung dafür abkanzeln würde, dass sie Menschen auf der Straße sterben ließ. Er sah die Schlagzeile schon vor sich: »Schockierende Entdeckung durch Dagbladet-Reporterin«.
Zu Hause würde es schwierig werden, wenn seine Frau davon erfuhr. Seit sie Wind davon bekommen hatte, dass Jensen wieder in Dänemark war, herrschte höchste Alarmstufe. Dass sie nun auch noch mit einem Mordfall zu tun hatte, dessen Ermittlungen Henrik leitete, würde die Sache nicht einfacher machen.
»Verbrechen sind nicht mein Ding«, hatte Jensen immer gesagt. Inzwischen fragte er sich allerdings, was überhaupt ihr Ding war. Er offenbar nicht.
Trotzdem wurmte es ihn, dass er sie nicht aus dem Kopf bekam. Er holte sein Handy heraus und checkte die Nachrichten.
Nichts.
6
Die Fensterbank in der Dachgaube ihres Büros bot Jensen gerade genug Platz, um sich dort hinzuhocken. Dort saß sie, während sich die Abenddämmerung über die roten Ziegeldächer der Stadt legte und allmählich in jede Ecke des Raumes kroch. Der zinnfarbene Himmel hatte weitere Schneemassen im Gepäck.
Die meisten ihrer Kollegen arbeiteten unten im Großraumbüro. Feste Sitzplätze gab es dort nicht. Alle bewahrten ihre Laptops und sonstige Habe in winzigen Schließfächern auf. Sie war eine der wenigen Glücklichen mit einem eigenen Büro in der unrenovierten obersten Etage des Gebäudes. Noch ein Grund, weshalb ihre Kollegen nicht viel für sie übrighatten. Als hätte sie nicht schon genug damit zu tun, dass sie den Job eines anderen bekommen hatte und unter Margrethes Schutz stand (jedenfalls so lange, wie es eben dauerte). Wobei derjenige, der beschlossen hatte, ihr einen eigenen Raum zu geben, allen anderen vermutlich einen großen Gefallen getan hatte. Die fünfzehn Jahre, die sie in London auf sich gestellt gearbeitet hatte, waren ihrer Fähigkeit, sich mit anderen zu arrangieren, nicht gerade zuträglich gewesen.
Inzwischen war klar, dass die Rückkehr ein großer Fehler gewesen war. Margrethe hatte sie bei einem Essen und reichlich Wein in einem teuren Restaurant in Mayfair dazu überredet. Eine seltene Geste von Großzügigkeit, um den Schlag abzumildern, den es für sie bedeutet hatte, als sie erfuhr, dass ihre Stelle als Korrespondentin des Dagbladet in London gestrichen worden war.
»Was will eine ungelernte Pressetante aus Dänemark dort noch?«, hatte sie am Ende des Abends deutlich angetrunken gelallt.
Die Gäste an den Nachbartischen hatten zu ihnen herübergestarrt und sie vermutlich für Mutter und Tochter gehalten. Dabei musste man schon blind gewesen sein, um auf die Idee zu kommen, dass sie demselben Genpool entstammten. Margrethe hatte sich an diesem Abend außergewöhnlich freundlich und fürsorglich gegeben. Im Schein der Kerzen, deren Licht von den Spiegelflächen des Restaurants zurückgeworfen wurde, hatte sie ein Bild von neuen Chancen und wiederentdeckten Möglichkeiten gezeichnet, aber tatsächlich hatte Kopenhagen Jensen nur noch mehr Lust auf London gemacht. Hier fühlte sie sich wie eine Fremde. In London war jeder ein Fremder. Die Stadt war groß genug, um darin zu verschwinden und sich immer wieder neu zu erfinden.
Nachdem sie Margrethes Büro verlassen hatte, hatte sie einen wenig produktiven Nachmittag damit verbracht, im Internet zum Thema Obdachlosigkeit in Dänemark zu recherchieren. Die Zahl der Obdachlosen wurde für das vergangene Jahr auf etliche Hundert geschätzt, von denen ein großer Teil Ausländer waren. Henrik hatte recht gehabt: Der Mann hatte möglicherweise keinen Schlafplatz für die Nacht bekommen, weil man die Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften heruntergefahren hatte.
Sie sah auf ihr Handy. Keine Nachricht von Henrik. Vielleicht hatte er wirklich noch keine neuen Informationen. Vielleicht war er noch sauer wegen ihres Wortwechsels in der Magstræde. Aber nicht das hatte sie davon abgehalten, auch nur einen einzigen Satz ihres Artikels zu schreiben.
Nichts fühlte sich richtig an.
Sie sah sich die Fotos an, die sie von dem toten jungen Mann gemacht hatte. Nichts, was auf einen Kampf oder Todesqualen hindeutete. Der friedliche Ausdruck in seinem Gesicht stand in deutlichem Widerspruch zu den schweren körperlichen Verletzungen. Und sollte er wirklich von der Unterkunft abgewiesen worden sein, warum hatte er sich dann entschieden, in der Magstræde zu bleiben, mit dem Rücken an eine Tür gelehnt, wenn es in der Nähe doch andere Ecken und Winkel gab, die mehr Schutz und Privatsphäre geboten hätten? Wenn er bettelte und im Freien schlief, warum war er dann so gut gekleidet? Hatte er die Adresse der Unterkunft selbst auf den Zettel geschrieben, oder hatte sie ihm jemand gegeben? Und wie war es überhaupt möglich, dass jemand in den Straßen einer Großstadt erstochen und die Tat erst Stunden später bemerkt wurde?
Margrethe irrte sich: Es war keine großartige Geschichte.
Noch nicht.
Aber das würde sie ihrer Chefin nicht ins Gesicht sagen. Fünf Mal hatte Margrethe sie allein in der letzten Stunde wegen des Augenzeugenberichts angerufen. Aber Jensen hatte nicht den Mut aufgebracht, den Hörer abzunehmen.
Bei dem vertrauten Geräusch schlurfender Schritte, die sich ihrem Büro näherten, sah sie auf. Henning Würtzen war einer der ehemaligen Chefredakteure, die in Margrethes Büro an der Wand verewigt waren, obwohl man ihn auf dem Foto kaum erkannte. Einige der älteren Kollegen erinnerten sich noch, wie er Anfang der 2000er-Jahre in den Ruhestand ging, aber niemand konnte sagen, wann er zurückgekommen war. Eines Tages war er einfach wieder da. Verschrumpelt wie eine alte Schildkröte, im braunen Anzug, mit einer kalten Zigarre im Mund, geisterte er seitdem durch die Gänge des Verlags wie ein Gespenst aus vergangenen Zeiten. Inzwischen war er der Nachrufschreiber des Dagbladet. Niemand von Rang und Namen starb, ohne dass Henning darüber schrieb. Er hatte eine riesige Anzahl fertiger Nachrufe in seinem Fundus, darunter, so hieß es, auch den für sich selbst.
Jensen mochte Henning. Banales Geschwätz interessierte ihn nicht, sodass ihm die verhaltene Begeisterung der Kollegen auf ihre Rückkehr aus London als angestellte Reporterin entgangen war. Ohne anzuklopfen, betrat er ihr Büro, drückte auf den Lichtschalter, steuerte direkt auf den Pappkaffeebecher auf ihrem Schreibtisch zu und schüttelte ihn, um zu sehen, ob noch irgendetwas darin war.
»Margrethe sucht dich«, sagte er und führte den Pappbecher mit zittrigen Händen zum Mund.
»Der ist von gestern, Henning.«
Jensen verzog das Gesicht, während er den Becher umstandslos leerte.
»Ich soll dir ausrichten, dass jetzt Frank die Reportage schreibt und dass du nach Hause gehen und dir überlegen kannst, wovon du leben willst, wenn du hier nicht mehr arbeitest«, sagte er, während er mit seinen wässrigen Augen an ihr vorbeisah, als würde er ein Gedicht auswendig vortragen.
Frank Buhl. Kriminalschriftsteller in Holzschuhen. Er dürfte sich gefreut haben, eine so reizvolle Geschichte auf den Tisch zu bekommen, umso mehr, weil sie sich als unfähig erwiesen hatte, sie zu schreiben. Ginge es nach ihr, konnte Frank sie gerne haben.
»Das war’s?«, fragte sie mit spöttischer Stimme.
Henning füllte den Pappbecher auf und schlurfte, eine Hand zittrig zum Gruß erhoben, aus dem Büro.
Kaum war er verschwunden, vernahm Jensen das charakteristische Geräusch von Holzschuhen.
»Was willst du, Frank?«, empfing sie ihn, den Blick zum gegenüberliegenden Gebäude gerichtet, in dem eine Etage tiefer gerade ein Box-Kurs abgehalten wurde.
»Ich wollte dich bitten, mir zu erzählen, was du gesehen hast. Wenn du dir schon nicht die Mühe machst, die Geschichte selbst zu schreiben, dann gib mir wenigstens etwas, womit ich arbeiten kann.«
Notizblock und Stift griffbereit, sah er sie erwartungsvoll an.
»Ich habe einen toten Mann gesehen«, meinte sie.
»Großartig, danke, sonst noch was?«
Sie gab vor, gründlich nachzudenken.
»Schnee.«
»Blut?«
»Ja.«
»Irgendwelche Anzeichen von Gewalt oder eines Kampfes?«
»Abgesehen von dem Blut, eigentlich nicht«, sagte sie, wobei ihr wieder einfiel, wie seltsam es ihr vorgekommen war.
»Irgendwelche persönlichen Dinge oder Papiere?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nichts.«
»Und der Arzt, der zum Tatort kam. Was hat er festgestellt?«
»Tut mir leid. Ich fürchte, dazu darf ich mich nicht äußern.«
Das entsprach zumindest der Wahrheit. Henrik hatte sie zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn ihr nicht klar war, warum, denn der Arzt hatte ihnen nur das gesagt, was für sie beide ohnehin offensichtlich war.
Frank klappte sein Notizbuch zu. »Großartig. Du warst mir eine echte Hilfe. Ich danke dir vielmals. Wenn ich mich bei Gelegenheit revanchieren kann, lass es mich gerne wissen. Vielleicht …«
»Vielleicht was?«
»Vielleicht gibst du dich das nächste Mal etwas weniger zugeknöpft. Was ist los mit dir?«
Was war los mit ihr? Sie wusste es nicht.
Nachdem Frank kopfschüttelnd ihr Büro verlassen hatte, stieg sie von der Fensterbank, griff nach ihrem Mantel, löschte das Licht und verweilte noch einen Augenblick mit geschlossenen Augen in dem lichtlosen Raum.
Vor einem halben Jahrhundert noch hätten die Druckpressen im Erdgeschoss das ganze Gebäude zum Vibrieren gebracht. In den Gängen wäre das Klappern der Schreibmaschinen zu hören gewesen, und die Reporter wären durch die verrauchten Büros gehetzt, weil sie wussten, dass das, was sie taten, von Bedeutung war. Dass die Menschen im ganzen Land darauf warteten, am Morgen die Zeitung vor ihrer Haustür zu finden. Jetzt war der Ort tot, ein Mausoleum für die vierte Gewalt.
Eigentlich hätte sie nicht überrascht sein dürfen. Der Niedergang der Printmedien hatte sich schon über Jahre hinweg abgezeichnet, bevor sie überhaupt in Erwägung gezogen hatte, Journalistin zu werden. In der Zeit, in der sie aus ihrer Londoner Wohnung heraus gearbeitet hatte, war ihr die Dynamik der Entwicklung verborgen geblieben. Hier, im Zentrum einer einstmals bedeutenden Institution, konnte sie sich den Tatsachen nicht länger entziehen.
Ihr Handy klingelte. Sie kramte es aus der Tasche und las, bereits im Mantel, im Dunkeln Henriks Nachricht, das Gesicht in den bläulichen Schein des Displays getaucht.
Ich muss dich sehen.
7
Der Mief in der Wohnung versetzte ihr seelisch einen Tiefschlag: Schweiß und Ausdünstungen fremder Menschen, die über die Jahre in die Wände gekrochen waren, das Essen, das auf dem Gasherd in der Küchenzeile gekocht wurde, der Geruch von Schimmel, der ihr aus den Kanälen tief unter dem Haus entgegenstieg. All das schlug ihr entgegen, kaum dass sie die Eingangstür geöffnet hatte, verstärkt noch durch den Anblick der Kartons, die sich auf dem Boden stapelten. Seit drei Monaten hatte sie es nicht geschafft, sie auszupacken, geschweige denn der Wohnung ihren persönlichen Stempel aufzudrücken.
Markus hatte alles im Stil eines isländischen Bauernhauses eingerichtet, mit Holzmöbeln, Kerzen und Schafsfellen. Alles hoffnungslos unpraktisch. Die Schafsfelle rutschten ständig von den Stühlen, und der Tisch – eine Holzplatte auf Böcken – geriet schon bei der geringsten Last gefährlich ins Wanken. In einer Ecke, unter einer roten Lampe, standen die Bartagamen, die Markus seine »Mädchen« nannte. Seine Bedingung dafür, dass er Jensen die Wohnung überließ, während er mit seinem Freund die Welt bereiste, war, dass sie seine Mädchen mit Futter und Wasser versorgte.
Der größte Teil ihrer Bücher, die Möbel und ihre Klamotten befanden sich noch in einem Container im Südhafen von Kopenhagen. Das Inventar für ihr Zuhause, sobald sie eines gefunden hatte. Was schwierig war, wenn man nicht suchte.
Sie öffnete den Kühlschrank und fand einen halben Becher Vanille-Skyr und zwei Flaschen Carlsberg. Sie nahm den Skyr und machte den Kühlschrank wieder zu. Dann öffnete sie ihn wieder, stellte den Skyr zurück und nahm sich stattdessen eine Flasche Bier. Sie trank es im Dunkeln, auf dem Bett sitzend, während sie vom Fernseher des Nachbarn, dem Kindergetrappel in der Wohnung über ihr und einem ständig wiederkehrenden Niesen beschallt wurde. Gegenüber auf der anderen Straßenseite stand ein baugleiches Haus, in dem laut dröhnende Fernsehgeräte in dunklen Räumen zu sehen waren. Wenn sie still dasaß und den Atem anhielt, war es, als wäre sie gar nicht da.
Sie klappte ihren Laptop auf. Franks Artikel war schon online: »Zweiter Obdachloser tot in Kopenhagener Straße gefunden«.
»Oh, sehr kreativ, Frank«, murmelte sie und prostete mit ihrem Bier dem Bildschirm zu.
Ein durchaus solider Artikel, wie aus dem Lehrbuch. Er hatte ein paar »Experten« zur rückläufigen Zahl von Schlafplätzen in Kopenhagen befragt und wies im Zusammenhang mit dem umstrittenen Bettelverbot auf das offenkundige Problem hin. Sogar ein Foto von ihr hatte er hinzugefügt. Das alte Verbrecherfoto aus der Zeit, als sie anfing, aus London zu berichten. Damals hatte sie noch kurze Haare gehabt und ausgesehen wie ein trotziger Junge. Das Zitat, demzufolge sie über die Entdeckung der Leiche sehr bestürzt gewesen sei, war komplett erfunden (verständlich: An Franks Stelle hätte sie das wahrscheinlich auch getan). Ein Sprecher der Premierministerin brachte die Besorgnis der Regierung zum Ausdruck und sagte eine umfassende Untersuchung des Falls und eventueller Versäumnisse seitens der Sozialbehörden zu. Kurz vor einer Parlamentswahl zeigte man sich gern bereit, alles zu versprechen. Es gab Fotos von der Fundstelle in der Magstræde, wo Leute Blumen und Beileidsbekundungen hinterlassen hatten, vielleicht aus einem Schuldgefühl heraus, weil sie dem Mann nicht geholfen hatten, als er noch am Leben war.
Sie ließ sich zurück auf die Kunstfelldecke sinken und starrte an die Decke, in der ein Leck in der Wohnung darüber einen Wasserfleck im Putz hinterlassen hatte. Es war wie mit der Wahrheit: Irgendwann fand das Wasser immer seinen Weg.
Was war nur los mit ihr? Warum schrieb sie nicht einfach den Artikel und brachte es einfach hinter sich? Warum hielt sie sich für etwas Besseres als Frank oder Margrethe? Sie, die an einem Bettler auf der Straße vorbeigeradelt war und ihn zum Sterben in der Nacht dort hatte sitzen lassen.
Margrethe hätte den Leitartikel für die morgige Printausgabe bereits geschrieben. Eine der für sie typischen Attacken auf die Ministerpräsidentin und deren Angriffe auf den Sozialstaat. Auch wenn sie Oberbefehlshaberin einer zahlenmäßig schwindenden Truppe war, gab Margrethe nicht auf. Sie hing nicht in ihrer Wohnung herum und lamentierte über den Niedergang des Zeitungswesens.
Jensens Telefon leuchtete auf. Eine Reihe kleiner Herzchen. Das blau-weiße Messenger-Symbol und der Name Henrik Jungersen lösten in ihr unwillkürlich dieses vertraute Gefühl aus, dass etwas sie zu ihm hinzog.
Wenn ich wüsste, wo du wohnst, würde ich etwas Dummes tun.
Die Nachricht hat er wahrscheinlich gelöscht, sobald er sie abgeschickt hatte. In seinem Leben hatte sie nicht mehr Spuren hinterlassen als in Markus’ Wohnung. Sie sagte sich, dass sie ihren gesamten Nachrichtenverlauf nur deshalb gespeichert und ausgedruckt hatte, um für die Nachwelt festzuhalten, dass es die Beziehung gegeben hatte, dass sie echt gewesen war. Über Jahre hinweg, begleitet von monatelangen Pausen, war es die zäheste Beziehung der Welt gewesen.
»Ich vertraue dir blind«, hatte Henrik einmal zu ihr gesagt. Lange hatte sie geglaubt, er verließe sich darauf, dass sie ihm gehörte. Jetzt wusste sie, dass er ihr damit das Geheimnis ihrer Beziehung anvertraut hatte.
Ihr altes Versteckspiel wieder aufzunehmen, dazu war sie noch nicht bereit.
Noch nicht, vielleicht aber auch nie mehr.
8
Als Erstes«, fing Margrethe an und brachte den Raum mit ihrem Reptilienblick augenblicklich zum Schweigen, »ein dickes Lob an Frank für die Arbeit, die er im Magstræde-Fall geleistet hat. Solider Journalismus, alte Schule. Wir sind wieder ganz vorn mit der besten Berichterstattung von allen Tageszeitungen.«
Unter dem zustimmenden Gemurmel der Anwesenden begann sie mit einer umfassenden Analyse der heutigen Ausgabe des Dagbladet, angefangen beim Leitartikel mit der am wenigsten überraschenden Schlagzeile des Jahrhunderts bis hin zum eigentlichen Bericht im Innenteil über die immer schlechter werdende Versorgung der Schwächsten in der Gesellschaft.
Jensen beäugte Margrethes Publikum, das sich um den ovalen weißen Konferenztisch versammelt hatte. Vor ihr saßen diejenigen, die das Glück gehabt hatten, die letzte Runde im Stellenabbau zu überleben. Dank der dänischen Journalistengewerkschaft wurden sie immer noch anständig bezahlt und hatten gute Aussichten auf eine ausreichende Altersversorgung, wobei nicht einmal die Gewerkschaft die digitale Flut hatte aufhalten können, die die angesehensten Zeitungen des Landes mit sich riss.
Irgendjemand hatte Geburtstag. Frische Brötchen aus einer Nobel-Bäckerei und Thermoskannen mit duftendem Kaffee standen auf dem Tisch. Henning bediente sich, aß und trank mit Hingabe, ohne sich anmerken zu lassen, ob er Margrethe überhaupt zuhörte. Aber Jensen wusste, dass ihm selten etwas entging. Sie fragte sich, was er zu Hause wohl kochte und wo er überhaupt wohnte. Auch ob es eine Frau Würtzen gab, wusste sie nicht. Sich Henning zu Hause auszumalen, ohne den beigefarbenen Anzug, mit etwas Alltäglichem beschäftigt wie Zähneputzen oder ein Spiegelei braten, war schwieriger, als ihn sich schlafend auf der Liege in seinem Büro im Obergeschoss vorzustellen. Tatsächlich hatte sie noch nie gesehen, dass er dort übernachtete, allerdings auch nicht, dass er das Gebäude verließ.
Frank kostete Margrethes Komplimente mit einem breiten Grinsen im Gesicht aus. Selbst Jensen musste zugeben, dass er mit dem, was ihm zur Verfügung stand, nämlich annähernd nichts, einen guten Job gemacht hatte.
Lise Dissing, die Kulturredakteurin, eine Frau mit rotblondem, zu einem strammen Knoten zusammengebundenen Haar und winzigen kupferfarbenen Sommersprossen im Gesicht, reichte Frank die Hand und klopfte ihm, erkennbar zu dessen Vergnügen, auf die Schulter. Jensen hätte wetten wollen, dass sie das nicht getan hätte, wenn nicht Margrethe am Kopfende des Tisches gesessen hätte. Jeder wollte mit Margrethe befreundet sein.
Sie dachte gern an ihre Zeit in London zurück, wenn sie sich in die Meetings einwählte, während sie auf dem Bett lag, die Nachrichten des Tages durchsah und die Meldungen auswählte, die sie vorschlagen wollte. Hier mit all den anderen an einem Tisch zu sitzen, bereitete ihr Unbehagen, zumal ihr nur zu bewusst war, dass sie selbst (mal wieder) nichts in der heutigen Ausgabe hatte. Mit der Aussicht darauf, dass sich ihr Freilos schon bald als Niete entpuppen dürfte, schnappte sie sich ein Brötchen und begann, es dick mit Butter zu bestreichen. Nicht dass sie hungrig gewesen wäre. Um nicht aufzufallen, tat sie das, was alle anderen auch taten. Der Kaffee schmeckte bitter, doch die älteren Journalisten kippten ihn hinunter wie Wasser.
Zum Glück lenkte Margrethe die Besprechung auf die für den kommenden Tag anstehenden Themen. Sie rieb sich die Hände, als das Team vom Politikressort, das per Videokonferenz aus Schloss Christiansborg zugeschaltet war, die Interviews abspulte, die es vorbereitet hatte.
Für den Sonntag kündigte Frank eine Reportage über gefährdete junge Einwanderer aus Osteuropa an.
»Immer noch nichts Neues zur Identität der beiden Opfer?«, erkundigte sich Margrethe.
Frank schüttelte den Kopf. »Niemand weiß, wer sie sind. Auch Interpol konnte nicht weiterhelfen. Keine Übereinstimmung mit Vermisstenmeldungen.«