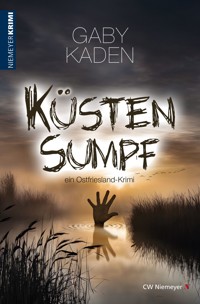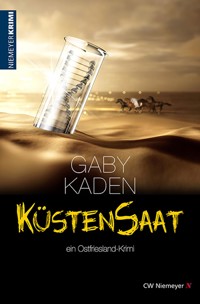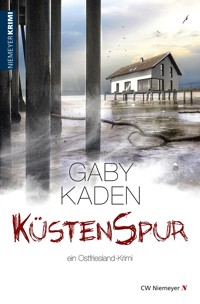9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Containerschiff treibt in pechschwarzer Nacht manövrierunfähig in der Nordsee. Meterhohe Wellen lassen seine Ladung über Bord gehen. Tausende Päckchen mit weißem Pulver werden an Land gespült. Mehl ist es nicht. Drogenmafia und Trittbrettfahrer liefern sich einen tödlichen Wettlauf um das weiße Gift. Welche Rolle spielt der verschwundene Ole, dessen Lieblingsschuhe in einem Müllcontainer gefunden werden? Wer bedroht seine Frau Fenja? Warum mutiert ihre verwöhnte Katze "Fee" plötzlich zur unnahbaren Wildkatze? Kam sie etwa mit den Drogen in Berührung? Während Recherchearbeiten verschwindet Kommissarin Miri Blum und die unberechenbare Katze "Fee" bleibt für Täter und Ermittlerteam um Tomke Evers ein Rätsel. Aber auch Oma, Tant' Fienchen und deren Nachbarin Anne darf man nicht unterschätzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
„Wenn ich das überlebe, bringe ich dich um!“
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2025, 1. Auflage dotbooks GmbH, Max-Joseph-Straße 7, 80333 Mü[email protected]/dotbooks/CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Osterstraße 19, 31785 [email protected] Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von Adobe StockSatz: CW Niemeyer Buchverlage GmbHEpub Produktion durch CW Niemeyer BuchverlageeISBN 978-3-8271-8749-9
Gaby KadenSchneeweißeKüste
Ich widme dieses Buch meinen Fans, meinen Leserinnen und Lesern, meinen Freundinnen und Freunden, meinem Mann, meiner Familie.Euch!
Und ich sage Danke
Bevor es losgeht, sage ich wie immer Danke an:
Natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CW Niemeyer Buchverlage für mehr als 10 Jahre wunderbare Zusammenarbeit.
Anne Hallen, meiner Nachbarin, gilt ein besonderer Dank dafür, dass ich sie in diesem Buch so wahrhaftig und mit Echtnamen erwähnen durfte.
Danke an meine Mitleser, bevor das Manuskript an den Verlag geht:
Werner, meinen Mann, für kritische Einwände.
Michael Frenz, fürs „Probelesen“ und die kritischen Anmerkungen eines Fans.
Kerstin Kaiser, die seit Jahren meine Manuskripte korrigiert und konstruktive Kritik äußert.
Walter Quante durfte ich wieder fachlich nerven, danke dafür.
Und sonst?
DANKE an alle meine Leserinnen und Leser, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet.
Danke an alle Buchhandlungen und Verkaufsstellen meiner Bücher.
Danke an euch alle, die ihr es möglich gemacht habt, dass meine Nummer 12 „schlüpfen“ durfte.
Die Idee zu diesem Buch entstand aus tatsächlichen Geschehnissen an der Nordseeküste.
Hier die Schlagzeilen der Medien dazu:
Drogen an der Nordseeküste – woher kommen sie?Touristen finden Kokainpäckchen am Strand! Lösen kleine Fischerhäfen an der Nordsee Drogenumschlagplätze wie Rotterdam, Antwerpen und andere ab? Schmuggelroute führt jetzt über kleine Häfen an der NordseeküsteDrogenmafia übernimmt kleine Häfen!Fahnder von LKA und BKA ermitteln!Drop-Off-Pakete an Schiffen!Letzter Fund 175 kg im Wert von 12 Millionen Euro!Früher Treibholz – heute Drogen!Nordsee neuer Drogen-Hotspot!BKA warnt vor Kokain-SchwemmeWas ich daraus gemacht habe, lest ihr in diesem Buch, und denkt daran, was jetzt folgt, ist ein Kriminalroman, meiner Fantasie entsprungen – keine wahre Geschichte!
Auch bitte ich um Verständnis, dass, in kriminaltechnischer Hinsicht, trotz aller Recherchen, nicht alles immer eins zu eins stimmt. Dies ist schließlich ein Roman und kein Sachbuch für Kriminalbeamte!
PROLOG
In schwarzer Nacht
Die Nordsee tobte, Windstärken wie schon lange nicht da gewesen brachten mehrere Schiffe auf dem Weg nach Skandinavien, Hamburg und weitere deutsche Seehäfen in Seenot. Darunter auch ein Containerschiff aus Südamerika, das inzwischen seit mehr als vierundzwanzig Stunden manövrierunfähig von meterhohen Wellen hin- und hergeworfen wurde. Das Ruder war gebrochen, ein Teil der Container waren verrutscht, mehrere Container schon über Bord gegangen. Das Schiff hatte inzwischen Schlagseite.
Hilfsmaßnahmen in lange nicht mehr da gewesenem Ausmaß waren angelaufen, gestalteten sich aber schwierig. Zu hoch waren die Wellen, zu heftig der Sturm. Die Fracht an Bord des Containerschiffes war das eine, aber viel schlimmer waren Hunderttausende von Litern Öl im Bauch des Schiffes. Sie drohten die Küste zu verunreinigen. Das musste unbedingt verhindert werden. Die Küstenwache zu Wasser und zu Luft arbeitete unermüdlich daran, dieses und weitere Schiffe zu sichern.
*
Die Besatzung des Containerschiffes Recipiente Maritimo aus Kolumbien versuchte verzweifelt, die Fracht zu sichern, was auf dem unkontrolliert hin- und herschaukelnden Schiff fast unmöglich war. Nur einer war nicht dabei. José Caveliari, der Kapitän des riesigen Schiffes, hatte anderes zu tun. Er saß in seiner Kabine, krallte sich mit der linken Hand am Tisch fest, in der rechten hielt er krampfhaft sein Handy. Es war ihm schon mehrmals aus der Hand gefallen, wenn eine weitere schwere Welle das Schiff hoch und wieder in die Tiefe der See geworfen hatte. Das, was zu tun war, musste getan werden, auch wenn es ihn viel Geld kosten würde. Er musste die an der Außenwand seines Schiffes angebrachten Metallkoffer loswerden. Bei der anstehenden Rettungsaktion und dem anschließenden Schleppmanöver in einen der nächsten Häfen würden sie auffallen. Das durfte er nicht riskieren. Er als Kapitän würde dafür geradestehen müssen, auch wenn er sie dort nicht selbst angebracht hatte. Caveliari war nur Mittelsmann, allerdings ein gut bezahlter. Fluchend gab er den Code in die App seines Handys ein, der bewirkte, dass sich die Metallkisten von der Außenwand des Schiffes lösten.
„Verdammt, verdammt“, entfuhr es ihm, aber er hatte keine andere Möglichkeit. Jahrelange Haft, wenn auch in dem zivilen Deutschland, wollte er nicht riskieren. Gefängnis in Deutschland oder Kolumbien, das war ein riesiger Unterschied. Und trotzdem. Es musste sein. Auch wenn er dadurch sicher den Repressalien der Kolumbianer ausgesetzt sein würde. Aber darüber wollte er erst später nachdenken.
José erhob sich schwankend und begab sich auf den schwierigen Weg nach draußen.
An die Reling des Schiffes wollte er sich nicht wagen, aber wenigstens die Außentür öffnen, um das Signal abzusenden. Der metallene Bauch des Schiffes verhinderte oft die Weitergabe von Signalen und Verbindungen nach draußen. Das durfte er nicht riskieren. Der Mann ging vorbei am Maschinenraum und stieg die steile Treppe nach oben, um an Deck zu kommen. Oben angekommen, entriegelte er das schwere Schott, ein kaum zu schaffendes Unterfangen. Mit viel Mühe gelang es ihm. Draußen herrschte pechschwarze Nacht. Der Sturm, heftig und ohrenbetäubend, tobte unvermindert. Gischt flog ihm ins Gesicht, machte das Deck rutschig.
Keinen Schritt weiter, nahm er sich vor, denn der Sturm oder die nächste heftige Welle würde ihn sofort über Bord spülen. Er zog das Handy aus der Tasche, lehnte sich an das geöffnete Schott, als er hinter sich eine Stimme vernahm. Es war Santos, sein zweiter Mann. Allerdings war Santos nur hier an Bord der zweite Mann, in Sachen Drogenschmuggel aber einer der Hauptakteure. Das wusste Caveliari jedoch nicht, und das war gut so. Santos hatte den Auftrag, alles im Auge zu behalten. Den Kapitän und alle, die später an der Bergung der Drogen beteiligt waren.
Der brüllte: „Was machst du hier?“
„Ich löse die Metallkisten von der Außenwand, sonst gehe ich in den Knast“, schrie José Caveliari zurück.
„Bist du verrückt? Wir …“
„Nicht wir, ich!“, brüllte er gegen den Sturm an. „Ich stehe dafür gerade. Die Container sind mir egal, mit denen habe ich nichts zu tun, aber die Metallkisten müssen weg“, brüllte er gegen die nächste Welle an und hielt sein Handy hoch. „Wir können bei diesem Sturm keine Übergabe auf See machen.“
Santos schrie ihn an: „Gib mir das verdammte …“ Mehr verstand der Kapitän nicht. Der Sturm hatte die Worte verschluckt, eine weitere Welle klatschte ihm zuerst Gischt und dann weiteres Nordseewasser ins Gesicht. Santos versuchte, dem Mann das Handy zu entreißen. Sie kämpften, doch kurz bevor er es fassen konnte, löste Caveliari den Code aus. Dann bekam er einen heftigen Tritt gegen die Hüfte und rutschte über das Deck. Den Rest übernahm der Sturm, anschließend die Nordsee. Sie verschluckte ihn wie ein großes, schwarzes Ungeheuer. Auch das Handy flog durch die Luft. Santos sah ein blinkendes, rotes Signal. Es zeigte ihm, dass er zu spät gekommen war. Die Kisten mit der heißen Ware hatten sich von der Bordwand gelöst, waren verloren. Das war der Supergau.
Wochen später überschlugen sich die Medien:
Lösen kleine Fischerhäfen an der Nordsee Drogenumschlagplätze wie Rotterdam, Antwerpen und andere ab?
Fahnder von LKA und BKA ermitteln erfolglos!
Schnee an der Küste!
Touristen finden Kokainpäckchen am Strand!
Drogenmafia übernimmt kleine Häfen …
lauteten die Schlagzeilen.
Immer wieder wurden Pakete an den Stränden der Nordsee angeschwemmt. Am Festland wie auf den Inseln. Von Borkum über Spiekeroog bis in den Norden nach Amrum und Sylt.
Der Inhalt? Mehl war es nicht. Sondern Kokain, reinstes Kokain im Wert von mehreren Millionen Euro. Woher kamen diese Pakete? Wem gehörten sie? Und das war noch nicht alles. Große Mengen davon gelangten in die Netze der Fischer, mit denen die eigentlich ihren Fang an Bord zogen. In einem solchen Fischernetz wurde auch die Leiche eines Mannes gefunden.
Stammten die Pakete aus den bei Sturm über Bord gegangenen Containern? Und der Tote, fiel der Mann bei Sturm über Bord? Vielleicht von einem der Containerschiffe? Hatte er am Ende etwas mit den Drogen zu tun? Eine Vermisstenanzeige, einen Notruf „Mann über Bord“ hatte es nicht gegeben.
Und dann tauchten da weitere, andere weiße Päckchen auf.
Klar war, dass die Besitzer ihre wertvolle Ware zurückhaben wollten. Mit allen Mitteln. Und wie es schien, gingen sie dabei über Leichen. Aber auch Trittbrettfahrer waren an der wertvollen Fracht interessiert. Welche Rolle spielte dabei der verschwundene Ole? Und welche Rolle eine verwöhnte Katze namens Fee? In dem kleinen Fischerort Schlicksiel herrschte helle Aufregung, und nicht nur dort. Vor allem, als in Carolinensiel eine Leiche aus der Harle gefischt wurde. Zufall – oder gab es einen Zusammenhang mit den Drogenfunden? Die Geschehnisse breiteten sich entlang der kompletten Nordseeküste aus.
Schlaf gut, Ole!
Fenja sah es sofort und stöhnte genervt auf.
Das Haus war hell erleuchtet, durch die Fenster drang gelbes Licht nach draußen. Sogar in dem kleinen Dachbodenfenster konnte sie einen Lichtschein erkennen.
„Verdammt, das hat mir gerade noch gefehlt!“ Fenja schloss den Wagen ab und lief Richtung Haustüre. „Wenn Ole jetzt wieder das ganze Haus unter Staub und Dreck gesetzt hat“, überlegte sie, „bring ich ihn um.“
Sie hatte den ganzen Tag in ihrer Fischbude gestanden, die Wünsche einer großen Schar an Gästen erfüllt. Nicht alle waren freundlich, manche sogar unhöflich, und jetzt auch noch das.
Fenja liebte ihre Fischbude, liebte ihre Gäste, die fast alle freundlich und dankbar bei ihr kauften, ihre Ware lobten – aber eben nur fast alle. Eigentlich nahm sie den kurzen Weg zur Fischbude im Hafen von Schlicksiel, in der sie Fisch- und Krabbenbrötchen, Backfisch, Kibbelinge und Pommes anbot, immer zu Fuß, nur heute nicht. Denn bevor sie um zehn Uhr ihren Verkaufsstand an diesem sehr von Touristen besuchten Platz im Hafen geöffnet hatte, war sie noch in Oldenburg beim Großhändler gewesen, um Servietten, Teller und andere Dinge zu besorgen, die ihr ausgegangen waren. Ein langer Tag lag hinter der jungen Frau.
Außerdem hatte der Besitzer einer Fischbude in Wilhelmshaven heute sehr lange auf sich warten lassen, um seine Ware abzuholen. Einmal in der Woche lieferte Bengt, der Fahrer der Fischereigenossenschaft, eine zusätzliche Kiste bei ihr ab, die dann der Kollege aus Wilhelmshaven abholte. Warum nicht? Sie tat Bengt gerne den Gefallen, um den er sie vor ungefähr zwei Monaten gebeten hatte. So sparte er sich eine zusätzliche Fahrt nach Wilhelmshaven. Erst nachdem der nun seine Ware abgeholt hatte, konnte Fenja nach Hause gehen. Sie musste unbedingt mit Bengt sprechen. Oft durfte das nicht passieren, dass der Typ sie so lange warten ließ. Im Übrigen war der Mann ihr unsympathisch. Sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass ein so unfreundlicher Mensch Kundenkontakt halten und erfolgreich Fisch verkaufen konnte. Nun, das sollte sie nicht kümmern. Sie hatte andere Probleme, denn zu Hause würde heute sicher wieder das Chaos auf sie warten.
„Der sieht aus wie zehn Jahre Zuchthaus“, hatte sie einmal zu Ole, ihrem Mann, gesagt. „Dass dem überhaupt jemand Fisch abkauft, kann ich mir nicht vorstellen.“ Ole hatte nur etwas Unverständliches gemurmelt.
Müde schloss sie die Haustüre auf. Eigentlich wollte sie nur noch ihre Ruhe haben. Duschen, die Füße hochlegen und einen Film schauen, einfach abschalten. Jetzt aber war ihr klar, was sie erwartete, denn sie roch den Staub schon, den Ole heute wohl wieder durch Sägearbeiten verursacht hatte. Ihr Mann renovierte! Seit fast einem Jahr schon. Direkt nachdem seine Mutter verstorben war und sie das Haus übernommen hatten, renovierte er, riss Wände heraus, baute neue auf. Allerdings hinterließ er die Baumaßnahme im Haus plötzlich als unfertige Baustelle. Entsprechend sah es im Haus aus. In den letzten Wochen hatte er in der Wohnung selbst gar nichts mehr gemacht, sich stattdessen intensiv mit dem Dachboden befasst, sogar eine Matratze irgendwann nach oben geschafft. Warum?
Seit einem Jahr lebten sie in Dreck und Staub. Immer wieder hatte Fenja ihn aufgefordert, die Räume mit Folie abzukleben, damit nicht alles versaut werden würde. Immer wieder musste sie nach der Arbeit das ganze Haus von oben bis unten putzen.
Und wenn sie dann fertig war, lag er frisch geduscht auf der Couch und daddelte an seiner Spielekonsole herum oder schnarchte, was das Zeug hielt. Dazu kam, dass er zwischendurch tage-, manchmal wochenlang für Jüst, seinen Chef und die Fischereigenossenschaft auf See war, die Arbeit in dieser Zeit ruhte und sie auf einer Baustelle leben musste.
Zwischendurch war ihm sogar das Geld ausgegangen, und Ole hatte eine Pause eingelegt. Aber Baustelle hatten sie trotzdem. Dann war von irgendwoher ein warmer Geldregen gekommen – Ole hatte ihr nicht gesagt woher –, und seitdem werkelte er fast nur noch auf dem Dachboden. Fenja fragte sich warum? Da würde nie ein Wohnraum entstehen, dafür war die Schräge viel zu niedrig. Ole aber engagierte sich dort immens und machte ein Geheimnis daraus. Warum? Für wen? Dachschräge und Fußboden hatte er verkleidet, dafür gesägt, was das Zeug hielt, und das mitten im Flur. Dementsprechend sah die Wohnung immer aus. Er hatte sogar eine neue Bodentreppe eingebaut, was sie von Anfang an für unnötig gehalten hatte.
Ja, von dort oben zog es im Winter und bei Stürmen, die hier an der Küste oft herrschten, wie Hechtsuppe. Ihrer Meinung nach hätte es aber gereicht, die alte Bodenklappe zu isolieren. So oft betraten sie den Boden nicht, eigentlich nie.
„Der Dachboden geht dich nichts an, das ist mein Ding, ich will dich hier oben nicht sehen“, war letzte Woche seine unwirsche Reaktion gewesen, als sie ihn wieder einmal darauf angesprochen hatte.
„Keine Angst, ich klettere da niemals hoch“, hatte sie geantwortet. Nein, das war klar, sie würde diese komische Ziehharmonikatreppe niemals betreten. Sollte er doch dort oben glücklich werden. Aber warum machte er so ein Theater um den Raum? Fenja konnte es nicht nachvollziehen.
Die junge Frau hatte die Nase voll. Was sie wohl heute erwartete? Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, hörte sie Ole schon.
„Da bist du ja endlich. Komm rauf, du musst mir helfen“, kam es von oben.
„Lass mich doch erst einmal heimkommen. Was ist denn schon wieder?“
„Komm rauf, du musst mir helfen!“ Oles Stimme schwoll an.
„Wo bist du?“
„Auf dem Dachboden, verdammt!“
Der Dachboden, schon wieder. War ja klar.
Mit einem Seufzer warf sie ihre Tasche in die Ecke, strich Fee, ihrer Katze, kurz über den Kopf und ging mit schweren Schritten die Treppe nach oben. Handlauf wie Treppenstufen waren wieder einmal über und über von Sägestaub bedeckt. Sie stöhnte entnervt auf.
Im ersten Stock traf sie auf die heruntergelassene Bodentreppe, Ole saß oben im Loch, seine langen Beine baumelten nach unten.
„Schieb das Ding mal hoch und mach die Klappe zu!“, forderte er.
„Hallo? Wie wäre es mit: ‚Moin, wie geht es dir, mein Schatz? Wie war dein Tag?‘ Ich komme von der Arbeit und bin platt.“
„Mein Tag war auch scheiße, ich ackere hier schon den ganzen Tag an der blöden Treppe herum. Hättest ruhig früher kommen können“, kam es zurück. Ihren Einwand überging er.
„Und außerdem hast du schon wieder nichts abgehängt. Das ganze Haus stinkt nach Staub, und überall liegt Sägemehl. Mensch Ole, wie oft soll ich dir das noch sagen?“
„Ich habe die Decke neu verkleidet, muss ja nicht jeder sehen, dass es hier einen Weg nach oben gibt. Und es ist perfekt geworden.“ Er lachte hämisch. „Sieht kein Schwein, also reg dich ab.“
Sie schaute kopfschüttelnd zu ihm hoch und wollte wissen: „Und warum muss ich jetzt hier helfen? Warum hast du nicht deinen Bruder geholt? Außerdem, welches Ding meinst du?“
„Weil Nils keine Ahnung hat und alles besser weiß.“
„Klar, ist ja auch dein Bruder!“, konterte Fenja.
„Quatsch nich, schieb die Leiter zusammen und die Klappe dann hoch. Ich muss hier an den Federn etwas einstellen und das Kabel anschließen. Geht aber nur, wenn das verdammte Ding geschlossen ist.“
„Ich?“ Fenja wusste, dass das bei ihrer Körpergröße von einhundertfünfundfünfzig Zentimetern schwierig werden könnte. „Ich sollte dich da oben sitzen lassen für die nächsten Tage, dich hält doch kein Mensch aus. Ole, du nervst!“
Wieder überging er sie.
„Mach schon, schieb!“
Mühsam schob sie den unteren Teil der Bodentreppe in den oberen, bis er in der Halterung einrastete. Es war ein schwieriges Unterfangen bei ihrer Körpergröße. Weiter kam sie nicht, schon das konnte sie nur auf Zehenspitzen erledigen.
„Und jetzt?“
„Hochklappen!“
„Witzbold, da komm ich doch gar nicht dran!“
„Stell dich nicht an, das geht!“
„Da muss es doch so einen Stab geben, den man dafür nimmt, um von unten zu schieben.“
„Der steht in der Ecke!“
„Wo?“
„Na da, irgendwo!“ Er ließ seinen Fuß kreisen, zeigte mal nach rechts, mal nach links.
„Wo ist denn unsere Trittleiter? Vielleicht geht es damit. Ich steige hoch, gebe der Klappe einen Schubs, und sie geht zu.“
„Nee, du brauchst den Stab. Der muss in das Loch einrasten, und dann musst du den Stab im Loch drehen, sonst bleibt die Klappe nicht zu und ich kann nix machen. Später läuft das anders, aber jetzt … Mach schon. Stell dich nicht an und nimm den Stab. Der muss da irgendwo stehen.“
„Ole, ich lass dich wirklich gleich da oben sitzen. Noch ein Wort und …“
„Warte mal, bring mir erst ein Bier, sonst verdurste ich, bis du es auf die Reihe gebracht hast, den Stab zu finden.“
„Und wie soll das gewünschte Bier nach oben kommen?“
„Stuhl, raufsteigen, Flasche hochreichen. Nun stell dich nicht blöder, als du bist! Mach los, ich will hier oben nicht übernachten. Und außerdem habe ich Hunger. Wenn ich fertig bin, brauch’ ich was zum Beißen.“
„Weißt du was? Ich …“ Fenja brach ab. Es hatte ja keinen Sinn. Ole und sein verdammter Dachboden. Vielleicht sollte sie irgendwann doch einmal nach oben klettern. Irgendwann, wenn er mal wieder auf See war. Wer weiß, welches Geheimnis er dort vor ihr verbarg. Und welches Kabel musste er eigentlich an der blöden Treppe anbringen?
Sie drehte sich um und lief nach unten in die Küche. Auf der untersten Stufe sah sie den gesuchten Stab. Er lehnte am Treppengeländer.
„Da isser ja“, entfuhr es ihr und: „Ach Ole, du bist solch ein Idiot!“
Und heute auch noch kochen? Nein, wirklich nicht. Aber das wollte sie ihm jetzt noch nicht sagen, auf das Gemaule hatte sie keine Lust. Fee kam aus der Küche auf sie zugelaufen und maunzte. „Hast du Hunger, meine Schöne? Hat der böse Ole dir nichts gegeben? Na, komm her, du bist wichtiger als sein blödes Bier.“
Aus dem Vorratsschrank holte sie eine Dose Katzenfutter und eine Flasche stilles Mineralwasser. Fee hatte einen ganz besonderen Geschmack. Als das Tier versorgt war, griff sich Fenja eine Bierflasche aus dem Kühlschrank und suchte in der Schublade nach dem Flaschenöffner. Wo war der denn wieder? Sie wühlte sich durch Papiere, Klammern, Schnüre, Flaschenverschlüsse, Halstabletten und …
„Mein Gott“, entfuhr es ihr. Da kam eine angebrochene Packung der starken Schlaftabletten, die ihre Schwiegermutter aus dem Krankenhaus mitgebracht hatte, zum Vorschein. Fenja nahm sie hoch. Flunitrazepan, las sie. Schwiegermutter brauchte die Tabletten nicht mehr, die war vor gut einem Jahr hier im Haus verstorben. Keiner hatte bemerkt, dass dieses Medikament noch in der Schublade lag. Fenja schüttelte den Kopf. Sie öffnete die Tür unterm Waschbecken, um die Tabletten in den Mülleimer zu werfen, doch dann hielt sie inne. Die mussten doch sicher in den Sondermüll. Sie legte die Packung zur Seite, suchte weiter nach dem Flaschenöffner und … Ein kurzer, böser Gedanke blitzte in der jungen Frau auf. Sie betrachtete die Tablettenpackung nachdenklich. Wenn sie davon eine oder zwei … Nein! Oder? Fenja griff sich ans Ohrläppchen. Wenn sie davon ein paar in Oles Bier … Diese kleine Strafe hätte er verdient. Und außerdem, was konnte er schon gegen ein paar Stunden Schlaf haben? Wenigstens hätte sie heute Abend ihre Ruhe, und kochen müsste sie dann auch nichts mehr.
Der Gedanke gefiel ihr immer mehr. Sie öffnete die Schachtel und zog einen vollen Blister heraus. Sollte sie wirklich? Wo war nur der verdammte Flaschenöffner?
Kurze Zeit später reichte sie ihrem noch immer nörgelnden Mann die Flasche durch die Luke. Den Stab, um die Klappe hochzuschieben, hatte sie mitgebracht. Er deutete darauf.
„Na, sag ich doch. Musst halt die Augen aufmachen“, kam es von oben. Er stellte die Bierflasche neben sich ab und zog die langen Beine hoch.
„Nun mach die Klappe zu, ich will damit heute noch fertig werden. Ab morgen Nachmittag fahre ich raus. Der Kapitän hat eine Tour rüber Richtung Amrum angenommen, Jan und ich sind dabei. Wir sind ungefähr zehn Tage draußen.“
„Zehn Tage? Warum so lange, das geht doch nicht, dann bleibt hier wieder alles liegen. Und der Fisch, den ihr …“
„Die Fische bleiben frisch“, unterbrach er sie, „keine Sorge. Außerdem wird das mal wieder eine Sonderfahrt. Und der Beifang bringt gutes Geld. Aber mehr musst du nicht wissen.“ Ole lachte ein Lachen, das sie in der letzten Zeit öfters gehört hatte, wenn er von Sonderfahrten sprach. Kam davon der plötzliche Geldsegen? Ole hatte vor einigen Tagen ein neues Auto bestellt und sich saumäßig teure Sneakers gekauft.
„Was ist nun“, rief er von oben, „wird das heute noch was?“
Fenja stöhnte auf, schimpfte: „Du bist wieder einmal die Liebe in Person. Danke, herzlichen Dank.“
Sie griff sich die Stange, stieg auf den bereitgestellten Stuhl und hakte den Stab in der Öffnung der Klappe ein.
Ole bestimmte: „Wenn ich fertig bin, rufe ich. Geh nicht zu weit weg, hier oben ist es schweineheiß. Also, bleib in der Nähe.“
„Davon träumst du. Ich gehe jetzt unter die Dusche, meine Fischbude ablegen. Entweder du wartest bei offener oder bei geschlossener Klappe, bis ich fertig bin, das ist mir egal!“ Fenja war sauer.
Ole murrte nur. „Aber beeile dich. Ich brauch höchstens ’ne halbe Stunde hier oben, dann will ich auch unter die Dusche. Hab’ später noch was vor.“
Fenja verstand das nicht. Warum machte er solch ein Geheimnis aus dem ollen Dachboden?
„Hast du ’ne Ahnung“, grinste sie dann in sich hinein.
Sie hörte ihn noch murmeln: „Wenn ich fertig bin, geht das Ding elektrisch …“ Mehr verstand sie nicht. „Ole“, flüsterte sie, „du leidest unter Paranoia“, und verschwand im Bad. Unter der Dusche erinnerte sie sich daran, dass Ole von: „Ich hab’ noch was vor!“, gesprochen hatte. Was hatte er vor? Ohne sie? Und dann sollte sie auch noch kochen? Nein, wirklich nicht.
Ihr Mann hatte sich in den letzten Wochen sehr stark verändert. Er war so unausstehlich, so gemein geworden. Ausgehen wollte er mit ihr auch nicht mehr. Manchmal hatte sie das Gefühl, er leide unter Verfolgungswahn. Andererseits war er abends oft bis spät in die Nacht unterwegs, alleine, ohne sie und machte ein Geheimnis daraus. Ob er wohl irgendwo etwas laufen hatte? Nun sollte auch noch der Dachboden zu einem Geheimnis werden. Das war die eine, neue Seite von Ole, aber es gab noch eine andere.
Jeden Abend kontrollierte er plötzlich, ob Vorder- und Hintertür gut verschlossen waren. Und immer öfter sprach er über Sicherheitsschlösser. Fenja konnte das und vieles andere nicht nachvollziehen. Wer sollte bei ihnen einbrechen? Hier gab es nichts zu holen. Was war nur mit Ole geschehen? Fenja dachte ernsthaft darüber nach, ob sie wirklich weiterhin so mit ihm leben wollte. Aber sich zu trennen, das war nicht ganz so einfach. Seine Mutter hatte ihm ein dickes Ei ins Nest gelegt. Ein Ei, von dem sie selbst profitierte und das ihr ein schlechtes Gewissen bereitete. Aber wenn sie darüber nachdachte …
Drei Stunden später lauschte sie nach oben. Von Ole war nichts zu hören. Gemeldet hatte er sich auch nicht. Er schlief wohl noch immer. Fenja stand auf, schaltete den Fernseher aus. Die Klappe zum Dachboden war zu. Tatsächlich konnte man nur, wenn man es wusste, sehen, dass es hier einen Weg nach oben gab. Sie hakte den Stab ein, entriegelte das Schloss und zog etwas an der Klappe. Ob sie wohl nachschauen sollte? Nein, sie hatte keine Lust auf die steilen Stiegen! Und außerdem wollte sie ihn nicht wecken. Und am Ende stürzte er noch im Halbschlaf durch das Loch der Bodentreppe, wenn sie ihn jetzt weckte. Wie sie ihren Mann kannte, würde er sich lautstark bemerkbar machen, nachdem er aufgewacht war. Nein, besser nicht wecken. Er sollte sich ausschlafen. Außerdem konnte er mit seinen fast zwei Metern Körperlänge den Dachboden auch ohne Treppe verlassen.
Sie brachte ihr Weinglas in die Küche, spülte es kurz aus. Auf der Fensterbank lag die Schachtel von Schwiegermutters Schlaftabletten. Der Blister daneben. Es fehlten zwei Stück. Fenja fragte sich, ob eine Tablette nicht doch ausreichend gewesen wäre. Etwas in ihr rebellierte. War das ihr schlechtes Gewissen? Ach was. Ole war ein Kraftpaket, ihm würden zwei Schlaftabletten nicht schaden, ihn nur ein wenig ausknocken, mehr nicht.
Auf dem Weg ins Schlafzimmer blickte sie nochmals zur Dachbodenluke, hielt kurz inne und ging dann ins Bett. Wenigstens würde sein elendes Schnarchen sie heute Nacht nicht stören.
Wo ist Ole?
Am nächsten Morgen.
Als Fenja erwachte, war das Bett neben ihr leer.
„Ups, hat er tatsächlich die ganze Nacht auf dem Dachboden geschlafen?“, fragte sich die junge Frau. Sie lauschte Richtung Flur, aber von Ole war nichts zu hören. Noch halb verschlafen schlug sie die Bettdecke zurück und schwang die Beine vors Bett. Von Fee, die sonst um ihre Füße strich, sobald diese den Boden berührten, war auch nichts zu sehen.
„Fee, du verfressene Katze, wo bist du?“, rief sie in den Flur. Und Ole? Wenn der wirklich noch immer schlief, hatten Schwiegermutters Schlaftabletten wohl ganze Arbeit geleistet. Fenja erhob sich und tapste mit nackten Füßen Richtung Schlafzimmertür. Durch den offenen Spalt fiel ihr Blick auf die heruntergelassene Bodentreppe. Wie konnte das sein?
„Ole?“, rief sie erstaunt, denn eigentlich hatte er ja gemeint, dass man diese nur von unten herunterlassen könne. Komisch. Komisch war auch, dass sie nichts mitbekommen hatte. Sie ging ein paar Schritte in den Flur und rief nochmals nach ihrem Mann. Aber er antwortete nicht. Sehr komisch. Hatte Ole, ohne etwas zu sagen, das Haus verlassen? War er sauer auf sie? Hatte er am Ende bemerkt, dass sie ihn ausgeknockt hatte? Fenja schaute ins Bad – nichts. Schaute ins danebenliegende Gästezimmer – nichts.
Motorengeräusche und Stimmen drangen an ihr Ohr.
„Ole!“ Und nochmals rief sie: „Ole!“ Eine Antwort bekam sie nicht. Woher kamen denn nur diese Geräusche? Ihr Blick glitt über die Treppe nach unten, und nun bemerkte sie verwundert, dass die Haustüre offen stand. Daher also die Stimmen und …
„Ole!“, rief sie erneut auf dem Weg nach unten. Stand er draußen vor der Tür und unterhielt sich mit jemandem? Im Schlafshirt und mit verwuschelten Haaren blinzelte sie in den Vorgarten. Nachbarn werkelten im Garten. Ein Wagen wendete auf dem Wendeplatz vor ihrem Haus und fuhr wieder weg, zwei Nachbarinnen standen am Gartenzaun und unterhielten sich. Eine entdeckte Fenja und hob grüßend die Hand, rief: „Moin Fenja. Ausgeschlafen?“
Von Ole war nichts zu sehen. Fenja grüßte nur halbherzig zurück, schaute nach rechts und links und schloss die Tür. Wo, verdammt, war Ole? Und noch jemanden vermisste sie.
Es schwimmt eine Leiche im …
Die Meldung traf in der Zentrale des Polizeipräsidiums Wittmund kurz nach neun Uhr ein.
„Da schwimmt eine Leiche im Wasser!“, teilte eine aufgeregte Frauenstimme mit.
„Wo?“, hakte Heino, der diensthabende Polizeibeamte, nach.
„Na, in der Harle.“
„Sicher? Sind Sie sicher, dass das eine Leiche ist?“, kam es zurück.
„Natürlich bin ich sicher. Ein toter Fisch ist es nicht. Da treibt einer auf dem Bauch in der Harle, Gesicht nach unten, ohne Luft zu holen, ohne sich zu bewegen, einfach so. Tot eben. Natürlich ist das eine Leiche“, antwortete die Frau außer Atem. Und weiter: „Aber was soll denn diese blöde Frage? Nun machen Sie schon, sie treibt Richtung Schleuse, und die ist zurzeit offen.“
„Also in Carolinensiel in der Harle?“
„Ja, aber schon außerhalb, Richtung Harlesiel.“
„Moment bitte, ich informiere die Kollegen!“
Heino bellte etwas in das Mikrofon der Sprechanlage und schickte zwei Kollegen los. Danach informierte er auch die Feuerwehr über den Vorfall, dann wandte er sich wieder der Anruferin zu.
„Wie ist Ihr Name und Ihr Standort, bitte?“
„Gödengass, Maritta. Ich stehe auf der Brücke an der Friedrichschleuse und … Oh Mann, da schwimmt sie jetzt gerade drunter durch. Wenn ihr euch nicht beeilt, treibt sie raus auf die Nordsee. Die offene Schleuse zieht sie raus.“ Die Stimme der Frau überschlug sich.
„Können Sie sie nicht aufhalten?“
„Iiich? Soll ich etwa in die Harle springen?“
„Nein, natürlich nicht. Ich setze mich mit dem Schleusenwart in Harlesiel in Verbindung. Bleiben Sie bitte am Apparat. Nicht auflegen, ich brauch noch Ihre Daten, und die Kollegen werden Sie nachher auch noch befragen.“
Die Gödengass hörte den Mann im Hintergrund sprechen. Sie lehnte sich an das Geländer der Brücke und rutschte ganz langsam daran herunter.
„Verdammter Mist!“, murmelte sie. „So ein verdammter Mist. So habe ich mir meinen ersten Urlaubstag nicht vorgestellt. Und dann stellt der auch noch solch bescheuerte Fragen.“ Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar und blickte dem treibenden Körper nach. Es war ein Mann, wie sie durch die Statur erkennen konnte. Er war voll bekleidet, trug dunkle Jeans und T-Shirt, allerdings keine Schuhe. Die nackten Füße konnte sie genau erkennen. Der war tot, der war sicher mausetot. So lange konnte keiner die Luft anhalten.
Heino unterbrach ihre Gedanken.
„So, jetzt bin ich ganz für Sie da. Entschuldigen Sie bitte die Nachfragen, aber wir haben hier immer mal wieder mit Leuten zu tun, die es witzig finden, uns zu einem nicht vorhandenen Tatort zu schicken. Jetzt aber zu Ihnen. Haben Sie den treibenden Körper noch im Blick?“
„Ja“, kam es zurück. „Der treibt jetzt mehr nach links, dorthin, wo die Concordia anlegt. Unglaublich, wie schnell das geht. Die müssen die Schleuse schließen, sonst isser weg.“
„Bleiben Sie ruhig, der Schleusenwart ist informiert. Konnten Sie irgendetwas beobachten, bevor Sie den treibenden Körper gesehen haben? Ist Ihnen jemand aufgefallen? Haben Sie Streit gehört?“
„Nein, nichts. Nur, dass da jemand schwimmt, dachte ich jedenfalls zuerst. Aber dann … Keine Ahnung, wie lange der schon dort treibt und wo der ins Wasser geraten ist.“
„Okay, Frau Gödengass. Geben Sie mir bitte Ihre Personalien, Ihre Handynummer sehe ich auf dem Display, und warten Sie auf meine Kollegen. Es wäre schön, wenn Sie den treibenden Körper weiterverfolgen, bis die Kollegen eintreffen. Die werden übrigens auch noch ein paar Fragen an Sie haben.“
Die Gödengass nannte ihm nochmals Namen und auch ihre Adresse und versprach, den Leichnam entlang der Harle weiter zu verfolgen. Dann beendeten die beiden das Gespräch.
Vielleicht, so überlegte sie, finde ich ja jemanden, der ins Wasser springt und den Mann herauszieht. Ich mache das jedenfalls nicht. Nun konnte sie erkennen, dass sich das Schleusentor schloss, die Brücke sich langsam senkte.
Leichenfund in der Harle
Die Nachricht erreichte Tomke Evers, die auf dem Weg zu einem Termin bei ihrer übergeordneten Polizeibehörde in Oldenburg war, im Auto. Heute würde, nein, heute musste sich entscheiden, ob und wie ihr berufliches Leben weiterging.
„Leiche in der Harle?“, wiederholte sie über die Sprechanlage ihres Autos. „Und warum rufst du mich an und nicht Carsten? Ihr wisst, dass er mich vertritt.“
„Weil du die Chefin bist und mal gesagt hast, dass du …“
„Ja, dass ich zuerst informiert werden will. Aber mein Gott, man kann es auch übertreiben. Ich sitze schließlich nicht im Büro, sondern bin im Auto unterwegs. Also bitte, informiere Carsten und den Rest des Teams, die werden mich schon auf dem Laufenden halten.“ Sie beendete das Gespräch und konzentrierte sich wieder auf den Verkehr.
Kurze Zeit später fuhren Polizeihauptkommissar Carsten Schmied und Polizeikommissarin Miri Blum Richtung Küste nach Harlesiel. Eigentlich waren sie zurzeit mit den Drogenfunden an der Küste und auf den Inseln voll ausgelastet, auch ein Leichnam war im gleichen Zeitraum aus der Nordsee geangelt worden. Sie vermuteten, dass er in Zusammenhang mit den Drogenfunden stand. Das Containerschiff war aus Kolumbien kommend auf dem Weg in einen deutschen Hafen gewesen. Der angeschwemmte Tote hatte die Physiognomie eines Mannes aus Südamerika. Seine Identität konnte bisher nicht geklärt werden. War der Mann, wie auch immer, von diesem Schiff gefallen?
Der Meldung eines Leichenfundes in der Harle mussten sie trotzdem schnellstens nachgehen. Zumal die Meldung hieß: vermutlich unnatürlicher Todesfall.
Polizeihauptkommissar Hajo Mertens, Tomkes Ehemann und Kollege, hielt die Stellung im Büro und versprach, sofort den Rechtsmediziner wie auch die Spurensicherer zu informieren. Wobei, die Spusi könnte hier erst einmal wenig ausrichten, überlegte Hajo. Spuren bei einer Wasserleiche zu finden war schwierig, zumal nicht klar war, wo der Tote ins Wasser gekommen war. Wenn Hajo Manninga, der Rechtsmediziner, mit der Leiche durch war, müsste das zuerst geklärt werden. Er stöhnte laut auf. Was da wohl auf sie zukam? Und das ausgerechnet jetzt, da Tomke sich endgültig entschlossen hatte, ihren derzeitigen Job als Interimspolizeirätin aufzugeben, vielleicht ganz aus dem Polizeidienst auszusteigen. Klar, teilweise war es ihrer Krankheit geschuldet, ausschlaggebend aber wohl, dass man sie vor einem Jahr genötigt hatte, den Posten der Polizeirätin, wenn auch interimsmäßig, zu übernehmen. Was im Grunde eigentlich nicht rechtens war, denn ihr fehlte dafür die korrekte berufliche Laufbahn, auch wenn man ihr dafür einen Stern mehr verpasst hatte. Oldenburg jedoch hatte da wohl eine Sonderlösung gefunden und fand die recht praktisch. Hajo lachte auf. Aber nicht mit seiner Tomke, die wehrte sich mit Händen und Füßen und war nun unterwegs, um Nägel mit Köpfen zu machen. Und Sterne interessierten seine Frau schon gar nicht. Allerdings hatte man sie damals vor die Entscheidung gestellt: Innendienst als Chefin, solange es ihre Erkrankung an Multipler Sklerose zuließ, oder vorzeitiger Ruhestand. Wie sie das wohl abwenden konnte?
Tomke hatte andere, ganz andere Vorstellungen, und Hajo war sich sicher, dass sie diese auch durchsetzen würde.
Was aber kam dann? Wer übernahm dann Tomkes Position? Auf jeden Fall würde es sich um einen oder eine außenstehende Person handeln, denn keiner im Revier hatte den Background, hier Polizeichef zu werden. Und keiner wollte das.
Hajo versuchte diese Gedanken abzuschütteln, der Fall hatte nun Vorrang. Seinen Namensvetter Hajo Manninga, den Rechtsmediziner, hatte er informiert, sicher war der schon auf dem Weg nach Harlesiel. Er atmete tief durch, griff zum Telefon, um bei seinen Kollegen vor Ort nach aktuellen Informationen zu fragen. War der schwimmende Tote bekannt? Hatten sie Papiere gefunden? Gab es schon Hinweise auf einen Täter? Wo war die Person ins Wasser gelangt? Dass es sich um ein Verbrechen handelte, hatten die beiden Kollegen der Streife, die als Erste vor Ort gewesen waren, wohl zweifelsfrei feststellen können. In der Brust des Mannes klaffte ein Loch, hieß es.
Mehr könnten sie ihm nicht sagen, hieß es weiter, er müsse abwarten.
Hajo fragte sich, wohin er die Spurensicherung schicken sollte. Er rief Rikus Stevensen, den Leiter der Spurensicherung, an und informierte ihn über den Fall.
„Warte noch“, bat er ihn, „ich habe keine Ahnung, wo ihr nach Spuren suchen könnt. Ich melde mich, wenn ich von Carsten mehr weiß.“
Hajo konnte nun weiter nichts unternehmen, er wandte sich wieder seinem Kokainfall zu.
Verdammt, wo ist Ole?
Nachdem sie das ganze Haus abgesucht hatte, kletterte Fenja ein paar Stufen zum Dachboden hoch und schaute über den Rand der Luke. Aber außer einem kleinen Schrank, einer Matratze sowie einer Holzkiste war nichts zu sehen. Kopfschüttelnd kletterte sie wieder nach unten.
Nun griff sie nach ihrem Handy und tippte Oles Nummer an. Kurz darauf vernahm sie den Klingelton im Wohnzimmer: Highway to Hell von AC/DC. Oles Klingelton.
„Das gibt es doch nicht!“, entfuhr es ihr. „Ole, Ole, bist du da? Willst du mich verarschen?“ Dass ihr Mann ohne sein Handy das Haus verlassen hatte, konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen.
„Ooole!“, rief sie nochmals, ihre Stimme überschlug sich dabei fast.
Hatte er bemerkt, dass sie ihm etwas in sein Bier getan hatte? War er deshalb sauer und spielte mit ihr Katz und Maus? Ole war alles zuzutrauen. Aber so langsam könnte er damit aufhören. Apropos Katz – wo war Fee?
„Ole!“, rief sie nochmals und diesmal energischer. „Es reicht! Du hattest deinen Spaß. Es tut mir leid, aber du hast mich so genervt, dass …“, dann brach Fenja ab.
Nun fiel ihr wieder ein, was ihr gerade erst durch den Kopf gegangen war. Fee, wo war sie? Unten hatte die Haustüre offen gestanden, war Fee etwa rausgelaufen? Daran durfte sie nicht denken. Fee war eine ausgesprochene Hauskatze, was Ole übrigens immens nervte.
„Das blöde Vieh soll gefälligst Mäuse fangen und nicht das teure Futter fressen!“, schimpfte er immer wieder. Selbst Fisch, den sie ihr anfangs aus ihrer Bude mitgebracht hatte, lehnte Fee ab. Und Fee fraß auch nur eine ganz bestimmte Sorte an Futter. Ja, einfach war das Tier nicht, und wenn sie nun durch die offene Tür nach draußen gelaufen war … Fenja mochte es sich nicht vorstellen.
Dann durchfuhr sie ein weiterer Gedanke. Sollte ihr Ole etwa etwas angetan haben? Er hatte das Tier nie gemocht. Hat er Fee am Ende mitgenommen und sie irgendwo ausgesetzt? Vielleicht um sie zu bestrafen? Schließlich wusste er, wie sehr sie das Tier liebte. Fenja wollte den Gedanken nicht zu Ende denken. Sie musste Fee suchen. Ole war jetzt zweitrangig. Der fand den Weg alleine nach Hause.
Sie schaute an sich herunter. So, noch immer im Schlafshirt, konnte sie das Haus nicht verlassen und auf die Suche gehen. Weder nach Ole noch nach Fee. Also schlüpfte sie schnell ins Bad, putzte die Zähne, wischte sich kurz durchs Gesicht und kämmte ihre Haare. Im Schlafzimmer sprang sie in eine frische Jeans und ein neues T-Shirt. Klamotten vom Vortag konnte sie niemals anziehen. Sie rochen zu sehr nach Fisch. Fenja griff sich noch schnell den Schlüssel vom Haken und verließ das Haus.
„Wer zuerst?“, überlegte sie nochmals. Keine Frage, Fee! Ganz klar Fee. Aber wo sollte sie suchen? Hinterm Haus? In Nachbars Garten? Sie entschied sich für die Straße, dort war es am gefährlichsten für das scheue Tier. Oles Auto war in der Garage, das Tor war wie immer geöffnet, ihr eigener Wagen stand auf der Straße. Mit dem Auto war er also nicht unterwegs.
Immer wieder nach ihrer Katze rufend, lief sie den Weg entlang in Richtung ihrer Bude, die sich ganz in der Nähe, nur zwei Straßen weiter befand. In einer Stunde musste sie öffnen, fiel ihr nun ein. Bengt, der Fahrer der Fischereigenossenschaft, hatte sicher schon eine frische Lieferung an Fisch neben ihre Bude gestellt. Das machte der immer so. Neue Ware stellte er in Kühlboxen neben den Verkaufsstand, wenn sie noch nicht da war, leere Boxen nahm er im Austausch mit. Eigentlich müsste sie schon bald hinter der Theke stehen und den frischen Fisch verarbeiten und einsortieren. Hoffentlich hatte Bengt auch an Granat gedacht, gepult und ungepult. Ein paar Einheimische hatten welchen bestellt, die aber nahmen immer nur ungepulten Granat. Und der Abfallcontainer, ein paar Meter neben ihrer Bude, würde auch heute abgeholt werden. Ausgerechnet. Alles heute. So ein Mist. Aber wo war Fee? Sie schaute unter jedes Auto, hinter jede Tonne. Lief weiter. Rief nach dem Tier, lockte es. Aber nichts. Fenja sprach Menschen an, die ihr begegneten, fragte nach ihrer getigerten Katze, doch keiner hatte Fee gesehen.
An ihrer Fischbude angekommen, stutzte sie. Die leeren Kühlboxen, die sie zum Austausch bereitgestellt hatte, waren geöffnet. Fenja aber war sich ganz sicher, die beiden Bügel rechts und links hochgeklappt zu haben. Jetzt lagen die Deckel daneben. Bei näherem Hinsehen musste sie entsetzt feststellen, dass es nicht die leeren vom Vortag, sondern die neuen, frischen Boxen, allerdings ohne Inhalt, waren. Sie erkannte es am Lieferschein, der wie immer oben aufgeklebt war. Was war hier geschehen? Wo war die Ware? Und eine weitere leere Box stand dabei. Auf dem dazugehörenden Deckel war mit schwarzem Filzer ein großes W angebracht. Das Zeichen für den Kollegen in Wilhelmshaven. Sonderbar. Sonst bekam der nur einmal die Woche Lieferung. Aber das sollte ihr im Moment egal sein.
Fenja schaute sich um. Überall nur Touristen, nicht ein einziger Einheimischer war zu sehen. Niemand, den sie fragen könnte. Wo war der Fisch? Wo war Fee, und wo, verdammt, war Ole?
Plötzlich stutzte sie. Ein leises Geräusch drang an ihr Ohr …
Woher kam es? Fenja hielt inne. Was war das? Ein Stöhnen …, ein Wimmern?
Wer hat der Leiche die Schuhe geklaut?
Als Carsten und Miri an der Stelle eintrafen, an der man die Leiche aus dem Wasser gefischt hatte, bot sich ihnen ein skurriles Bild. Eine Frau saß im Gras und weinte bitterlich. Dennis, einer der beiden uniformierten Kollegen von der Schutzpolizei, versuchte, sie zu beruhigen. Dirk, sein Kollege, bemühte sich, eine aufgebrachte Touristenschar vom Fundort fernzuhalten.
„Was ist denn hier los?“, rief Carsten laut über die Leute hinweg. Die Menschen riefen durcheinander, sodass er sich keinen Reim machen konnte.
„Wiederbeleben, Arzt rufen, Erste-Hilfe-Ausbildung“, war zu hören.
Dennis tätschelte die Schulter der weinenden Frau, machte ein paar Schritte auf Carsten zu und tippte sich an die Stirn.
„Die spinnen doch. Kannst du das Volk nicht wegjagen?“
„Noch mal, was ist los?“
„Wir müssten einen Arzt rufen, verlangen sie. Einer bot an, ihn wiederzubeleben. Aber das ist Quatsch, da gibt es nichts wiederzubeleben. Außerdem meinen sie, ich würde die Frau quälen, weil ich sie nicht zu ihrem Mann ließe.“
„Tust du das?“
„Auch Quatsch, das ist nicht seine Frau, das ist eine Frau! Die, die den Mann im Wasser entdeckt und gemeldet hat.“
„Und warum sitzt sie jetzt da und heult?“
„Die Nerven! Sie hat ihn im Wasser treiben sehen, etliche Leute angesprochen, aber keiner hat geholfen, ihn rauszuholen. Kurz vor der Schleuse ist dann doch einer ins Wasser gesprungen und hat den Leichnam rausgezogen.“
„Wer?“
„Ein Kollege von der hiesigen Feuerwehr.“
„Wo ist der Mann?“
„Nach Hause, sich trockenlegen. Ich kenne ihn. Seine Aussage habe ich, wenn noch was ist, können wir ihn auf der Arbeit antreffen.“
Carsten nickte. „Wenn unser Rechtsmediziner eintrifft, soll er sich zuerst um die Frau kümmern, die Wasserleiche hat Zeit, die ist ja schon tot.“ Er schaute sich um. Miri beugte sich gerade über den Toten, der zweite Uniformierte redete auf die Leute ein. Carsten hatte genug. Er ging auf die Gruppe zu – es waren inzwischen nur noch sechs oder sieben Leute –, zückte seinen Dienstausweis und forderte sie entschieden auf, weiterzugehen.
„Sie behindern hier Ermittlungsarbeit. Der Mann ist tot, Sie können nicht helfen, um die Frau wird sich gekümmert, also bitte, gehen Sie.“
Wieder wurden Stimmen laut, keiner rührte sich von der Stelle.
„Wer von Ihnen hat gesehen, wie der Mann ins Wasser gekommen ist?“
Allgemeines Kopfschütteln.
„Niemand?“
Kopfschütteln.
„Kennt jemand den Mann?“
Kopfschütteln.
„Haben Sie sonst etwas Erhellendes mitzuteilen? Haben Sie eine Aussage zu machen? Sind Sie Zeuge oder Zeugin?“, wollte er wissen. „Dann bleiben Sie. Ein Polizeibus wird Sie später zur Befragung ins Polizeipräsidium bringen. Wenn nicht, gehen Sie weiter. Gaffer können wir hier nicht brauchen.“
Die Leute schauten sich an, kamen langsam in Bewegung. Gemurmel war zu hören.
„Frechheit!“
„Nichts gesehen!“
„Wollte nur helfen!“
„Von wegen Gaffer!“
„Schwamm da plötzlich!“