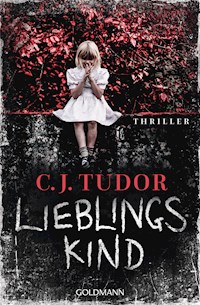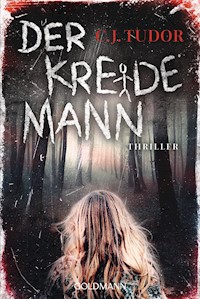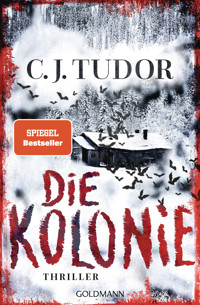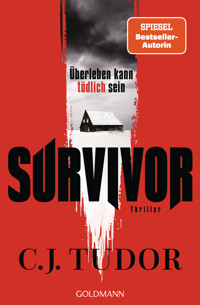9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Mädchen sagt nur ein Wort: »Daddy«. Sie blickt Gabe von der Rückbank des Autos vor ihm an. Dann ist der fremde Wagen verschwunden und mit ihm Gabes fünfjährige Tochter Izzy. Er wird sie nie mehr wiedersehen. Drei Jahre später verbringt Gabe seine Tage und Nächte noch immer damit, die Autobahn abzufahren, besessen von der Hoffnung, sie zu finden. Auch Fran und ihre Tochter Alice sind unterwegs auf den Straßen Englands. Aber sie sind nicht auf der Suche, sie sind auf der Flucht. Denn Fran kennt die Wahrheit. Sie weiß, was damals mit Izzy geschah. Und was ihre Verfolger tun werden, wenn Alice und sie ihnen in die Hände fallen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Das Mädchen sagt nur ein Wort: »Daddy.« Sie blickt Gabe von der Rückbank des Autos vor ihm an. Dann ist der fremde Wagen verschwunden und mit ihm Gabes fünfjährige Tochter Izzy. Er wird sie nie mehr wiedersehen. Drei Jahre später verbringt Gabe seine Tage und Nächte noch immer damit, die Autobahn abzufahren, besessen von der Hoffnung, sie zu finden. Auch Fran und ihre Tochter Alice sind unterwegs auf den Straßen Englands. Aber sie sind nicht auf der Suche, sie sind auf der Flucht. Denn Fran kennt die Wahrheit. Sie weiß, was damals mit Izzy geschah. Und was ihre Verfolger tun werden, wenn Alice und sie ihnen in die Hände fallen …
Weitere Informationen zu C. J. Tudor und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
C. J. Tudor
Schneewittchen schläft
Thriller
Deutsch von Marcus Ingendaay
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Other People« bei Michael Joseph, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by C. J. Tudor
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Arcangel; Plainpicture/Bénédite Topuz; FinePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26509-0V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Mum und Dad, die besten Menschen überhaupt.
Die Hölle, das sind die anderen.
Jean-Paul Sartre
Sie schläft. Ein blasses Mädchen in einem weißen Zimmer. Sie ist umstellt von Maschinen. Mechanische Wächter, die das schlafende Mädchen am Ufer der Lebenden halten und verhindern, dass es ins offene Wasser gezogen wird, den dunklen Ozean.
Das unausgesetzte Piepen und die mühsamen Atemgeräusche des Mädchens sind hier das einzige Wiegenlied. Früher einmal hat sie Musik geliebt, sang sogar selbst, spielte Instrumente. Alles empfand sie als Musik, Vögel, Bäume, das Meer.
In einer Ecke des Zimmers steht ein kleiner Flügel. Der Tastendeckel ist hochgeklappt, die Tasten sind staubbedeckt. Oben auf dem Flügel liegt eine große Muschel. Das rosa schimmernde Innere gleicht einem menschlichen Ohr.
Die Maschinen piepen und surren.
Die Muschel zittert leise.
Plötzlich ertönt ein hartes Cis.
Irgendwo anders fällt ein weiteres Mädchen.
1
Montag, 11. April 2016
M1, Fahrtrichtung Norden
Als Erstes fielen ihm die vielen Aufkleber auf, mit denen die Heckscheibe und der Stoßfänger vollgeklebt waren.
Hupe, wenn du geil bist.
Fahr mir nicht nach, ich kenn mich auch nicht aus.
Wer so fährt wie ich, glaubt auch an Gott.
Hupe kaputt. Achten Sie auf den Finger.
Real men love Jesus.
Nicht gerade ein einheitlicher Auftritt. Eines kam trotzdem sofort rüber: Der Fahrer war ein Blödmann, das stand außer Frage. Einer von denen, die auch Mottoshirts trugen und auf der Arbeit diesen Spruch an der Wand hatten: Man muss nicht wahnsinnig sein, um hier zu arbeiten, aber es erleichtert die Sache ungemein. Dazu das Bild eines Schimpansen, der sich an den Kopf fasst.
Gabe fragte sich, wie der Kerl durch die Heckscheibe überhaupt noch etwas sehen konnte. Immerhin, er bot Lesestoff für alle, die im Stau hinter ihm standen. Wie gerade wieder. Die Baustelle, an der sich die Blechkarawane gerade vorbeiquälte, existierte gefühlt seit der Jahrtausendwende. Fertigstellung vermutlich irgendwann im nächsten Jahrhundert, falls nichts dazwischenkam.
Gabe seufzte und trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad, als ließe sich der Verkehrsfluss dadurch beschleunigen oder eine Zeitmaschine in Gang setzen. Er war schon jetzt so gut wie zu spät. Also noch nicht wirklich zu spät. Noch nicht. Theoretisch konnte er immer noch pünktlich zu Hause sein. Große Hoffnung hatte er aber nicht. Die Hoffnung war bereits hinter der Ausfahrt 19 gestorben, wo viele andere so schlau waren, auf ihr Navi zu hören und die Umleitung über die Landstraße zu nehmen.
Was besonders frustrierend war: An diesem Tag war er sogar pünktlich losgefahren. Und bis halb sieben zu Hause zu sein schien eigentlich machbar. Halb sieben, damit Izzy ihn zumindest an diesem Tag zu Gesicht bekam. Um halb sieben wurde zu Abend gegessen, danach hieß es für Izzy: ab ins Bett. Das war alles. Er hatte es Jenny sogar ausdrücklich versprochen.
»Nur einen Abend in der Woche, mehr verlange ich nicht. Ein einziges Mal, wo wir gemeinsam zu Abend essen und du Izzy noch etwas vorliest. Können wir nicht wenigstens einmal so tun, als wären wir eine ganz normale Familie?«
Das tat weh. Und sollte es wohl auch.
Klar, er hätte jetzt darauf verweisen können, dass er es war, der die Kleine am Morgen schulfein gemacht hatte, da Jenny ja schon so früh einen Kundentermin hatte. Und wer, bitte, hatte Izzys Kinn mit Bepanthen verarztet, als ihre unberechenbare Katze aus der Auffangstation die Krallen ausgefahren hatte? Übrigens ein Tier, das von Jenny ins Haus geholt worden war, nicht von ihm.
Aber er sagte nichts von alledem. Weil sie beide ganz genau wussten, dass es seine chronische Abwesenheit nicht wettmachte. Und normalerweise war Jenny jemand, mit dem man reden konnte. Nur in puncto Familienleben hatte sie klare Vorstellungen. Wenn man da eine bestimmte Grenze überschritt, beruhigte sie sich so schnell nicht mehr.
Und genau dafür liebte er sie, ihr Löwenherz bei allem, was Izzy betraf. Gabes eigene Mutter hatte eher die Wodkaflasche zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht, und seinen Vater hatte er sowieso nicht gekannt. Er, Gabe, hatte sich vorgenommen, es einmal anders zu machen als seine Mutter, ganz anders. Er selbst würde seine Tochter nie im Stich lassen.
Allerdings wurde er einmal mehr von der Realität ausgebremst und hing jetzt in diesem vermaledeiten Stau fest. Und für Izzy blieb wieder mal keine Zeit. Was Jenny dazu sagen würde, konnte er sich ausmalen – und ließ es genau deswegen.
Er hatte noch versucht, sie anzurufen, aber nur die Mailbox erreicht. Jetzt stand sein Akku auf ein Prozent und das Handy kurz vor der Selbstabschaltung, und ausgerechnet an diesem Tag hatte er sein Ladegerät zu Hause gelassen. Wie gern hätte er in diesem Moment das Gaspedal niedergetreten und das rollende Blech vor ihm mit Bulldozergewalt aus dem Weg geräumt. Ging natürlich nicht. Deshalb blieb ihm auch nichts weiter übrig, als in ohnmächtiger Wut das Lenkrad zu bearbeiten und auf diesen kleinen Stinker zu starren, der mit einem Heck voller Aufkleber vor ihm herschlich.
Diese Scheißaufkleber waren wirklich historisch. Und so vergammelt, dass sie schon Wellen warfen. Nicht anders als die ganze Karre. Alter Ford Cortina oder so was in der Art, vermutlich noch in Originallackierung, Knallorange aus den Siebzigern. Doch die Farbe war definitiv im Herbst ihres Lebens angelangt, das alte Leuchten in etwa so brillant wie ein schmutziges Heftpflaster. Angegrabbeltes Abendrot.
Stilecht jedenfalls die rußigen Abgasschleier, die der Wagen hinter sich herzog. Auf dem ehemals verchromten Stoßfänger blühte der Rost, und eine Herstellerplakette war auch nirgendwo zu sehen. Hatte sich sicher ebenso verabschiedet wie die eine Hälfte des Kennzeichens, von dem nur die Buchstaben T und N sowie Fragmente einer Zahl (6 oder 8) geblieben waren. Gabe verzog abschätzig den Mund. War so etwas überhaupt zulässig? Er konnte sich nicht vorstellen, dass so ein Schrotthaufen noch durch die Hauptuntersuchung kam. Ähnliches galt vermutlich für den Fahrer. Führerschein Fehlanzeige. Also lieber nicht so dicht auffahren.
Er überlegte noch, ob er – sicher ist sicher – die Spur wechseln sollte, als zwischen den Aufklebern im Heckfenster plötzlich das Gesicht dieses kleinen Mädchens auftauchte. Ein rundes Gesicht mit roten Bäckchen, vielleicht fünf, sechs Jahre alt mit zwei kurzen blonden, abstehenden Zöpfen.
Sein erster Gedanke: Haben die keinen Kindersitz? Kinder müssen angeschnallt sein.
Sein zweiter: Izzy!
Das Mädchen sah ihn an und riss auf einmal die Augen auf. Öffnete auch den Mund, wobei eine Zahnlücke sichtbar wurde. Er erinnerte sich, wie er den Zahn in ein Kleenex gewickelt und unter ihr Kopfkissen gesteckt hatte – für die Zahnfee.
Ihre Lippen bildeten – unhörbar für ihn – das Wort Daddy. Daddy!
Dann langte eine fremde Hand nach hinten und zog das Mädchen von der Heckscheibe weg, worauf es nicht mehr zu sehen war. Fort, als wäre es nie da gewesen.
Er starrte auf das leere Fenster des vorausfahrenden Fahrzeugs.
Izzy!
Das gab’s doch gar nicht!
Izzy war zu Hause bei ihrer Mutter. Schaute sicher gerade Disney Channel, während Jenny das Abendessen vorbereitete. Wie also konnte sie gleichzeitig in einem fremden Auto sein und nicht einmal angeschnallt? Wohin fuhr sie da? Und mit wem?
Aber die vielen Aufkleber verdeckten die Sicht auf den Fahrer. Oberhalb von Hupe, wenn du geil bist sah er zwar die Spitze eines Schädels, aber mehr auch nicht. Er hupte trotzdem, betätigte sogar die Lichthupe. Der vorausfahrende Wagen schien einen Tick schneller zu werden. Sie näherten sich dem Ende der Baustelle, und die 50-Meilen-Schilder wechselten zu 70.
Izzy! Er gab Gas. Sein neuer Range Rover ging ab wie eine Rakete, aber die alte Rostlaube zog ebenfalls davon. Gabe beschleunigte weiter, sah, wie die Tachonadel die 70 hinter sich ließ, 75, 85 … bis er schließlich doch aufholte. Urplötzlich scherte der orangefarbene Wagen auf die Mittelspur aus und zog auf der falschen Seite an mehreren Fahrzeugen vorbei. Gabe blieb dran und schnitt dabei einen Lkw, der mit ohrenbetäubendem Horn protestierte. Gabe spürte, wie sich sein Herz bemerkbar machte, als sei es ein fremdes Wesen. Beinahe so wie in dieser krassen Szene von Alien 3.
Der orangefarbene Wagen schlängelte sich in riskanten Manövern weiter durch den Verkehr, während Gabe zwischen einem Ford Focus und einem Toyota eingekeilt war. Verdammt, so kam er nicht weiter. Er blickte in den Rückspiegel, überholte den Toyota und kehrte auf die Mittelspur zurück, was im selben Moment auch ein Jeep probierte. Um ein Haar hätte er ihn gerammt. Gabe stieg auf die Bremse, worauf der Jeep seine Warnblinkanlage einschaltete und ihm den Stinkefinger zeigte.
»Du mich auch, du dämlicher Wichser!«
Unterdessen hatte der Fahrer der Schrottkarre weiter an Vorsprung gewonnen und legte sogar zu, indem er sich dreist in jede Lücke drängelte. Gabe gab sich geschlagen. Bei dieser Fahrweise kam er nicht mit, zu gefährlich.
Und überhaupt, wer sagte, dass er sich nicht geirrt hatte? Das Ganze war doch vollkommen absurd. Izzy hier auf der Autobahn? Unmöglich. Was sollte sie hier? Und dann noch in diesem Auto. Er war müde und abgespannt, die Dunkelheit brach herein. Es musste irgendein anderes Mädchen gewesen sein. Eines, das nur so aussah wie Izzy. Zugegeben, die Ähnlichkeit war verblüffend. Ein kleines Mädchen mit denselben blonden Zöpfen und derselben Zahnlücke im Frontbereich. Okay, so etwas kam vor. Aber auch ein Mädchen, das ihn mit Daddy ansprach? Im Ernst?
Ein Hinweisschild kündigte in einer halben Meile eine Rastanlage an. Er könnte kurz rausfahren und anrufen, das würde ihn sehr beruhigen. Aber er war eh schon spät dran und sollte zusehen, dass er nach Hause kam – einerseits. Andererseits, ein Anruf kostete nur wenige Minuten. Er war bereits in Höhe der Ausfahrt, also was jetzt? Von der Autobahn runter oder weiterfahren? Ja oder nein? Izzy. In letzter Sekunde riss er das Steuer nach links und bretterte über den weißen Rüttelstreifen der Ausfahrt, was weiteres hektisches Gehupe anderer Autos zur Folge hatte. Immerhin war damit eine Entscheidung getroffen.
Normalerweise mied Gabe Autobahnraststätten. Er fand sie deprimierend. Man sah dort immer nur Leute, die eigentlich ganz woanders sein wollten.
Allein zwischen den diversen Fast-Food-Tempeln ein Münztelefon zu finden dauerte seine Zeit. Er entdeckte schließlich eines, gut versteckt in der Nähe der Toiletten, und es war auch das einzige weit und breit. Kein Mensch benutzte heute noch Münztelefone. Außerdem brauchte man Kleingeld, das er erst suchen musste. Dass man auch mit Karte bezahlen konnte, merkte er erst nach mehreren Minuten. Er schob seine Bankkarte in den Schlitz und rief zu Hause an.
Jenny ging nie beim ersten Klingeln dran. Sie hatte ständig zu tun, so ein Kind war anstrengend. Jenny sagte, sie hätte gerne acht Hände. Auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Warum war er nie da und half?
»Hallo?«
Eine Frauenstimme, aber nicht Jenny. Hatte er sich verwählt? Er rief nur selten zu Hause an, und wenn, dann mit dem Handy. Er kontrollierte die gewählte Nummer auf dem Display, aber es war eindeutig ihr Festnetzanschluss.
»Hallo?«, sagte die Frauenstimme abermals. »Spreche ich mit Mr Forman?«
»Ja, Forman hier. Wer zum Teufel sind Sie?«
»Ich bin Detective Inspector Maddock.«
Die Kriminalpolizei? Bei ihm zu Hause? Eine Polizistin, die bei ihm ans Telefon ging?
»Wo sind Sie, Mr Forman?«
»Ich? Auf der M1. Das heißt, auf der dortigen Raststätte. Ich komme gerade von der Arbeit.«
Warum sagte er das? Es hörte sich an wie ein Schuldeingeständnis. Was es in gewisser Weise auch war. Er war schuld, an so vielem.
»Bitte kommen Sie umgehend nach Hause, Mr Forman.«
»Warum? Was ist passiert? Stimmt etwas nicht?«
Es folgte eine längere Pause. Lastendes Schweigen. Die Art von Stille, die so viel Unausgesprochenes enthielt. Wörter, die ein ganzes Leben zerstören konnten.
»Es geht um Ihre Frau … und Ihre Tochter.«
2
Montag, 18. Februar 2019
Autobahnraststätte Newton Green an der M1, Ausfahrt 15, 1:30 Uhr nachts
Der dünne Mann trank schwarzen Kaffee mit Unmengen Zucker. Außer Kaffee nahm er nur selten etwas zu sich. Bei ein, zwei Gelegenheiten hatte er sich ein Toast bestellt, aber nie aufgegessen. Seine ganze Erscheinung, dachte Katie, rückte ihn in die Nähe des Todes, dabei war er noch gar nicht so alt. Die Klamotten schlotterten an ihm wie bei einer Vogelscheuche, der man die Füllung herausgerissen hatte. Die allgemeine Auszehrung hatte sich tief in sein Gesicht eingegraben und ließ die knöchernen Konturen unnatürlich scharf hervortreten, besonders an der Augen- und Wangenpartie. Auch die Hand, die den Kaffeebecher hielt, wirkte geradezu skelettartig, wenngleich sie noch von pergamentdünner Haut umhüllt wurde.
Hätte es Katie nicht besser gewusst, wäre ihr erster Eindruck gewesen: Da sitzt jemand im Endstadium einer Krebserkrankung. Sie kannte sich aus. Ihre Großmutter war an Krebs gestorben und hatte genauso ausgesehen. Doch diesen Mann quälte etwas anderes. Seine Krankheit war eher seelischer Natur als körperlich, und selbst die besten Medikamente, die besten Ärzte der Welt konnten ihm nicht helfen. Ihm war schlicht nicht zu helfen.
Damals, als er anfing, den Autohof anzusteuern (etwa ein-, zweimal pro Monat), hatte er noch Flugblätter verteilt. Katie selbst hatte eins genommen. Auf dem Flugblatt das Foto eines kleinen Mädchens, darunter die Frage: HABENSIEMICHGESEHEN? Aber das war nicht das Problem. Katie hatte dieses Kind gesehen, wie übrigens alle anderen auch. Über den Fall der verschwundenen Mutter mit ihrem Kind war ja lang und breit berichtet worden.
Damals hatte der Mann noch Hoffnung gehabt. Oder was man so Hoffnung nennt. Eine Kraft, die ihn antrieb wie eine Droge. Das war vielleicht nicht gesund, aber mehr als das hatte er nicht. Und er sog daran wie an einer Crackpfeife, auch wenn er ahnte, dass er längst süchtig war. Süchtig nach irgendeiner Hoffnung. Angeblich machten Hass und Verbitterung die Leute kaputt, aber das stimmte nicht, es war die Hoffnung. Die Hoffnung fraß die Menschen von innen her auf wie ein Parasit. Sie ließ sie zappeln wie einen Köder im Haifischbecken – ohne dass die Haie je zuschnappten. So gnädig war Hoffnung nicht.
Der dünne Mann jedenfalls war bereits ausgesaugt. In ihm war nichts mehr, nichts als jede Menge Meilen und jede Menge Bonuspunkte auf seiner Coffee-Club-Card.
Katie nahm die leere Tasse an sich und wischte den Tisch sauber.
»Kann ich Ihnen noch einen bringen?«
»Oh, sogar mit Bedienung?«
»Für Stammkunden tun wir alles.«
»Danke, aber ich muss weiter.«
»Okay. Dann bis die Tage.«
Er nickte. »Alles klar …«
Mehr war nicht. Das war die ganze Unterhaltung, jedes einzelne Mal. Sie war nicht einmal sicher, ob er überhaupt registrierte, dass er immer mit derselben Person sprach. Gut möglich, dass er andere Menschen nur noch als Hintergrundrauschen wahrnahm.
Denn wie Katie erfahren hatte, war dies nicht der einzige Coffeeshop an der Autobahn, den er besuchte. So wie bei ihnen das Personal hin und her geschoben wurde, konnte es nicht ausbleiben, dass sich solche Sachen herumsprachen. Gäste, die man nicht vergisst. Die Beamten der Autobahnpolizei, die ebenfalls öfter vorbeikamen, kannten ihn ebenfalls. Angeblich fuhr er Tag und Nacht die M1 ab, auf der Suche nach dem Fahrzeug, das seine Tochter entführt hatte.
Katie wäre es lieber gewesen, die Geschichte hätte nicht gestimmt. Aber das war nicht der Fall, sie war Realität. Katie hoffte trotzdem, dass der dünne Mann mit der Zeit Frieden fand – und das nicht nur um seinetwillen. Denn irgendetwas an seiner stummen Verzweiflung rührte bei ihr an einen wunden Punkt. Am besten wäre es, er käme nie wieder. Dann müsste sie auch nie wieder einen Gedanken an ihn verschwenden.
3
Früher fuhr Gabe nur ungern nach Einbruch der Dunkelheit. Nachtfahrten waren generell unangenehm. Das blendende Licht der entgegenkommenden Scheinwerfer. Die unbeleuchtete Strecke vor ihm, wo die Autobahn in ein grenzenloses Nichts überging, gerade so, als würde er auf ein schwarzes Loch zurasen. Keine Orientierung mehr, die Dunkelheit veränderte alles. Entfernungen wurden unberechenbar, Konturen verzerrten sich bis zur Unkenntlichkeit.
Inzwischen war die Nacht sein Freund. Es war die Zeit, in der es ihm noch am besten ging. Aufgehoben in seinem bequemen Schalensitz, umschmeichelt von den unaufdringlichen Klängen seiner Audioanlage. An diesem Abend zum Beispiel lief das Strange-Angels-Album von Laurie Anderson. Es war bei ihm die meistgespielte Musik. Diese getragenen, schwebenden, beinahe jenseitigen Lieder trafen bei ihm einen Nerv. Sie waren die Musik zu seinem Seelenzustand während der endlosen Fahrten über die dunkle Autobahn.
Manchmal kam er sich vor wie auf einem Boot, das einen tiefen, langen Fluss entlangfuhr. Dann wieder driftete er haltlos durch den schwarzen Weltraum, auf einer Reise in die ewige Dunkelheit. Und was für bizarre Gedanken ihm in den frühen Morgenstunden durch seinen Kopf geisterten, zu einer Zeit, in der jeder vernünftige Mensch seinen Tagesverstand zu Bett schickte. Doch gleich, welche Wege seine Gedanken in der toten Zeit auch nahmen, seine Augen blieben hellwach und suchten unablässig die Straße ab.
Er schlief so gut wie nie. Nicht im eigentlichen Sinne. Deshalb war er ja nachts auf Achse. Wenn er, aus einem letzten Rest Eigenverantwortung heraus, doch einmal eine Pause machte, dann immer auf einem der Autohöfe entlang der Strecke, welche ihm mittlerweile so vertraut waren.
Er konnte sie alle aufzählen, einschließlich Serviceangebot, Kundenbewertung und der Distanzen zwischen ihnen. Anscheinend waren sie zu seinem neuen Zuhause geworden. Was nicht einer gewissen Komik entbehrte, bedachte man, wie sehr er sie einst verabscheut hatte. Wenn er, was auch vorkam, einmal etwas mehr Kraft tanken musste, als mit einer Tasse schwarzem Kaffee zu haben war, stellte er seinen Campingbus in einer der Lkw-Buchten ab und legte sich für ein paar Stunden hin. Meistens reute ihn diese Untätigkeit später, doch während sein Hirn nie Ruhe gab, benötigten seine Augen, Hände und Beine ein Minimum an Erholung. Wenn er sich manchmal aus dem Fahrersitz quälte, fühlte er sich wie ein Neandertaler, der zum ersten Mal den aufrechten Gang versucht. Eine geknickte, verbogene Existenz, die sich zwingen musste, ihre ein Meter neunzig wenigstens einmal am Tag für zwei Stunden auszustrecken – soweit das in einem Camper möglich war. Danach ging es weiter.
Alles, was er brauchte, hatte er dabei, Toilettenartikel sowie Wäsche zum Wechseln. Leider gab es Waschsalons nur abseits der Autobahn, und das missfiel ihm sehr. Die Fahrt dorthin führte gewissermaßen zurück in die Lebenswelt ganz normaler Menschen. Leute, die einkaufen gingen, sich zu einem Kaffee verabredeten oder die Kinder zur Schule brachten. Alles, was er nicht mehr tat. Alles, was er verloren oder preisgegeben hatte.
Auf der Autobahn, auch in den Raststätten, war das normale Leben unterbrochen. Auf der Autobahn wollten alle nur irgendwohin, sie war die Linie zwischen zwei Punkten, war weder hier noch dort. Niemand wollte dort sein. Autobahn war wie ein kleines Fegefeuer.
Handy und Laptop hatte er immer in Griffweite, zusammen mit den entsprechenden Ladegeräten und Ersatzakkus. (Dass er unversehens ohne Energie dastand, sollte ihm kein zweites Mal passieren.) Wenn er nicht gerade fuhr, verbrachte er die Zeit mit Kaffeetrinken und Nachrichtenportalen – nur für den Fall, dass es in seiner Sache doch etwas Neues gab. Aus demselben Grund checkte er regelmäßig die diversen Internetforen über vermisste Personen.
Die meisten dieser Seiten waren kaum mehr als eine Pinnwand mit Steckbriefen der Bitte-melde-dich-Art, vermischt mit kleinen Erfolgsmitteilungen und Infos über geplante Aktionen, mit denen die Öffentlichkeit »sensibilisiert« werden sollte. Alles in der verzweifelten Hoffnung, dass irgendwer da draußen irgendwas gesehen haben könnte und Kontakt aufnahm.
Für ihn trotzdem Pflichtlektüre. Bis ihm das ewig gleiche Muster auffiel. Die Hoffnung zu Beginn, gefolgt von der Verzweiflung, wenn dieselben Fotos immer wieder aufs Neue auftauchten. Gesichter von Menschen, die seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten spurlos verschwunden waren, konserviert im Blitzlicht einer Partykamera. Mit jedem verpassten Geburtstag kamen die Frisuren ein bisschen mehr aus der Mode, wurde ihr Lächeln ein bisschen lebloser.
Allerdings stießen beinahe täglich neue Gesichter hinzu, von denen noch die Aura des Lebendigen ausging und deren Spuren im Leben der anderen noch frisch waren. Ein Kopfabdruck in einem Kissen. Die Zahnbürste im Bad. Kleidung im Schrank, die nach Weichspüler roch und nicht nach Mottenkugeln.
Ihnen würde dasselbe widerfahren wie all den anderen. Die Zeit ging über sie hinweg, das Leben nahm wieder Fahrt auf. Nur die Hinterbliebenen warteten weiter auf dem Bahnsteig und weigerten sich anzuerkennen, dass es kein Wiedersehen mehr geben würde.
Natürlich ist der Vermisstenstatus nicht gleichbedeutend mit Tod. Genau das macht dieses bloße Fehlen ja so entsetzlich. Es gibt nämlich keinen Abschluss. Tote kann man betrauern. Kann ihrer gedenken. Kerzen für sie aufstellen. Blumen aufs Grab legen. Und irgendwann loslassen.
Wird der andere jedoch nur vermisst, bleibt alles in der Schwebe. Die Verlassenen wagen kaum zu atmen in jenem unguten Zwischenzustand, wo die Hoffnung zwar noch nicht tot ist, aber bereits die Geier anlockt.
Das Handy in der Halterung am Armaturenbrett meldete sich. Angesichts des Anrufernamens auf dem Display stellten sich seine Nackenhaare auf.
Wer als Fahrensmann im Reich der Toten nur lang genug unterwegs war, begegnete über kurz oder lang anderen Nachtgestalten. Anderen Vampiren. Truckern im Fernverkehr, Leuten von Autobahnpolizei und Rettungsdienst, Servicepersonal von Rastanlagen. Wie etwa diese blonde Kellnerin, die an diesem Abend wieder Dienst gehabt hatte. Sie wirkte immer so nett – und schien gleichzeitig zu Tode erschöpft. War vielleicht mal verheiratet gewesen, aber der Mann hatte sie verlassen. Jetzt arbeitete sie nachts in dem Coffeeshop, um sich tagsüber um die Kinder zu kümmern.
Ob es wirklich so war, wusste er nicht. Aber er entwarf oft solche Hintergrundgeschichten für Leute, die er nicht kannte. Als wären es Romanfiguren. Manche waren einfach, leicht zu ergründen. Bei anderen brauchte man schon länger. Und wieder andere erschlossen sich ihm in tausend Jahren nicht.
Der Samariter zum Beispiel war so einer.
Seine SMS lautete: »Wobidu?«
Eigentlich konnte Gabe diese Abkürzeritis nicht leiden, nicht einmal in SMS. Ein Nachhall aus seinem früheren Leben als Werbetexter. Doch dem Samariter sah er es nach, aus einer Reihe von Gründen.
Er tippte auf das Mikrofon-Symbol und sagte: »Zwischen Newton Green und Watford Gap.« Im nächsten Moment erschienen die Wörter in Textform auf dem Display. Gabe tippte auf Senden.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Treffen @ Barton Marsh hinter #14. GPS folgt.«
Barton Marsh. Kleines Dorf unweit von Northampton. Es gab schönere Orte. Fahrzeit zirka fünfzig Minuten.
»Warum?«
Es kamen genau drei Wörter zurück. Wörter, auf die er fast drei Jahre gewartet hatte – und vor denen es ihm graute.
»Ich habe es.«
4
Autobahnraststätte Tibshelf an der M1,
zwischen Ausfahrt 28 und 29
Fran nippte an ihrem Kaffee. Oder was sie hier Kaffee nannten. Auf der Karte stand Kaffee. Das Zeug sah aus wie Kaffee, roch entfernt nach Kaffee, schmeckte aber wie Spülwasser. Sie schüttete ein weiteres Zuckertütchen in die Tasse, das vierte. Alice, die mit an dem klebrigen Tisch saß, griff lustlos nach einem anämischen Stück Toast, das, wie der Kaffee, wohl dem Wortlaut der Lebensmittelverordnung entsprach, aber auch nicht mehr.
»Isst du das noch?«, fragte Fran.
»Nein«, antwortete Alice abwesend.
»Kann ich dir nicht verdenken«, sagte Fran und probierte ein mitfühlendes Lächeln, das wehtat – womit es zumindest zu ihrem restlichen Zustand passte.
Im grellen Neonlicht waren ihre pochenden Kopfschmerzen schlimmer als je zuvor. Sie hatte seit anderthalb Tagen nichts mehr gegessen, doch was ihr zu schaffen machte, war weniger ihr leerer Magen als der Schlafmangel. Nicht nur, aber auch deswegen war sie an der Raststätte herausgefahren. Sie dachte, ein Kaffee und etwas zu essen würden helfen. Aber sie hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, sozusagen. Geschah ihr ganz recht, wenn sie weder das eine noch das andere bekamen. Sie schob ihren Kaffee fort.
»Musst du noch aufs Klo, bevor wir weiterfahren?«
Alice schüttelte den Kopf, überlegte es sich aber sofort anders: »Wie weit ist es denn noch?«
Gute Frage: Wie weit? Wie weit ist weit genug? Sie hatte offen gestanden keine Ahnung, wollte es nur nicht zugeben. Sie war doch diejenige, die bestimmte, wo es langging, und alles im Griff hatte. Sollte sie Alice wirklich sagen, dass ihr ganzer sogenannter Plan nur darin bestand, so schnell und so weit fortzufahren, wie es irgend ging? Möglichst viele Meilen herunterzureißen, um maximalen Abstand zu ihrer letzten Adresse herzustellen?
»Na ja, es ist noch ein weiter Weg, aber es gibt ja auch noch andere Raststätten.«
Es sei denn, sie verließen die Autobahn. Abseits der Autobahn gab es günstigstenfalls eine Haltebucht mit Gebüsch.
Alice zog ein Gesicht. »Dann gehe ich lieber jetzt.«
Sie sagte es mit einem Enthusiasmus, als hätte man sie gefragt, ob sie einen Raubtierzwinger betreten wolle.
»Soll ich mitkommen?«
Kurzes Zögern. Alice hatte einen Horror vor öffentlichen Toiletten, andererseits wollte sie auf keinen Fall wie ein kleines Baby erscheinen.
»Nein, geht schon.«
»Sicher?«
Alice nickte und setzte ihre entschlossene Miene auf. Von hier an spielte sie die Erwachsene. Sie stand auf und griff nach ihrem kleinen pinkfarbenen Rucksack mit dem violetten Blumenmuster. Fran kannte das schon. Alice ging nirgendwohin ohne ihren Rucksack, nicht einmal auf die Toilette. Das viele Zeug darin rappelte, als Alice den Rucksack über ihre schmale Schulter warf.
Fran versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, vor allem keine Angst. Sie nahm ihre Tasse und tat so, als würde sie daraus trinken, während Alice sich in Richtung der Toiletten aufmachte. Sie sah der schmächtigen Gestalt in dem allzu weiten Dufflecoat nach. Dieser lange wippende Pferdeschwanz, die Kinderjeans in den gefakten UGG-Boots!
Einmal mehr wurde sie von dieser unfassbaren Liebe überwältigt, die älter war als die Zeit. Das passierte ihr zuweilen. Erschreckend, welche Macht dieses Gefühl über sie hatte, praktisch vom Moment der Geburt an. Wie sich mit einem Schlag alles änderte, als einmal dieses weiche, noch feuchte Wesen in ihren Armen lag. Eine Mischung aus Faszination und Angst, die von nun an ihr ganzes Leben bestimmte. Faszination darüber, was sie, Fran, hervorgebracht hatte, gepaart mit der permanenten Angst, dies alles wieder zu verlieren. Nie zuvor hatte sie das Leben so zerbrechlich, so gefährdet eingeschätzt.
Halbwegs beruhigt war sie nur, wenn ihr Kind schlief. So sollte es jedenfalls sein. Was konnte ihrem kleinen Mädchen passieren, wenn es warm und sicher in seinem Bett lag? Aber genau hier fing das Problem an. Alice schlief nicht nur in ihrem Bett. Sie konnte überall einschlafen, ohne Vorwarnung. Auf dem Schulweg, im Park oder auf der Damentoilette. Gerade noch war sie hellwach, in der nächsten Sekunde weg. Es war beängstigend.
Doch das war nichts gegen den Moment des Erwachens.
Fran dachte an den Rucksack und das klickernde Geräusch, das der ganze Ballast immer machte. Und in ihrer Brust flatterte die Panik wie eine schwarze Motte.
Alice starrte auf das Piktogramm des Damenklos. Frau mit dreieckigem Rock. Als sie noch klein war, hatte sie angenommen, mit einer Hose dürfe sie dort nicht hinein. Im Augenblick wollte sie nicht einmal aufs Damenklo. Aber Angst zog ihren Magen zusammen, wodurch sie natürlich erst recht pinkeln musste.
Es waren nicht einmal die Toiletten, die ihr Angst machten. Oder diese lauten Handtrockner, obwohl auch sie schlimm waren. Es war etwas anderes. Etwas, dem man auf keiner Toilette entging, erst recht gar keiner öffentlichen mit ihren vielen Waschbecken und unerwarteten Ecken.
Spiegel. Es waren die Spiegel, die sie fürchtete, schon immer. Eine ihrer frühesten Kindheitserinnerungen ging so: Sie hat sich als Eiskönigin verkleidet, steht nun in ihrem glitzernden Elsa-Kleid vor Mamas großem Spiegel im Schlafzimmer … und schreit. Sie kann gar nicht mehr aufhören zu schreien.
Nicht alle Spiegel waren gleich. Manche gingen, andere waren gefährlich. Warum, wusste sie nicht. Sie hatte keine Erklärung. Sie wusste nur, dass vertraute Spiegel nicht so gefährlich waren wie neue, unbekannte. In den unbekannten sah sie diese Sachen, die dazu führten, dass sie ins Bodenlose fiel.
Es wird schon gut gehen, mahnte sie sich. Du darfst nur nicht geradeaus gucken. Immer nach unten sehen, auf den Boden, dann passiert dir nichts.
Sie holte tief Luft und stieß die Schwingtür auf. Sofort umfing sie diese brechreizerregende Mischung aus Raumduft und scharfen Reinigungsmitteln. Zumindest war niemand sonst da, was ungewöhnlich war. Allerdings war es noch früh am Tag, und der eigentliche Run auf die Raststätte kam erst noch.
Mit starr nach unten gerichtetem Blick lief sie zur erstbesten Kabine und schloss die Tür hinter sich zu. Sie setzte sich aufs Klo, pinkelte und trocknete sich schnell ab. Dann noch die Spülung betätigt, und schon war sie wieder draußen, alles ohne einmal die Augen zu heben. Doch nun kam der schwierige Teil, das Händewaschen.
Auch das hätte sie locker geschafft, wenn nur der Seifenspender funktioniert hätte. Aber sie drückte und drückte, und nichts passierte – und dann sah sie doch hoch. Es geschah automatisch, sie konnte nichts dagegen tun. Aber vielleicht war es auch der Reiz des Verbotenen wie bei einer nur angelehnten Tür. Man musste eine solche Tür einfach weiter aufdrücken, um zu sehen, was dahinter war.
Genau so fiel ihr Blick in diesem Moment auf ihr eigenes Spiegelbild. Nur dass sie nicht sich sah – und streng genommen auch kein Spiegelbild –, sondern etwas, das real vor ihr stand. Ein Mädchen, das zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr hatte, aber etliche Jahre älter war als sie. Während Alice dunkle Haare hatte und blaue Augen, wirkte die andere mit ihrer bleichen Haut, den aschblonden Haaren und milchig grauen Augen fast wie ein Albino.
»Alisssss.«
Sogar ihre Stimme war bleich und substanzlos wie etwas, das der Wind hergeweht hatte.
»Nicht jetzt. Geh weg.«
»Shhhhhhh. Ganz ruhig.«
»Lass mich in Ruhe.«
»Aber ich brauche dich.«
»Es geht jetzt nicht.«
»Sonst finde ich keinen Schlaaaaaf.«
»Nein. Ich bin nicht …«
Noch ehe sie das Wort »müde« aussprechen konnte, fielen ihr die Augen zu, und sie sank zu Boden.
5
Ich habe es.
War das nach all der Zeit überhaupt möglich? Ihm war sehr bewusst, was der Samariter nicht gesagt hatte. Er hatte gesagt: »Ich habe es«, nicht »sie«. Es sei denn, er wollte es Gabe schonend beibringen. Aber warum meldete er sich dann überhaupt? Es musste mehr dahinterstecken, das spürte er. Der Samariter verschwieg etwas, wenn er sagte: »Ich habe es gefunden.« Was kam als Nächstes?
Verwirrt registrierte er die ungewohnten Verkehrsschilder am Straßenrand, während er den Campingbus über verschlungene und scheinbar zu enge Nebenstrecken steuerte. Diese Verunsicherung befiel ihn immer, sobald er die Autobahn verließ. Als hätte er eine Fangleine gekappt, die Nabelschnur durchschnitten, die ihn mit der Realität verband, und sich ohne Fallschirm in einen Abgrund gestürzt.
Abseits der Autobahn war auch die alte Angst nicht weit, er könnte sie abermals verlieren. Verlieren, weil er nicht drangeblieben war. Die Angst war komplett irrational, aber er war machtlos dagegen. Die Autobahn war sein einziger Anhaltspunkt. Dort hatte er sie zuletzt gesehen, dort hatte er sie verloren.
Und für das eigene Kind tut man ja alles, heißt es. Alles. Doch er hatte tatenlos zugesehen, wie sie in einem fremden Auto verschwand, war nicht drangeblieben. Deshalb war seine Tochter jetzt weg. Dieser Film lief in seinem Kopf immer und immer wieder ab. Wenn er nur anders gehandelt hätte, die Autobahn nicht verlassen, sondern diese Schrottkarre weiterverfolgt hätte. Hätte, hätte!
Tja, mit dem Wissen von heute! Aber was war das schon für ein Wissen? Das Wissen von heute ist ein mieser kleiner Trickbetrüger. Ein Quizmaster im goldenen Anzug und mit einem schlecht sitzenden Toupet, der dir hämisch vorrechnet, was du alles hättest gewinnen können …
… wenn du nur ein bisschen schneller, ein bisschen mutiger, ein bisschen entschlossener gewesen wärst. Trotzdem, Herrschaften, Applaus für unseren Kandidaten! Er hat alles gegeben. Aber er ist und bleibt nun mal ein bekackter Versager!
Er fasste das Steuer fester und blickte auf die Uhr des Armaturenbretts: 2:47. Der Himmel draußen noch wie ein tiefschwarzer Schonbezug über der englischen Countryside, durchbrochen von einzelnen hellen Nadelstichen. Es würde noch dauern, bis die Dämmerung die spärlich möblierte Landschaft freilegte. Jetzt, Mitte Februar, war damit frühestens in drei Stunden zu rechnen.
Ihm war es nur recht. Er bevorzugte die Dunkelheit – und damit auch die dunkle Jahreszeit. Wenn im Oktober die Tage kürzer wurden, war er froh – und hasste es zugleich. Doch lange warme Sommerabende taten ihm definitiv nicht gut. Schönes Wetter lockte die Leute auf die Autobahn. Überall voll besetzte Familienkutschen auf großer Tour. Fröhliche, verschwitzte, genervte Gesichter. Lachende Kinder, heulende Kinder, das volle Programm. Und überall sah er Izzy.
Ganz zu Beginn passierte es ihm sogar zweimal, dass er kleinen Mädchen nachlief, in der festen Überzeugung, es handle sich um seine Tochter. Zum Glück erkannte er in beiden Fällen seinen Irrtum, ehe er sich zum Narren machen konnte – oder von einem erbosten Vater eine gescheuert bekam. Die Demütigung war damit abgewendet, nicht aber seine grenzenlose Enttäuschung.
Spätestens im Oktober war damit Schluss, die glücklichen Familien tauschten die Autobahn wieder gegen ihr normales Pendlerdasein, kehrten zurück an Schule und Arbeitsplatz. Dafür standen Feiertage wie Halloween oder Bonfire Night an, die für ihn nicht weniger schmerzhaft waren. Irgendwie gab es das ganze Jahr über irgendwelche Feste, die scheinbar nur den Sinn hatten, die Einsamen daran zu erinnern, dass sie tatsächlich ganz allein waren. Keine glücklichen Kinderaugen im Schein des Guy-Fawkes-Feuers, keine bessere Hälfte, die man fest an sich drücken konnte, wenn die Nächte kalt wurden.
Weihnachten war das Schlimmste von allen, denn es verfolgte einen überallhin. Andere Feiertage merkte man auf der Straße praktisch nicht, aber Weihnachten, dieses beschissene Fest, kündigte sich auf den Rastanlagen von Jahr zu Jahr früher an.
Selbst Tankstellen wollten da nicht zurückstehen und errichteten schiefe Christbäume, unter denen schlampig eingeschlagene Dekorationspräsente lagen. Die echten gab es in den Shops, die berühmten »Geschenke in letzter Minute« für alle diejenigen, denen auf dem Weg zur Familienfeier einfiel, dass sie für die blöde Tante noch nichts hatten. Und dann die Weihnachtslieder! Die in Endlosschleife abgenudelten Weihnachtslieder trieben ihn endgültig in den Wahn. Und es waren auch nie die Originale, sondern stets nur lieblose, auf modern getrimmte Coverversionen. Nach seiner ersten Saison auf der Straße erstand er deshalb teure Noise-Cancelling-Kopfhörer, die ihm erlaubten, mit seiner eher schwermütigen Musikauswahl allein zu sein.
Kurz und gut, Gabe hasste Weihnachten. Alle, die schon einmal einen Menschen verloren haben, hassen Weihnachten. Für sie hat das Fest der Liebe mit seinen rückwärtsgewandten Bräuchen und »Stille Nacht, heilige Nacht« nichts zu bieten außer weiteren Schmerz. Es erinnert die Betroffenen daran, dass es nie wieder so sein wird, nie wieder so sein kann wie früher. Man kann einen solchen Verlust auch nicht wegpacken wie Christbaumschmuck, so gern man es vielleicht möchte. Sobald der Trubel vorbei ist, kehrt er als Gespenst zurück wie der Geist von Jacob Marley in Dickens’ Weihnachtsgeschichte.
Je weiter Weihnachten zurücklag, desto besser fühlte er sich. Nicht glücklich, das Gefühl kannte er nicht, hielt es in seinem Fall auch nicht mehr für möglich. Aber doch eher bereit, sein Leben so anzunehmen, wie es nun einmal war. Ruhelos, freudlos, unendlich anstrengend und voller Härten. Aber das war okay. Er verdiente es nicht besser. Zumindest bis zu dem Tag, an dem er sie fand – so oder so.
Aus der Dunkelheit tauchte ein grünes Ortsschild auf: BARTONMARSH, 2 MEILEN. Nächste Ausfahrt rechts. Er betätigte den Blinker und zog auf die Abbiegespur. Laurie Anderson sang von Hänsel und Gretel zwei Jahrzehnte später. Auch diese beiden haben sich in zwanzig Jahren gründlich auseinandergelebt und finden sich nur noch zum Kotzen. Er dachte: Glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, das war einmal. Offenbar gibt es für niemanden mehr ein Happy End.
Die Straße nach Barton Marsh war noch schmaler als die, von der er kam. Keinerlei Beleuchtung mehr, nur sporadische Reflektoren auf der Fahrbahnmitte. Sein Smartphone meldete sich mit einer SMS.
»Schon da?«
»Noch zwei Meilen.«
»An der Farm vorbei?«
»Nein.«
»Hinter der Farm kommt ein Rastplatz. Da raus und dann den Fußweg in den Wald.«
»Okay.«
Den Fußweg in den Wald.
Kribbeln auf der Kopfhaut. Er fragte sich, was den Samariter in diese gottverlassene Ecke geführt hatte. Aber wollte er das wirklich wissen?
Er konzentrierte sich wieder auf die Straße. Auf der linken Seite kam ihm ein Schild entgegen: OLDMEADOWSFARM. Unmittelbar dahinter das von Bäumen zugewachsene Parkplatzschild. Er hatte sein Ziel erreicht.
Er parkte hinter dem einzigen anderen Wagen, einem schwarzen BMW, nicht mehr ganz neu und mit einem Nummernschild, das unter dem Straßenschmutz nur teilweise zu erkennen war. Nicht so verdreckt, dass ihn die Polizei angehalten hätte, aber doch so, dass man das Fahrzeug auf den ersten Blick nicht identifizieren konnte. Auch die getönten Heck- und Seitenscheiben dienten primär wohl nicht dem Komfort der Passagiere.
Er schaltete den Motor aus, denn der Diesel des Campers war sicher bis zur Farm zu hören, holte eine kleine Taschenlampe aus dem Handschuhfach, nahm seinen dicken Parka vom Beifahrersitz und zog ihn über. Er stieg aus und schloss die Wagentür ab, was eigentlich nicht nötig war, sondern Beschäftigungstherapie. Er tat alles, um die Begegnung mit dem Samariter hinauszuzögern.
Draußen zog er den Reißverschluss des Parkas bis zum Anschlag hoch. In der Kälte war sein Atem so kompakt wie Zigarettenrauch. Er sah sich um. Links wies ein halb verrottetes Fußgängerschild auf eine Lücke im verwilderten Unterholz.
Den Fußweg in den Wald.
Gabe fragte sich ernsthaft, ob bei einem Treffpunkt wie diesem, zumal um diese Zeit, etwas Gutes herauskommen könnte.
Dennoch schaltete er die Taschenlampe ein und marschierte los.
6
Acht Minuten. Fran sah auf ihre Uhr. Alice war schon viel zu lange fort. Selbst wenn man ihre Toilettenphobie mit einrechnete, waren acht Minuten zu lang. Fran schnappte sich ihre Tasche und stand auf.
Sie lief durch den zu dieser Tageszeit fast menschenleeren Zentralbereich in Richtung Toiletten, vorbei an einem gelangweilten Putzmann in zu enger Arbeitskleidung, der seinen Wischmopp eher pro forma über den Boden schob. Dahinter kamen die Buchhandlung und die Spielhalle, wo selbst am frühen Morgen ein einsamer Zocker saß und auf die Tasten eines Automaten haute wie ein willenloser Obst-Zombie. Die Toiletten lagen ganz am Ende der Halle.
»Alice!«
Alice lag in fötaler Position vor den Waschbecken. Die Haare hingen ihr im Gesicht, und eine Hand hielt den Rucksack fest. An einer Schuhsohle klebte ein Stück Toilettenpapier.
»Ach du Scheiße!« Fran kniete sich hin und wischte zuerst die dunklen Haare zur Seite. Alices Atem ging flach, aber regelmäßig. Das war nicht immer so. In diesem Zustand konnte sich ihre Atemfrequenz auch so weit verringern, dass man mit dem Schlimmsten rechnen musste. Aber nicht diesmal. Diesmal kamen sie noch einmal davon. Und ihre Atmung normalisierte sich weiter, als sie Alice’ Kopf auf ihren Schoß bettete. Gleich vorbei, dachte sie. Na los, komm, wach auf …
Langsam schlug Alice die Augen auf. Fran wartete geduldig, bis sie wieder wusste, wo sie war. Auch wenn diese Attacken nur wenige Minuten dauerten, sank Alice jedes Mal in die tiefsten Abgründe. Dorthin, wo die wahren Albträume lauerten. Und Ungeheuer ihre Bahnen zogen.
Wie die aussahen, wusste Fran genau.
»Keine Angst, ich bin da, Schatz. Alles ist gut«, sagte sie.
»Entschuldige, ich …«
»Alles gut. Hast du dir was getan?«
Blinzelnd setzte sich Alice auf, Fran half ihr dabei. Noch etwas benommen blickte sie umher.
»Schon wieder auf dem Klo?«
»Ja.«
Das Übliche eben. Toiletten, Umkleideräume, im Grunde alles mit einem Spiegel. Also ziemlich irrational, dachte Fran anfangs. Aber Ängste sind nie irrational, nicht für den, der sie hat. Mittlerweile verstand Fran die Ursachen besser. Spiegel waren ein Auslöser, aber es steckte mehr dahinter.
Hinter der Ecke näherten sich Schritte von Spitzenabsätzen. Fran wandte sich um. Eine Frau mit zerknittertem Hosenanzug, abgetretenen Heels und zu viel Make-up um die Augen kam herein. Sie blickte kurz auf die beiden am Boden und ging weiter zu den Spiegeln, wo irgendetwas ihren Unwillen erregte.
Fran folgte ihrem Blick. Sie war so sehr mit Alice beschäftigt, dass sie den zerbrochenen Spiegel über einem der Waschbecken ebenso wenig bemerkt hatte wie die Glassplitter auf dem Boden.
»Manche Leute können sich echt nicht benehmen«, bemerkte die Frau und sah zu Fran und Alice hinüber. »Geht es Ihrer Tochter nicht gut?«
»Doch, alles in Ordnung«, antwortete Fran mit gespielter Leichtigkeit. »Sie ist nur ausgerutscht, weiter nichts.«
»Na dann«, sagte die Frau und quittierte das Ganze mit einem erschöpften Lächeln, ehe sie in eine Kabine entschwand.
Sie war vermutlich nur froh, dass sie nichts weiter tun musste, so war es ja meistens. Die Leute taten immer unheimlich zuvorkommend, aber wirklich helfen wollte kaum einer. Jeder lebt halt in seiner eigenen Ego-Trutzburg.
Die Frau mit den krumm getretenen Schuhen würde sie jedenfalls schnell wieder vergessen. Vermutlich noch, ehe sie ans Waschbecken trat, um sich die Hände zu waschen. Das eigene Leben, die eigenen Abläufe, die eigenen Probleme waren allemal wichtiger.
Oder auch nicht. Vielleicht ging ihr der Anblick des auf dem Boden liegenden Mädchens nicht aus dem Kopf und sie würde die Begegnung gegenüber Freunden oder Kollegen oder irgendeiner Internetbekanntschaft erwähnen.
Sie sollten zusehen, dass sie weiterfuhren.
»Komm, Schatz, wir müssen los«, sagte sie, stand auf und zog Alice hoch, bis sie halbwegs auf eigenen Füßen stand. »Kannst du laufen?«
»Klar. Ich bin nur hingefallen.«
Alice hob ihren geräuschvollen Rucksack auf und schwang ihn – klickedi-klick – über die Schulter. Gemeinsam gingen sie zur Tür, wo Alice jedoch stehen blieb.
»Was ist denn nun schon wieder?«, zischte Fran.
Alice ging zurück zu den Waschbecken. Ihre knirschenden Schritte auf den Scherben. Nervös blickte Fran auf die eine geschlossene Kabine. Aus dem kaputten Spiegel starrte sie ihr zersplittertes Ebenbild an. Die Mitte war komplett herausgefallen, ein schwarzes Loch. Schwer, hier noch sich selbst zu erkennen. Sie zwang sich wegzusehen, richtete stattdessen ihren Blick nach unten auf das Waschbecken.
Im Waschbecken lag ein Kieselstein, der offenbar zu groß für den Abfluss war. Fran verspürte den kindlichen Drang, den Stein trotzdem durch die runde Öffnung zu stopfen, damit er endlich weg war.
Aber Alice kam ihr zuvor und steckte den Kieselstein schnell in ihren Rucksack, wo die anderen Steine lagen. Fran versuchte nicht einmal, sie daran zu hindern. Es war, wenn man es so bezeichnen wollte, ihr Ritual. Dass völlig unklar war, woher dieser Stein kam, blendete sie aus, wie immer.
Aber sie wusste noch, wie das mit den Steinen angefangen hatte. Zwei Jahre war das jetzt her. Es war nach einem dieser Anfälle. Alice in fötaler Stellung auf dem Wohnzimmerboden. Als sie nach zwanzig Minuten endlich erwachte, bemerkte Fran, dass sie etwas in der Hand hielt.
»Sag mal, was ist das denn?«, fragte sie.
»Ein Kieselstein. Ich habe ihn mitgenommen.«
»Wo?«
Was Alice daraufhin sagte, jagte ihr einen Schauer über den Rücken.
»Vom Strand.«
Seit diesem Tag wachte Alice jedes Mal mit einem Stein in der Hand auf. Nicht dass Fran nicht nach rationalen Erklärungen gesucht hätte. Vielleicht hob Alice die Steine irgendwo auf und versteckte sie so trickreich in ihrer Hand, dass Fran nichts davon wahrnahm. Das war denkbar, aber nicht sehr überzeugend.
Also woher kamen die verdammten Dinger?
Aus der geschlossenen Kabine ertönte die Wasserspülung.
»Wir gehen jetzt besser«, sagte Fran mit falscher Lockerheit.
Schon waren sie an der Tür, Fran blickte noch einmal zurück. Irgendetwas störte sie an dem Spiegel. Es war das Loch in der Mitte. Überall auf dem Boden lagen Scherben, nur im Waschbecken war keine einzige.
Hatte Alice mit dem Stein den Spiegel eingeworfen?
In diesem Fall müssten die Scherben direkt nach unten gefallen sein, also ins Waschbecken, nicht auf den Boden.
Auf dem Boden lagen sie nur, wenn etwas durch den Spiegel geworfen wurde.
Von der anderen Seite.
Sie schläft. Ein leichenblasses Mädchen in einem weißen Zimmer. Regelmäßig schauen Krankenschwestern nach ihr, auch wenn dies kein Krankenhaus ist. Ihre Versorgung ist rund um die Uhr gewährleistet. Die Krankenschwestern werden gut bezahlt, und ihre Aufgabe ist überschaubar. Es geht darum, das Mädchen in festgelegten Abständen umzulagern, es zu waschen und dafür zu sorgen, dass es ihm an nichts fehlt. Um den Rest kümmern sich die Maschinen.
Gleichwohl ist die Fluktuation unter den Pflegekräften groß, die meisten bleiben nur wenige Monate. Offenbar ist die Aufgabe nicht sehr befriedigend. Ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr zu tun wäre wünschenswert.
Aber das war nicht der Grund.
Miriam zum Beispiel, die dienstälteste Schwester, war von Anfang an dabei. Zu einer Zeit, in der »es« noch nicht begonnen hatte. Lang genug, dass sich eine persönliche Beziehung zu dem Mädchen entwickeln konnte. Vielleicht war sie deswegen auch geblieben, trotz der Dinge, die seither ständig passierten.
Das erste Mal lag jedenfalls schon Jahre zurück. Es war so: Sie war gerade unten und machte sich einen Tee, als sie diesen Ton hörte. Eine einzelne Note auf dem Klavier, mehr nicht. Dann wieder Stille. Der Ton wiederholte sich nicht. Könnte es sein, dass das Mädchen aufgewacht war? Eigentlich unmöglich. Aber Wunder gab es immer wieder.
Sie eilte natürlich sofort zu ihrer Patientin. Im Krankenzimmer alles wie gehabt: Das schlafende Mädchen schlief. Die lebenserhaltenden Systeme surrten. Die Werte des Mädchens alle im Normalbereich. Sie ging hinüber zum Klavier. Die Tasten staubbedeckt und unberührt.
Schließlich sagte sie sich, dass sie sich den Ton nur eingebildet hatte. Doch eine Woche später passierte es wieder. Und dann wieder. Alle paar Wochen hörte man aus dem Zimmer des Mädchens diesen einzelnen Klavierton. Der Zeitpunkt nicht abschätzbar, es konnte jederzeit passieren, Tag und Nacht.
In der Belegschaft raunte man bald von Poltergeistern, die Abgeklärteren unter ihnen zogen Telekinese in Betracht. Miriam wollte von diesem Unsinn nichts hören, aber eine bessere Erklärung hatte sie auch nicht. So versah sie weiterhin ihren Dienst und bemühte sich, das Phänomen so gut wie möglich zu ignorieren.
Als an diesem Abend der unheimliche Ton erklang, begab sie sich eher genervt als erschrocken ins Zimmer ihrer Patientin. Sie kontrollierte erst das Klavier und sämtliche Apparate und stand dann ratlos über dem schlafenden Mädchen, schaute auf das bleiche Gesicht mit den wilden flachsblonden Haaren. Keine Veränderung, alles wie zuvor. Sie streichelte den dünnen Arm des Mädchens und strich beiläufig das Laken glatt. Hoppla, was war denn das? Schmutz? Wie konnte das sein? Sie hatten das Bett doch gerade erst frisch bezogen.
Sie fühlte genauer nach, hob die Decke an. Rieb den Befund zwischen Daumen und Zeigefinger.
Das war kein normaler Schmutz.
Es war Sand.
7
Der Fußweg war schmal und lehmig. Ringsum nichts als dichtes Unterholz. Es gab sicher schönere Wanderwege, erst recht an einem kalten dunklen Februarmorgen.
Von beiden Seiten ragten knorrige Baumstämme über den altersschwachen Zaun. Hier und da trafen sich die Äste sogar in der Mitte. Umschlangen sich wie Liebende oder hatten sich rettungslos ineinander verhakt wie zwei Ringer in einem Kampf, den keiner je gewinnen konnte …
Schöner Vergleich. Allerdings unterband er solche lyrischen Anwandlungen bei sich sofort. Denn es stimmte leider: einmal Schriftsteller, immer Schriftsteller. Ein Beruf wie ein Fluch. Oder wie Alkoholismus. Das Verlangen nach dem Stoff ließ nie nach.
Als kleiner Junge hatte er einmal davon geträumt, auch Bücher zu schreiben. Bücher wie die von Stephen King oder James Herbert. Aber wenn man in einem abgerockten Badeort aufwuchs, ohne Vater und mit einer Mutter, die ihr Arbeitslosengeld lieber in den Pub trug, wurden einem solche Schwachheiten schnell ausgetrieben.
Dort, wo er lebte, betrachtete man Ehrgeiz mit Argwohn. Fleiß und Erfolg bei anderen erinnerten die Leute zu sehr an ihr eigenes Versagen und an ihre beschränkten Möglichkeiten. Wer es dennoch versuchte, bekam zu hören, dass er wohl »etwas Besseres« sein wollte. »Hau bloß ab mit deinem feinen Realschulabschluss, so was wie dich brauchen wir hier nicht.«
Vor seinen Freunden tat er zwar immer so, als sei ihm die Schule völlig egal, und büffelte dennoch bis in die Nacht für seine Prüfungen. Trotz passabler Noten hätte er seinen Traum dennoch fast in den Sand gesetzt, doch mit viel Glück ergatterte er einen Studienplatz an der örtlichen Fachhochschule und danach einen – dürftig bezahlten – Job in einer kleinen Werbeagentur. Noch ehe es richtig losging, starb seine Mutter. Alle aus seinem Viertel kamen zu ihrem Begräbnis, aber keiner steuerte auch nur einen Penny bei. Gabe musste ihren gesamten Nachlass versetzen, um wenigstens die Bestattungskosten zu begleichen.
In den folgenden drei Jahren verfasste er wie am Fließband Info-Broschüren für Verhütungsspiralen, wechselte dann zu einer großen Agentur in den Midlands. Auf einem Agenturpitch lernte er eine freiberufliche Grafikdesignerin kennen, Jenny. Sie verliebten sich, heirateten … und Jenny wurde schwanger. Und wenn sie nicht gestorben sind, lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr …
Aber so läuft das nicht.
Im Scherz sagte er oft, er habe die Lüge zu seinem Beruf gemacht. Haha.
Niemand ahnte, wie nah er damit der Wahrheit kam.
Ich bin ein berufsmäßiger Lügner. Ich lebe eine Lüge.
Der vor ihm liegende Pfad wurde nun breiter, und die Bäume hörten auf. Gabe fand sich auf einem schmalen Uferstreifen wieder. Still schwamm eine anorektische Mondsichel auf der weiten Wasserfläche. Ein Teich.
Kein großer Teich, etwa zehn mal fünfzehn Meter. Auf der gegenüberliegenden Seite eine Wand aus Bäumen. Rechts ging es eine kleine Anhöhe hinauf. Ein verschwiegenes Plätzchen, eher Geheimtipp. Allerdings, wie schon der Weg, nicht besonders schön. Eher ein fauliger, algenverseuchter Tümpel mit einem tückisch steilen Uferbereich, der mit alten Plastiktüten und Bierdosen zugemüllt war.
Und mitten in dem Tümpel, halb unter Wasser, stand ein Auto.
Das Auto war wohl erst seit Kurzem zu sehen. Die ungewöhnliche Trockenheit der vergangenen Jahre hatte überall den Grundwasserspiegel abgesenkt. Und so gab der Teich Zentimeter um Zentimeter seine Geheimnisse preis. Was auch den ganzen Müll am Ufer erklärte.
Gabe trat so nah an das Wasser heran, dass die schwarze Brühe über die Spitze seiner Turnschuhe schwappte. Das Auto war völlig verrostet und derart mit schleimigen Wasserpflanzen überzogen, dass es sich in der Dunkelheit kaum von seiner Umgebung abhob. Aber im Licht seiner Taschenlampe erkannte er deutlich, was ihm das Heck des Wagens mitzuteilen hatte:
H p , wenn d eil ist.
Hupe kap tt. A ten Sie au inger.
Er ignorierte, dass seine Socken bereits nass waren, und ging noch einen Schritt weiter ins Wasser hinein. Plötzlich sagte eine Stimme:
»Hatte ich recht?«
»Fuck!«
Er fuhr herum. Hinter ihm stand der Samariter. Er musste sich im Dickicht versteckt haben, aber vielleicht war er auch einfach aus dem Nichts aufgetaucht wie ein Geist. Gabe hielt beides für möglich.
Der Samariter war hochgewachsen, dünn und wie immer ganz in Schwarz. Schwarze Jeans mit langer schwarzer Jacke, und seine Haut war nur wenig heller. Sein rasierter Schädel glänzte im Mondlicht. Von verblüffendem Weiß waren seine Zähne, auf einem glitzerte sogar ein Brillant. Gabe hatte ihn schon einmal danach gefragt, aber nur eine ausweichende Antwort erhalten.
»Ach, das sind so Sachen von früher. Etwas, das ich irgendwie behalten wollte.«
»Also ein Erinnerungsstück?«
»Kann man sagen. Damit ich so etwas nie wieder mache.«
Damit war das Thema erledigt, und Gabe war klug genug, es nie wieder anzusprechen.
Jetzt aber starrte er den Samariter an und sagte: »Gott, hast du mich erschreckt. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen.«
»Sorry.«
Der Samariter grinste, die Entschuldigung war nicht ernst gemeint. Gabe beließ es dabei, wollte auch nicht wissen, was er mitten in der Nacht an diesem gottverlassenen Ort zu suchen hatte.
»Ist das der Wagen?«, fragte der Samariter.
Die Aufkleber am Heck waren größtenteils verblichen oder abgefallen. Das Fahrzeug stand zur Hälfte im Wasser, und das Kennzeichen fehlte völlig. Trotzdem gab es für Gabe keinen Zweifel.
»Das ist er«, sagte er und nickte.
Und stand da wie benommen, schwankte sogar leicht hin und her, als hätte er jeden Halt verloren. Außerdem wurde ihm schlecht. So schlecht, dass er meinte, kotzen zu müssen. Das ist er! Das ist der Wagen! Allein diese Worte auszusprechen, nach all der Zeit, war zu viel für ihn. Der Wagen war also real, es gab ihn, er befand sich direkt vor seinen Augen in diesem Schlammloch. Aber wenn es den Wagen gab, dann …
»Sie ist nicht drin«, sagte der Samariter.
Die Übelkeit ließ nach. Zumindest war Izzy nicht in diesem stinkenden Tümpel zu Tode gekommen, sein schwarzes Wasser nicht in ihre Lunge eingedrungen, während ihre Hände an der Seitenscheibe vergeblich nach einer Fluchtmöglichkeit suchten …
Schluss jetzt, sagte er sich. Hör endlich auf, dich verrückt zu machen. Er fuhr sich durch die Haare, rieb sich die Augen, als könne er damit die üblen Gedanken aus seinem Kopf kehren. Der Samariter sah es und wartete, bis er sich gefangen hatte.
»Aber da ist noch etwas, das du dir ansehen musst.«
Mit diesen Worten ging er an Gabe vorbei und watete, ohne mit der Wimper zu zucken, ins Wasser. Gabe hätte sich auch nicht gewundert, wenn er übers Wasser gewandelt wäre. Oder verwechselte er ihn mit jemandem?
In wenigen Schritten erreichte der Samariter das abgesoffene Fahrzeug und drehte sich nach Gabe um.
»Ich sagte, du musst dir das ansehen. Also, was ist nun?«
Gabe zögerte keine Sekunde und folgte dem Samariter nach. Das Wasser war nicht so kalt wie befürchtet und gleichwohl überwältigend, als er unversehens bis zum Schritt darin eintauchte. Er spürte, wie ihm die Luft wegblieb und wie seine Haut von selbst anfing zu zittern. Er biss die Zähne zusammen und schob sich weiter durch den fauligen Schlamm. Allein der Gestank, der dabei aufstieg, drehte ihm den Magen um.
Doch dann stand auch er vor dem Wagen, wo es noch übler roch.
»Und was jetzt?«, fragte er.
Die Antwort des Samariters bestand darin, dass er den Kofferraum aufmachte. Die rostigen Scharniere fügten sich klagend, die Kofferraumklappe schwang hoch.
Und Gabe sah hinein.
Nur kurz blickte er den Samariter an.
Dann musste er sich übergeben.