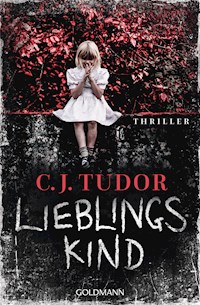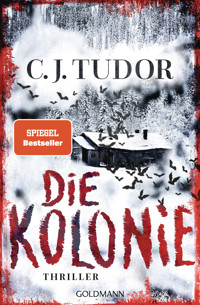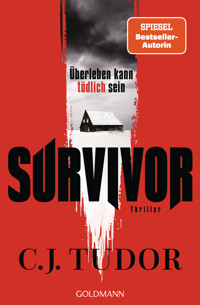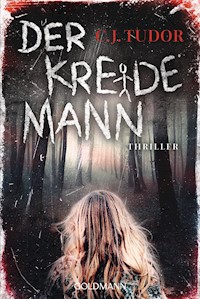
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles begann an dem Tag, an dem sie auf den Jahrmarkt gingen. Als der zwölfjährige Eddie den Kreidemann zum ersten Mal traf. Der Kreidemann war es auch, der Eddie auf die Idee mit den Zeichnungen brachte: eine Möglichkeit für ihn und seine Freunde, sich geheime Botschaften zukommen zu lassen. Und erst einmal hat es Spaß gemacht – bis die Figuren sie zur Leiche eines jungen Mädchens führten. Das ist dreißig Jahre her, und Eddie dachte, die Vergangenheit liegt hinter ihm. Dann bekommt er einen Brief, der nur zwei Dinge enthält: ein Stück Kreide und die Zeichnung eines Strichmännchens. Und als die Geschichte beginnt, sich zu wiederholen, begreift Eddie, dass das Spiel nie zu Ende war ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alles begann an dem Tag, an dem sie auf den Jahrmarkt gingen. Als der zwölfjährige Eddie den Kreidemann zum ersten Mal traf. Der Kreidemann war es auch, der Eddie auf die Idee mit den Zeichnungen brachte: eine Möglichkeit für ihn und seine Freunde, sich geheime Botschaften zukommen zu lassen. Und erst einmal hat es Spaß gemacht – bis die Figuren sie zur Leiche eines jungen Mädchens führten. Zumindest zu dem, was davon übrig war. Das ist dreißig Jahre her, und Eddie dachte, die Vergangenheit liegt hinter ihm. Dann bekommt er einen Brief, der nur zwei Dinge enthält: ein Stück Kreide und die Zeichnung eines Strichmännchens. Und als die Geschichte beginnt, sich zu wiederholen, begreift Eddie, dass das Spiel nie zu Ende war …
Weitere Informationen zu C. J. Tudor finden Sie am Ende des Buches.
C. J. Tudor
Der Kreidemann
Thriller
Deutsch von Werner Schmitz
Die Originalausgabe erscheint 2018 unter dem Titel »The Chalk Man« bei Michael Joseph, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2017 by C. J. Tudor
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Februar 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21415-9V004
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Betty. Alle beide.
Prolog
Der Mädchenkopf lag auf einem kleinen Haufen orangebrauner Blätter.
Ihre Mandelaugen starrten in das Geäst der Platanen, Buchen und Eichen, sahen aber nicht die Finger aus Sonnenlicht, die zaghaft durch die Zweige drangen und den Waldboden mit Gold bestreuten. Sie blinzelten nicht, wenn glänzende schwarze Käfer über ihre Pupillen trippelten. Sie sahen gar nichts mehr, nur Dunkelheit.
Etwas davon entfernt ragte eine bleiche Hand aus ihrem kleinen Leichentuch aus Laub, als suche sie Hilfe oder wolle sich vergewissern, dass sie nicht allein sei. Aber da war nichts. Der Rest ihres Körpers lag außer Reichweite, versteckt an anderen abgelegenen Stellen im Wald.
Ganz in der Nähe knackte ein Zweig laut wie ein Böller in der Stille, und ein Schwarm Vögel brach lärmend aus dem Unterholz. Da kam jemand.
Und kniete neben dem blinden Mädchen nieder. Strich ihr mit fiebrig zitternden Fingern sanft übers Haar und über die kalte Wange. Hob dann den Kopf auf, wischte ein paar am Halsstumpf klebende Blätter ab und schob den Kopf vorsichtig in eine Tasche, wo er zwischen Kreidestummeln zu liegen kam.
Langte nach kurzem Überlegen hinein und schloss ihre Lider. Zog den Reißverschluss der Tasche zu, stand auf und trug sie fort.
Einige Stunden später trafen Polizei und Spurensicherung ein. Sie nummerierten, fotografierten und untersuchten die Leiche des Mädchens und brachten sie schließlich in die Gerichtsmedizin, wo sie wochenlang auf Vervollständigung wartete.
Die kam nicht. Es gab großangelegte Suchaktionen, Zeugenbefragungen und Aufrufe, aber trotz aller Anstrengungen seitens der Polizei und der gesamten Einwohnerschaft wurde der Kopf nie gefunden, und das Mädchen vom Wald wurde nie wieder ganz zusammengesetzt.
2016
Doch von Anfang an.
Das Problem war nur, wir konnten uns über den Anfang nicht einig werden. War es, als Fat Gav zum Geburtstag den Eimer mit Kreidestiften bekam? War es, als wir anfingen, die Kreidefiguren zu zeichnen, oder als sie anfingen, von selbst zu erscheinen? War es der schreckliche Unfall? Oder war es, als die erste Leiche gefunden wurde?
Jede Menge Anfänge. Ich denke, jeden davon könnte man den Anfang nennen. Aber tatsächlich fing es wohl auf dem Jahrmarkt an. Der Tag ist mir am deutlichsten in Erinnerung. Wegen des Waltzer-Mädchens, klar, aber auch, weil an diesem Tag alles aufhörte, normal zu sein.
Wenn unsere Welt eine Schneekugel wäre, war dies der Tag, an dem irgendein Gott vorbeigeschlendert kam, sie einmal kräftig schüttelte und wieder hinstellte. Und nachdem Schaum und Flöckchen sich gesetzt hatten, war nichts mehr wie zuvor. Nicht genau wie zuvor. Durchs Glas mag es genauso ausgesehen haben wie vorher, aber im Innern war alles anders.
Dies war auch der Tag, an dem ich Mr. Halloran kennenlernte, und wie es mit Anfängen nun einmal ist, dürfte dieser so gut wie jeder andere taugen.
1986
»Heute gibt’s ein Gewitter, Eddie.«
Mein Dad liebte es, mit seiner tiefen autoritären Stimme das Wetter vorherzusagen, wie die Leute im Fernsehen. Er sprach jedes Mal mit absoluter Überzeugung, auch wenn er meist danebenlag.
Ich sah aus dem Fenster in den vollkommen blauen Himmel, so strahlend blau, dass man blinzeln musste.
»Sieht mir nicht nach einem Gewitter aus, Dad«, sagte ich mit einem Bissen Käsesandwich im Mund.
»Weil es keins geben wird«, sagte Mum, die plötzlich lautlos wie ein Ninja-Krieger in die Küche gekommen war. »Die BBC sagt, das ganze Wochenende wird warm und sonnig … und sprich nicht mit vollem Mund, Eddie«, fügte sie hinzu.
»Hmmmm«, machte Dad, wie immer, wenn er anderer Meinung war als Mum, ihr aber nicht zu widersprechen wagte.
Niemand wagte Mum zu widersprechen. Mum war – und ist – irgendwie unheimlich. Sie war groß, hatte kurzes dunkles Haar und braune Augen, die vor Vergnügen funkeln konnten oder fast schwarz wurden, wenn sie wütend war (und ähnlich wie den unglaublichen Hulk wollte niemand sie wütend machen).
Mum war Ärztin, aber keine normale Ärztin, die den Leuten wieder ihre Beine annähte oder einem irgendwelche Spritzen gab. Dad hat mir mal erzählt, dass sie »Frauen hilft, die in der Klemme sind«. Was genau das sein sollte, sagte er nicht, aber ich nahm an, es musste schon was ziemlich Schlimmes sein, wenn man dafür einen Arzt brauchte.
Dad arbeitete auch, aber von zu Hause aus. Er schrieb für Zeitschriften und Zeitungen. Doch nicht immer. Manchmal stöhnte er, niemand wolle ihm Arbeit geben, oder meinte mit bitterem Lachen: »Diesen Monat einfach nicht mein Publikum, Eddie.«
Als Kind kam es mir nicht so vor, als hätte er einen »richtigen Job«. Nicht für einen Dad. Ein Dad sollte Anzug und Krawatte tragen und morgens zur Arbeit gehen und abends zum Essen nach Hause kommen. Mein Dad ging zur Arbeit ins Gästezimmer und setzte sich manchmal sogar ungekämmt in Schlafanzug und T-Shirt an den Computer.
Mein Dad sah auch nicht aus wie andere Dads. Er hatte einen Zottelbart und lange, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Er trug abgeschnittene Jeans mit Löchern drin, sogar im Winter, und verwaschene T-Shirts mit den Namen alter Bands wie Led Zeppelin oder The Who. Manchmal trug er auch Sandalen.
Fat Gav nannte meinen Dad einen »beknackten Hippie«. Wahrscheinlich hatte er damit recht. Aber damals empfand ich das als Beleidigung und schubste ihn, worauf er mich brutal zu Boden stieß und ich zerschrammt und mit blutiger Nase nach Hause wankte.
Später vertrugen wir uns natürlich wieder. Fat Gav konnte ein richtiger Mistkerl sein – einer dieser Fettklöße, die immer die Lautesten und Fiesesten sein müssen, um die echten Schlägertypen auf Abstand zu halten – aber er war auch einer meiner besten Freunde und so treu und großzügig wie sonst keiner, den ich kannte.
»Kümmere dich um deine Freunde, Eddie Munster«, sagte er einmal feierlich zu mir. »Freunde sind das Wichtigste.«
Eddie Munster war mein Spitzname. Weil ich mit Nachnamen Adams hieß, wie in Addams Family. Natürlich hieß der Junge in der Addams Family Pugsley, und Eddie Munster war aus The Munsters, aber damals schien es irgendwie logisch und blieb, wie es mit Spitznamen so geht, an mir hängen.
Eddie Munster, Fat Gav, Metal Mickey (wegen seiner riesigen Zahnspange), Hoppo (David Hopkins) und Nicky. Das war unsere Gang. Nicky hatte keinen Spitznamen, weil sie ein Mädchen war, auch wenn sie sich alle Mühe gab, das zu verbergen. Sie fluchte wie ein Junge, kletterte auf Bäume wie ein Junge und prügelte sich fast so gut wie die meisten Jungen. Aber sie sah schon wie ein Mädchen aus. Ein echt hübsches Mädchen mit langen roten Haaren und blasser Haut voller Sommersprossen. Nicht dass mir das wirklich aufgefallen wäre oder so.
An diesem Samstag waren wir verabredet. Samstags trafen wir uns fast immer, entweder bei einem von uns zu Hause oder auf dem Spielplatz, manchmal auch im Wald. Aber an diesem Samstag war Jahrmarkt, also was Besonderes. Der wurde einmal im Jahr veranstaltet, in dem Park am Fluss. Und dieses Jahr durften wir zum ersten Mal allein dahin, ohne Erwachsene, die auf uns aufpassten.
Wir hatten uns seit Wochen darauf gefreut. Überall in der Stadt hingen die Plakate, auf denen Autoscooter, ein Meteor, ein Piratenschiff und eine Rakete angekündigt wurden. Sah spitze aus.
»Ich treff mich um zwei mit den anderen vorm Park«, nuschelte ich, während ich den Rest meines Käsesandwiches verschlang.
»Bleib auf der Hauptstraße, wenn du da hingehst«, mahnte Mum. »Nimm keine Abkürzungen, sprich mit keinem, den du nicht kennst.«
»Ist gut.«
Ich rutschte vom Stuhl und rannte zur Tür.
»Und nimm deine Gürteltasche mit.«
»Oh, Muuuum.«
»Und was, wenn dir auf dem Karussell das Portemonnaie aus der Hosentasche fällt? Keine Widerrede. Du nimmst die Gürteltasche.«
Ich machte den Mund auf und wieder zu. Meine Wangen brannten. Ich hasste diese blöde Gürteltasche. Fette Touristen trugen Gürteltaschen. Kein Mensch würde das cool finden, vor allem Nicky nicht. Doch wenn Mum so war, hatte man keine Chance.
»Okay.«
Das war es nicht, aber ich sah die Uhr in der Küche auf zwei vorrücken und musste los. Ich lief die Treppe rauf, schnappte die blöde Gürteltasche und schob mein Geld rein. Fünf Pfund. Ein Vermögen. Dann rannte ich wieder nach unten.
»Bis nachher.«
»Viel Spaß.«
Den würde ich mir nicht nehmen lassen. Die Sonne schien. Ich hatte mein Lieblings-T-Shirt und die Converse an. Schon glaubte ich das ferne Wummern der Jahrmarktsmusik zu hören und den Duft von Hamburgern und Zuckerwatte zu riechen. Heute konnte nichts schiefgehen.
Fat Gav, Hoppo und Metal Mickey warteten schon am Eingang, als ich kam.
»Hey, Eddie Munster. Hübsches Täschchen!«, kreischte Fat Gav.
Ich lief dunkelrot an und zeigte ihm den Mittelfinger. Hoppo und Metal Mickey kicherten über Fat Gavs Scherz. Hoppo, der immer der Netteste und der Friedensstifter war, sagte zu Fat Gav: »Immerhin sieht die nicht so schwul aus wie deine Shorts, Sackgesicht.«
Fat Gav packte grinsend seine Shorts am Saum und schmiss die Stummelbeine hoch wie eine Ballerina. So war das mit Fat Gav. Man konnte ihn nicht beleidigen, weil ihm einfach alles egal war. Jedenfalls erweckte er bei allen diesen Eindruck.
»Außerdem«, sagte ich, weil ich trotz Hoppos Ablenkungsmanöver immer noch fand, dass die Gürteltasche blöd aussah, »trage ich sie gar nicht.«
Ich löste die Schnalle, steckte das Portemonnaie in die Hosentasche und sah mich um. Die Hecke um den Park schien mir ein gutes Versteck. Da stopfte ich die Gürteltasche rein, damit keiner sie im Vorbeigehen sah, aber nicht so tief, dass ich sie später nicht wieder herausholen konnte.
»Willst du die wirklich dalassen?«, fragte Hoppo.
»Ja, und wenn deine Mummy das erfährt?«, säuselte Metal Mickey höhnisch.
Er war zwar in unserer Gang und Fat Gavs bester Freund, trotzdem konnte ich Metal Mickey nicht leiden. Er hatte was an sich, das so kalt und hässlich war wie die Zahnspange in seinem Mund. Aber wenn man an seinen Bruder dachte, war das eigentlich keine große Überraschung.
»Ist mir egal«, log ich schulterzuckend.
»Uns auch«, sagte Fat Gav ungeduldig. »Können wir jetzt diese dämliche Tasche vergessen und endlich reingehen? Ich will als Erstes zum Orbiter.«
Metal Mickey und Hoppo setzten sich in Bewegung – wir machten eigentlich immer, was Fat Gav wollte. Wahrscheinlich weil er der Größte und Lauteste war.
»Aber Nicky ist noch nicht da«, sagte ich.
»Na und?«, gab Metal Mickey zurück. »Die kommt immer zu spät. Lass uns gehen. Die findet uns schon.«
Mickey hatte recht. Nicky kam wirklich immer zu spät. Andererseits war das so nicht abgemacht. Wir sollten alle zusammenbleiben. Allein war man auf dem Jahrmarkt nicht sicher. Besonders als Mädchen.
»Wir geben ihr noch fünf Minuten«, sagte ich.
»Du hast sie wohl nicht mehr alle!«, schrie Fat Gav und fuchtelte wütend herum wie einst John McEnroe, was aber bei seiner Figur ziemlich albern aussah.
Fat Gav machte dauernd irgendwen nach. Hauptsächlich Amerikaner. Und immer so schlecht, dass wir uns vor Lachen kaum noch einkriegten.
Metal Mickey lachte nicht ganz so laut wie Hoppo und ich. Er mochte es nicht, wenn er das Gefühl hatte, die Gang sei gegen ihn. Aber egal, es spielte keine Rolle, weil wir gerade aufgehört hatten zu lachen, als eine vertraute Stimme fragte: »Was ist denn so komisch?«
Wir drehten uns um. Nicky kam den Hügel hinauf auf uns zu. Wie immer bekam ich bei ihrem Anblick ein komisches Gefühl im Bauch. So eine Art Mischung aus Hunger und Übelkeit.
Heute trug sie ihre roten Haare offen, sie hingen wild durcheinander fast bis an den Bund ihrer zerfransten Jeans. Sie hatte eine ärmellose gelbe Bluse an, mit blauen Blümchen um den Kragen. Ich sah etwas Silbernes an ihrem Hals aufblinken. Ein kleines Kreuz an einer Kette. Über ihrer Schulter hing ein großer und schwer aussehender Jutebeutel.
»Du bist spät dran«, maulte Metal Mickey. »Wir haben auf dich gewartet.«
Als ob das seine Idee gewesen wäre.
»Was hast du in dem Beutel?«, fragte Hoppo.
»Ich soll diesen Scheiß hier für meinen Dad unter die Leute bringen.«
Sie nahm ein Flugblatt aus dem Beutel und zeigte es herum.
Kommt in die Kirche St. Thomas und preist den Herrn. Das bietet mehr Nervenkitzel als die beste Jahrmarktsattraktion!
Nickys Dad war der Pfarrer unserer Gemeinde. Ich selbst ging nicht zur Kirche – so was machten meine Eltern nicht –, sah ihn aber manchmal in der Stadt. Er trug eine kleine runde Brille, und seine Glatze war so voller Sommersprossen wie Nickys Nase. Er lächelte immer und sagte Hallo, aber irgendwie war er mir unheimlich.
»Ich glaub, mein Schwein pfeift, Alter«, sagte Fat Gav.
»Mein Schwein pfeift« war auch so einer von Fat Gavs Lieblingsausdrücken, und wenn er »Alter« sagte, hörte sich das immer ziemlich hochgestochen an.
»Aber das tust du nicht, oder?«, fragte ich und malte mir schon aus, wie wir den ganzen Tag hinter Nicky herlatschten, während sie diese Flugblätter verteilte.
Sie bedachte mich mit einem Blick, der mich an meine Mum erinnerte.
»Natürlich nicht, du Flachkopf«, sagte sie. »Wir lassen nur ein paar fallen, als ob Leute sie weggeworfen hätten, und der Rest kommt in den Papierkorb.«
Wir grinsten. Es gibt nichts Besseres, als etwas zu tun, das man nicht darf, vor allem, wenn man Erwachsenen damit eins auswischen kann.
Wir verstreuten ein paar Zettel, schmissen den Beutel weg und stürzten uns ins Getümmel. Der Orbiter (echt spitze), der Autoscooter, wo Fat Gav mich so heftig rammte, dass mir beinahe das Rückgrat brach. Die Rakete (voriges Jahr noch ganz schön aufregend, aber jetzt eher langweilig), die Riesenrutsche, der Meteor und das Piratenschiff.
Wir aßen Hotdogs, und Fat Gav und Nicky versuchten, Enten zu angeln, und mussten sich sagen lassen, »Jeder gewinnt einen Preis« bedeutet nicht unbedingt, dass man sich den Preis aussuchen kann, worauf sie sich kichernd mit den bescheuerten kleinen Stofftieren bewarfen, die sie gewonnen hatten.
Allmählich rann uns der Nachmittag durch die Finger. Die Wirkung des Adrenalins ließ nach, und dazu kam der Gedanke, dass mein Geld wahrscheinlich nur noch für zwei oder drei Fahrten reichte.
Ich griff in die Hosentasche. Mein Herz machte einen Satz. Das Portemonnaie war weg.
»Scheiße!«
»Was?«, fragte Hoppo.
»Mein Portemonnaie. Ich hab’s verloren.«
»Bist du sicher?«
»Klar bin ich sicher.«
Ich tastete trotzdem die andere Tasche ab. Beide leer. Mist.
»Wo hattest du es denn zuletzt?«, fragte Nicky.
Ich überlegte. Nach der letzten Fahrt hatte ich es noch; erstens hatte ich nachgesehen, und zweitens hatten wir die Hotdogs gekauft. Beim Entenangeln hatte ich nicht mitgemacht, also …
»Die Hotdog-Bude.«
Die Hotdog-Bude war weit weg vom Orbiter und dem Meteor, wo wir gerade standen.
»Scheiße«, sagte ich.
»Komm«, meinte Hoppo. »Lass uns da hingehen.«
»Ist doch sinnlos«, sagte Metal Mickey. »Das hat längst irgendwer aufgehoben.«
»Ich kann dir Geld leihen«, bot Fat Gav an. »Aber viel hab ich nicht mehr.«
Das war bestimmt gelogen. Fat Gav hatte immer viel mehr Geld als wir anderen. Genau wie er immer das beste Spielzeug und das neueste, glänzendste Fahrrad hatte. Seinem Dad gehörte eine Kneipe, The Bull, und seine Mum war Avon-Beraterin. Fat Gav war zwar großzügig, aber ich wusste auch, dass er auf jeden Fall noch etliche Fahrten machen wollte.
Ich schüttelte den Kopf. »Danke. Ist schon gut.«
War es nicht. Hinter meinen Augen brannten Tränen. Nicht nur, weil ich das Geld verloren hatte. Ich kam mir dumm vor, der Tag war im Eimer. Und ich wusste schon, wie verärgert Mum reagieren würde: »Hab ich’s dir nicht gesagt?«
»Macht ihr nur weiter«, sagte ich. »Ich geh da mal nachsehen. Wir brauchen nicht alle unsere Zeit zu verschwenden.«
»Cool«, sagte Metal Mickey. »Kommt. Gehen wir.«
Sie dackelten los. Eindeutig erleichtert. Sie hatten kein Geld verloren, ihr Tag war nicht im Eimer. Ich machte mich auf den Weg zum Hotdog-Stand. Der war direkt gegenüber dem Waltzer, also nahm ich den zur Orientierung. Das alte Kirmeskarussell war nicht zu übersehen. Ziemlich in der Mitte des Jahrmarkts.
Verzerrte Musik dröhnte aus den alten Lautsprechern. Bunte Lämpchen flimmerten, und Kinder kreischten, während die hölzernen Wagen des Karussells schneller und immer schneller im Kreis herumrasten.
Als ich näher kam, verlangsamte ich meine Schritte und suchte den Boden ab. Müll, Hotdog-Servietten, kein Portemonnaie. Natürlich nicht. Metal Mickey hatte recht. Irgendwer hatte es längst aufgehoben und mein Geld geklaut.
Stöhnend blickte ich auf. Und sah zum ersten Mal den Bleichen Mann. Das war natürlich nicht sein Name. Später erfuhr ich, dass er Mr. Halloran hieß und unser neuer Lehrer war.
Der Bleiche Mann war kaum zu übersehen. Zunächst einmal war er sehr groß und dünn. Er trug verwaschene Jeans, ein bauschiges weißes Hemd und einen riesigen Strohhut. Er sah aus wie dieser alte Sänger aus den Siebzigern, den meine Mum so mochte. David Bowie.
Der Bleiche Mann stand neben der Hotdog-Bude, trank einen blauen Slush mit Strohhalm und beobachtete den Waltzer. Jedenfalls dachte ich, er beobachtet den Waltzer.
Dann sah auch ich dorthin, und da erblickte ich das Mädchen. Ich war noch immer stinksauer wegen meinem Geld, aber ich war auch ein Junge von zwölf Jahren, in dem schon die Hormone zu köcheln anfingen. Abends in meinem Zimmer tat ich auch anderes, als mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen.
Sie stand da mit einer blonden Freundin, die ich schon mal in der Stadt gesehen hatte (ihr Dad war Polizist oder so was), doch die tat ich gleich ab. Es ist traurig aber wahr, dass Schönheit, echte Schönheit alles und jeden in ihrer Nähe in den Schatten stellt. Die blonde Freundin war hübsch, aber das Waltzer-Mädchen – wie ich sie für mich immer nannte, auch nachdem ich ihren Namen erfahren hatte – war ausgesprochen schön. Groß und schlank, lange dunkle Haare und noch längere Beine, so glatt und braun, dass sie in der Sonne glänzten. Sie trug einen Rara-Minirock und ein weites, mit »Relax« beschriftetes Jäckchen über einem neongrünen Top. Sie strich sich die Haare hinters Ohr, und eine goldene Kreole glänzte in der Sonne auf.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich anfangs kaum auf ihr Gesicht achtete, doch als sie sich umdrehte und etwas zu ihrer Freundin sagte, wurde ich nicht enttäuscht. Ihr Gesicht war herzzerreißend schön, mit vollen Lippen und schrägen Mandelaugen.
Und dann war es weg.
Eben noch war sie da, war ihr Gesicht da, und dann auf einmal kam dieser entsetzliche, ohrenzerfetzende Krach, wie das Gebrüll eines Ungeheuers aus dem Bauch der Erde. Später erfuhr ich, es war das Geräusch, mit dem der altersschwache und zu selten gewartete Drehkranz an der Achse des Waltzers brach. Ich sah ein Metallstück, das ihr Gesicht, eine Hälfte davon, wegriss und eine klaffende Masse aus Knorpel, Knochen und Blut hinterließ. Sehr viel Blut.
Sekundenbruchteile später, bevor ich auch nur die Chance hatte, den Mund zu einem Schrei aufzumachen, schoss ein riesiges schwarzrotes Ding an mir vorbei. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall – ein Wagen des Waltzer, der in den Hotdog-Stand krachte und einen Hagelsturm herumfliegender Metall- und Holzsplitter auslöste. Und dann überall Schreie von Leuten, die panisch in Deckung sprangen. Ich selbst wurde umgerissen und zu Boden geschleudert.
Andere fielen auf mich drauf. Irgendwer trampelte mir aufs Handgelenk. Ein Knie schlug mir an den Kopf. Ein Stiefel trat mich in die Rippen. Ich schrie auf, schaffte es aber, mich aufzurappeln. Dann schrie ich wieder. Das Waltzer-Mädchen lag neben mir. Zum Glück waren ihr die Haare übers Gesicht gefallen, doch ich erkannte das T-Shirt und das neongrüne Top, obwohl beides voller Blut war. Blut lief ihr am Bein entlang. Ein zweites scharfes Metallteil hatte ihr direkt unter dem Knie die Knochen durchtrennt. Ihr Unterschenkel hing nur noch an ein paar dünnen Sehnen.
Ich wollte bloß noch weg – sie war eindeutig tot. Ich konnte nichts machen – und da streckte sie plötzlich die Hand aus und packte meinen Arm.
Ihr blutiges, verwüstetes Gesicht wandte sich mir zu. Irgendwo aus all dem Rot starrte mich ein braunes Auge an. Das andere hing ihr auf die zerstörte Wange.
»Hilf mir«, krächzte sie. »Hilf mir.«
Ich wollte weglaufen. Ich wollte schreien und weinen und mich übergeben. Und vielleicht hätte ich das alles auf einmal getan, doch dann packte mich eine andere, große und starke Hand an der Schulter, und eine ruhige Stimme sagte: »Alles gut. Ich weiß, du hast Angst, aber du musst mir jetzt ganz genau zuhören und einfach tun, was ich sage.«
Ich drehte mich um. Der Bleiche Mann sah zu mir runter. Erst jetzt fiel mir auf, dass sein Gesicht unter dem großen Hut fast so weiß war wie sein Hemd. Seine Augen waren von einem durchsichtigen Grau, wie Nebel. Er sah aus wie ein Gespenst, ein Vampir, und unter anderen Umständen hätte ich wahrscheinlich Angst vor ihm gehabt. Jetzt aber war er ein Erwachsener, und ich brauchte einen, der mir sagte, was ich tun sollte.
»Wie heißt du?«, fragte er.
»Ed−Eddie.«
»Okay, Eddie. Bist du verletzt?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Gut. Aber die junge Frau, die ist verletzt. Also müssen wir ihr helfen, okay?«
Ich nickte.
»Pass auf, ich sage dir, was du tun sollst … nimm ihr Bein, da, und halt es ganz fest.«
Er legte meine Hände um das Bein des Mädchens. Bei all dem Blut fühlte es sich warm und schleimig an.
»Hast du’s?«
Wieder nickte ich. Ich hatte einen bitteren, metallischen Geschmack im Mund, den Geschmack der Angst. Zwischen meinen Fingern quoll Blut hervor, dabei drückte ich sie ganz fest zusammen, so fest wie ich konnte …
Von weit weg, viel weiter weg als es in Wirklichkeit war, hörte ich Musik und lautes Lachen. Das Mädchen schrie nicht mehr. Sie lag jetzt reglos und stumm da, nur das leise Rasseln ihres Atems war noch zu hören, und auch das wurde immer schwächer.
»Eddie, du musst dich konzentrieren. Okay?«
»Okay.«
Ich sah nur noch den Bleichen Mann. Er löste den Gürtel seiner Jeans. Es war ein langer Gürtel, zu lang für seine schmale Taille, mit zusätzlichen Löchern, damit er überhaupt passte. Komisch, was einem in den schlimmsten Situationen so alles auffällt. Zum Beispiel, dass das Waltzer-Mädchen einen Schuh verloren hatte. Einen Plastikschuh. Pink, mit Glitzer. Und ich dachte, den wird sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen, wo ihr Bein praktisch abgeschnitten ist.
»Hörst du mir zu, Eddie?«
»Ja.«
»Gut. Wir haben’s gleich. Du machst das großartig, Eddie.«
Der Bleiche Mann nahm den Gürtel und schlang ihn um den Oberschenkel des Mädchens. Und zurrte ihn fest, richtig fest. Er war stärker, als er aussah. Fast im selben Augenblick spürte ich, dass der Blutstrom nachließ.
Er sah mich an und nickte. »Du kannst jetzt loslassen. Ich hab sie.«
Ich nahm die Hände weg. Jetzt, wo die Anspannung sich gelöst hatte, begannen sie heftig zu zittern. Ich klemmte sie mir unter die Achseln.
»Wird sie wieder gesund?«
»Das weiß ich nicht. Hoffen wir, dass man ihr Bein retten kann.«
»Und ihr Gesicht?«, flüsterte ich.
Er sah mich an, und etwas in diesen blassgrauen Augen beruhigte mich. »Hast du ihr Gesicht vorher gesehen, Eddie?«
Ich machte den Mund auf, wusste aber nicht, was ich sagen sollte, und verstand auch nicht, warum seine Stimme sich plötzlich nicht mehr so freundlich anhörte.
Er wandte den Blick ab und sagte leise: »Sie wird überleben. Das ist das Wichtigste.«
In diesem Augenblick ertönte ein gewaltiger Donnerschlag, und langsam setzte Regen ein.
Hier begriff ich wohl zum ersten Mal, wie Dinge sich von einer Sekunde zur anderen ändern können. Wie uns alles, was wir für selbstverständlich halten, mit einem Schlag genommen werden kann. Vielleicht hatte ich deswegen zugepackt. Um etwas festzuhalten. Es zu bewahren. So jedenfalls erklärte ich es mir.
Aber wie so vieles, was wir uns sagen, war auch dies wahrscheinlich nur ein Haufen Mist.
Die Zeitung nannte uns Helden. Man brachte Mr. Halloran und mich in den Park zurück und machte Fotos von uns.
Kaum zu glauben, aber die zwei Leute in dem Waltzer-Wagen erlitten bloß Knochenbrüche und leichte Schnittwunden. Einige Passanten erwischte es schlimmer, ihre Wunden mussten genäht werden, und bei der panischen Massenflucht kam es zu weiteren Knochenbrüchen und angeknacksten Rippen.
Und das Waltzer-Mädchen (Elisa hieß sie) überlebte tatsächlich. Den Ärzten gelang es, ihr Bein wieder anzunähen, und sogar ihr Auge konnten sie retten. Die Zeitungen sprachen von einem Wunder. Vom Rest ihres Gesichts sprachen sie nicht so viel.
Wie bei allen Dramen und Tragödien ließ das Interesse daran allmählich nach. Fat Gav verzichtete auf seine geschmacklosen Witze (über Leute ohne Beine), und Metal Mickey wurde es leid, mich Hero Boy zu nennen und zu fragen, wo ich meinen roten Umhang gelassen hätte. Andere Nachrichten und Gerüchte rückten in den Vordergrund. Eine Massenkarambolage auf der A36, der Vetter eines unserer Mitschüler starb, und dann wurde Marie Bishop aus der Fünften schwanger. Und so ging das Leben weiter wie üblich.
Ich machte mir keine großen Gedanken. Irgendwie hatte ich die ganze Sache satt. Ich war keiner von denen, die gern im Mittelpunkt stehen. Außerdem, je weniger ich davon sprach, desto weniger musste ich an Elisas verschwundenes Gesicht denken. Die Albträume verblassten. Und ich schlich immer seltener mit beschmutzten Bettlaken zum Wäschekorb.
Mum fragte ein paarmal, ob ich Elisa nicht im Krankenhaus besuchen wolle. Ich sagte jedes Mal nein. Ich wollte sie nicht wiedersehen. Ihr zerstörtes Gesicht. Diese braunen Augen, die mich so anklagend anstarrten: Ich weiß, dass du weglaufen wolltest, Eddie. Wenn Mr. Halloran dich nicht festgehalten hätte, hättest du mich sterben lassen.
Mr. Halloran hat sie besucht. Oft. Anscheinend hatte er Zeit genug. Er sollte erst im September bei uns an der Schule anfangen. Aber er hatte sein Haus schon ein paar Monate vorher bezogen, um sich erst einmal in der Stadt einzuleben.
Das war bestimmt eine gute Idee. So hatten alle die Chance, sich an seinen Anblick zu gewöhnen. Alle Fragen ausgeräumt, bevor er ins Klassenzimmer kam:
Was ist mit seiner Haut? Er sei ein Albino, erklärten die Erwachsenen geduldig. Das bedeutete, ihm fehlte etwas, das sie »Pigmente« nannten; die sorgten dafür, dass Haut rosa oder braun wurde. Und seine Augen? Dasselbe. Ihnen fehlten bloß die Pigmente. Er ist also keine Missgeburt, kein Monster oder Gespenst? Nein. Ein ganz normaler Mann mit einer körperlichen Störung.
Das stimmte nicht. Mr. Halloran war manches, aber normal war er ganz bestimmt nicht.
2016
Der Brief kommt aus heiterem Himmel. Er fällt durch den Briefkastenschlitz, zusammen mit einem Spendenaufruf für Macmillan und dem Flyer eines neuen Pizzaladens.
Und wer zum Teufel schreibt heutzutage noch Briefe? Selbst meine Mutter mit ihren achtundsiebzig Jahren benutzt nur noch E-Mail, Twitter und Facebook. Und hat mehr Ahnung davon als ich. Ich hab’s nicht so mit Technik. Für meine Schüler bin ich eine Witzfigur, und wenn sie von Snapchat, Favoriten, Tags und Instagram reden, klingt das für mich wie eine Fremdsprache. Ich dachte immer, ich bringe euch Englisch bei, beklage ich mich oft bei ihnen. Aber ich verstehe kein Wort von dem, was ihr da redet.
Die Handschrift auf dem Umschlag sagt mir nichts, aber meine eigene kann ich ja auch kaum noch entziffern. Wo wir alle nur noch auf Tasten und Touchscreens herummachen.
Ich reiße den Umschlag auf, dann sitze ich am Küchentisch, trinke eine Tasse Kaffee und beginne zu lesen. Doch das stimmt nicht so ganz. Ich sitze am Tisch und starre den Brief an, und der Kaffee neben mir wird kalt.
»Was hast du da?«
Ich zucke zusammen und sehe mich um. Chloe tappt in die Küche, gähnend und noch vom Schlaf zerknautscht. Ihre schwarzgefärbten Haare sind verwuschelt, die Ponyfransen stehen zu Berge. Sie trägt ein altes Cure-T-Shirt und Reste der Schminke von gestern Abend.
»Das«, sage ich und falte das Blatt sorgfältig zusammen, »nennt man einen Brief. In alten Zeiten haben die Leute so etwas zum Kommunizieren verwendet.«
Sie bedenkt mich mit einem vernichtenden Blick und zeigt mir den Mittelfinger. »Offenbar sprichst du mit mir, aber ich höre nur bla bla bla.«
»Das ist das Problem mit der heutigen Jugend. Ihr hört einfach nicht zu.«
»Ed, du bist kaum alt genug, um mein Vater zu sein, warum hörst du dich also wie mein Großvater an?«
Sie hat recht. Ich bin zweiundvierzig, und Chloe ist Ende zwanzig (glaube ich. Wie alt genau, hat sie mir nie gesagt, und als Gentleman frage ich natürlich nicht.) Nicht so sehr viele Jahre zwischen uns, aber oft fühlt es sich wie Jahrzehnte an.
Chloe wirkt jung und cool und könnte noch als Teenager durchgehen. Ich bin ganz anders und könnte eher als Rentner durchgehen. »Vergrämt« wäre noch eine freundliche Beschreibung. Doch was heißt schon Gram, wenn man ständig von Sorgen und Reue geplagt wird.
Mein Haar ist noch dicht und ziemlich dunkel, aber meine Lachfalten haben vor einiger Zeit ihren Sinn für Humor verloren. Wie viele große Leute gehe ich gebeugt, und meine Lieblingsklamotten sind Sachen, die Chloe als »Flohmarkt-Schick« bezeichnet. Anzüge, Westen und ordentliches Schuhwerk. Ich besitze auch einige Jeans, doch damit gehe ich nicht zur Arbeit, und ich arbeite – falls ich mich nicht in meinen Bau verkrieche – fast immer und gebe zusätzlich in den Ferien noch Nachhilfestunden.
Ich könnte behaupten, das sei so, weil ich den Lehrerberuf liebe, aber so sehr liebt niemand seinen Beruf. Ich tu es, weil ich das Geld brauche. Deshalb wohnt auch Chloe hier. Sie ist meine Untermieterin und, bilde ich mir gern ein, Freundin.
Zugegeben, wir sind ein seltsames Paar. Chloe ist nicht die Art von Frau, die ich normalerweise zur Untermiete nehmen würde. Aber ich war gerade von einem anderen möglichen Mieter im Stich gelassen worden, als die Tochter eines Bekannten von »diesem Mädchen« erzählte, das dringend ein Zimmer suchte. Es scheint zu funktionieren, und die Miete kann ich brauchen. Ebenso die Gesellschaft.
Es mag merkwürdig scheinen, dass ich überhaupt einen Untermieter nötig habe. Ich werde relativ gut bezahlt, das Haus, in dem ich lebe, wurde mir von meiner Mum überlassen, und so dürften die meisten davon ausgehen, dass ich ein behagliches, von Hypotheken unbelastetes Leben führe.
Die traurige Wahrheit ist, das Haus wurde zu einer Zeit gekauft, als die Kreditzinsen zweistellig waren, dann musste für Renovierungen ein weiterer Kredit aufgenommen werden, und dann noch einer, damit wir das Pflegeheim für meinen Vater bezahlen konnten, als sein Zustand sich so sehr verschlechterte, dass wir zu Hause nicht mehr damit zurechtkamen.
Mum und ich lebten bis vor fünf Jahren zusammen, bis sie Gerry kennenlernte, einen sympathischen Banker, der aus seinem Job ausgestiegen war und sich für ein unabhängiges Landleben in einem selbstgebauten Ökohaus in Wiltshire entschieden hatte.
Ich habe nichts gegen Gerry. Für ihn spricht eigentlich auch nichts, aber Mum scheint mit ihm glücklich zu sein, und das ist, wie wir uns gern weismachen, die Hauptsache. Ich bin zwar schon zweiundvierzig, trotzdem ist es mir irgendwie nicht recht, dass Mum mit einem anderen Mann als Dad glücklich ist. Ich weiß, das ist kindisch, unreif und egoistisch. Aber was soll’s.
Davon abgesehen, Mum ist achtundsiebzig, und meine Meinung ist ihr scheißegal. Sie hat das nicht wortwörtlich so gesagt, als sie mir ihren Entschluss mitteilte, mit Gerry zusammenzuziehen, doch es lief schon darauf hinaus:
»Ich muss raus aus diesem Haus, Ed. Hier sind mir zu viele Erinnerungen.«
»Du willst das Haus verkaufen?«
»Nein. Ich will es dir lassen, Ed. Mit ein wenig Liebe kann es ein wunderbares Haus für eine Familie sein.«
»Mum, ich habe nicht mal eine Freundin, geschweige denn eine Familie.«
»Dazu ist es nie zu spät.«
Ich antwortete nicht.
»Wenn du das Haus nicht haben willst, dann verkauf es einfach.«
»Nein. Ich … Ich will doch nur, dass du glücklich bist.«
»Von wem ist denn der Brief?«, fragt Chloe, die sich an der Kaffeemaschine einen Becher eingießt.
Ich stecke ihn in die Tasche meines Hausmantels. »Nicht wichtig.«
»Oooh. Ein Geheimnis.«
»Nicht doch. Bloß … ein alter Bekannter.«
Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Noch einer? Wow. Wie sie auf einmal alle aus ihren Löchern kriechen. Wusste gar nicht, dass du so viele Freunde hattest.«
Ich sehe sie fragend an. Und dann fällt mir ein, dass ich ihr erzählt hatte, wer heute Abend zum Essen kommt.
»Tu nicht so überrascht.«
»Bin ich aber. Dass ein so ungeselliger Mensch wie du überhaupt Freunde hat, versteht sich schließlich nicht von selbst.«
»Ich habe Freunde, hier in Anderbury. Du kennst sie. Gav und Hoppo.«
»Die zählen nicht.«
»Warum?«
»Weil das keine richtigen Freunde sind. Das sind bloß Leute, die du dein ganzes Leben lang kennst.«
»Nennt man das nicht Freunde?«
»Nein. Das nennt man provinziell. Mit Leuten herumhängen, weil man sich aus Gewohnheit dazu verpflichtet fühlt, und nicht, weil einem wirklich etwas an ihrer Gesellschaft liegt.«
Stimmt schon. Irgendwie.
»Aber jetzt«, wechsle ich das Thema, »sollte ich mich mal anziehen. Ich muss noch in die Schule.«
»Habt ihr nicht Ferien?«
»Im Gegensatz zur landläufigen Meinung müssen Lehrer auch arbeiten, wenn die Schule für den Sommer dichtmacht.«
»Wusste gar nicht, dass du auf Alice Cooper stehst.«
»Ich liebe ihre Musik«, sage ich trocken.
Chloe grinst, eine komische Grimasse, und plötzlich sieht ihr eher unscheinbares Gesicht nach etwas aus. Manche Frauen sind so. Auf den ersten Blick nichtssagend, aber schon ein Lächeln oder ein Heben der Augenbrauen kann sie vollkommen verwandeln.
Kann sein, dass ich ein bisschen verknallt in sie bin, nur würde ich das niemals zugeben. Ich weiß, für sie bin ich eher der gute Onkel als ein potenzieller Freund. Ich würde sie niemals in die Verlegenheit bringen, annehmen zu müssen, dass ich sie mit etwas anderem als väterlicher Zuneigung betrachte. Außerdem ist mir sehr bewusst, dass man einem in meiner Position in einer Kleinstadt ein Verhältnis mit einer viel jüngeren Frau falsch auslegen könnte.
»Wann kommt denn dein ›alter Bekannter‹?«, fragt sie und setzt sich mit ihrem Kaffee an den Tisch.
Ich schiebe meinen Stuhl zurück und stehe auf. »Gegen sieben.« Und dann: »Du kannst gern dabei sein.«
»Das lass ich lieber. Möchte euer Wiedersehen nicht stören.«
»Okay.«
»Vielleicht ein andermal. Nach dem, was ich gelesen habe, scheint er ganz interessant zu sein.«
»Ja.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Interessant, das kann man wohl sagen.«
Zur Schule ist es ein flotter Fußmarsch von fünfzehn Minuten. An einem Tag wie heute – sommerlich warm, ein Hauch von Blau hinter dünnen Schleierwolken – ist es ein angenehmer Spaziergang, auf dem ich vor der Arbeit meine Gedanken sortieren kann.
Während der Schulzeit kann das nützlich sein. Viele meiner Schüler an der Anderbury Academy sind das, was man »schwierig« nennt. Zu meiner Zeit hätte man von einem »Haufen kleiner Arschlöcher« gesprochen. An manchen Tagen reicht es, wenn ich mich geistig auf den Umgang mit ihnen vorbereite. An anderen Tagen gelingt mir die Vorbereitung nur mit einem Schuss Wodka im Morgenkaffee.
Wie viele Kleinstädte macht Anderbury auf den ersten Blick einen malerischen Eindruck. Idyllisches Kopfsteinpflaster, Teeläden, ein halbwegs berühmter Dom. Zweimal die Woche ist Markt. Dazu die hübschen Parkanlagen und Promenaden am Fluss. Die Sandstrände von Bournemouth und die weite Heidelandschaft von New Forest sind mit dem Auto leicht erreichbar.
Blickt man hinter diese touristische Fassade, sieht die Sache ganz anders aus. Viele Saisonarbeiter, hohe Arbeitslosigkeit. Scharen gelangweilter Jugendlicher treiben sich in Geschäften und Parks herum. Minderjährige Mütter schieben kreischende Babys die Hauptstraße rauf und runter. Das ist nichts Neues, scheint aber häufiger zu sein als früher. Jedenfalls kommt es mir so vor. Mit zunehmendem Alter wird man nicht unbedingt klüger, nur intoleranter.
Ich komme am Old Meadows Park vorbei. Unser alter Treffpunkt hat sich seit damals sehr verändert. Was auch sonst. Es gibt jetzt eine Skateranlage, und die Spielwiese am anderen Ende des Parks, wo unsere Gang sich immer getroffen hat, musste einem modernen »Freizeitgelände« weichen. Neue Schaukeln, eine riesige Tunnelrutsche, Kletterseile und alles mögliche coole Zeug, von dem wir als Kinder nicht mal träumen konnten.
Seltsamerweise ist der alte Spielplatz noch da, verlassen und verfallen. Das Klettergerüst ist verrostet, die Schaukeln hängen schief und krumm, von dem einst bunt bemalten Holzkarussell blättert die Farbe, überall sieht man verblasste Graffiti, und Helen ist eine Schlampe oder Andy W ich liebe dich sagt längst keinem mehr was.
Ich bleibe stehen, sehe mir das an und lasse die Erinnerungen kommen.
Das leise Quietschen einer Babyschaukel, die beißende Kälte des frühen Morgens, das Knirschen weißer Kreide auf schwarzem Asphalt. Noch eine Botschaft. Aber diese war anders. Kein Kreidemännchen … etwas anderes.
Ich wende mich ab. Jetzt nicht. Nicht schon wieder. Ich lasse mich nicht wieder da reinziehen.
In der Schule habe ich nicht lange zu tun. Mittags bin ich fertig. Ich packe meine Bücher, schließe ab und gehe ins Stadtzentrum.
The Bull ist eine Eckkneipe an der Hauptstraße, die letzte alte Kneipe hier. Früher gab es in Anderbury zwei weitere, The Dragon und The Wheatsheaf, dann kamen die Imbissketten. Die alten Kneipen machten zu, und Gavs Eltern mussten die Preise senken und Frauenabende und Happy Hours und Familientage einführen, um zu überleben.
Irgendwann hatten sie genug davon und zogen nach Mallorca, wo sie jetzt eine Bar namens Britz betreiben. Gav, der seit seinem sechzehnten Geburtstag halbtags in der Kneipe gearbeitet hatte, wurde zum neuen Herrscher der Zapfhähne und ist es bis heute geblieben.
Ich stoße die schwere alte Tür auf und trete ein. Hoppo und Gav sitzen an unserem üblichen Fenstertisch in der Ecke. Von der Hüfte aufwärts ist Gav immer noch kräftig genug gebaut, um daran zu erinnern, warum wir ihn früher Fat Gav genannt haben. Nur dass er jetzt mehr Muskeln als Fett hat. Seine Arme gleichen Baumstämmen, die Adern treten hervor wie stramme blaue Drähte. Sein Gesicht ist wie gemeißelt, sein kurzgeschorenes Haar grau und schütter.
Hoppo hat sich kaum verändert. In seiner Klempnermontur könnte man ihn bei nicht so genauem Hinsehen immer noch für einen verkleideten Zwölfjährigen halten.
Die zwei sind ins Gespräch vertieft. Die Gläser vor ihnen sind kaum angerührt. Guinness für Hoppo, Cola light für Gav, der selten Alkohol trinkt.
Ich bestelle ein Taylor’s Mild bei der missmutig dreinblickenden Thekenfrau, die erst mich, dann den Zapfhahn mit einem Blick bedenkt, als hätten wir sie tödlich beleidigt.
»Muss erst das Fass wechseln«, brummelt sie.
»Okay.«
Ich warte. Sie verdreht die Augen.
»Ich bring’s dann.«
»Danke.«
Ich gehe zu den anderen. Als ich mich umdrehe, steht sie immer noch da.
Ich setze mich auf den wackligen Stuhl neben Hoppo.
»Tag.«
Sie blicken auf, und sofort ist mir klar, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist passiert. Gav rollt sich hinter dem Tisch hervor. Seine Armmuskeln bilden einen starken Kontrast zu den dürren Beinen, die reglos von seinem Rollstuhl hängen.
Ich drehe mich um. »Gav? Was …«
Seine Faust fliegt auf mich zu, meine linke Wange explodiert vor Schmerz, und ich stürze rückwärts zu Boden.
Er starrt zu mir runter. »Wie lange weißt du das schon?«
1986
Fat Gav war größer als wir alle und der Anführer unserer Gang, aber er war auch der Jüngste von uns.
Sein Geburtstag war Anfang August, zu Beginn der Sommerferien. Darauf waren wir ganz schön neidisch. Vor allem ich. Ich war der Älteste. Mein Geburtstag lag auch in den Ferien, drei Tage vor Weihnachten. Und das hieß, statt zwei richtigen Geschenken bekam ich fast immer nur ein einziges »großes« Geschenk oder zwei nicht so gute.
Fat Gav bekam immer haufenweise Geschenke. Nicht nur weil seine Eltern reich waren, sondern auch, weil er eine Million Verwandte hatte. Tanten und Onkel und Vettern und Kusinen und Großeltern und Urgroßeltern.
Auch darauf war ich ein bisschen neidisch. Ich hatte nur meine Eltern und meine Oma, die wir nur selten sahen, weil sie weit weg lebte und außerdem allmählich »plemplem« wurde, wie mein Dad es ausdrückte. Ich besuchte sie nicht gern. In ihrem Wohnzimmer war es immer zu warm und stickig, und immer lief derselbe Film bei ihr im Fernsehen.
»War Julie Andrews nicht schön?«, seufzte sie jedes Mal mit verschleiertem Blick, und wir alle mussten dann nicken und »Ja« sagen und weiche Kekse aus dieser rostigen Blechdose mit dem tanzenden Rentier drauf essen.
Fat Gavs Eltern schmissen jedes Jahr eine große Party für ihn. Für dieses Jahr war Grillen angesagt. Dann der Auftritt eines Zauberers und anschließend Disco.
Meine Mum verdrehte die Augen, als sie die Einladung sah. Ich wusste, sie mochte Fat Gavs Eltern nicht besonders. Einmal hatte ich gehört, wie sie zu Dad sagte, sie seien »großkotzig«. Erst als ich älter wurde, verstand ich, dass damit nicht irgendeine seltsame Krankheit gemeint war.
»Disco, Geoff?«, sagte sie zu meinem Dad. Sie betonte das so komisch, dass ich nicht erkennen konnte, ob sie das gut oder schlecht fand. »Was sagst du dazu?«
Dad ließ den Abwasch stehen, trat zu ihr und sah sich die Einladung an. »Könnte lustig werden«, meinte er.
»Du kommst nicht mit, Dad«, sagte ich. »Das ist eine Kinderparty. Du bist nicht eingeladen.«
»Doch, das sind wir.« Mum zeigte auf die Einladung. »Eltern willkommen. Bitte Würstchen mitbringen.«
Ich sah noch einmal hin und verzog das Gesicht. Eltern auf einer Kinderparty? Keine gute Idee. Gar keine gute Idee.
»Was schenkst du Fat Gav zum Geburtstag?«, fragte Hoppo.
Wir saßen auf dem Klettergerüst im Park, ließen die Beine baumeln und lutschten Cola-Wassereis. Murphy, Hoppos alter schwarzer Labrador, döste unter uns im Schatten.
Das war Ende Juli, knapp zwei Monate nach der schrecklichen Sache auf dem Jahrmarkt und eine Woche vor Fat Gavs Geburtstag. Langsam fanden wir in den Alltagstrott zurück, und ich war froh. Aufregung und Katastrophen waren nichts für mich. Normale Tage waren – und sind – mir lieber. Schon mit zwölf räumte ich meine Socken ordentlich in die Schublade und stellte meine Bücher und Kassetten alphabetisch geordnet ins Regal.
Vielleicht tat ich das, weil alles andere in unserem Haus so chaotisch war. Zum Beispiel war es nicht fertig gebaut. Auch das war typisch für den Unterschied zwischen meinen Eltern und anderen Eltern, die ich kannte. Abgesehen von Hoppo, der mit seiner Mum in einem alten Reihenhaus wohnte, wohnten die meisten meiner Mitschüler in schönen modernen Häusern mit gepflegten Vorgärten, die alle gleich aussahen.
Und wir wohnten in diesem hässlichen alten viktorianischen Haus, an dem ständig irgendwas repariert werden musste. Hinten gab es einen großen, zugewucherten Garten, bis an dessen hinteres Ende ich noch nie vorgedrungen war, und oben mindestens zwei Zimmer, wo man durch die Decke den Himmel sehen konnte.
Mum und Dad hatten es als »renovierungsbedürftig« gekauft, als ich noch klein war. Das war vor acht Jahren, und soweit ich das beurteilen konnte, gab es immer noch reichlich zu renovieren. Die Zimmer waren halbwegs bewohnbar. Aber in Flur und Küche war noch der nackte Putz an den Wänden, und Teppiche hatten wir nirgendwo.
Oben war noch das alte Badezimmer. Eine prähistorische Emaillewanne mit einer Spinne als Untermieter, einem undichten Waschbecken und einem antiken Klo mit Kettenspülung. Keine Dusche.
Als zwölfjähriger Junge fand ich das ungeheuer peinlich. Wir hatten nicht mal einen Elektroofen. Dad musste draußen Holz hacken, es reinschleppen und Feuer machen. Wie im finstersten Mittelalter.
»Wann wird das Haus endlich mal fertig?«, fragte ich manchmal.
»Dazu braucht es Zeit und Geld«, sagte Dad dann.
»Haben wir denn kein Geld? Mum ist Ärztin. Fat Gav sagt, Ärzte verdienen einen Haufen Geld.«
Dad seufzte. »Darüber haben wir doch schon gesprochen, Eddie. Fat … Gavin weiß auch nicht alles. Und vergiss nicht, meine Arbeit wird nicht so gut bezahlt und kommt auch nicht so regelmäßig.«
Und meistens hätte ich dann gern gefragt: »Warum kannst du dir nicht einfach einen richtigen Job suchen?« Aber dann hätte sich mein Dad nur aufgeregt, und das wollte ich nicht.
Ich wusste, Geldfragen waren Dad unangenehm, weil er nicht so viel verdiente wie Mum. Wenn er gerade mal nicht für Zeitschriften schrieb, arbeitete er an einem Buch.
»Wenn ich meinen Bestseller fertig habe, wird alles anders«, sagte er oft grinsend und zwinkerte mir zu. Er tat so, als sei das ein Scherz, aber ich denke, insgeheim glaubte er wirklich daran, dass es eines Tages passieren würde.
Doch dazu kam es nie. Höchstens ein bisschen. Ich weiß, dass er Manuskripte an Agenten schickte und dass eins davon sogar ein wenig Interesse weckte. Nur wurde irgendwie nie etwas daraus. Vielleicht hätte er es am Ende doch noch geschafft, wenn er nicht krank geworden wäre. Aber die Krankheit nahm ihm den Verstand, und als Erstes nahm sie ihm, was er am meisten liebte. Seine Sprache.
Ich lutschte fester an meinem Wassereis. »Über ein Geschenk hab ich noch gar nicht richtig nachgedacht«, sagte ich zu Hoppo.
Eine Lüge. Ich hatte darüber nachgedacht, lange und gründlich. Das war das Problem mit Fat Gav. Weil er so ziemlich alles hatte, war es echt schwierig, ihm ein Geschenk zu kaufen.
»Und du?«, fragte ich.
Er zuckte die Schultern. »Weiß noch nicht.«
Ich wechselte das Thema. »Kommt deine Mum zu der Party?«
Er verzog das Gesicht. »Kann ich nicht sagen. Vielleicht muss sie arbeiten.«
Hoppos Mum arbeitete als Putzfrau. Oft sah man sie in ihrem rostigen alten Reliant Robin in der Stadt herumtuckern, den Kofferraum mit Schrubbern und Eimern vollgestopft.
Metal Mickey nannte sie »Zigeunerin«, wenn Hoppo nicht dabei war. Ich fand das gemein, aber tatsächlich sah sie mit ihren struppigen grauen Haaren und ihren formlosen Kleidern ein bisschen wie eine Zigeunerin aus.
Wo Hoppos Dad abgeblieben war, weiß ich nicht genau. Hoppo sprach praktisch nie von ihm, aber ich hatte den Eindruck, dass er abgehauen war, als Hoppo noch ganz klein war. Hoppo hatte einen älteren Bruder, doch der war zur Armee gegangen oder so was. Im Rückblick kommt mir der Verdacht, unsere Gang könnte hauptsächlich deswegen zusammengefunden haben, weil keine unserer Familien ganz »normal« war.
»Kommen deine Eltern?«, fragte Hoppo.
»Glaub schon. Aber hoffentlich wird’s dann nicht langweilig.«
Er zuckte die Schultern. »Glaub ich nicht. Und dann kommt ja auch ein Zauberer.«
»Ja.«
Wir grinsten. Dann meinte Hoppo: »Wenn du willst, könnten wir uns ja mal die Schaufenster ansehen, ob wir was für Fat Gav finden.«
Ich zögerte. Eigentlich war ich gern mit Hoppo zusammen. Bei ihm musste man nicht dauernd kluge Sprüche absondern. Oder auf der Hut sein. Man konnte ganz locker bleiben.
Hoppo war zwar nicht der Gescheiteste, aber einer von denen, die immer zurechtkamen. Er versuchte nicht, sich bei allen beliebt zu machen wie Fat Gav, oder sein Fähnchen in den Wind zu hängen wie Metal Mickey, und dafür bewunderte ich ihn.
Deswegen war mir jetzt nicht ganz wohl, als ich sagte: »Geht leider nicht. Ich muss heim und Dad bei irgendwas im Haus helfen.«
Damit redete ich mich meistens raus. Kein Mensch konnte bezweifeln, dass in unserem Haus immer »irgendwas« zu tun war.
Hoppo nickte; er war mit seinem Wassereis fertig und ließ die Verpackung auf den Boden fallen. »Okay. Dann geh ich mit Murphy.«
»Okay. Bis später.«
»Bis dann.«
Er schlenderte davon, Ponyfransen im Gesicht, Murphy munter an seiner Seite. Ich warf mein Papier in den Abfalleimer und wandte mich in die entgegengesetzte Richtung, nach Hause. Und als ich außer Sichtweite war, machte ich kehrt und ging in die Stadt.
Ich belog Hoppo nicht gern, aber es gibt Dinge, die kann man nicht gemeinsam machen, nicht mal mit den besten Freunden. Auch Kinder haben Geheimnisse. Manchmal mehr als Erwachsene.