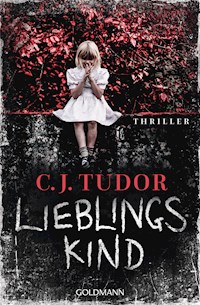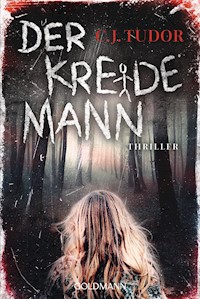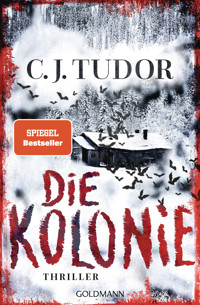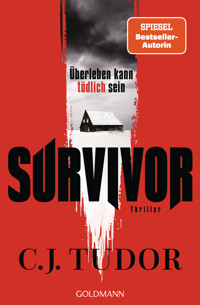9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meisterhafte Kurzgeschichten der SPIEGEL-Bestsellerautorin C.J. Tudor - dämonisch, dunkel, abgründig.
Als Olivia von dem Mann verlassen wird, den sie liebt, beschließt sie, sich eine Auszeit auf Gran Canaria zu gönnen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft in dem Hotel beschleicht sie ein ungutes Gefühl: Warum ergreifen zwei kleine Kinder bei ihrem Anblick schreiend die Flucht? Weshalb scheint sie fast der einzige Gast zu sein in dem prächtigen, aber verlassen wirkenden Etablissement? Und wie ist es zu erklären, dass sie ihre verstorbenen Eltern am Pool entdeckt? Nicht besser ergeht es einer Gruppe von Überlebenden, die auf einer einsamen Insel angespült werden und dort eine grauenhafte Entdeckung machen. Oder Leila, die auf einem riesigen Luxusliner festsitzt ohne die geringste Chance, ihrem schwimmenden Gefängnis zu entkommen – außer sie bezahlt mit dem Tod.
Willkommen in der »Villa der verlorenen Seelen«. Bleib, solange Du möchtest. Es ist ein wunderbarer Ort ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Als Olivia von dem Mann verlassen wird, den sie liebt, beschließt sie, sich eine Auszeit auf Gran Canaria zu gönnen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft in dem Hotel beschleicht sie ein ungutes Gefühl: Warum ergreifen zwei kleine Kinder bei ihrem Anblick schreiend die Flucht? Weshalb scheint sie fast der einzige Gast zu sein in dem prächtigen, aber verlassen wirkenden Etablissement? Und wie ist es zu erklären, dass sie ihre verstorbenen Eltern am Pool entdeckt? Nicht besser ergeht es einer Gruppe von Überlebenden, die auf einer einsamen Insel angespült werden und dort eine grauenhafte Entdeckung machen. Oder Leila, die auf einem riesigen Luxusliner festsitzt ohne die geringste Chance, ihrem schwimmenden Gefängnis zu entkommen – außer sie bezahlt mit dem Tod.
Weitere Informationen zu
lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
C.J. Tudor
Die Villa der verlorenen Seelen und andere Geschichten
Aus dem Englischen von Marcus Ingendaay
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »A Sliver of Darkness« bei Michael Joseph / Penguin Random House UK.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2025
Copyright © 2022 by Betty & Betty Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotiv: © Yolande de Kort / Trevillion Images
Redaktion: Regina Carstensen
CN · Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-30308-2V001
www.goldmann-verlag.de
Für Dad
Einleitung
Im Januar 2021 starb mein Vater.
Er lebte schon seit zwei Jahren in einem Pflegeheim, trotzdem war sein Tod ein Schock. Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnten wir ihn nur alle vierzehn Tage für eine halbe Stunde besuchen, und selbst dann waren wir durch eine Schutzwand aus Plexiglas voneinander getrennt.
Erst am Tag seines Todes konnte ich ihn wieder in die Arme schließen – das erste Mal seit über einem Jahr.
Allein das Jahr 2020 war schwer genug gewesen. Lockdown und Homeschooling zerrten an jedermanns Nerven. Dazu kam in meinem Fall, dass ich seit dem Herbst versuchte, meine Eltern von Wiltshire nach Sussex zu verpflanzen, wo ich mich besser um sie kümmern konnte.
Meine Mutter lebte zu dieser Zeit noch in unserem angestammten Familienhaus, sodass drei Dinge gleichzeitig anfielen. Ich musste nicht nur das alte Haus verkaufen, sondern auch eine geeignete neue Wohnung für meine Mutter finden, plus einen Pflegeplatz für meinen Vater. Alles höchst kompliziert, so viel sei gesagt. Zumal Wiltshire nicht direkt nebenan liegt.
Und in dem ganzen Durcheinander wollte ich noch ein Buch schreiben. Ich neige eigentlich nicht zum Jammern, aber mehr als einmal wachte ich morgens auf und fragte mich beklommen, wie ich an diesem Tag überhaupt irgendetwas zu Papier bringen sollte. Andererseits war mir die Situation nicht neu. Bei jedem vorangegangenen Buch gab es Phasen, in denen mir nichts richtig gelingen wollte. Ich tröstete mich immer damit, dass ich die problematischen Stellen später überarbeiten konnte. Hauptsache, nicht alles hinschmeißen.
Doch nach Dads Tod wurde alles noch viel schlimmer. Schon morgens den Laptop aufzuklappen, wurde zur Überwindung und jedes Wort zur Tortur. Vor allem die Dialoge zwischen den Figuren, die sich meistens so natürlich ergaben, klangen auf einmal künstlich und gewollt. Ich machte trotzdem weiter. Alles nur psychisch, redete ich mir ein.
Mein Bauchgefühl sagte etwas anderes.
Mein Bauchgefühl sagte: Aus diesem Buch wird nichts.
Gleichwohl ackerte ich tapfer weiter, bis auch das letzte Kapitel abgehakt war. Anschließend schickte ich das Manuskript an den Verlag, in der Hoffnung, wenigstens von dort ein positives Feedback zu erhalten. Doch schon ein Blick auf die Anmerkungen am Rand zeigte mir später, dass ich mit meinen Zweifeln nicht allein war.
Normalerweise bereiten mir selbst größere Änderungen keine Probleme. Diesmal jedoch schwante mir, dass das Buch nicht zu retten war, egal, wie lange ich daran herumdokterte. Erschwerend kam hinzu, dass mir die ganze Story mittlerweile zuwider war, weil sie sich nämlich auf vielfältige Weise mit dem zurückliegenden Schmerzensjahr verbunden hatte. Alle diese Gespenster noch einmal aufzuscheuchen … ohne Übertreibung, ich glaube, ich wäre darunter zusammengebrochen.
Ich tat also das einzig Richtige: Ich heulte mich bei meiner wundervollen Agentin Maddy aus und konnte nach einem längeren Gespräch zum ersten Mal wieder klar denken. Anschließend machte ich bei meinem Verlag reinen Tisch und bat um ein Jahr Pause bis zu meinem nächsten Roman. Die gewonnene Zeit wollte ich für ein langjähriges Herzenszprojekt – Survivor – verwenden, dessen Stunde ich endlich gekommen sah.
In unserer Aufmerksamkeitsökonomie sind solche Unterbrechungen heikel. Zudem taten mir meine Leserinnen und Leser leid, die im Jahr 2022 so gar nichts von mir hören sollten. Ersatzweise schlug ich meinen Lektoren einen Band mit Short Storys vor, ich liebte die kurze Form ohnehin, und die Gelegenheit schien günstig.
Mein ursprüngliches Buch dagegen wird vermutlich nie in Druck gehen, aber damit kann ich leben. Manchmal muss man einen klaren Schnitt machen, um sich weiterzuentwickeln. Überhaupt ist nichts im Leben (oder in der Literatur) wirklich vergebens. So taucht ein Abschnitt des verworfenen Romans in der vorliegenden Sammlung als Kurzgeschichte auf. (Wollen Sie raten, in welcher?)
Mein Vater war kein Mensch vieler Worte und zeigte ungern die ganz großen Gefühle. Aber ich weiß, er war stolz auf meine Bücher und meinen Erfolg. Ich bin froh, dass er das alles noch erlebt hat, und bedaure nur, dass er meine neuen Geschichten nicht mehr lesen wird.
Aber wir alle kommen im Buch des Lebens nur bis zu einer bestimmten Stelle – und müssen es dann für immer schließen.
Dieses Buch ist jedenfalls für dich, Dad. Nein, eigentlich für alle.
Traumziele
Vorgeschichte
2021 unternahm ich mit meiner Familie zum ersten Mal eine Kreuzfahrt.
Es war mitten in der Pandemie, deshalb war die kleine Rundreise durch britische Gewässer strikt als Staycation-Cruise gelistet – mit großem Bordprogramm, eingeschränktem Landgang und ausschließlich für englische Staatsbürger. Trotzdem, mir gefiel es. Durchgeführt von einem der größten Player auf dem Gebiet der Familienunterhaltung (denken Sie an die Maus), konnten Eltern zudem auf zahlreiche kindgerechte Animationsangebote zählen.
Und so plantschte unsere Tochter Betty zufrieden im Pool, während wir, die Eltern, obwohl mit eisgekühlten Cocktails gut versorgt, unweigerlich wieder auf das alles beherrschende Thema einschwenkten, nämlich die Pandemie, und wie die Menschheit bloß der drohenden Auslöschung entgehen könnte. Vielleicht durch ein spezielles Raumfahrtprogramm? Der Blick über das glitzernde Meer war herrlich, und ich erinnere mich, wie mein Mann daraufhin sagte: »Also, wenn ein Killervirus wirklich die ganze Welt ausradiert, bräuchte man eigentlich kein Raumschiff. Es genügt, wenn man die Leute alle auf ein riesiges Kreuzfahrtschiff packt.«
Die Idee gab mir zu denken.
Was mich an Themenparks so fasziniert, ist die Tatsache, dass sie sich immer auf der haarfeinen Demarkationslinie zwischen dem Zauberhaften und dem Unheimlichen bewegen. Sichtbar wird dies besonders bei stillgelegten oder heruntergewirtschafteten Parks. Jeder, der einmal Donnie Darko gesehen hat, weiß, dass ein plüschiges Hasenkostüm auch etwas zutiefst Verstörendes haben kann. Außerdem verändert sich mit der Zeit unser Blick. Eine knallbunte Gute-Laune-Welt mag für ein, zwei Wochen ganz nett sein, aber möchte man so leben – vor allem, wenn man, wie auf einem Kreuzfahrtschiff, der Zwangsbespaßung nicht entrinnen kann?
Meine erste Geschichte, Traumziele, befasst sich mit solchen Nebenwirkungen. Also alle an Bord für eine Vergnügungsreise der anderen Art, es geht los.
Sie träumte oft vom Ertrinken.
In den leeren Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen lag sie in ihrer schmalen Koje wach und stellte sich vor, wie die Wellen nach ihr langten. Natürlich war das Wasser eiskalt. Mit etwas Glück starb sie an Unterkühlung, bevor das Wasser ihre Lunge flutete. Und mit noch mehr Glück sorgte ein Meergott für ein rasches Ende.
Sie hätte gern gewusst, ob sie sich schon im Voraus eine Winterfeier wünschen konnte.
Und auch, wie es die anderen erlebt hatten. Und wann sie an der Reihe war.
Okay, heute schon mal nicht. Ihr Tagesablauf war eng getaktet. Nach dem Frühstück war Aqua-Aerobic, danach war Ruhezeit im Schatten, mindestens eine Stunde, wo sie etwas lesen könnte. Gefolgt von einem kleinen Spaziergang übers Schiff, ehe es Zeit fürs Mittagessen wurde. Am Nachmittag gab es oft ein von der Crew gestaltetes Showprogramm. Auch das war in der Regel sehr schön, selbst wenn die diversen Veranstaltungssäle sichtlich in die Jahre gekommen waren und nicht einmal die gnädigste Beleuchtung die blätternde Farbe und die verschossenen, vielfach geflickten Sitze kaschieren konnte. Doch die Leute taten ihr Möglichstes, solche kleinen Schönheitsfehler zu ignorieren, die meisten kannten es ohnehin nicht anders.
Sie hingegen schon. Sie erinnerte sich genau. Und sehnte sich zurück nach den alten Zeiten, in denen das Leben an Bord ein Luxus war, den sich nur wenige Privilegierte leisten konnten – statt diesem trostlosen Dauerzustand. Sie brauchte sich nur die Fotos an ihrer winzige Spiegelkommode anzusehen. Das eine zeigte sie alle am Tag der Abfahrt: Sie und Nick zusammen mit ihren Eltern. Wie jung sie damals aussah, als frisch getraute Ehefrau mit Mann. Und das war nicht einmal gelogen, sie waren jung damals. Sie fünfundzwanzig und Nick gerade mal zwei Jahre älter. Eigentlich hatten sie noch gar nicht gelebt. Zumindest hatten sie noch keinen größeren Schatz an Erfahrungen angesammelt, als sie an Bord gingen – und ihr ganzes Dasein auf ein paar Decks und die immer gleichen Kabinenflure zusammenschnurrte.
Das andere Foto betrachtete sie eher selten, weil der Anblick nur wehtat. Manchmal fragte sie sich sogar, warum sie es nicht weglegte. Bei den Machern waren Bilder von früher nicht gern gesehen. Über vermisste Personen sprach man nicht und gedachte ihrer erst recht nicht. Andenken, gleich welcher Art, waren verpönt. Doch es war das einzige Erinnerungsstück, von dem sich Leila nicht trennen konnte.
Das Foto ihrer Tochter Addison.
Das letzte, das von ihrem kleinen Mädchen gemacht wurde.
Addison an ihrem achtzehnten Geburtstag. Addison an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Allerdings war all das, was sie als Mädchen ausgemacht hatte, noch da. Die dunklen Haare, die ihr wild ins Gesicht fielen, das breite Grinsen, die blauen Augen, in denen Spott und Auflehnung blitzten. Zu viel der Auflehnung möglicherweise.
Vielleicht hätte Leila sie strenger erziehen, ihr weniger durchgehen lassen sollen. Nick hatte es versucht. Nick wollte sie mit sanftem Druck auf eher weibliche Betätigungsfelder lenken wie Nähen oder Kochen. Vielleicht hätte sie ihn besser darin unterstützt, statt Addy auch noch zu ermutigen, Maschinenbau und Wartungstechnik zu belegen.
Dummheiten und falsche Entscheidungen! Mit ein bisschen Lebenserfahrung, Selbsterkenntnis vorausgesetzt, ist man um eigene Beispiele nicht verlegen. Leila wandte sich von dem Bild ab, denn sie wollte pünktlich zum Frühstück erscheinen. Den Machern war ein fester Zeitplan wichtig, jede Abweichung davon brachte nur Unruhe ins Schiff.
Sie sah sich kurz im Spiegel an. Anders als jene, die sich gedankenlos dem Salzwind und der brutalen Sonne aussetzten, hatte sie sich ihren hellen, zarten Teint bewahrt. Sie hatte Fältchen, ja, viele sogar, aber bestimmt nicht diese gegerbte Lederhaut wie viele andere ältere Passagiere. Ähnlich stand es um die Sehkraft ihrer blauen Augen. Keinerlei Anzeichen für eine Linsentrübung, nur zum Lesen brauchte sie mittlerweile eine Brille. Ihre langen weißen Haare trug sie nicht umsonst zu einem straffen Knoten gebunden.
Leila lächelte ihrem Spiegelbild zu. Des Lebens Mai lag sicher schon eine Weile zurück, aber sie hielt sich eigentlich ganz gut. Genauso wie dieses Schiff.
In zwei Tagen feierte sie ein doppeltes Jubiläum: ihren fünfundsiebzigsten Geburtstag und ihr fünfzigstes Jahr an Bord.
Frühstück war an diesem Tag im Großen Saal.
Es gab drei verschiedene Restaurants, die, je nach Mahlzeit und Zimmernummer, umschichtig besetzt wurden. Leila stellte sich in die Schlange am Eingang zum Großen Saal, wo bereits der übliche Mix aus jungen Familien und älteren Herrschaften darauf wartete, platziert zu werden. Weiter hinten im Atrium vertrieben sich Kinder die Zeit mit Fangenspielen, als sei es das Normalste der Welt. Was es für sie auch war. Das Schiff mit seinen vierzehn Decks auf einer Gesamtlänge von 366 Metern war ihr ganzes Universum. Sicher, sie konnten, vom Oberdeck aus, den Blick scheinbar ungehindert schweifen lassen, aber nicht selten löste diese riesige Wasserfläche unter dem leeren Himmel in Leila eher Beklemmung aus. Wie klein ihre Welt geworden war!
Die Essensschlange bewegte sich vorwärts. Lächelnd nickte Leila bekannten Gesichtern zu. Irgendwann stand auch sie vor dem Pult des Restaurantmanagers.
»Mrs Simmonds, wie ist das werte Befinden heute?« Der Restaurantmanager war ein kleiner, makellos gestylter Herr mit sonnengebräunter Haut und bohrenden schwarzen Augen. Er hieß Julian. Seit zehn Jahren nun, seit dem Ausscheiden seines Vaters aus derselben Position, war er hier der Chef über das gesamte Geschehen, aber Leila konnte sich noch immer nicht mit ihm anfreunden, denn Julian stand in dem Ruf zu petzen. Jedenfalls hatten die Passagiere gelernt, in seiner Nähe auf ihre Worte zu achten.
Leila lächelte auch ihn an. »Danke, Julian, sehr gut. Und wie geht es Ihnen?«
»Oh, mir geht es immer gut, Mrs Simmonds, vor allem, wenn ich Gäste wie Sie begrüßen darf.« Sein Lächeln war ebenso scheuerfest wie unecht. »Ihre Tischpartnerin ist bereits da. Warten Sie, ich bringe Sie hin.«
Leila war sofort beunruhigt. »Bin ich etwa zu spät?«
»Aber keineswegs. Ihre Tischgenossin war heute Morgen nur schon etwas früher da.« Sein Lächeln wurde breiter und zerrte an den Mundwinkeln, weil sein restliches Gesicht das Lächeln nicht mitmachte. Irgendetwas stimmte hier nicht. »Bitte folgen Sie mir.«
Leila folgte ihm in gewundener Linie durch die mustergültig eingedeckten Tische. Alles im Großen Saal war nach Art eines viktorianischen Tearooms gestaltet. Wohin man sah, gefakte Kandelaber und dekorative Kunstgegenstände zweifelhafter Qualität. Tapeten mit Blumenmuster. Und natürlich die Porträts der berühmtesten Trickfiguren der Macher, auch sie passend in historischer Kostümierung. Sogar die Arbeitskleidung des Servicepersonals folgte der thematischen Vorgabe, mit langen Röcken und hochgeschlossenen Blusen für die weiblichen und dem klassischen schwarzen Dreiteiler für die männlichen Kräfte. Die lückenlose Halluzination einer anderen Realität mochte albern erscheinen, aber die Macher wussten genau, was sie taten. Ihre Kulisse hatte vier Wände – und das nonstop. Das angestrebte Passagiererlebnis durfte keine Sekunde lang durch konzeptfremde Elemente gestört werden.
Und so war auch der typische Hotel-Frühstücksgeruch (mit Basisnoten aus gebratenen Speckstreifen und frisch gebackenen Waffeln) reine Aromachemie, die per Lüftungssystem über die Leute gebracht wurde. Tatsächlich hatten die Passagiere schon ewig kein echtes Fleisch mehr gegessen, und selbst das Frühstücksangebot an Bord war recht überschaubar. Es beschränkte sich im Wesentlichen auf Müsli, Toast und Früchte der Saison von einem der riesigen schwimmenden Nahrungsmittelerzeuger, sogenannten Harvestern.
Trotzdem war an diesem Morgen das Stimmengewirr erheblich. Der Saal war zwar groß, und es saßen mindestens schon hundert Gäste. Aber so laut war es eigentlich nie. Meistens saßen die Gäste nur stumm vor ihrem frugalen Mahl und machten sich allenfalls durch klapperndes Besteck auf feinem Porzellan bemerkbar. Was gab es auch groß zu reden, ohne Nachrichten, ohne Politik, ohne Promi-Gossip und die kleinen und großen Skandale, welche uns sonst in Atem halten? Was es im Überfluss gab? Es gab die Zeit. Zeit, die Seele baumeln zu lassen. An diesem Morgen jedoch, das spürte sie, lag Anspannung in der Luft.
»Da wären wir, Madam.«
Leilas Tischgenossin erwartete sie bereits an ihrem Stammplatz vor einem der großen Bullaugen. Julian schob Leila den Stuhl heran.
»Danke«, sagte sie.
Julian wippte neben ihr auf und ab wie ein flugunfähiger Vogel. »Kaffee kommt sofort, Madam.«
Leila wandte sie nun der Frau zu, die äußerlich so ganz anders war als sie. Leila war hochgewachsen und von kantiger Statur, die sie immer leicht in Verlegenheit brachte. Mirabelle dagegen war ein federleichtes Persönchen von maximal ein Meter fünfzig mit mageren, tief bronzierten Gliedmaßen und einer riesigen UV-gebleichten Fönfrisur. Selbst in Innenräumen war sie nie ohne ihre Sonnenbrille zu sehen, die beinahe ihr halbes Gesicht abdeckte.
Noch ehe Leila zur Speisekarte greifen konnte – mehr aus Gewohnheit denn aus Neugier, da sie seit Jahrzehnten stets dasselbe Frühstück zu sich nahm –, lehnte sich Mirabelle weit über den Tisch und flüsterte: »Hast du schon gehört?«
Und so etwas kam nicht oft vor. Denn Mirabelle war vornehm, richtig vornehm sogar. Zwar rechnete sich auch Leila zur kultivierten Oberschicht, wohlhabend genug, um die strengen Aufnahmekriterien der Macher zu erfüllen. Doch Mirabelle gehörte zur Crème de la Crème und verkörperte, wie man früher einmal sagte, »altes Geld«. Einer ihrer Ex-Ehemänner (inzwischen verstorben) war einst Erster Offizier auf diesem Schiff, ihr ältester Sohn war der jetzige Deckoffizier. Dazu kam ihre Tochter, welche das gesamte Entertainment an Bord verantwortete. Selbst auf einem Traumschiff, dieser schwimmenden Utopie der Gleichheit, waren einige offenbar gleicher als andere.
Und das merkte man. Während Leila nach Nicks Tod gehalten war, in eine kleinere Einzelkabine umzuziehen, durfte die verwitwete Mirabelle in ihrer großzügigen Suite wohnen bleiben. Allerdings mochte bei dieser Entscheidung auch mitgespielt haben, dass die heiratslustige Witwe sich meist schnell den nächsten Mann angelte. Ehe die Einzelkabine drohte, war sie wieder zu zweit.
Leila setzte ihre Brille auf und nahm die Speisekarte zur Hand.
»Was gehört?«, fragte sie so beiläufig wie möglich. Sie wusste, wie sehr die Macher solche Gerüchte unterbinden wollten.
Eine perfekt geformte Augenbraue wölbte sich über dem oberen Rand von Mirabelles Designerbrille.
»Einer aus der Mannschaft …«, sagte sie und deutete mit violettem Fingernagel die Halsabschneider-Geste an.
Leila blickte sie über ihre Karte hinweg an. »Wirklich? Tot?«
Mirabelles Lächeln zeugte von einem Hochgefühl, das dem grausigen Sachverhalt nicht gerecht wurde. »Man hat ihn heute Morgen aus dem Kinderbecken gefischt«, erklärte sie.
Leila tat unbeeindruckt und starrte die Freundin nur weiter an. »Du meinst aus Mikey’s Mini-Funpool?«
Dies war in der Tat etwas Neues. In der Vergangenheit hatten sich schon Leute das Leben genommen, sowohl unter der Mannschaft als auch bei den Passagieren. Aber sich im Kinderbecken zu ertränken, wo der nächste Ozean nur wenige Schritte entfernt lag, schien originell.
»Selbstmord?«, fragte sie.
»Eben nicht«, wisperte Mirabelle. »Angeblich war es Mord.«
Plötzlich spürte Leila, wie sie ihre Augen aufriss. »Mord?«
Mirabelle nickte entzückt. »Abgestochen.« Abgestochen. Daher also die Unruhe im Speisesaal.
Etwas Vergleichbares hatte es in fünfzig Jahren – offiziell – nur ein einziges Mal gegeben, als ein Passagier seine Frau im Streit erwürgte. In anderen Fällen wurde zwar viel gemutmaßt, doch das Logbuch verzichtete auf das M-Wort. Es war auf einem Schiff auch nicht so einfach, sich einer Leiche zu entledigen, umso eigenartiger wirkte der Fund im Pool.
Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit war Leila von etwas gepackt.
»Weiß man schon, wer der Täter ist?«
Mirabelle schüttelte den Kopf. »Nein, sie sind derzeit noch voll damit beschäftigt, alles zu vertuschen.«
Was nachvollziehbar war. Nichts durfte die unbeschwerte Ferienstimmung trüben. Und sie alle, Leila eingeschlossen, hatten an dieser Inszenierung mitgewirkt, schon aus Angst vor den Konsequenzen. Doch diesmal – der Lärmpegel im Speisesaal bewies es – schien alles nichts mehr zu fruchten. Die Leute ließen sich nicht mehr den Mund verbieten.
»Andererseits«, sagte Mirabelle, »wer wird es schon gewesen sein? Bestimmt wieder ein Prolet aus der Mannschaft, der seine kleinen deprimierenden Streitigkeiten um Drogen oder Mädchen nicht anders zu lösen vermochte als so.«
Sie rümpfte missbilligend die Nase. Es war einer dieser Momente, in denen Leila den Snobismus ihrer langjährigen besten Freundin einfach taktlos fand.
»Und was, wenn nicht?«, entgegnete sie. Sie konnte nicht anders. »Was, wenn es ein Passagier war?«
Mirabelle schnaubte. »Warum sollte ein Passagier jemanden aus der Mannschaft ermorden? Das ist doch albern.«
Bei Leila sträubten sich die Nackenhaare. Zum Glück erschien im selben Moment die Kellnerin, eine glutäugige Latina mit Namen Luciana.
»Einen wunderschönen guten Morgen, die Damen. Haben Sie schon gewählt?«
»Ja«, sagte Leila schnell. »Für mich bitte den Haferjoghurt mit Knuspermüsli, dazu Toast und Marmelade.«
»Sehr gern. Und für Sie, Madam?« Sie wandte sich an Mirabelle.
»Ach, wissen Sie«, sagte sie, begleitet von einem tückischen Lächeln, »zur Feier des Tages würde ich gern ein paar Eier Benedict killen.«
Das Schiff verfügte über zwei Sonnendecks, drei Pools, zwei Wasserrutschen und ein halbes Dutzend Bars und Außenbistros. Im Innern erwarteten die Gäste drei große Restaurants, zwei Cafés sowie sechs weitere Bars und zwei Theatersäle, dazu ein Gym, eine Wellness-Oase und etliche Shops mit einem ausgewählten Angebot an Souvenirs und Geschenkartikeln, die aber kein Mensch kaufte, denn wer verlangt schon nach Andenken an ein Schiff, von dem man nie herunterkommt?
Doch auch dies diente der Aufrechterhaltung der großen Kreuzfahrt-Lüge. Ohne sie hätten die Passagiere ihrer aussichtslosen Lage ins Auge blicken müssen. Nach Jahren der verordneten Trägheit war es fast unmöglich, sich einzugestehen, dass sie alle Verdammte auf einem Fliegenden Holländer waren.
Zudem wusste man, was jenen widerfuhr, die es dennoch taten. Leila absolvierte also ihren gewohnten Morgenspaziergang, zwei Runden über das Oberdeck, wo bereits die ersten Liegestühle besetzt waren. Und warum auch nicht? Die Lufttemperatur betrug angenehme zweiundzwanzig Grad bei schwachem Wind. Ein Blick in den saphirblauen Himmel mit lediglich vereinzelten Schleierwolken versprach einen schönen Tag. Einen schönen Tag mehr. Aber der Kapitän tat auch alles Menschenmögliche, das Schiff in Schönwettergebieten zu halten. Vielleicht sehnte sich Leila deshalb so nach Regen und Sturm, wenigstens von Zeit zu Zeit. Nicht einmal stärkere Böen kannte man an Bord. Geschweige denn Blitz und Donner. Geschweige denn das Rascheln von Herbstlaub. Geschweige denn das kitzlige Gefühl von Gras unter nackten Füßen oder – meinetwegen – den Matsch, durch den man nur mit Gummistiefeln kam. Allesamt vergessene Freuden. Hier auf dem Schiff existierte nur knarzendes Schiffsparkett und der gedämpfte Tritt auf den einstmals luxuriösen, jetzt nur noch schäbigen Teppichböden in Restaurants und Lounges. Seit fünf Jahrzehnten hatte Leila keinen Fuß an Land gesetzt, und nun, kurz vor ihren fünfundsiebzigsten Geburtstag, rechnete sie auch nicht mehr damit.
Sie beschleunigte ihre Schritte und versuchte, sich zusammenzureißen. Solche Grübeleien brachten nie etwas. Sie begrüßte mehrere Paare auf ihren Liegestühlen, junge Leute, schlank, sonnengebräunt. Sie hoffte, dass wenigstens sie das süße Nichtstun genossen. Mit einundzwanzig war die schöne Zeit für sie ohnehin zu Ende, dann wurden sie für mindestens zwei Jahre zum Mannschaftsdienst abkommandiert, so wollten es die Aufenthaltsbestimmungen des Schiffes. Überraschenderweise blieben einige sogar dabei, wenn ihre Dienstzeit endete. Was vielleicht weniger verwunderlich war, als es zunächst schien. Denn Freizeit war eigentlich nur dann schön, wenn sie die Ausnahme darstellte und nicht einer Verurteilung zur Untätigkeit gleichkam. Inzwischen stammte ein Großteil der Crew aus den Reihen der Passagiere. Die Arbeit gab ihrem Leben einen Sinn. Es war schon frappierend, zu sehen, wie sich die Wünsche des Menschen veränderten. Wie ungeliebte Tätigkeiten zur Beglückung und das scheinbar große Los zum Fluch werden können. In vielerlei Hinsicht stand das Leben an Bord auf dem Kopf. Doch immerhin war es ein Leben. Das Schicksal der Zurückgelassenen war ungleich grausamer.
Leila ging die Treppe zum Spaßbad hinunter, wo sich Jung und Alt im großen Pool vergnügten oder eine der Wasserrutschen hinuntersausten. Das Kinderbecken, Mikey’s Mini-Funpool, hingegen war noch immer abgesperrt und mit einer Plane bedeckt. Laut Hinweisschild arbeitete Mikey »mit Hochdruck daran, dass der Spaß weitergehen kann«. Oder entfernte Mikey mit dem Hochdruckreiniger nur das Blut?, fragte sich Leila. Überhaupt warf der Tote im Pool Fragen auf. Warum hatte man ihn nicht einfach über die Reling gehen lassen? Vielleicht weil der oder die Täter gestört wurden oder ihnen aus einem anderen Grund die Zeit davonlief?
Leila war selber überraschte, welche makabre Faszination sie aus dem Vorfall zog. Es war seit Langem das erste Mal, dass ihr Verstand eine ernst zu nehmende Aufgabe erhielt. Sie sah sich auf der Pool-Ebene um. Auch dort gab es lange Reihen mit Liegestühlen, dazu eigene Gastro-Bereiche, wo die Badegäste kleine Erfrischungen zu sich nehmen konnten. Leila hätte zu gern gewusst, ob sich am Verhalten der Leute etwas verändert hatte oder ob sie so taten, als wäre nichts passiert. Allerdings war man im Spaßbad nie allein, alle paar Meter stand jemand von der Crew, und es empfahl sich nicht, öffentlich über die Zustände an Bord zu diskutieren. Jedenfalls nicht vor einer offiziellen Stellungnahme der Schiffsführung.
»Verbreitung von Unzufriedenheit« galt als schweres Vergehen und wurde entsprechend geahndet. Wiederholungstäter kamen gar ins Reeducation-Center im ehemaligen Nachtclub unterhalb des Theatersaals, genannt »Mikey’s Fun-Lab«. Was genau dort vor sich ging, darüber wurde nicht gesprochen, aber Leila hatte mehrere Delinquenten nach der Umerziehung erlebt – gedrückte Gestalten mit glasigem Blick, die innerlich wie entkernt wirkten.
An einen erinnerte sie sich sogar genau, einen lebenslustigen jungen Kellner mit blendendem Lächeln, der immer wieder spitze Bemerkungen über »die da oben« fallen ließ: Bobby. Das ging so lange, bis er im Reeducation-Center landete. Als er wieder auftauchte, war sein ganzer Überschwang dahin, und er bewegte sich so furchtsam durch die Gänge wie ein Greis. Auch sein hinreißendes Lächeln war nicht mehr da, sondern kam, wenn überhaupt, mit Verzögerung, ohne Beteiligung der Augen. Nur wenn zweimal am Tag die berühmten Trickfiguren der Macher ihre Tanzeinlage hinlegten, durchzuckte es ihn, und er klatschte Beifall, als hinge sein Leben davon ab.
Eines Tages lief Leila auf dem Oberdeck geradewegs auf ihn zu, und als sie die Hand erhob – wohlgemerkt, nur zur Begrüßung –, erschrak er so sehr, dass er stolperte und stürzte. Dabei fiel irgendetwas aus seinem Mund. Leila wollte den Gegenstand für ihn aufheben, doch er war schneller. Es war ein Gebiss.
Entgeistert verfolgte sie, wie er sich das Teil wieder in den Mund stopfte.
»Was haben sie dir angetan?«, fragte sie.
Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er flüsterte: »Das sehen Sie ja. Sie haben mir mein Lächeln genommen.«
Leila sah ihn danach nie wieder. Am nächsten Tag hieß es, es habe einen tragischen Unfall gegeben und er sei ins Wasser gestürzt. Gemessen an der Sicherheitskultur des Schiffs und der Zahl der einschlägigen Vorschriften kam es erstaunlich oft zu derartigen Unfällen.
Sie fuhr zusammen, als eine Hand ihren Arm berührte.
Sie drehte sich um. Ein junges blondes Crewmitglied von etwas zu gewöhnlicher Attraktivität (»Chrystelle« laut Namensschild) blickte sie besorgt an. Leila riss sich auf der Stelle zusammen. Alles, was irgendwie nach Kritik klang, konnte sich ungünstig auswirken.
Sie machte also gute Miene. »Nein, alles gut«, erklärte sie. »Ich war nur einmal mehr überwältigt von dem schönen Tag.«
Chrystelle stufte ihr Lächeln hoch.
Sie haben mir mein Lächeln genommen.
»Nicht wahr. Einfach fantastisch!«
»Und so reizend, den Kindern beim Plantschen zuzuschauen.«
»Die Kinder liegen uns ganz besonders am Herzen.«
»Schade nur, dass Mikey’s Mini-Funpool gerade geschlossen ist.«
Chrystelles Lächeln hielt stand. »Nun ja, auch der Mini-Pool braucht mitunter ein kleines Verwöhnprogramm. Gerade das Becken für die Kleinen sollte sich jederzeit im Bestzustand präsentieren, meinen Sie nicht?«
»Auf jeden Fall«, sagte Leila und verbreiterte ihr Lächeln ebenfalls bis zur Schmerzgrenze. »Und Sie von der Mannschaft kümmern sich ja wirklich um alles.«
»Oh, wir machen nur unseren Job.«
»Trotzdem, Sie sollten wissen, wie dankbar wie Ihnen dafür sind.«
Worauf Chrystelle nickte und befriedigt von ihr abließ. Leilas Lächeln fiel in sich zusammen. Das Klischee von der tütteligen Oma beherrschte sie so gut, dass sie manchmal selber daran glaubte. Zumindest war es an Bord immer einfacher, sich innerhalb der zugewiesenen Rolle zu bewegen. Hier war Fassade alles. Insofern saßen sie und die Macher – sorry – durchaus im selben Boot.
Sie setzte sich an ihren gewohnten Tisch und schlug ihren zerlesenen Krimi auf, doch sie konnte sich nicht konzentrieren. Sie starrte auf die gedruckten Wörter, aber die kamen nicht bei ihr an. Ihre Gedanken wanderten augenblicklich erneut zu dem realen Mord. Der Tote im Schwimmbecken dürfte den Machern nicht gefallen, denn er war nicht geplant. Für gewöhnlich war alles geplant, sogar der Tod. Und so sehr sie sich auch bemühten, die Sache unter Verschluss zu halten, die Gerüchte schwirrten bereits hin und her. Und Gerüchte waren schlecht für die Moral, vor allem die Moral jener, deren Stilllegungsfeier näher rückte.
Die Stilllegungsfeierlichkeiten waren jedes Mal eine große Sache auf dem Schiff, fast wichtiger als Weihnachten. So wie zurzeit wieder. Die ersten Plakate und Girlanden hingen schon, und bis zum Wochenende war das ganze Schiff geschmückt. Die Theatertruppe probte die große Abschiedsgala, in der Küche liefen die Vorbereitungen für das Galadinner, und die Macher kamen langsam zu einer Entscheidung, welches Kind in diesem Jahr die Ruheständler auswählen durfte.
Normalerweise oblag dies den Allerkleinsten und galt als große Ehre. Entsprechend erbittert kämpften die Eltern darum. Leila konnte bereits ehrgeizige Mütter beobachten, die Mädchen in Prinzessinnen-Kostümen vor dem Bühneneingang in Stellung brachten. Und wie immer lächelte Leila ihnen aufmunternd zu, und die Kleinen lächelten zurück. Nur die Mütter schlugen diesmal betreten, fast schuldbewusst die Augen nieder. Immerhin war Leila schon recht betagt, und es war alles andere als ausgeschlossen, dass ein kleiner Zeigefinger in diesem Jahr auf sie deutete.
Leila hatte nicht übel Lust gehabt, ihnen allen zuzurufen: Freut euch nicht zu früh. Eines Tages seid ihr an der Reihe. Die Stilllegung passiert uns allen – falls wir nicht bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen.
Sie klappte ihr Buch zu und ließ den Blick über das Pooldeck schweifen. Die ringsum angebrachten Lautsprecher knisterten, und Kinder kreischten vor Vergnügen, als die fröhliche Durchsage kam: »So und jetzt begrüßt bitte alle zusammen: Käpt’n Mikey und seine fidele Bagage!«
Daraufhin ertönte blechern Käpt’n Mikeys Erkennungsfanfare, und die fidele Bagage kam angetanzt. Die jüngeren Kinder jubelten und winkten, die Älteren spielten einfach weiter. Sie hatten das alles schon tausendmal gesehen. Genau wie Leila.
Dennoch verfolgte Leila den Auftritt mit großer Aufmerksamkeit. Von Weitem verströmte er zwar noch die alte karnevaleske Buntheit, doch der nähere Blick enthüllte: Die Kunstpelze waren längst räudig geworden, die Kostüme fadenscheinig, die Flicken darauf echt und nicht nur aufgemalt. Selbst die Lieder klangen erschöpft. Aber sie würden sich nie ändern. Nichts an Bord würde sich je ändern, es sei denn … Leila stutzte und blickte über ihre Lesebrille hinweg. Da war Käpt’n Mikey. Und Rachel Rabbit. Und Susie Squirrel. Und Chrissy Cat … Moment mal, da fehlte doch einer. Einer war nicht da: Donnie Dog, Addisons absoluter Liebling. Der Hund mit dem kecken Halsband und dem himmelwärts gebogenen Schwanz, der freche kleine Kerl, der Käpt’n Mikey und seine biedere Bagage immer wieder »voll verarscht«.
Wenn sich also nie etwas änderte, wo war dann Donnie?
»Ihr Wasser, Madam«, sagte eine gedämpfte Stimme unmittelbar neben ihr.
Sie blickte hoch, wollte schon sagen, dass sie kein Wasser bestellt habe … und erschrak.
An ihrem Tisch stand Donnie Dog und setzte mit pelziger Pfote das Glas ab. Sein übergroßer struppiger Schädel wackelte dabei so diensteifrig hin und her, dass selbst die lange rosa Gummizunge in Bewegung geriet.
Doch das konnte unmöglich stimmen. Die Maskottchen gehörten nicht zur Service-Brigade. Donnies Platz war vorn bei den anderen, die gerade ihre Tanzeinlage absolvierten. Doch ehe sie zu einem Schluss gelangte, walzte Donnie schon wieder von dannen, und Leila sah ihm perplex nach. Was ging hier vor?
Übelkeit überkam sie wie sonst nur bei höherem Wellengang, was aber die Ausnahme darstellte. Auch jetzt war die See spiegelglatt, die Sonne schien, und aufgewühlt war nur sie selbst.
Waren das die ersten Anzeichen? War sie nicht mehr ganz richtig im Kopf? Beim letzten Gesundheitscheck war sie noch »unauffällig« gewesen, wie es hieß. Aber vielleicht wollte der Arzt sie nur nicht unnötig aufregen. Alle hier wussten, wenn es erst einmal so weit war, blieb – als humanste Lösung – nur die vorzeitige Stilllegung.
Vielleicht hätte Leila dem Arzt sagen sollen, dass sie keine Angst vor dem Sterben hatte. Wie auch? Die einzigen beiden Menschen, die sie je geliebt hatte, ihre Tochter und ihr Mann, waren schon tot. Selbst wenn sie nicht an ein Jenseits glaubte, so hatte der eigene Tod zumindest den Vorteil, dass sie an diesem Verlust nicht weiter zu leiden hatte. So sehr ihr dieser Schmerz in den letzten Jahrzehnten zur zweiten Natur geworden war, so frisch war er jeden Morgen, wenn sie die Augen aufschlug – und, ehrlich, wer brauchte das?
Leila griff nach ihrem Wasser und hielt inne. Unter dem Glas lag ein Zettelchen. Unauffällig blickte sie sich um. Niemand beachtete sie, alle Augen waren auf die Animation der fidelen Bagage gerichtet. Leila zog den Zettel unter dem Glas hervor und ließ ihn in ihrem Buch verschwinden. Vorsichtig senkte sie den Blick.
0 Uhr an Sammelplatz 1.
Ihre Finger zitterten, und abermals ergriff sie ein Schwindelgefühl. Käpt’n Mikey und Konsorten waren bei ihrer Schlussnummer angelangt.
»Because we’re loving life
and loving you …
and you …
and you …«
Der ewig gleiche Refrain.
Sammelplatz ١.
Dort, wo ihre Tochter zuletzt lebend gesehen wurde.
Addison war schon immer ein wildes Kind gewesen, hatte früh sprechen, früh laufen gelernt. Und nutzte es, um sich von ihrer Mutter zu entfernen oder ihre Nähe mit einem wütenden »Nein!« abzuweisen.
Auch Leilas Mutter, Addisons Großmutter, fand ihr Enkelkind gleichermaßen bezaubernd wie schwierig.
»Du solltest sie mehr an die Kandare nehmen«, riet sie Leila und Nick mehr als einmal. »Sie wickelt euch beide doch um den kleinen Finger. Dieses Kind braucht mehr Strenge.«
Aber Strenge fruchtete erst recht nicht. Oder wurde vielmehr grundsätzlich infrage gestellt. Schon in jungen Jahren reagierte sie heftig auf ungerechte Machtausübung. »Weil ich es sage«, war für dieses Mädchen also nie eine zureichende Antwort. Die ärgerliche Gegenfrage kam immer postwendend: »Und warum? Nur weil du es sagst, ist es noch lange kein Grund.«
Hatte Leila nicht absehen können, dass Addisons Verlangen nach vernünftigen Antworten eines Tages ihr Untergang sein würde? Wie häufig sie wegen Addisons Renitenz schon beim Leiter der bordeigenen Schule gesessen hatte, konnte sie gar nicht zählen. Aber sie erinnerte sich an das letzte Mal, als er sie geradezu beschwor: »Hören Sie, Addison ist sicher ein hochbegabtes Kind, und das Schiff könnte eines Tages von ihren Fähigkeiten profitieren. Jedoch … wenn sie die Macher weiterhin auf diese Weise kritisiert, dann, fürchte ich, werden wir zu anderen, intensiveren Lehrmethoden übergehen müssen.«
Genau das hatte ihr Addison noch am selben Tag in aller Ruhe erklärt. Fragen durfte sie haben, aber manchmal war es klüger, mal den Mund zu halten, zumindest vor der Klasse. Sonst konnte es sein, dass die Macher sehr, sehr böse mit ihr würden und ihretwegen die ganze Familie bestraften.
Addison war ganz erschrocken – und fragte in aller Unschuld: »Aber warum gefällt das den Machern nicht?«
Auch dies eine berechtigte Frage, auf die Leila nur seufzen konnte: »Ich fürchte, sie haben Angst, dass den Leuten die Antwort nicht gefällt.« Sie ergriff Addisons Hand. »Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, Addison, aber, bitte, tu mir die Liebe: Keine weiteren Fragen mehr. Mach einfach, was der Lehrer euch sagt.«
Worauf Addison nickte. »Okay, versprochen.«
Leilas Lächeln war dennoch eher traurig. »Hör mal, eines Tages wirst du das besser verstehen. Eigentlich können wir uns glücklich schätzen, überhaupt auf diesem Schiff zu sein, wo wir in Sicherheit sind. Und die Macher tun wirklich alles, damit es uns hier an nichts fehlt. Also verscherze es dir nicht.«
Und Addison nickte abermals, aber nur, um noch eine allerletzte Frage nachzureichen: »Aber wenn es doch so toll ist und wir uns glücklich schätzen sollen und alles, warum traut sich dann niemand, etwas zu sagen? Warum haben alle Angst?«
Zu Mittag gegessen wurde an diesem Tag in der Artist’s Suite, einem minimalistischen Saal, dessen Wände mit Konzeptstudien aus der Frühzeit von Mikey und Co. dekoriert waren. Erinnerung an andere, unschuldigere Zeiten.
Sogar die alten Trick- und Familienfilme liefen nach wie vor auf dem Hotelkanal, wenn auch nicht alle. Reale Städte, für viele an Bord ohnehin eine ungewohnte Vorstellung, waren ebenso tabu wie alles, was an die Erde von früher erinnerte. Stattdessen sollten ausgerechnet Märchen über Drachen und Prinzessinnen sowie Weltraumabenteuer vor unrealistischen Erwartungen schützen.
Verrückt, dachte Leila oft. Wenn Kinder sich in Zauberreichen besser auskannten als in dem Land, in dem sie geboren wurden.
Leila ließ sich an ihren Stammplatz führen. Abermals war Mirabelle schon da. Wie schaffte es diese Frau bloß, keine Mahlzeit auszulassen und trotzdem kein Gramm zuzunehmen? Aber dass sie schon so früh im Restaurant saß, war auch für Mirabelle die Ausnahme. Offenbar gab es Neuigkeiten, die sie unbedingt loswerden musste.
Genauso war es. Leila hatte nicht einmal ihren Platz eingenommen, als Mirabelle sich über den Tisch lehnte.
»Weißt du schon das Neueste?«
Leila tat so, als sei die Menükarte vorerst interessanter.
»Worüber?«, fragte sie.
»Na, über den Mord natürlich«, platzte es aus Mirabelle hervor.
Leila hielt die Luft an und prüfte die Umgebung. Offenbar hörte niemand zu, aber man konnte nicht vorsichtig genug sein. Unentwegt strichen Kellner durch den Saal, lautlos wie Ninjas.
»Müssen wir das unbedingt jetzt besprechen?«, wisperte sie.
»Von mir aus können wir über das Wetter reden.« Mirabelle simulierte ein Gähnen.
»Dann sag schon.«
»Sie haben das Opfer identifiziert!«
Leila starrte ihre Freundin an. Mirabelle hatte ihre Ohren überall, und ihre Quellen waren über jeden Zweifel erhaben. Der Vorteil einer einflussreichen Familie. Deshalb kam sie mit ihrem losen Mundwerk auch immer davon. Es gab einfach zu viele Leute, die ihre schützende Hand über sie hielten. Leila konnte nur hoffen, dass dies in abgeschwächter Form ebenfalls für Mirabelles engste Vertraute galt, also sie selbst.
Doch genau das war alles andere als sicher. Denn gegen sie, Leila, lag bereits etwas vor: Addison. Sie durfte sich also nicht annähernd dasselbe herausnehmen wie Mirabelle. Die Geduld der Macher war endlich, auf Nachsicht konnte sie nicht hoffen. Ein Punkt, den Mirabelle überhaupt nicht begriff. Nicht jeder besaß ihren Sonderstatus.
»Ach wirklich?«, fragte sie leise. »Wer ist es?«
Mirabelle lächelte selbstgefällig. »Nun, das ist in der Tat interessant«, sagte sie. Ihre Vorfreude war offensichtlich. Doch erst einmal drehte sie sich der herbeieilenden Kellnerin zu. »Lucy, wo bleiben Sie denn? Ich dachte, Sie kommen heute gar nicht mehr. Dabei bin ich am Verhungern.«
Die Bestellung war schnell erledigt: Salat und Suppe, wie immer. Kaum war Lucy fort, erhob Mirabelle ihr Weinglas und trank einen Schluck. Leila hielt es kaum noch aus.
»Nun, was ist jetzt?«, drängte sie.
»Richtig, ja. Also …«, sagte sie und zog das Wort absichtlich in die Länge. »Du kennst das Opfer. Es ist einer aus der Küchenbrigade: Sam Weatherall.«
Leila fiel das Buttermesser aus der Hand, und das Klirren hallte durch den ganzen Saal. Schon drehten sich die Ersten nach ihnen um. Verdammt.
Sie wollte das Messer vom Boden aufheben, doch ein Kellner kam schon mit einem neuen.
»Bitte bemühen Sie sich nicht, Madam. Lassen Sie mich das aufheben. Alles in Ordnung bei Ihnen?«
»Aber ja«, sagte Leila. »Was bin ich nur für ein Trampel!«
»Wir haben doch nicht wieder Kreuzsee?«, intervenierte Mirabelle. »Sagen Sie bloß, Sie haben das nicht mitbekommen, junger Mann.«
»Ähm … sicher. Sie haben recht. Bitte entschuldigen Sie.«
Stumm entschwand er in der Unsichtbarkeit. Leila holte tief Luft und versuchte, ihre Fassung wiederzugewinnen. Sie griff nach ihrem Wein und nahm einen Schluck.
»Das tut mir jetzt leid«, sagte Mirabelle in einem seltenen Anflug von Selbstkritik. »Ich dachte, du freust dich darüber.«
Leila, die sich mittlerweile wieder voll unter Kontrolle hatte, sagte nur: »Ach, was nützt das alles noch?«
Mirabelle blickte sie unverwandt an. »Na ja, Darling, wenn mir so etwas passiert wäre … und ich hätte soeben erfahren, dass der Mann, der meine Tochter verraten hat, endlich die Quittung dafür bekommt, also, ich würde Freudentänze aufführen.«
Doch außer einem Engegefühl in der Brust und einem Kloß im Hals spürte Leila rein gar nichts. »Ich bin eben nicht du«, sagte sie und stand auf. »Entschuldige, ich muss mal kurz auf die Toilette.«
Aufrecht wie ein Grenadier, das Gesicht starr geradeaus gerichtet, schritt sie durch den Speisesaal hinaus zu den Damentoiletten. Am Ziel angelangt, zitterten ihre Beine, und ihre Miene war durch die krampfhafte Selbstkontrolle wie versteinert.
Zum Glück war in der Damentoilette niemand, alle Kabinen waren leer.
Leila beugte sich über das Waschbecken und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Mehrmals holte sie tief Luft, ehe sie sich in einer der abgetrennten Einheiten einschloss. Außer der eigenen Kabine war dies der einzige Ort, an dem man wirklich für sich war. Und selbst für die Kabinen galt eine empfohlene Verweildauer von maximal zehn Stunden täglich. Länger sollte niemand unbeaufsichtigt existieren.
Sie setzte sich auf den geschlossenen Toilettendeckel und stützte den Kopf in die Hände, um wieder zu sich zu kommen.
Nun gut. Sie haben also die Leiche identifiziert. Es ist Sam aus der Küche.
Sam war einer von Addisons ganz alten Freunden. Er gehörte zu der Clique, in der sie gespielt und gelernt und mit der sie ihre Pubertät durchgemacht hatte – bis hin zur zweijährigen Dienstzeit in der Schiffsmannschaft.
Alles hatte man miteinander geteilt. Und war wohl auch gemeinsam auf die geniale Idee gekommen, »nach achtern zu gehen«, wie es im Schiffsjargon genannt wurde. Es war ein anderes Wort für heimlich auschecken und in den Augen der Macher gleichbedeutend mit Landesverrat. Aber wiederum nur inoffiziell. Offiziell wollte man nicht einmal zugeben, dass es solche Unzufriedenen überhaupt gab, die auf der Kreuzfahrt ihres Lebens einfach ausstiegen.
Und doch gab es sie, Leute, die plötzlich nicht mehr da waren. Die Fälle wurden totgeschwiegen oder als »tragische Unfälle« abgehakt. Selbst wenn dies eine Lüge war, fragte sich Leila zuweilen, wie viele von ihnen es am Ende geschafft hatten, allein, mitten auf dem Ozean, dem Meergott und den Kreaturen der Tiefe schutzlos ausgeliefert.
Denn das Kreuzfahrtschiff mied – aus Furcht vor Kontamination durch Landwinde – alle küstennahen Gewässer. Frische Lebensmittel bezog man von schwimmenden Farmen, und man folgte auf einem endlosen Schlingerkurs den großen Hochdruckgebieten, bis die Passagiere an Bord jede Orientierung verloren hatten. Selbst die Gestirne schienen irgendwann zu lügen.
Nur ganz selten, meistens bei Nacht und vor drohenden Stürmen, verließ das Schiff die hohe See, und so mancher schickte dann einen sehnsuchtsvollen Blick nach dem, was am Horizont mehr zu erahnen als zu erkennen war: Festland, Terra firma, auf ewig verlorene Heimat. Doch kein einziges Mal in all den Jahren hatte sie von jemandem gehört, der es tatsächlich bis dorthin geschafft hatte.
Und in der ganzen Zeit kam auch nur ein einziges Rettungsboot abhanden.
Nämlich das mit ihrer Tochter.
Sie waren zu fünft gewesen, Freunde seit frühester Kindheit. Wie alle Teenager wurden sie angetrieben von einer Mischung aus Frust und Rebellion. So weit, so normal wie Akne und überschießende Hormone. Eine Phase, die sich auch wieder legte, sobald sie älter wurden. Aber nicht bei Addison. In Addison loderte ein existenzielles Feuer, das nicht einfach in sich zusammenfiel, nur weil etwas Zeit vergangen war. Leila hätte wissen können, dass aus dem nervigen kleinen Mädchen irgendwann der Desperado erwachsen würde, der es einfach wissen wollte. Während andere sich nach und in die Realitäten an Bord einfügten, war sie wie ein eingesperrtes Tier. Sie würde sich nie mit den Käfiggittern abfinden.
Aber sie war auch schlau, übertraf die in sie gesetzten Erwartungen locker und schluckte begeistert, was immer ihr die Macher vorkauten.
Nur Leila fiel auf, dass sie dabei diesen fernen Blick hatte. Als hätte sie innerlich längst abgeheuert.
Was Addison und ihre Freunde konkret planten, wusste sie hingegen auch nicht. Das schmerzte zuweilen. Dann wieder redete sie sich ein, dass Addison lediglich versucht hatte, Schaden von ihr, Leila, fernzuhalten, indem sie sie ahnungslos hielt. Tatsächlich konnten ihr die Macher später nichts nachweisen. Trotzdem wünschte sie heute, sie hätte ihrer Tochter nähergestanden, öfter mit ihr geredet, besser Bescheid gewusst. So, wie sie sich wünschte, Sams Verrat hätte besser funktioniert und das Rettungsboot hätte gar nicht erst abgelegt. Ein selbstsüchtiger Wunsch, zugegeben. Auf jeden Fall war es knapp. Es kam sogar zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf zwei Seeleute sowie ein Flüchtling im Wasser landeten. Die Seeleute wurden später gerettet, der Flüchtling nicht. Und das Boot mit den drei Jugendlichen, darunter Addison: unauffindbar.
Was nichts bedeuten musste. Ihre Überlebenschance war so oder so gering. Selbst wenn sie festes Land erreichten, es war wohl kaum ein gelobtes Land, sondern ein auf Jahrhunderte verseuchtes Sperrgebiet, Aufenthalt nicht empfohlen. Und die verbliebene Menschheit, weit entfernt, sich glücklich zu schätzen, zurückgefallen auf einen vorzivilisatorischen Zustand nahe am Tier. Allein auf den gigantischen Kreuzfahrt-Archen war menschliches Leben noch möglich.
Aber warum haben dann alle Angst?
Leila seufzte. Sie machte Sam keinen Vorwurf.
Andererseits hielt sich ihre Erschütterung über seinen gewaltsamen Tod in Grenzen.
Sie hatte ihn seit Addisons Flucht ohnehin nur noch sporadisch gesehen. Für seine Beteiligung an der Sache (auch wenn er in letzter Sekunde abgesprungen war) kam er erst in die Reeducation und wurde danach ausschließlich in Verwendungsbereichen unter Deck eingeteilt. Direkt begegnet waren sie sich nie. Was hätte sie ihm zudem sagen sollen? Warum musstest du meine Tochter ans Messer liefern? Wo wolltet ihr eigentlich hin? Zwanzig Jahre war das jetzt her. Spielten Antworten überhaupt noch eine Rolle?
Das Rettungsboot wurde auch später nicht gefunden, aber das war wenig überraschend. Vielleicht war es gekentert oder an irgendeiner Felsenküste zerschellt. Die See war erbarmungslos. Zu gern hätte sie geglaubt, dass Addison noch lebte, aber manchmal war diese Hoffnung schwerer zu ertragen, als sich endlich ihrer Trauer hinzugeben.
Sie fuhr zusammen, als die Tür zur Damentoilette aufging. Der Aufenthalt auf den Toiletten zu einem anderen als dem vorgegebenen Zweck war nicht ratsam, Weinen ging gar nicht. Sie stand auf und betätigte schnell die Wasserspülung. Dann zupfte sie ihr Kleid zurecht, setzte ihr normales Gesicht wieder auf und trat aus der Kabine.
Seltsamerweise war der Vorraum leer, niemand da, obwohl sie definitiv jemanden gehört hatte. Allerdings konnte es sein, dass die Klospülung übertönt hatte, wie diese Person wieder gegangen war.
Sie trat an die Waschbecken und kontrollierte sich im Spiegel. Sie durfte nicht so derangiert in den Speisesaal zurückkehren. Nicht nur Mirabelle fiel so etwas auf, auch die Kellner hatten einen Blick für jede Art Unregelmäßigkeit.
Das harsche Licht der Deckenbeleuchtung machte sie älter. Unter der schlaffen, faltigen Haut war die Frau, die sie einst gewesen war, kaum mehr zu erkennen. Aber so wütet die Zeit in jedem Gesicht. Vielleicht ganz gut, dass sie selbst in der Blüte ihrer Jugend nie die große Schönheit gewesen war, so hielt sich der Verlust in Grenzen. Und vielleicht wäre er noch weniger bitter, wenn die Spuren der Zeit wenigstens redlich erworben wären. Durch Erfahrungen, gute wie schlechte, Höhen und Tiefen, durch Arbeit, durch Ortswechsel, kurz, durch das, was gemeinhin Leben genannt wurde.
Aber da war nichts. Es gab kein Leben, kein Drama, nur ewigen Stillstand. Sie war eine Topfpflanze, die zwar regelmäßig gewässert, aber auch an der Entfaltung gehindert wurde.
Als sie den Wasserhahn aufdrehte, sah sie etwas im Waschbecken liegen, einen kleinen Stein. Sie hob ihn auf und drehte ihn in der Hand. Der Stein war rau. Auf einer Seite ein spiralförmiges Muster, der Abdruck eines vor Jahrmillionen gestorbenen Lebewesens. Ein Fossil, dachte Leila. Sie war noch ein Kind, als sie so etwas zum letzten Mal gesehen hatte. Auf einem Schiff kamen Steine nicht vor. Auch kein Sand, kein Gras, keine Erde.
Ein Stein wie dieser konnte nur vom Festland stammen.
In diesem Moment spürte sie, wie eine Welt ins Wanken geriet. Nein, unmöglich.