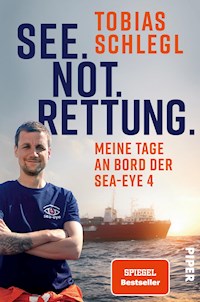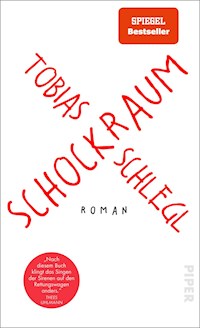
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irgendetwas stimmt nicht im Leben von Notfallsanitäter Kim. Er fühlt sich wie betäubt, ist ängstlich und macht Fehler, die seine Patienten gefährden. Auch seine Beziehung zu Marie geht in die Brüche. Was Kim nicht wahrhaben will: Er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung – ausgelöst von einem Einsatz, den er verdrängt hat. Auf einem Roadtrip mit seinem besten Freund Benny lernt er Luzi kennen. Sie bietet ihm einen unverhofften Ausweg. Doch Kim hat nur eine Chance, wenn er sich seinen Ängsten stellt … Mitreißend und temporeich zeichnet Tobias Schlegl ein alarmierendes Bild von den schwierigen Arbeitsbedingungen in unserem Gesundheitssystem und teilt zugleich seine große Leidenschaft für seinen überlebenswichtigen Beruf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
WIDMUNG
PROLOG
WARUM?
AUFWACHEN
DARUM
WACHE
FREUNDSCHAFT
MARIE
SCHLECHTER SCHERZ
THE LONG NIGHT
TAG 1
TAG 2
TAG 3
TAG 4
METALHEAD
AM RAND
WEISSER ORDNER
ESKALATION
KÖLN
HALT SIE FEST
ERKENNTNIS
VOR ZEHN MONATEN
ALLEIN
ZU ZWEIT
MARIE
TEAMPARTNER
KOLLEGEN
SCHICHT
SCHOCKRAUM
BRIEFE
EPILOG
TEXTNACHWEISE
WIDMUNG
Für alle, die sich im sozialen Bereich engagieren. Für alle, die sich im ökologischen Bereich engagieren. Für alle Kolleginnen und Kollegen.
PROLOG
Einhundertsieben Jahre. Neuer Rekord. So alt war noch keine meiner Patientinnen.
»Als junge Frau war ich Schauspielerin. Stellen Sie sich vor, ich habe noch in einem Stummfilm mitgespielt!«
»Tatsächlich?«, staune ich, nehme den leeren Infusionsbeutel vom Haken und hänge einen neuen an.
»War alles noch in Schwarz-Weiß damals. Ich hatte langes schwarzes Haar. Das sah gut aus auf der Leinwand! Dazu meine großen dunklen Augen …« Der Wagen bremst, ich halte mich an der Rückenlehne der Trage fest. Sie ist hochgestellt, damit Frau Jakobi es bequemer hat. Ihre Haare sind inzwischen schlohweiß, die Augen eingerahmt von etlichen Lachfältchen.
Die Frau blitzt mich schelmisch an und drückt meinen Unterarm: »Sie sind aber auch noch ganz schön knackig!«
Ich lache. »Sind Sie auf der Suche?« Ich muss laut sprechen, um den Motor zu übertönen.
»Ach, wo denken Sie hin, ich nicht mehr! Aber meine Tochter.«
»Ja?« Die Blutdruckmanschette pumpt sich auf. Auf dem Monitor beobachte ich die Messwerte.
»Ich stell sie Ihnen gleich mal vor. Sie wartet an der Klinik auf mich.«
Ihr Blutdruck ist in Ordnung.
Sie beobachtet mich.
»Und, mögen Sie Ihre Arbeit?«
»Ja, schon. Ich bin noch mitten in der Ausbildung. Aber es gefällt mir. Ich kann Menschen helfen, das ist toll. Und am Ende des Tages weiß ich, was ich getan hab. Ehrlich gesagt auch körperlich. Ist schon viel Geschleppe. Und die Schichten sind lang.«
»Na, das ist doch kein Problem für Sie! Sie sind doch noch jung!«, schäkert sie.
Frau Jakobi bekommt allmählich wieder eine rosige Gesichtsfarbe. Sie hatte den Notruf gewählt, weil ihr schwindelig geworden war. Vielleicht die Hitze draußen oder einfach nur Flüssigkeitsmangel. Weil wir aber nicht ausschließen konnten, dass sie einen Schlaganfall hatte, haben wir sie mitgenommen, zur Kontrolle.
Ein Rumpeln. Der Rettungswagen schwankt. Der lästige Bordstein an der Krankenhausauffahrt. Meine Kollegin Laura hat nicht rechtzeitig abgebremst.
»Verzeihen Sie die kleine Achterbahnfahrt«, sage ich.
»Alles gut, Schätzchen. Mich haut so schnell nichts um.« Sie grinst mich an.
»Das merke ich!« Ich grinse zurück. Der Wagen hält an, der Motor geht aus.
»Wir müssen uns jetzt leider schon verabschieden«, sage ich, öffne die Hintertüren und springe nach draußen. Schwüle schlägt mir entgegen.
»Na, warten Sie mal! Sie wollten doch noch meine Tochter kennenlernen!«
Ach ja. Bin gespannt. Wie die Mutter, so die Tochter, sagt man doch. Sicherlich eine schöne, witzige Frau.
Laura hilft mir, die Trage aus dem Wagen zu ziehen. »Ich hab gleich ein Blind Date«, sage ich, und sie rollt mit den Augen.
Die alte Dame reckt den Kopf. »Da ist sie ja!« Sie hebt ihren Arm samt Infusionsschlauch und winkt. »Hallöchen, Liebes! Hier bin ich!«
Ich drehe mich um und kann es nicht fassen. Auf uns schlurft eine alte Oma zu, über einen Rollator gebeugt, das silbergraue Haar zu einem festen Dutt gebunden. Fast so alt wie Frau Jakobi, nein, eigentlich sieht sie sogar älter aus. Was hatte ich denn anderes erwartet? Wenn die Mutter einhundertsieben ist, dann muss die Tochter so um die achtzig sein!
»Darf ich vorstellen?«, fragt unsere Patientin und kann sich das Lachen kaum verkneifen. »Elisabeth, meine Tochter. Und das ist Kim, mein Retter!«
Später sitze ich mit Marie auf unserem Balkon. Eine der seltenen lauen Sommernächte in Hamburg. Es ist schon spät, aber wir wollen beide nicht, dass der Abend endet. Vor uns zeichnen sich schwarz die Giebel und Schornsteine der Nachbarhäuser ab, über uns der Nachthimmel, der niemals ganz dunkel ist in dieser Stadt.
»Und dann kam raus: Mein Blind Date Elisabeth war siebenundachtzig!« Wir kichern. Marie boxt mir liebevoll in die Seite.
»Damit das klar ist. Du sollst nicht mit anderen Frauen flirten. Du hast mich!«
Ich halte mir theatralisch die Rippen und blicke sie an. Sie ist perfekt. Hübsch. Schlau. Lustig. Physiotherapeutin. Sie kümmert sich um andere, wie ich, hilft Menschen und liebt die Foo Fighters, wie ich. Und sie lacht viel. Laut lachen mit Marie, mehr brauche ich nicht.
»Ich meine das ernst! Wenn du dir noch einmal von einer Siebenundachtzigjährigen den Kopf verdrehen lässt, mach ich dich fertig!« Sie holt aus und boxt mich noch einmal. O fuck, das hat gesessen. Der Schmerz lässt meinen Oberkörper reflexartig nach vorn schnellen. Ich nehme ihre Faust und küsse sie.
DARUM
Benny geht nicht ran. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Bin jetzt erreichbar. Ruf einfach an. Und lass meine Augen in Ruhe.
Keine Häkchen. Ungewöhnlich, normalerweise antwortet er direkt. Woher er die Zeit dafür hat, erklärt sich, wenn man Bennys Arbeitgeber kennt. Benny fährt auch im Rettungsdienst. Aber für die Feuerwehr. Die eine Hälfte der Arbeitszeit ist er für den Rettungsdienst zuständig, die andere für den Brandschutz. Und da seit der Erfindung der Rauchmelder selbst in Großstädten relativ selten ein Großbrand ausbricht, hat Benny mehr Zeit, mit seinem Smartphone zu spielen.
Ich bin trotzdem alles andere als neidisch. Ich will keine Brände löschen. Feuerwehrmann sein ist für mich keine Option.
Zum Abendbrot schnippele ich mir einen Salat. Blätter, Tomaten, Mozzarella, Dosenmais. Die Gurke ist schrumpelig, sie landet im Müll. Marie hätte die vielleicht noch gegessen, aber sie ist nicht da. Mit einer Freundin verabredet.
Ich summe gegen den Tinnitus an. »Hatten Sie in der letzten Zeit vielleicht viel Stress?«, hat der Arzt gefragt.
Ich hab mit den Schultern gezuckt. »Nicht mehr als sonst.«
Am Rand der Schüssel klopfe ich den Schneebesen ab, dann gieße ich die Soße über den Salat und streue noch ein paar Kürbiskerne drüber.
Nicht mehr als sonst. Stimmt ja gar nicht. Bin viel gestresster als sonst. Nichts hat sich verändert, und doch fühlt sich alles anders an, beängstigend, bedrohlich. Auf einmal ist da diese Panik, wie beim Metalhead. Fuck, warum habe ich mir nur diesen Job ausgesucht? Wieso bin ich so blöd und tue mir das an?
Der Salat steht vor mir, aber ich mag nichts davon essen. Ich weiß es doch genau. Ich weiß, warum ich mir das antue. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Auch wenn das alles andere als nahelag und schwer zu erklären ist. Wenn Kollegen fragen, erzähle ich meist irgendeinen Bullshit.
Meine Lieblingsantwort ist: »Ich hab mich schon immer für Medizin interessiert und hab das nach dem Abi eigentlich studieren wollen – wenn mein anderer Job nicht dazwischengekommen wäre.« Was für ein herrlicher Quatsch.
Ich wusste damals überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und auf keinen Fall wollte ich Medizin studieren. Ich hatte panische Angst vor medizinischen Eingriffen. Allein wenn mir Blut abgenommen wurde, musste ich mich fürchterlich konzentrieren, damit mir nicht schwarz vor Augen wurde. Ich hasse das Gefühl, wenn ich merke, wie mir das Blut langsam aus der Vene gesaugt wird. Ich bilde mir ein, ein lautes schmatzendes Saugen zu hören. So widerlich.
Ich bin nach wie vor froh, dass ich bisher noch nie eine größere OP über mich ergehen lassen musste. Die Mandeln wurden mir entfernt, da war ich sieben. Das reicht mir an OP-Erfahrung völlig aus. Ich hab mich damals wie E. T. gefühlt. Kurz davor, von Regierungsschergen bei lebendigem Leibe aufgeschnitten und seziert zu werden. Nach und nach entfernen sie die einzelnen Organe, und E. T. muss dabei zusehen. Das ist mein persönliches alternatives Ende von E. T. Und so ausgeliefert habe ich mich damals auf dem Operationstisch gefühlt. Vermummte Gestalten drückten mir eine Maske aufs Gesicht und befahlen mir, rückwärts zu zählen: zehn … neun … acht … sieben … und dann fielen mir die Augen zu. Und als ich erwachte, hatte ich höllische Schmerzen im Rachen. Ich konnte nicht mehr schlucken, ohne das Gesicht zu verziehen, ich fühlte mich misshandelt. Ich wollte nur noch raus aus dem Krankenhaus.
Ein Jahr später hatten wir Schulfest, wir tobten im Klassenzimmer, und ich wollte allen zeigen, wie groß ich bin. Dass ich schon die Decke berühren kann. Auf Zehenspitzen, die Arme gereckt, unter mir ein Stuhl, der auf einem Tisch stand. Hab die Decke nicht erreicht – und dann das Gleichgewicht verloren. Unterarmbruch.
In der Notaufnahme waren zwar alle nett zu mir, aber ich hatte ein Problem, das mich wahnsinnig machte: Es dauerte alles viel zu lang. Seit Wochen hatte ich mich auf den Abend gefreut. Im Fernsehen lief Dumbo, und meine Eltern hatten mir nach langem Quengeln erlaubt, den Film zu gucken. Obwohl er erst um 20.15 Uhr anfing und obwohl es unter der Woche war.
Und da saß ich, in der Notaufnahme, und es war 20.35 Uhr, und alle Erwachsenen hatten die Ruhe weg. Sogar meine Eltern auf der Heimfahrt, obwohl sie doch um die Brisanz der Lage wussten. Als wir zu Hause waren, konnte ich noch die letzten fünfzehn Minuten sehen. Was für eine Enttäuschung. Ich fand das schlimmer als den Bruch.
Ich erinnere mich auch noch, wie meine Großtante im Sterben lag. Da war ich elf Jahre alt. Meine Eltern mussten mich regelrecht zu ihr schleifen. Ich wollte die Tante zwar sehen, aber ich wollte nicht ins Krankenhaus.
Dann stand ich an ihrem Bett und sah ihr aufgequollenes Gesicht. In ihrem Hals steckte ein Schlauch, und die Geräte piepten, als gäbe es gleich eine Sprengstoffdetonation.
Nein, Krankenhäuser waren alles andere als positiv besetzt für mich. Ich hätte niemals Medizin studiert, damals, nach dem Abi. Ich habe einen bequemeren Weg gewählt.
Da gab es diesen Kumpel, der war ein paar Jahre älter und arbeitete in einer Werbeagentur. Ein kleines Start-up, das schnell wuchs und dringend Manpower benötigte. Dort jobbte ich nachmittags, schon in der Schulzeit. Einen Besseren hätten sie nicht finden können. Wenn ich will, kann ich Leute ganz gut überzeugen und sie für etwas begeistern, das sie eigentlich gar nicht interessiert. Ich lernte, pointierte Texte zu schreiben, Websites zu bauen, und ich war gut. Die Seiten wurden geklickt.
Das lief parallel zur Oberstufe. Meine Eltern haben immer aufs Geld geachtet, wollten nie viel von dem ausgeben, was sie sich hart erarbeitet hatten. Und auf einmal konnte ich mir Dinge leisten, die meine Klassenkameraden nicht hatten. Eine Videokamera, einen größeren Fernseher, eine Spielekonsole, das erste eigene Auto, selbst gekauft. Und natürlich: Reisen. Mit dem Skateboard im Gepäck nach New York. Das war immer mein Traum. Nach dem Abi hab ich ihn mir erfüllt.
Dann bekam ich das Angebot, bei einem großen Hamburger Unternehmen einzusteigen. Quer einzusteigen. Bei einer angesagten Klamottenmarke als Junior Assistant Product Content Manager. Oder so ähnlich. Die Titel wechselten jährlich. Der Job war aufregend, die Bezahlung unverschämt, und ich habe oft in mich hineingegrinst, dass ich mich ohne Ausbildung und Studium so weit hochgearbeitet hatte.
Nach ein paar Jahren allerdings kamen erste Zweifel: Was mache ich hier eigentlich? Ist es das, wofür es sich zu leben lohnt? Immer nur Werbung? Braucht das irgendjemand? Mach ich das jetzt noch dreißig Jahre bis zur Rente, und dann sterbe ich? Und ist es mir eigentlich völlig egal, wo, von wem und unter welchen Bedingungen diese Klamotten hergestellt werden?
Mit den Jahren wurden die Fragen quälender. Ich konnte sie nicht länger ignorieren. Ich brauchte einen radikalen Schnitt. Ich wollte einen Beruf, der das genaue Gegenteil von dem war, was ich bisher gemacht hatte. Ich wollte mutig sein. Verwegen. Ich wollte, dass meine Kollegen mich für völlig bescheuert erklären. Ich wollte einen Job, der keine oberflächliche Scheiße propagiert. Ich wollte Inhalt. Inneren Halt. Erfüllung. Wert. Nichts, aber auch gar nichts gesellschaftlich Wichtiges hatte ich bis dahin geschaffen. Was wäre passiert, wenn mich ein Verrückter auf offener Straße erschossen hätte? Mein Leben wäre wertlos gewesen. Eine leere Hülle, die in sich zusammenfällt.
Das war der Zustand vor meiner Ausbildung zum Notfallsanitäter. Bevor ich alles zurück auf null gesetzt hab. Diesmal wollte ich nicht den bequemen Weg, ich wollte den steinigen. Ein langes Medizinstudium kam mit Anfang dreißig nicht mehr infrage. Aber eine Ausbildung. Also habe ich quasi auf dem Absatz kehrtgemacht und bin in die andere Richtung gelaufen. Meiner großen Angst entgegen. Als Auszubildender musste ich in den drei Jahren allein siebenhundertzwanzig Stunden im Krankenhaus arbeiten. Besonders viele davon im OP. Guten Tag, Angst. Hier bin ich.
Ende der Leseprobe