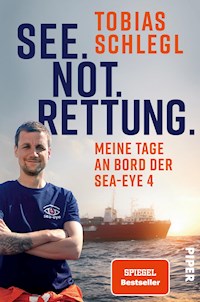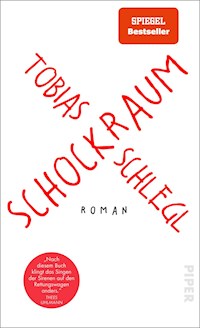19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nora ist wie vom Blitz getroffen. Sie steckt mitten in der Ausbildung zur Notfallsanitäterin, als sie bemerkt: Sie ist schwanger. All ihre Pläne lösen sich plötzlich in Luft auf. Um einer Entscheidung zu entkommen, wirft sie sich in das Praktikum auf der Demenzstation. Dort trifft sie Diddy, der alles gibt für seine eigenwilligen Patienten. Und sie begegnet Frank, einem verschlossenen Typen, der selbst mal Sanitäter war und im Notfall über sich hinauswächst. Notfälle hat es hier zuletzt auffällig viele gegeben. Bald erkennen Nora und Diddy, dass Frank für den Rausch des Rettens Leben aufs Spiel setzt … Ein mitreißender, berührender Roman übers Helfen und Hilflosigkeit, über Pflege, Macht und die Frage nach dem Wert des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Tobias Schlegl 2023
((immer))
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
EPILOG
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Conny
1
Nora schwankt nach rechts, ihre Schulter rummst gegen die Tür. Sie greift nach einem Mantel an der Garderobe und zieht sich wieder hoch.
Nichts rührt sich. Nur nicht Sonja wecken, das hat sie ganz und gar nicht gern, gesunder Schlaf muss sein. Nora schleicht durch den Flur zum Bad, erleichtert, dass keine Diele knarzt. Sie will bloß raus aus den verschwitzten Klamotten, sich die Haare bürsten und mit einer Paracetamol dem Kater vorbeugen.
Sie tastet nach dem Schalter unter dem Spiegel, da ist er – und da ist sie. Nora blinzelt sich an. Ein paar Strähnen haben sich aus dem Pferdeschwanz gelöst, die Wimperntusche ist ein wenig verschmiert. Sie lässt kaltes Wasser über ihre Hände laufen, taucht das Gesicht ein und trinkt, viele kräftige Schlucke, um den Wodka zu verdünnen, den Schwindel zu vertreiben. Damit der eine freie Tag morgen nicht komplett fürn Arsch ist. Gut, dass sie sich nicht dazu hinreißen lassen hat, mit Tino rumzumachen. Keiner aus dem Jahrgang, lautet die Regel. Außerdem wäre es unfair gegenüber Stefan. Was auch immer das mit Stefan ist. Nora grinst in ihr Handtuch. Wäre er dabei gewesen, wäre sie sicherlich nicht nach Hause gekommen.
Nora wühlt in ihrer Schublade. Fenistil, Nasenspray, Vomex. Keine Kopfschmerztabletten. Egal, Sonja hat bestimmt welche. Sonja hat alles. In welcher ihrer Kisten und Kästchen sind die Medis? In der großen weißen. Yes. Desinfektionsspray, Allergiepillen, Halsschmerztabletten, Hustenlöser, Jodsalbe, Wundheilsalbe, Arnikasalbe, Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin. Sogar ein Schwangerschaftstest. Auf Vorrat, man weiß ja nie. Sonja ist echt unglaublich.
Nora lässt sich auf den Klodeckel sinken, in ihrem Bauch gluckert es, die Welt wankt noch immer. Ein Schwangerschaftstest. Seit einer Woche sind ihre Tage überfällig. Aber eine Woche, was heißt das schon? Der Schichtdienst bringt alles durcheinander. Und sowieso, Stefan und sie haben aufgepasst. Da kann überhaupt rein gar nichts passiert sein.
Nora zieht sich den Hoodie samt T-Shirt über den Kopf und stopft ihn in den Wäschesack neben der Dusche. Ab wann kann man so einen Test durchführen? Sie öffnet noch einmal Sonjas weiße Kiste und zieht die hellblaue Packung heraus. Sicherheit ab dem ersten Tag der ausgefallenen Periode. Dann kann sie es doch sofort machen. Dann ist die Sache erledigt. Dann halten sie mit dem RTW am Montag an der Apotheke, und sie besorgt Sonja Ersatz. Also, was sagt der Beipackzettel?
Das Ding sieht aus wie ein Coronatest, eine schmale Plastikkassette mit Sichtfenster, an dessen Rand ein C und ein T. Am unteren Ende der Teststreifen, da muss sie zehn Sekunden draufpinkeln. Sie hält den Test in den Strahl und zählt. Es kann auch Vorteile haben, mal ordentlich einen zu bechern. Mit der freien Hand faltet sie etwas umständlich ein paar Blätter Klopapier und drapiert sie unter dem Test auf dem Spülkasten. Jetzt genau fünf Minuten warten.
Sie löst ihren BH und schlüpft in den Pyjama von Papa. Viel zu groß, aber gemütlich. Papa. Sie will gar nicht dran denken. Während sie die Zahnbürste kreisen lässt, zwingt sie sich, nicht hinzugucken. Was soll schon sein? Wäre doch absurd. Jetzt schwanger, mit dreiundzwanzig, mitten in der Ausbildung.
Gerade als sie die Kappe mit der Mundspülung ansetzt, vibriert das Handy. Sie schielt zum Klo. Zwei Striche. Sie kippt die Spülung in den Mund, stellt die Kappe ab und beugt sich nach vorn. Ja – zwei Striche. Nora schnappt nach Luft, die scharfe Flüssigkeit gelangt in ihren Rachen, sie würgt und prustet, die Mundspülung sprenkelt die Klobrille grünlich. Zwei Striche, einer bei C und einer bei T. Das muss ein Irrtum sein.
Es klopft.
»Nora, alles in Ordnung?« Sonja. Verschlafen und not amused.
»Ja, alles okay!«
»Bist du grad erst gekommen?«
»Ja, war wild heute.«
Sonja stöhnt auf. »Musst du dich übergeben?«
»Nein, ich hab mich nur verschluckt.«
»Brauchst du Hilfe?«
»Nein, nein – alles gut!« Warum gibt die nicht auf?
»Kann ich bitte auf die Toilette?«
Hektisch wischt Nora die Klobrille trocken und versteckt die Bestandteile des Tests unter dem Pulli im Wäschekorb. Dann hält sie inne, zieht die Gebrauchsanweisung wieder raus und klemmt sie unter dem Bündchen ihrer Schlafanzughose fest.
Im Bett knipst sie die Nachttischlampe an und liest. Es ist zu berücksichtigen, dass unter bestimmten Umständen der Test einen falsch-positiven Befund ergeben kann. Genau so muss es sein. Wie bei Corona, falsch-positiv. Hier liegt schlicht und einfach ein Fehler vor.
2
»Guten Abend, General Kampa. Hier kommt die Nachtschicht. Haben Sie Ihre Tabletten genommen?«
Frank schließt die Tür und geht auf den alten Mann zu. Seine Crocs knartschen auf dem Linoleum.
Herr Kampa stöhnt leise. Frank greift nach der Tablettenbox und schüttelt. Die blauen Pillen für den Abend klappern in der dritten Kammer.
»Wo bleibt die Disziplin, Herr General? Denken Sie an Ihren Druck!«
Frank prüft die Vitalwerte. Kampa ist verkabelt, bei ihm wird dauerhaft der Blutdruck gemessen. 172/90. Bei einem systolischen Wert von 180 schlägt das Gerät Alarm.
Herr Kampa starrt Frank an. Sein Blick ist schwer zu lesen. Er hat etwas Finsteres, Strafendes und ist doch ausdruckslos. Frank ist sich unsicher, ob der General ihn überhaupt wahrnimmt. Vielleicht betrachtet er schon seit Stunden die Wand, und Frank ist ihm lediglich ins Sichtfeld getreten.
»Hallo? Jemand zu Hause?« Frank legt den Kopf schief. Vielleicht ahnt der General, dass ihm Großes bevorsteht, und bereitet sich innerlich vor.
Herr Kampa blinzelt, seine trockenen Lippen bewegen sich.
Frank lächelt aufmunternd.
»Docha«, haucht Herr Kampa.
»Wie bitte? Ich kann Sie nicht verstehen!« Als er sich hinunterbeugt, bemerkt Frank den unangenehmen Geruch, unverkennbar ekelerregend. Er beginnt, durch den Mund zu atmen, und lupft die Bettdecke. Ausgerechnet heute.
»War ja klar! Warum gehen Sie nicht zur Toilette, wenn Sie müssen?« Frank lächelt in sich hinein.
Er schlägt die Decke zurück. Kaum erträglich wallt ihm der Gestank entgegen. Die Schutzhose des Generals ist verrutscht. Braune Masse quillt auf die Auflage. Am Schenkel ein dunkler Fleck. Oberhalb des Knies endet Kampas Bein, vor einiger Zeit wurde es amputiert. Die Gefäße waren verschlossen, eine Folge der Diabetes.
»Da haben mir die lieben Kollegen aber eine schöne Überraschung hinterlassen. So liegen Sie schon eine ganze Weile, was?«
Frank hat keine Wahl, heute kommt Besuch. Kampa war einmal ein hohes Tier bei der Bundeswehr, jetzt liegt er da. Von draußen holt Frank Tücher und eine frische Auflage. Er packt den General an Hüfte und Schulter, drückt ihn hoch und auf die Seite.
Herr Kampa stöhnt auf. »Tochder!«, krächzt er.
»Ach, Tochter! Was ist mit Ihrer Tochter?«
Frank stützt Herrn Kampas Rücken mit dem Unterarm.
»Tochter! Ich … muss … Tochter!«
Mit einer Hand löst er den Klebestreifen der Schutzhose.
Der General räuspert sich. »Ich muss … meine Tochter abholen, vom Kindergarten.«
Frank wischt über den Hintern. Um die Einfärbung am Schenkel bemüht er sich gar nicht erst.
»Ihre Tochter geht nicht mehr in den Kindergarten. Die ist erwachsen.«
Herr Kampa grunzt. »Doch.«
Frank lässt ihn wieder auf den Rücken rollen. Die Auflage ist gewechselt, die neue Schutzhose sitzt. »Und jetzt nimm endlich deine Pillen.«
Er packt die dünnen Haare und drückt den Kopf nach vorn. Herr Kampa verzieht das Gesicht.
»Komm schon. Nicht so wehleidig!« Frank steckt ihm eine nach der anderen in den Mund und lässt ihn an der Schnabeltasse saugen.
»Na bitte. Das hätten wir. Nun bist du fein für deinen großen Auftritt.« Frank lächelt. »Ich lüfte mal, wenn’s recht ist. Nicht, dass sich die hohen Kollegen aus der Intensiv noch ekeln!«
Heute Nacht ist Frank ganz allein auf Station. Mal wieder. Alle krank. Trotzdem wird es gleich voll werden. Gleich kommen sie alle angerannt. Und dann werden sie sehen und staunen.
»Sagen Sie«, flüstert der General, »sagen Sie meiner Tochter, dass ich bald da bin.«
»Ich ruf sie nachher an, versprochen!«, antwortet Frank. Er zieht die Tür hinter sich zu und erstarrt.
*
Happy ist Diddy nicht, als er in den dunkelblauen Kasack schlüpft. Er ist spät dran und hat die Übergabe verpasst, aber das ist nicht das Thema. Eigentlich säße er jetzt mit Olli auf der Couch, bei Netflix, Pinot noir und Zartbitterschoki. Doch gerade, als sie den Tisch abgeräumt hatten, rief Paula an. »Ein absoluter Notfall«, »eine Riesen-Ausnahme«, »richtig was gut« habe Diddy bei ihr. Ob ihr bewusst ist, dass sie jedes Mal das Gleiche sagt? Wäre er Pflegedienstleiter – aber er ist nicht Pflegedienstleiter, und er will es auch gar nicht sein. Nur noch Orga am Hacken, Mangelverwaltung mit Chef im Nacken. Dabei ist er der Dienstälteste auf Station, fast dreißig Jahre im Beruf, zehn davon hauptsächlich hier in der Geriatrie. Er könnte den Laden mit links leiten. Aber dann hätte er kaum noch Zeit für die Patienten.
Diddy atmet tief durch und schlüpft in die Birkenstocks. Alle Betten sind belegt. Optimalerweise ist die Nachtschicht zu dritt. Tatsächlich arbeiten sie meist zu zweit. Heute hat sich kurz vor Dienstbeginn Anastasia krankgemeldet. Übrig blieb Frank. Keine Frage, Frank ist fit, der kann den Job. Aber ganz allein mit achtzehn Patienten – das ist gemein. Das möchte er selbst Frank nicht zumuten, obwohl der ihm nicht sonderlich sympathisch ist.
Diddy schließt den Spind. An der Tür hängt eine Klappkarte mit der Diddl-Maus, vor einer rosa-lila Wolke reckt sie ihm einen Blumenstrauß entgegen. Ganz liebe Geburtstagsgrüße! Jedes Jahr machen sich die Kollegen einen Scherz draus und schenken ihm eine Diddl-Karte. Er tauscht die alte gegen die neue und trägt es mit Fassung.
Auf der Station ist es still. Nur ein mattes Husten dringt aus dem ersten Isolationszimmer links vom Eingang, rechter Hand hört Diddy Hans und Doris schnarchen. Er mag den Trubel am Tag lieber als die Ruhe der Nacht, die so trügerisch sein kann. Diddy genießt es, wenn Leben in der Bude ist, wenn aus dem Fernseher in der Guten Stube die Kastelruther Spatzen schmettern und die dementen Patienten den Flur entlangmarschieren, immer im Kreis, bis sie müde sind.
»Dann mal los«, murmelt Diddy, greift sich zwei benutzte Tassen von einem Teewagen und eilt den Gang im Osten hinunter zum Cockpit. Vor dem Zimmer von Herrn Kampa bleibt er wie angewurzelt stehen.
»Nicht so wehleidig!«, hört er eine Stimme durch die Tür. Bei allem Respekt, Frank vergreift sich manchmal befremdlich im Ton. Vielleicht sollte er das bei Gelegenheit mit Paula besprechen. Vor knapp einem Jahr ist Frank ins Team gekommen – und seither eine echte Stütze, robust und belastbar. Gerade in brenzligen Situationen funktioniert er wie ein Uhrwerk. Und sein Wissen ist beachtlich – über Medikamente kann er regelrecht Vorträge halten: Dosierung, Kontraindikationen, Wirkweise, die physiologischen Abläufe. Er wäre ein guter Arzt geworden. Außerdem kann Frank reanimieren wie kein Zweiter, von ihm werden sich im Kollegium Heldengeschichten erzählt. Er war wohl mal Rettungssani, da sammelt man natürlich Erfahrung. Diddys letzte Reanimation ist ewig her. Irgendwie kommt er immer drumrum.
Die Tür schwingt auf.
»Ich ruf sie nachher an, versprochen!«, sagt Frank. Als er Diddy sieht, entgleist ihm sein spöttisches Grinsen.
»Hast du mich erschreckt, Diddy! Was machst du denn hier?«
»Ich bin für Anastasia eingesprungen. Hat dich das nicht erreicht?« Mal wieder typisch, denkt sich Diddy. »Ist alles ruhig so weit?«
Er wendet sich in Richtung Cockpit, Frank folgt ihm.
»Ja, so weit sind alle versorgt. Frau Kurz macht ihr übliches Theater – ›Hilfe, Hilfe!‹. Du weißt schon. Geht man rein, ist nichts.«
»Schmerzmittel hat sie?«
»Der Tropf ist komplett durchgelaufen, aber ich mache mir etwas Sorgen um den General«, sagt Frank und fängt an, in seinem Rucksack zu kramen, der neben einer Tastatur im Besprechungsraum liegt. »Er wirkt völlig weggetreten. Der macht’s nicht mehr lange, glaub ich«, sagt Frank abwesend.
»Hm. Sobald er Besuch hat, ist er das blühende Leben. Frank?«
Frank reagiert nicht, sein Kopf versinkt im Rucksack. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ärgert sich Diddy.
»Übrigens, die Dokumentation hat noch viele Lücken«, murmelt Frank. »Mit herzlichen Grüßen der Spätschicht. Danke für nichts. Na endlich!« Er scheint gefunden zu haben, was er gesucht hat.
»Ach, mir reicht schon, dass alle im Bett sind. Wenn du willst, kann ich mich an die Doku setzen.«
»Von mir aus gern. Ich dreh gleich eine große Runde. Und schau auch noch mal bei Frau Kurz rein.« Frank strahlt. »Aber erst mal das!« Er hält einen Schokoriegel in die Höhe. »Nie den Blutzucker vergessen. Nicht, dass ich noch eine Hypoglykämie bekomme.« Er sieht Diddy herausfordernd an.
Du solltest dir besser um deine HYPERglykämie Sorgen machen, denkt Diddy, erbarmt sich aber und grinst zurück.
3
Arbeiten hilft ihr zu verdrängen. Vergessen wäre wohl zu viel verlangt, das weiß sie. Oder gar löschen. Ungeschehen machen. Die Zeit zurückdrehen.
Nora schrubbt den Herd in der Wachküche. Wenn schon kein Einsatz reinkommt, kann sie sich wenigstens nützlich machen. Dieses Chaos im Kopf macht sie wahnsinnig, das Rumoren im Bauch, der kribbelnde Hauch Panik.
Gestern war sie guter Dinge zur Apotheke am Hauptbahnhof geradelt und hatte zwei Schwangerschaftstests besorgt – einen als Ersatz für Sonjas, eine andere Marke zwar und bestimmt fünfmal so teuer, aber was soll’s. Den anderen kaufte sie für sich. Die Laune war ihr schnell vergangen: Wieder positiv.
Die Edelstahlflächen des Herdes glänzen. Als Nora sich dem Ofen widmen will, schrillt ihr Melder.
»Das müsste es sein, Nummer 24«, sagt Nora und
schaltet das Blaulicht aus.
Fynn stoppt den Rettungswagen in zweiter Reihe und runzelt die Stirn.
»Hörst du den Heli?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.«
Nora zuckt mit den Schultern, nimmt den C3 und das Beatmungsgerät.
»Soll ich dir was abnehmen?«, ruft Fynn ihr hinterher.
Das wäre ja noch schöner. Er ist Einsatzleiter, sie Azubi.
Versuchter Suizid stand auf der Einsatzdepesche. Das ist nichts Alltägliches. Zügig nehmen sie die Treppen in den ersten Stock. Es riecht nach Gemüsesuppe. Die Tür steht offen, ein junger Mann tritt von einem Bein aufs andere.
»Sie hat es schon wieder gemacht. Schon wieder!«, brüllt er.
Im Flur der Wohnung liegt eine Frau auf dem Rücken. Die Haare lang, zerzaust und blond gefärbt, der dunkle Ansatz nachgewachsen. Mit großen Augen schaut sie Nora und Fynn an. In ihrem Hals steckt ein Schälmesser, direkt unter dem Kehlkopf.
»O Mel«, heult der Mann auf und lässt sich auf die Knie fallen. Er legt seinen Kopf auf ihren Bauch. »Stirb nicht, bitte stirb nicht!«
Fynn schaut betreten drein. »Sie … Sie müssen da weg. Von der Frau«, sagt er mit dünner Stimme.
Nora kniet sich hin. »Ist das Ihre Frau?«
Der Mann nickt.
»Wie heißt sie?«
»Melanie.« Er fängt an zu weinen.
»Und wie heißen Sie?«
»Momo.«
»Gut, Momo. Sie müssen uns Platz machen, damit wir Melanie helfen können. Und zwar sofort.«
Fragend schaut er erst die Sanitäter an, dann auf das Messer. Mit einem Ruck zieht er es heraus.
»Nein!«, brüllt Nora. Ein rascher Blick zu Fynn, doch der steht regungslos da. »Nun machen Sie endlich Platz!« Sie drängt Momo beiseite.
Er springt auf, wirft das Messer in die Ecke und beginnt, hin und her zu laufen. Melanies Augen folgen ihm. Aus dem Schlitz an ihrem Hals sickert Blut. Übertrieben rot, denkt Nora, total unecht, sie ist immer wieder aufs Neue irritiert. Glücklicherweise ist es nicht viel.
»Melanie, ich untersuche Sie jetzt.« Nora checkt den Mundraum. Frei.
Im Treppenhaus hört sie Momo schreien: »Hilfe! Meine Frau stirbt!«
»Fynn! Ruf die Polizei. Der dreht ja völlig durch.«
»Bin schon dabei, bin schon dabei!«
Nora legt das Pulsoxy an. Melanie braucht Sauerstoff, 15 Liter. Nora hört es blubbern und röcheln. Sollte sie die Beatmungsmaske vielleicht über die Stichwunde legen? Atmet Melanie jetzt da durch? Und wenn ja, reicht das aus, oder muss sie die Öffnung erweitern? Angestrengt denkt Nora nach: Was hat sie zu den Themen »Beatmung« und »Koniotomie« gelernt? Sie lässt das Skalpell im Notfallrucksack und positioniert die Maske auf dem Mund. Melanie guckt und röchelt. Creepy.
Mit der Absauge entfernt Nora Blut aus der Wunde, immerhin blubbert es nun weniger, wenn Melanie atmet.
Fynn diskutiert mit dem Mann. Warum lässt er sich so ablenken, denkt Nora. Der müsste hier die Führung übernehmen. Es war ihr gar nicht klar, dass er so wackelt, wenn es hart auf hart kommt. Diese Blöße würde sie sich nie geben.
Sie tastet Melanies Oberkörper ab. Um ein Loch in ihrem T-Shirt zeichnet sich ein länglicher dunkler Fleck ab. Nora schiebt das Shirt nach oben. Auch im Oberbauch ist eine Wunde. Das Blut ist bereits angetrocknet.
»Dreimal wollte sie sich schon umbringen. Sie war deshalb in der Psychiatrie!« Momo kommt Nora unangenehm nah.
Fynn versucht, ihn zu beruhigen.
Sie findet keine weiteren Verletzungen. Aber die Sättigung fällt, nur noch 88 Prozent.
»Fynn, ich brauch dich hier!«
»Ja, komme.«
Dann hört sie Stimmen. Es ist die Polizei. Fynn redet und kommt nicht.
Nora befestigt die Blutdruckmanschette und startet das Messgerät. Am anderen Oberarm spannt sie den Stauschlauch für den Zugang.
Melanie regt sich. »Sterbe … ich … jetzt?«
Nora versteht sie kaum und schiebt die Sauerstoffmaske ein Stück zur Seite.
»Nein, das versuche ich gerade zu verhindern.« Sie zuckt zusammen. Hoffentlich hat sie nicht zu viel versprochen. Sie trifft die Vene sofort, die Infusion läuft.
»Lass mich … bitte. Lass mich gehen.« Melanie schließt die Augen.
Nora rückt die Maske zurück und schluckt. Wer sprechen kann, ist noch nicht tot, denkt sie. Gut, dass sie das Skalpell nicht gezückt hat. Sie beobachtet Melanies Atmung. Gleichmäßig und ruhig. Die Sauerstoffsättigung scheint wieder stabil.
Wenn die Frau wirklich sterben will, warum nimmt sie dann so ein simples, kleines Gemüsemesser? Warum die halbherzige Wunde im Oberbauch? Warum nicht die Pulsadern?
Es poltert an der Tür.
»Läuft der Zugang?«, fragt eine Notfallsanitäterin.
»Wo ist das Messer?«, will die Notärztin wissen.
Nora trägt vor, was sie über die Patientin weiß, dann wird sie beiseitegeschoben. Eine Last fällt von ihren Schultern. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie angespannt sie war.
Das Heli-Team arbeitet Hand in Hand. Die zwei Frauen und ihr Kollege kommunizieren Zahlen, melden einen Schockraum an, sprechen mit Momo. Melanie bleibt still liegen, die Augen geschlossen. Nora folgt Fynn runter zum RTW, die Trage holen. Im Treppenhaus fällt es ihr wieder ein. Sie ist schwanger.
Sofort zieht sich ihr Magen zusammen. Die Knie werden weich. Eigentlich dürfte sie gar nicht arbeiten. Zu viele Gefahren für das ungeborene Leben. Aber wenn das ungeborene Leben ungewollt ist, dann ist das doch egal, oder?, denkt sie. Andererseits, ungewollt oder nicht, es ist immer noch Leben. Das kann doch nicht egal sein.
Sie quetschen sich zur Patientin hinten in den Rettungswagen – Nora, Fynn und die Notärztin, die sich als Britta vorgestellt hat.
»Ich will eine Narkose. Kontrollierte Beatmung«, sagt Britta. »Siebener Tubus, zweiter Zugang, Beatmungsgerät vorbereiten.«
Fynn kramt in den Schubladen, der Kopf hochrot, er zieht Fächer auf und schließt sie wieder.
»Sauerstoffsättigung bei 82 Prozent«, sagt Nora. Sie öffnet die vorletzte Schublade auf der linken Seite und reicht den Tubus an.
»Laryngoskop, mittlerer Spatel.«
Wieder kramt Fynn hilflos in den Schubladen. Nora staunt. Was ist nur los mit ihm?
»Machst du das mal kurz?«, raunt er ihr zu.
Sie reicht alles rasch an. Auch die Bedienung des Beatmungsgeräts übernimmt Nora. Fynn wechselt hinters Lenkrad.
Die Narkose läuft. Melanie wird mittlerweile von der Maschine beatmet, nicht durch einen Tubus im Hals, sondern durch den Mund. Auch Britta hat nicht die letzte Eskalationsstufe gezündet.
Sie übergeben Melanie der Notaufnahme mit schlechten Sauerstoffwerten, aber lebendig.
»Gute Arbeit. Sorry, dass ich manchmal etwas straight bin«, verabschiedet sich Britta im Gang vor dem Schockraum. Sie lächelt, klopft Nora und Fynn auf die Schultern und kehrt zurück zu den unzähligen Ärzten und Pflegern, die sich um Melanie kümmern.
»So ein Chaos. Irgendwie konnte ich gerade nicht ganz so strukturiert arbeiten«, sagt Fynn auf dem Parkplatz vor der Notaufnahme, während Nora und er den RTW desinfizieren.
Nicht ganz so strukturiert? Das ist die Untertreibung des Tages, denkt Nora. Aber das behält sie für sich. »Ist schon okay. So konnte ich ordentlich was machen und lernen.«
Sie drücken sich, eine kollegiale Umarmung, fast beiläufig. Doch als sie Fynns Bauch an ihrem spürt, ist der Schrecken zurück.
4
»Herr General, es ist Zeit«, flüstert Frank. Er wirft einen Blick zurück in den grell erleuchteten Flur. Alles ruhig. Er weiß, dass Diddy im Cockpit sitzt, in die Patientendokumentation versunken, und zieht die Tür hinter sich zu.
Herr Kampa schläft. Frank schleicht durchs Halbdunkel und schließt das Fenster. Ein kalter Hauch streift seine Unterarme. Die Haare stellen sich auf, er fröstelt. Nur nicht nervös werden.
Frank holt vier kleine Ampullen aus der Kasacktasche. Ajmalin. Aus der anderen nimmt er eine 20-Milliliter-Spritze. Langsam zieht er die Flüssigkeit auf, Ampulle für Ampulle, erst die eine Spritze, dann die zweite. Er beobachtet den General. Sollte es schlecht für ihn laufen, siecht er noch einige Tage auf der Intensiv dahin. Andernfalls wird er heute erlöst: Kein Soldat mit einem letzten Rest Würde kann das hier wollen. Wie auch immer es ausgeht, Frank ist ihn los.