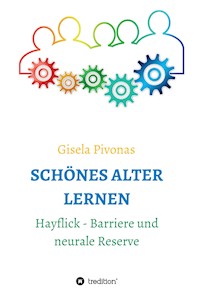
4,99 €
Mehr erfahren.
Was sollte ich über das Altern wissen, wenn ich mit 75 Jahren mein Leben neu planen will? Diese Frage stand am Anfang der Recherche für den vorliegenden Bericht. Verwendet habe ich, entsprechend meinem ursprünglichen Fachbereich, vor allem psychologische Veröffentlichungen aus den Jahren 2003-2017. Da ich mir das Gelesene nicht mehr so schnell merken kann wie früher, habe ich mir schriftliche Notizen gemacht. Wichtig waren mir ein Umfang von nicht mehr als 50 (Din A4) oder 100 Seiten (Din A5) sowie ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, das Gesuchtes rasch wiederfindbar macht. In meinem früheren Beruf habe ich ausschließlich über eigene Forschungsergebnisse berichtet. Bei der vorliegenden Synopse handelt es sich dagegen um Sekundärliteratur. Den Quellenzugang wollte ich anderen Laien erleichtern: deshalb die ausführlichen Literaturangaben. Als ich fertig war, gab ich meinen Bericht weiter: meinem Mann und Freunden. Sie ermutigten mich, ihn auch für andere zugänglich zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
SCHÖNES ALTER LERNEN
Hayflick – Barriere und neurale Reserve
Gisela Pivonas
© 2018 Gisela Pivonas
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7469-7966-3
Hardcover
978-3-7469-7967-0
E-Book
978-3-7469-7968-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung (Erfahrungen als berufstätige Frau)
1. Verlängerte Lebenserwartung – zu kurze Lebenspläne
2. Abwertung des Alters – die ungemütliche, traditionelle Perspektive
3. Tradierte Normen behindern die Entwicklung neuer Ziele
3.1 Das 85 Jahre- Paradigma
3.2 Pauschalierte Lebenspläne mit dem Endpunkt „Rentenalter“
3.3 Vorstellungen vom Rentenbeginn
4. Was hat die Wissenschaft über den Prozess des Alterns herausgefunden?
4.1 Differenzierung von Stufen im Prozess des Alterns
4.2 Körperliche Veränderungen
4.2.1 Körpergröße und Körpermaße
4.2.2 Das Hayflick-Limit
4.2.3 Bedeutung der Stammzellen
4.2.4 „Normale“ körperliche Veränderungen beim Altern
4.3 Verhalten: kognitive und emotionale Veränderungen, Veränderungen der Persönlichkeit und der sozialen Beziehungen
4.3.1 Der Zusammenhang von kognitiven Veränderungen und Sensumotorik
4.3.2 Persönlichkeitseinflüsse
4.3.3 Intelligenz, Selbstkonzept, Selbstkontrolle
4.3.4 Soziale Beziehungen
4.4 Motivationale Veränderungen
4.5 Verhaltensabhängigkeit der Gesundheit im Alter
4.6 T rainings- und Lerneffekte im Alter
4.7 Hinweise aus neueren biologischen und neurobiologischen Forschungen
5. Maßnahmen für die Verbesserung des Alternsprozesses
5.1 Primärprävention für ein gesundes Altern
5.2 Unterstützung der Sekundärprävention
5.3 Ergebnisse des „Longevity-Projektes“: fundamentale Bedrohungen und selbstkontrolliertes Leben
5.4 Entwicklung einer neuralen Reserve
5.5 Nicht Abbau sondern Umbau: Ein Blick nach Japan
6. Staatliche Erfassung von Krankheiten, die die nationale Sterblichkeitsrate beeinflussen
6.1 Nationales Monitoring (Bundesgesundheitssurvey)
6.2 Internationales Monitoring (Global Burden of Disease)
7. Wie kann das gesammelte Wissen individuell nützlich gemacht werden?
7.1 Was ist anders als in der Jugend, wenn man mit 75 die eigene Zukunft gestalten will?
7.2 Neue Vorbilder
7.2.1 Arthur Rubinsteins „Selektive Optimierung mit Kompensation“
7.2.2 Nahestehende Frauen, die “gut altern“
7.3 Ein vergleichender Blick auf den Durchschnitt
7.4 Individueller Relevanz-Raster als Korrekturhilfe
8. Ausblick
Quellenverzeichnis
EINLEITUNG
(Erfahrungen als berufstätige Frau/ Suche nach einem Neustart)
Erfahrungen als berufstätige Frau
Als Berufstätige gehörte ich drei Berufsverbänden an. Eines Tages schrieb einer dieser Verbände, dass ich seit 35 Jahren Mitglied sei. Einer meiner größten Klienten rief mich an und riet, gegen diese Veröffentlichung sofort vorzugehen und sie dementieren zu lassen: sie sei geschäftsschädigend. So wurde mir individuell verdeutlicht, wie riskant es in unserer Gesellschaft sein kann, wenn man 35 Jahre Mitglied in einem akademisch geprägten Verein ist, dem viele erst mit 30 oder mehr Jahren beitreten. Schon die Assoziation eines potentiellen Alters von 65 ist gefährlich – selbst wenn man jünger aussieht und Sachkenntnis wie Erfahrung sich gerade einem Optimum nähern.
Mein Diplom in Psychologie hatte ich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erworben, in einer Zeit, in der in Deutschland weniger als 5 % der Frauen ein Studium abschlossen. Ich hatte eine Zeit lang geschwankt zwischen klinischer Psychologie, einer Karriere an der Universität und der Tätigkeit in einem Sozialforschungsinstitut. Ich hatte alle drei Lösungen ausprobiert und für mich die besten Perspektiven in der empirischen Sozialforschung gefunden. Ich hatte sechs Jahre lang sukzessive in mehreren Institutionen gearbeitet und dann gewusst, was mir gefiel und was ich anders machen wollte.
Nach der 1973 erfolgten Gründung eines Institutes für Sozial- und Wirtschaftsforschung arbeitete ich über 40 Jahre, zunehmend international, als Unternehmerin, Geschäftsführerin, Psychologin – die meiste Zeit mit etwa zehn fest angestellten Mitarbeitern. Mich faszinierte die Forschung ebenso wie die enge Zusammenarbeit mit Kollegen und langjährigen Auftraggebern, von denen einige Großunternehmen waren.
Als ich über 50 war, berichteten mir gleichaltrige Kollegen stolz, dass sie genug verdient hätten, um sich mit 55 zur Ruhe zu setzen. Dieses Ziel war für mich nicht reizvoll. Ich hatte von Axel Börsch-Supan gelesen, der die Sache volkswirtschaftlich betrachtet und erklärt hatte, unser Rentensystem sei nur aufrecht zu erhalten, wenn man mindestens doppelt so lange arbeite wie man Rente beziehen wolle. Diese Perspektive erschien mir vernünftig und in meinem Fall auch realisierbar.
Ich habe – nach dem oben erwähnten Anruf, der Unmöglichkeit, die 35jährige Mitgliedschaft zu dementieren und dem folgenden Verlust des Klienten („Bei uns hört man mit 65 auf“) voll weitergearbeitet bis 75. Mir wurde immer stärker bewusst, wie sich in meinem beruflichen Umfeld Zustimmung und Ablehnung, an die ich mich seit langem gewöhnt hatte, mit Missgunst und der Forderung mischten, dass ich mich altersgemäß zurückziehen solle. Ich begann, für mich zu präzisieren, dass tatsächlich Altes beendet werden muss, damit sich Neues entwickeln kann. Ich fand, beide Seiten hätten ein Recht, so zu denken: auch ich selbst.
Suche nach einem Neustart
Ich hatte Ziele und Aufgaben, die mir als junger Frau passend erschienen waren, jahrzehntelang verfolgt. Einen Lebensplan, den heute noch viele mit der Vorstellung „Rentenalter 65“ abschließen, hatte ich um 10 Jahre verlängert – ohne Alternative für die darauffolgenden Dezennien. Mir fiel schließlich auf, wie viel Zeit ich schon – ohne erneute Zukunftsplanung – hatte vergehen lassen. Ich entdeckte andere, denen es ähnlich ging. Mein Mann artikulierte meine Unruhe: er fand, ich thematisiere ständig das Alter und wolle dabei von Null auf Hundert.
Ich suchte für meine Vorstellungen eine verbale Kurzform und kam auf ANNA oder OTTO. Als Palindrome von vorn und von hinten mit dem gleichen Resultat lesbar, drücken beide Namen etwas von der Faszination für bestimmte Erkenntnisse der „Entwicklungspsychologie der Lebensspanne“ (Brandstädter/ Lindenberger, 2007) aus. Dass es in jeder menschlichen Entwicklungsphase – Kindheit wie Alter – Talente und Fähigkeiten gibt, die zugrunde gehen, neben solchen, die neu entstehen. Sie helfen bei der assoziativen Verknüpfung von Anfang und Ende. Sie wirken als Ansporn, das Leben als einen Spannungsbogen zu begreifen, mit besonderen Eskalationen am Anfang und Ende, die einer verstärkten Gestaltung bedürfen.
Die Ergebnisse für Männer und Frauen ganz gleichzusetzen, wäre nicht ideal. Wie die folgenden Seiten verdeutlichen, ist die Situation für Männer und Frauen in Deutschland 2017 in vielen Bereichen unterschiedlich. Laut Statistik ist die Mehrheit der über 65jährigen (57,5 %) in Deutschland weiblich (DESTATIS, Zensus 9. Mai 2011, 6). Deshalb wollte ich ANNA – als Verkörperung der Mehrheit – zunächst verstärkt beachten.
Das war nicht möglich. Eine konsequente, genderspezifische Differenzierung für alle altersspezifischen Befunde erwies sich beim heutigen Stand als unmöglich. Medizin, Biologie oder Psychologie differenzieren ihre zunächst verallgemeinerten Befunde erst sukzessive, meist beschränkt auf ein Merkmal: entweder das Alter oder das Geschlecht. In vielen wissenschaftlichen Beiträgen, in denen über altersspezifische Befunde berichtet wird, fehlt eine Unterscheidung nach dem Geschlecht – oft wird in den Stichprobenbeschreibungen dieses Merkmal nur am Rande erwähnt.
Grundlagen und Perspektive
Ich habe mich jahrzehntelang mit Psychologie und Statistik beschäftigt. In vielen grossen, repräsentativen Untersuchungen, die ich durchgeführt habe, waren Alter, Geschlecht und Bildungsstand relevante Merkmale, die sich vor allem im Zusammenwirken als differenzierungsfähig erwiesen.
Bei meiner Suche nach entsprechend aufbereiteten Befunden der Altersforschung wurde ich nur selten fündig; oft waren wohl auch die zugrundeliegenden Stichproben zu klein.
Ich liess mich schliesslich auf eine Verallgemeinerung als vergröbernden Kompromiss ein, der doch schon viel mehr verspricht als ein totales Nicht-Wissen.
In diesem Sinne will ich versuchen, ein paar Daten über das, was die meisten von uns beim Altern erwartet, zusammenzutragen.
Wie können wir mit der Hilfsbedürftigkeit am Ende des Lebens ähnlich achtsam umgehen wie mit der am Anfang?
1. Verlängerte Lebenserwartung – zu kurze Lebenspläne
Die durchschnittliche Lebensdauer der Menschen nimmt seit einigen Jahrzehnten massiv zu. 2014 waren weltweit schon 8.1 % der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Besonders hoch waren die vergleichbaren Prozentsätze in Japan (25,8 % der Bevölkerung über 65 Jahre alt), Italien (21,5 % über 65), Deutschland (21,3 % über 65) und Griechenland (20,0 % über 65).(Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2015, 632/ 633)
Zwar gab es auch schon vor Jahrhunderten Methusalems, aber erst in jüngster Zeit nähert sich die Lebensdauer des Durchschnittsmenschen stufenweise dem seit langem konstanten, maximal erreichbaren Lebensalter von 120 – 125 Jahren.
1776 schrieb der Liederdichter Hölty (www.aphorismen.de, 2016):
„Rosen auf den Weg gestreut
Und des Harms vergessen!
Eine kleine Spanne Zeit
Ward uns zugemessen.“
Er starb mit 28 Jahren.





























