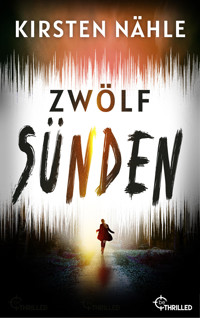Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektivin Valentina Wallrapp ermittelt
- Sprache: Deutsch
Robert hat seiner fränkischen Heimat den Rücken gekehrt. Seit dem ungeklärten Mord an seiner Schwester vor 20 Jahren ist auch der Kontakt zur Familie fast abgebrochen. Doch die Krankheit seiner Mutter führt ihn zurück nach Würzburg. Bald trifft er alte Bekannte und Freunde seiner Schwester, die damals unter Verdacht standen. Sie wecken in Robert unerwünschte Erinnerungen, da er mit der Vergangenheit abgeschlossen hat. Aber als ein anonymer Brief auftaucht, beginnt er nachzuforschen und kommt der Wahrheit über den Tod der Schwester gefährlich nahe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirsten Nähle
Schrei am Main
Würzburg-Krimi
Zum Buch
Ein Nest aus Lügen Der 33-jährige Robert hat seiner fränkischen Heimat den Rücken gekehrt und lebt in Kanada. Seit dem grausamen Mord an seiner Schwester Marlene vor 20 Jahren ist der Kontakt zu seiner Familie und nach Deutschland so gut wie abgebrochen. Die Tat wurde nie aufgeklärt. Doch die Krebserkrankung seiner Mutter führt ihn zurück ins Heimatdorf nahe Würzburg. Schon bald trifft er alte Bekannte, auch Freunde seiner Schwester, die damals unter Verdacht standen. Sie wecken in Robert unerwünschte Erinnerungen, da er mit der Vergangenheit abgeschlossen hat. Aber ein mysteriöser Brief und ein Vorfall an Marlenes Grab lassen ihn nicht los. Gemeinsam mit der Privatdetektivin Valentina Wallrapp kommt er der Wahrheit über den Tod seiner Schwester gefährlich nahe. Dabei muss er sich auch der eigenen Schuld stellen.
Kirsten Nähle unterhielt schon als Kind ihre Familie mit eigenen Geschichten. Später begann sie, diese auch aufzuschreiben. Am Schreiben fasziniert sie, dass sie und ihre Leser in fremde Leben eintauchen und gefahrlos Abenteuer erleben können. Ob als Journalistin oder PR-Redakteurin, ob in Köln, Basel oder Würzburg– die Autorin hat stets auch beruflich geschrieben. Seit 2011 wohnt Kirsten Nähle in ihrer Wahlheimat Würzburg, die sie zu einer Kriminalroman-Trilogie inspiriert hat. Außerdem veröffentlicht die Autorin Kurzgeschichten. Feedback zu ihren Büchern nimmt sie gern auf Instagram oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © RudyBalasko / istockphoto.com
ISBN 978-3-7349-3128-4
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Warum ist es so dunkel? Meine Augen sind geöffnet und doch sehe ich nichts als Schwärze. Ich liege auf dem Rücken, seltsam verdreht. Es ist unbequem. Mein Kopf pocht schmerzhaft, und das Schlucken fällt mir schwer.
Wo bin ich? Irgendetwas habe ich da am Hals, es kitzelt unangenehm. Ich greife mit der rechten Hand danach. Kühl und ledrig legt es sich um meine Kehle, die so trocken ist, dass ich husten muss.
Das ist ein Gurt, denke ich und fahre mit den Fingerspitzen an ihm entlang. Er endet an einem ebenso ledrigen Gegenstand. Ich benötige einen Augenblick, um diesen als eine Handtasche zu identifizieren. Ist das meine?
Schnell befreie ich den Hals aus der Schlaufe, und mit einem Stöhnen versuche ich, mich zu strecken. Was nicht geht. Meine Sandalen stoßen an etwas Festes. Vorsichtig taste ich die Umgebung unter mir ab. Filzartiger Stoff auf bretthartem Untergrund. Ich richte mich auf und stoße mit dem Kopf an. Sinke zurück und kriege Panik. Ich spreize die Arme, die schnell auf Widerstand stoßen.
Ich bin eingesperrt. Wieso? Mein Herz donnert gegen meine Rippen, während ich zu erfühlen versuche, wo ich bin. Es könnte eine Kiste sein, doch die Form ist zu unklar. Auch riecht es komisch hier drinnen.
Ich liege in einem Sarg, schießt es mir durch den Kopf. Lebendig begraben. Kann das sein? Warum?
Das ist ein Irrtum. Ich bin nicht tot!, schreie ich stumm, weil Angst mir den Hals zuschnürt. Ich drehe und wende mich so weit es geht. Keuche, weil ich das Gefühl habe zu ersticken.
Das ist nur ein Albtraum, oder? Wach auf, Marlene! Feuchtigkeit läuft mir in die Augen, und ich blinzle. Mit Scham registriere ich, dass es auch zwischen meinen Beinen nass ist. Und dass es dort furchtbar schmerzt. Mit zittriger Hand taste ich unter mein Kleid. Mein Unterleib brennt. Wieso trage ich keine Unterhose? Erst jetzt bemerke ich, dass etwas um meine Fesseln baumelt. Ich winde mich vor Schmerzen, als ich den Slip wieder an die richtige Stelle hochziehe.
Ich muss hier raus.
»Hilfe.« Es ist kaum mehr als ein Flüstern, so geschwächt fühle ich mich. Ich klopfe gegen den Deckel über mir. Hämmere wild drauflos in der Hoffnung, dass mich jemand hört. »Hilfe!«, rufe ich lauter. Tränen laufen mir über die Wangen und ersticken weitere Schreie. Mein Puls dröhnt mir in den Ohren. Trotzdem glaube ich, Stimmen zu hören. Oder spielt mir meine Wahrnehmung einen Streich?
Mama? Papa? Seid ihr das? Falls ja, bitte helft mir.
Ich halte kurz mit dem Klopfen inne. Doch, da ist irgendjemand. Jetzt bin ich sicher, etwas gehört zu haben. Die Stimme kommt näher, wird lauter. Zwar kann ich nicht verstehen, was die Person sagt, doch bestimmt hat sie meinen Hilfeschrei vernommen. Gleich bin ich frei.
Moment mal, sind da etwa mehrere Stimmen? Wem gehören sie? Reden sie über mich? Kommen sie wirklich, um mir zu helfen, oder haben sie mich hier eingesperrt?
Plötzlich öffnet sich der Sargdeckel, und ein Gesicht, das mir vage bekannt vorkommt, starrt mich an. »Mein Gott, was habt ihr getan?«
»Bitte helfen Sie mir«, stoße ich erleichtert aus und setze mich auf.
Doch dann erkenne ich die Person, die neben meinem Retter steht, und die Erinnerung stürzt wie ein Tsunami auf mich ein. Alles in mir verkrampft sich. Ich japse. Gleichzeitig überfällt mich Scham. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich muss weg von hier, oder die Person wird mir erneut wehtun. Von Grauen erfasst versuche ich, aus meinem Gefängnis zu klettern, doch gelingt es mir nicht. Alles schmerzt, und der Schrecken lähmt mich. »Bitte«, dränge ich. »Ich brauche Hilfe.«
Da ist ein Arm, der sich mir entgegenstreckt und nach dem ich dankbar greife. Doch dann verschwindet er wieder, und mein Retter befiehlt etwas. Seine Wut macht mir Angst, aber immerhin hat er die andere Person weggeschickt.
Auch kann ich endlich ausmachen, wo ich bin. Erneut versuche ich, mich aus eigener Kraft zu befreien. Ich möchte nach Hause. Zu meinen Eltern.
Doch grob werde ich zurück in mein Gefängnis gezwungen. Wieder lande ich auf dem Rücken. Ich will mich aufrichten, schreien, doch ein fester Druck auf Mund und Nase verhindert, dass mir auch nur ein Wort über die Lippen kommt.
Tränen fließen mir aus den Augen. Ich trete und schlage um mich. Dabei rutscht mir eine Sandale vom nackten Fuß. Ich bekomme keine Luft, mein Puls rast. Vor lauter Panik beiße ich mir in die Zunge und schmecke Blut.
Ich will das Gesicht über mir zerkratzen, doch es ist zu weit weg. Stattdessen kralle ich die Fingernägel in die muskulösen Unterarme, die mich unbarmherzig quälen.
Ich ziehe die Beine an und bohre die Füße in den harten Boden, um die Hüfte hochzustemmen. Doch es hilft nicht. Mein Gegner ist zu stark.
Wie konnte ich nur so naiv sein? Mich so sehr täuschen? Ich bin selbst schuld. Was wird meine Familie nur von mir denken? So oft haben Mama und Papa mich davor gewarnt.
Ich werde sie nie wiedersehen, schießt es mir plötzlich durch den Kopf. Ich werde hier sterben. Bitte, lieber Gott, ich will nicht sterben. Meine Lunge fühlt sich an, als würde sie jeden Moment zerreißen. Ich denke an meinen kleinen Bruder. Daran, wie sehr ich ihn enttäuscht habe. Es tut mir so leid. Wie gern würde ich ihm das jetzt sagen. Auch, dass ich ihn lieb habe.
Ich sehe meine Eltern vor mir. Ob sie mich schon suchen? Papa. Mama. Ich bin hier. Bitte helft mir. Warum hilft mir denn keiner?
Ich kann nicht mehr. Meine Kräfte schwinden, die Muskeln erschlaffen. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Durch den Tränenschleier hindurch sehe ich ein kleines Stück vom Himmel. Die Sterne schimmern über mir. Sie sind wunderschön. Verblassen. Ich denke an Robert, und Wärme strömt durch mich hindurch. Dann stürze ich in eine tiefe Dunkelheit.
Kapitel 1 Donnerstag, 08. August 2019
Robert
Die Maschine setzt derart holprig auf, dass ich mehrfach aus dem Sitz gehoben werde. Dabei presst sich der Gurt unangenehm in meinen ohnehin schon angespannten Unterleib.
Ich hasse Fliegen. Mit einem Seufzer öffne ich die Augen, während ein paar wenige Passagiere verhalten klatschen. Ich habe noch nie verstanden, warum die Leute bei Landungen applaudieren. Ich meine, der Pilot macht auch nur seinen Job. Mich hat bisher keiner mit Applaus überschüttet, nur weil ich es geschafft habe, Schatten und Beleuchtung bei einem Game effektvoll zu programmieren.
»Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Frankfurt am Main, Flughafen. Es ist 15.20 Uhr Ortszeit und es herrschen angenehme Temperaturen von 29 Grad. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, mit …«
Angenehme Temperaturen? Scherzkeks. Sofort sehne ich mich nach den 21 Grad in Vancouver zurück, die ich gestern noch genießen durfte.
»Entschuldigen Sie, aber ich müsste an mein Gepäck.« Meine Sitznachbarin hat sich schon abgeschnallt und steht geduckt neben mir. Den ganzen Flug über hat sie kaum eine Minute stillgesessen und ständig Kaugummis gekaut. Den künstlichen Erdbeergeruch habe ich noch immer in der Nase.
Ich rücke meine Brille zurecht und öffne betont langsam die Schnalle des Sitzgurtes. Beobachte die anderen Passagiere, wie sie Gepäckfächer aufreißen, Smartphones einschalten und sich im Gang drängeln, obwohl der voll besetzte Flieger seine Türen noch gar nicht geöffnet hat.
»Das dauert«, sage ich mit gespieltem Bedauern zu meiner Sitznachbarin. »Da kommen wir jetzt nicht ran.« Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der keine Eile hat, das Flugzeug zu verlassen. Kein Wunder, da ich es am liebsten gar nicht erst bestiegen hätte.
»Sie machen auf.« Meine Sitznachbarin deutet nach vorn, und die Menschen schlängeln sich durch den engen Gang.
Ich erwische eine Lücke und erhebe mich aus dem Sitz, um das Gepäckfach zu öffnen. Dann lasse ich der Dame den Vortritt, warte, bis alle anderen an mir vorbeigezogen sind, nehme in Ruhe meinen Rucksack und steige aus der Maschine.
Warme Luft und der Geruch von Kerosin erschlagen mich für einen Moment. Am liebsten würde ich mir das Sweatshirt vom Leib reißen, aber ich trage nur ein Unterhemd drunter. Gut, dass ich daran gedacht habe, ein paar T-Shirts einzupacken. Ich bin eher der Typ für Hemden und Anzüge.
Leider gibt es keine Gangway zum Terminal, stattdessen bringen uns zwei Busse zum Flughafengebäude. Allein der Anblick des riesigen Airports, von dem ich als Kind ein paar Mal mit meiner Familie in den Urlaub geflogen bin, bereitet mir leichte Panik. Ich gehöre hier einfach nicht mehr her.
Der Bus hält. Wieder drängelt sich alles an mir vorbei ins Freie. Es sind nur ein paar Schritte bis zur Rolltreppe im Gebäude, die uns ein Stockwerk nach oben trägt.
Die Ausweiskontrolle geht fix, da ich einen deutschen Pass habe, und so folge ich den Schildern zur Gepäckhalle. Das Rollband für meinen Koffer steht noch still. Zeit, E-Mails zu checken. Ich schalte mein Smartphone ein, das ich auch dienstlich nutze. Meinem Geschäftspartner Rory habe ich versprochen, dass ich für ihn erreichbar bin. Das war das Mindeste, nachdem ich von einem auf den anderen Tag abgereist bin und ihn mit einem wichtigen Projekt hängen gelassen habe.
Angerufen hat er nicht, dafür eine E-Mail geschickt. Unser Kunde hat mal wieder ein paar Änderungswünsche. Nichts Besonderes, das kriegt Rory hin. Ich antworte ihm, dass ich mit seiner Vorgehensweise einverstanden bin, dann öffne ich mit angehaltenem Atem wieder die Anrufliste.
Ava hat angerufen. Zweimal. Dann eine WhatsApp geschickt, in der sie mich fragt, ob ich schon angekommen bin und wie der Flug war. Sie ist auch eine, die ich mit meiner ungeplanten Reise vor den Kopf gestoßen habe. Ich antworte ihr, dass alles gut gelaufen ist und ich sie später anrufe. Sofort schäme ich mich, da ich nicht weiß, ob ich es tatsächlich tun werde.
Es kommt Bewegung in die Menge vor dem Band. Die Koffer rollen an. Ich habe Glück, denn meiner ist unter den ersten, und so schnappe ich mir das schwarze Ungetüm, lasse den Zoll hinter mir und nehme die Skyline zum Fernbahnhof.
Schon im Flieger war es komisch, vereinzelt wieder Deutsch zu hören, doch jetzt am Bahnsteig prasseln so viele Stimmen in meiner Muttersprache auf mich ein, dass es wie ein kleiner Kulturschock ist. Obwohl Deutschland ja meine Heimat ist – war.
Natürlich telefoniere ich ab und zu mit meiner Mutter auf Deutsch, aber dann ist es eben nur ihre Stimme.
Ich schüttle den Kopf über meine Verwirrung. So lange ist es auch wieder nicht her. Nach dem Studium vor acht Jahren habe ich das letzte Mal meine Mutter in Deutschland besucht. Shame on me. Aber sie ist eben schon lange nicht mehr die Frau, die sie einmal war.
Die Bahn ist zu spät. Wenigstens etwas, das sich in diesem Land nie ändern wird. Ich entscheide mich, eine der Reservierungsanzeigen zu ignorieren, und hoffe, die Person taucht nicht auf. Immerhin ist es nicht weit bis zu meinem Zielbahnhof.
»Nächster Halt: Würzburg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.« Die Ansage lässt mich aufschrecken. Bin ich doch tatsächlich eingenickt. Lustlos greife ich nach meinem Gepäck. Ein Teil von mir wünscht sich, dass die Reise zum Zielort endlich zu Ende ist, ein anderer, dass ich schon bald nach Vancouver zurückfliegen kann.
Würzburg in Unterfranken. Hier habe ich das Deutschhaus-Gymnasium besucht, mir Actionfilme im Kino angesehen und mich im Dallenbergbad zum ersten Mal verliebt.
Wie mir gleich auffällt, hat sich die Bahnhofshalle zum Besseren gewandelt. Meine Mutter hat mir irgendwann einmal erzählt, dass das gesamte Bahnhofsgelände seit 2012 saniert wird. Das ehemalige Fahrkartenbüro ist einem direkten Zugang zu den Gleisen gewichen, und die unansehnlichen gelben Wandfliesen wurden von einem weißen Anstrich sowie hellen Fliesen abgelöst, die für mehr Freundlichkeit sorgen. Auch die neuen Ladengeschäfte wie Drogerie, Buchhandlung und Bäckerei sowie mehr Sitzplätze und Aufzüge für Rollstuhlfahrer verleihen dem Inneren einen ungewohnt modernen Eindruck.
Der Vorplatz des Gebäudes führt mich zur Straßenbahnhaltestelle und zum Busbahnhof. Auch hier hat sich einiges verändert. Die zahlreichen Bahnhofsbuden sind alle verschwunden. Immerhin steht der Kiliansbrunnen noch an gewohnter Stelle, und der Bus, der Würzburg mit meiner Heimatgemeinde Friedberg verbindet, fährt häufiger als früher, wie ich mit Blick auf den Fahrplan erfreut feststelle. Leider ist es im Inneren des Fahrzeugs nicht klimatisiert. Ich puste mir eine dunkle Haarsträhne aus der mit Schweiß bedeckten Stirn. Ich muss mal wieder zum Friseur. In den letzten Wochen habe ich so viel in der Firma zu tun gehabt, dass selbst dafür keine Zeit war.
»Entschuldigen Sie, Ihr Koffer …« Eine junge Frau, vielleicht 16, spricht mich an. Mein Gepäck steht mitten im Gang.
»Oh, sorry.« Einen Moment lang stockt mir der Atem, und ich starre die Frau, die eigentlich noch ein Mädchen ist, an. Etwas zu lang, wie mir ihre zusammengekniffenen Augen verraten. Verständlich, denn ich bin doppelt so alt wie sie, und mein Glotzen könnte sie fehlinterpretieren. Kaum bin ich zurück in der Heimat, da sehe ich Gespenster.
Schnell ziehe ich den Koffer zwischen meine Beine, die wenig Freiheit genießen. 25 Minuten später steige ich aus. Ein paar Meter von der Bushaltestelle entfernt ist ein Bushäuschen, von der eine andere Linie durch die Gemeinde fährt. Das Häuschen existiert seit über 20 Jahren, genau an dieser Stelle. Der Dorfbus würde mich quasi direkt vor dem Haus meiner Mutter absetzen, es ist nur eine Station. Doch ein paar Schritte zu Fuß werden mir nach dem langen Herumsitzen guttun.
Trotz Gepäck meide ich die Abkürzung über den Weinbergsweg und folge der kurvigen und steilen Hauptstraße hinauf, vorbei an vertrauten Einfamilien- und Reihenhäusern. Ich bin froh, niemandem zu begegnen. Mein Auftauchen wird sich schnell genug in Friedberg herumsprechen.
Mein Ziel ist ein alleinstehender Bungalow mit Vorgarten, der äußerst ungepflegt wirkt. Die Beete sind vertrocknet, und der Rasen sieht aus, als hätte er seit Wochen keinen Sprenger mehr gesehen. Aber was habe ich nach dem Anruf meiner Mutter auch erwartet? Sie hat andere Sorgen als ihre Blumenbeete. Trotzdem – sie liebt ihren Garten, hat sich immer selbst darum gekümmert. Sogar für Vater waren die Beete tabu. Ich lächle bei der Erinnerung an einen Nachmittag, an dem ich meiner Mutter eine Freude machen wollte und das Unkraut im Garten zupfte. Ich muss elf oder zwölf gewesen sein, meine Kindheit noch unbeschwert.
»Du hackst mir meine schönen Beete kaputt«, schimpfte sie zu Recht, denn ich hatte einige Setzlinge erwischt.
Jetzt, wo ich vor der Haustür stehe, schäme ich mich auf einmal, dass ich so verschwitzt bin. Meine Haare in der Stirn sind nass, und auch unter dem Sweatshirt hat sich Feuchtigkeit angesammelt.
Sie öffnet sofort auf mein Klingeln. Wahrscheinlich hat sie mich vom Küchenfenster aus entdeckt.
»Robert, da bist du ja endlich.« Mutter nimmt mich in den Arm. Sie reicht mir kaum bis zur Schulter. »Du bist blass«, meint sie, nachdem sie sich von mir gelöst hat. »Gibt es in Kanada keine Sonne?«
»Doch«, antworte ich. Aber da ich viel arbeite, bin ich zu selten im Freien. Dein Gesicht hat noch weniger Farbe, denke ich. Die dunklen Ringe, die seit Jahren von Schlafmangel zeugen, heben sich markant auf ihrer fahlen Haut ab. Auch hat sie abgenommen, was mir über Skype nicht aufgefallen ist.
Das Haus ist aufgeräumt, und der Geruch nach Putzmitteln drängt sich mir auf.
»Du magst doch in deinem alten Zimmer schlafen, oder?« Meine Mutter lächelt mich an. »Ich kann dir aber auch das Gästezimmer vorbereiten, wenn du das lieber möchtest.«
»Nein, das passt. Danke.« Unser Umgang miteinander wirkt etwas förmlich, aber was habe ich erwartet nach acht Jahren, in denen wir uns nur über Telefon oder Videochat gesprochen haben? Schnell unterdrücke ich das schlechte Gewissen. Es ist nicht meine Schuld. Jedenfalls nicht nur.
Ich bringe das Gepäck in mein altes Schlafzimmer. Natürlich sieht es nicht mehr aus wie ein Kinderzimmer, auch wenn Bett und Kleiderschrank schon immer dort standen, wo sie jetzt stehen. Ich bin kurz vor meinem 20. Geburtstag ausgezogen. Trotzdem erinnere ich mich noch genau an die Poster vom Videospiel StarCraft, mit denen ich als Teenager die Wände tapeziert habe. Und auch an meinen ersten PC, auf den ich damals so irre stolz war.
Der Raum nebenan ist das Elternschlafzimmer, in dem jetzt nur noch meine Mutter schläft. Das Zimmer gegenüber ist zugesperrt. Ich schlucke, wende den Blick ab.
»Ich habe dein Lieblingsessen gekocht.« Meine Mutter steht auf einmal hinter mir. »Rinderrouladen.«
Mir wird kurz übel, nicht vor Hunger, sondern weil sie doch eigentlich wissen müsste, dass ich Rouladen nicht mehr esse. Seit fast 20 Jahren nicht. Doch ich zwinge mich zu einem Lächeln, da ich weiß, wie viel Arbeit sie sich gemacht hat, nur um mir eine Freude zu bereiten.
Trotzdem frage ich mich, ob ich das Essen runterkriegen werde. Zwar knurrt mein Magen, doch Rouladen sind für mich zu eng mit der Katastrophe verknüpft, die vor zwei Jahrzehnten über dieses Haus hereingebrochen ist.
Kapitel 2 Freitag, 09. August 2019
Valentina
»Wie viele Energydrinks hattest du heute Morgen schon?« Kris’ Stimme ist anzuhören, dass er sich mal wieder über mich lustig macht.
»Nur zwei. Keine Sorge.« Die beiden leeren Dosen liegen auf dem Beifahrersitz meines heutigen Dienstwagens. Ich greife in die Tüte Gummi-Colafläschchen auf der Ablage und stecke mir drei auf einmal in den Mund. Säße Kris neben mir, würde er die Augen verdrehen. Zucker, Koffein und Farbstoffe – nichts hält mich besser wach. Die letzte Nacht war wie die meisten davor wieder kurz. Um Mitternacht im Bett und um 4.30 Uhr raus für den nächsten Job.
Seit zweieinhalb Stunden sind der Kollege und ich im Einsatz. Kris’ Wagen steht nur wenige Meter von meinem entfernt. Über Funk und Handy sind wir in ständigem Kontakt.
»Der Kerl ist jedenfalls kein Frühaufsteher.« Kris gähnt. »Mein Hintern schläft langsam ein.«
Ich schmunzle. »Jetzt schon?«
»Ja. Ich werde wohl zu alt für den Job.«
»Lange kann es nicht mehr dauern. Es sei denn, er ist wirklich krank.«
»Ach was. Wird schon was dran sein. Selbst du weißt doch mittlerweile, wie das läuft.« Kris spielt auf meine Berufserfahrung an, da ich erst seit etwas über zwei Jahren dabei bin. Er dagegen ist mit Ende 40 ein alter Hase. Ich arbeite gern mit Kris zusammen. Es ist immer kurzweilig mit ihm, vor allem, wenn er eine Geschichte aus seiner 20-jährigen Laufbahn auspackt. Gestern haben wir uns zehn Stunden gemeinsam den Hintern wund gesessen, ohne die Zielperson überhaupt gesehen zu haben. Hoffentlich verläuft der heutige Tag anders.
»Arbeitest du am Wochenende?«, fragt Kris.
»Morgen auf jeden Fall.« Ich habe sowieso nichts vor am Samstag. »Sonntag mal sehen. Du?«
»Hab frei. Gott sei Dank.« Es klingt weniger erleichtert, als seine Worte es vermuten lassen. Kris lebt für den Job. Das müssen wir alle, da das Privatleben auf der Strecke bleibt. Na ja, ich habe ohnehin keines.
Endlich tut sich etwas. Die Haustür, die ich seit Stunden fokussiere, öffnet sich. »Er kommt raus.«
»Alles klar.«
»Er nimmt den Wagen. Es kann losgehen.«
Ich höre, dass Kris den Motor startet. »Übernimmst du das Protokoll?«
Ich bejahe und schalte das Diktiergerät an. »Die Zielperson verlässt das Haus mit der Nummer 16 um 7.42 Uhr. Sie steigt in einen schwarzen Passat, Kennzeichen WÜ-KJ-1518.« Ich warte, dass Kris an mir vorbeifährt, bevor ich ebenfalls dem Passat folge.
Nur 15 Minuten dauert die Fahrt, dann hält die Zielperson vor einer Baustelle.
»In derselben Stadt«, höre ich die Stimme des Kollegen. »Nicht zu fassen. Macht sich nicht einmal die Mühe, weiter weg anzuheuern.«
»Leichter für uns«, antworte ich. »Dann kommen wir heute vielleicht schneller ans Material als gedacht.« Ich parke am gegenüberliegenden Straßenrand, sodass ich ungehindert auf die Baustelle schaue. Kris biegt um die Ecke und stellt den Wagen eine Straße weiter ab, um sich dem Gebäude von der anderen Seite zu nähern. Schließlich weiß man nie, aus welcher Perspektive die besten Bilder zu holen sind.
Die Malerarbeiten an der Fassade des Neubaus sind bereits im vollen Gange. Ich nenne dem Diktiergerät nochmals die aktuelle Uhrzeit sowie Adresse und Hausnummer, dann schnappe ich mir die Videokamera, hänge sie mir um und verlasse leise den Dienstwagen. Kris wird nur sein Handy für Aufnahmen nutzen, da zwei Personen mit Kameras – sollte jemand uns sehen – doch sehr auffällig sind.
Es nieselt. Ich binde meine blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und ziehe mir etwas umständlich die Kapuze des Hoodies über den Kopf. Ich mag es nicht, während der Arbeit offene Haare zu tragen. Bei der Länge stören sie mitunter, vor allem wenn es windig ist und sie beim Fotografieren oder Filmen vor die Linse fliegen.
»Ich habe die Jungs gut im Blick«, teilt mir Kris mit. Wir sind immer noch über unsere Smartphones verbunden. Meines ist in der rechten Tasche des Hoodies. Ich trage kabellose Kopfhörer. »Sind sehr fleißig. Auch unser Mann.«
Ich grinse in mich hinein, da ich mir vorstelle, wie Kris gerade irgendwo auf der anderen Seite der Baustelle steht und sich handschriftlich Notizen macht. Von meiner Position aus kann ich ihn nicht entdecken. Schon so oft habe ich ihm den Tipp gegeben, einfach alles ins Handy zu sprechen oder die Notizen-App zu nutzen, doch da ist er altmodisch. Er schreibt alles mit Kuli auf einen Block. Der Chef hat nichts dagegen, denn Kris’ Berichte sind einwandfrei und haben den Kunden vor Gericht schon oft den Hals gerettet. Vermutlich tarnt er sich als Spaziergänger, manchmal hat er sogar seinen Basset dabei, um vorzugeben, Gassi zu gehen.
Ich brauche eine Weile, um eine Ecke vor dem Bauzaun zu finden, die von dem Neubau aus nicht so leicht einzusehen ist und gleichzeitig brauchbare Bilder liefert. »Bin auch so weit«, sage ich ein paar Minuten später, nachdem ich einen Baum entdeckt habe, der meinen schlanken Körper zumindest teilweise verdeckt. »Hab unseren Mann auch im Visier.«
»Dass die Leute immer noch glauben, damit durchzukommen.« Kris schnauft. »Und hinterher heulen sie ihrem Arbeitgeber was vor.«
»Ja, von wegen krank. Sieht mir ganz fit aus, so wie er den Strukturroller schwenkt.«
»Wette, die allermeisten von denen arbeiten schwarz. Da würde ich zu gern mal jemanden vorbeischicken.«
Nicht unsere Baustelle, denke ich und filme weiter. Mehrere Stunden lang. Die Jungs machen nicht mal Frühstückspause. Ich bin es gewohnt, mir die Beine in den Bauch zu stehen, doch bin ich trotzdem froh, als Kris um kurz nach 12 Uhr vorschlägt, für ein paar Minuten zurück zu den Autos zu gehen, um etwas zu essen.
Mir kommt die Unterbrechung auch deshalb gelegen, weil ich pinkeln muss und keine geeignete Stelle für das kleine Geschäft gefunden habe. Im Auto habe ich für den Notfall immer ein tragbares Urinal dabei.
»Hey, Sie, was machen Sie da mit der Kamera?«
Ich fahre zusammen. Scheiße, was will der denn jetzt?
Einer der Männer kommt auf mich zugelaufen. Ich beschleunige den Schritt, schaffe es aber nicht rechtzeitig, an ihm vorbeizuziehen. Er öffnet den Bauzaun und stellt sich mir in den Weg.
Ich schlucke. Es ist mir noch nie passiert, dass mich jemand während der Arbeit auf diese anspricht. Wenigstens ist er nicht unsere Zielperson, aber trotzdem …
Ich versuche, ruhig zu bleiben und mich daran zu erinnern, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Wie ich mit der Situation umgehen muss.
»Machen Sie etwa Fotos von der Baustelle?« Der Mann stemmt die Hände in die Hüften, wodurch sein Bizeps unnötig zur Geltung kommt.
»Nein. Ich bin Journalistin und komme von einem Pressetermin«, antworte ich möglichst locker. »Wieso? Möchten Sie, dass ich filme? Gibt es was Besonderes über den Bau zu berichten? Ich bin immer auf der Suche nach einer Story. Bin noch ganz frisch im Job, wissen Sie?« Ich rede zu viel! Das wird er mir nie abkaufen.
Doch zu meiner Überraschung tritt er ein paar Schritte zurück und schüttelt den Kopf. »Nein. Ist nur ein Wohnhaus. Nix Besonderes.«
Es ekelt mich an, wie er mich von oben bis unten mustert. Der Typ ist kaum größer als ich. Er fährt sich mit einer Hand über die schwitzige Stirn und leckt seine Lippen. »Aber wenn Sie mal ’nen richtigen Mann haben wollen, können Sie gern mal ohne Kamera vorbeikommen.« Sein Grinsen ist so schleimig wie die Pomade in seinem Haar.
Gerne hätte ich ihm geantwortet, dass ich lieber nie wieder Sex als mit ihm haben würde, doch dann besinne ich mich eines Besseren. Ich muss zum Wagen, bevor ich die Aufmerksamkeit der anderen Männer auf mich ziehe. Also verabschiede ich mich mit einem »Frohes Schaffen noch«, und wechsle die Straßenseite. Ich bin sicher, der Typ ist nicht der Einzige, der mir hinterherstarrt.
Robert
Heute habe ich für uns gekocht, weil meine Mutter nicht mehr verbergen kann, wie schlecht es ihr geht. Schon am Morgen habe ich mich darüber gewundert, dass ich vor ihr in der Küche stand. Sie war nie eine Langschläferin.
»Schmeckt sehr gut.« Es klingt leicht überrascht, so als hätte sie mir nicht zugetraut, das Mittagessen für uns beide zuzubereiten. Spaghetti mit Tomatensoße, na also, das kriege ich gerade noch so hin, auch wenn ich tatsächlich selten koche.
»Was sagt denn der Arzt?«, frage ich, sehe meine Mutter dabei aber nicht an. Gestern fand ich es aus irgendeinem Grund zu unhöflich, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen.
Sie seufzt schwer. »Ein paar Wochen. Vielleicht auch zwei, drei Monate, aber Weihnachten werde ich wohl nicht mehr erleben.«
Ich schlucke. Scheiß Krebs. »Aber so plötzlich. So schnell.« Lustlos drehe ich die Spaghetti auf meine Gabel. Noch immer wage ich es nicht, sie anzusehen, aus Angst, dass ich die Tränen dann nicht mehr zurückhalten kann.
»Darmkrebs in dem Stadium geht in der Regel immer schnell. Wer weiß, wie lange ich es schon habe.« Sie sagt es seltsam unberührt, als würde sie von einer entfernten Bekannten sprechen. Vielleicht, weil sie schon vor 20 Jahren gestorben ist. Zumindest innerlich.
»Aber man muss doch was machen können. Operieren oder Chemo.«
Wieder ein Seufzen. »Wenn man ihn früher entdeckt hätte, dann ja. Ich bin alt, Robert. Menschen sterben. Du wirst dich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass ich bald nicht mehr da bin.«
»62 ist kein Alter, Mama«, protestiere ich.
»Du musst mir nicht beim Sterben zusehen, wenn es das ist, was du fürchtest.« Sie legt die Gabel beiseite. Ihr Teller ist noch halb voll. »Ich wollte dich nur noch mal sehen, das ist alles.«
Nun schaue ich sie doch an. Wir haben beide Tränen in den Augen. Appetit habe ich keinen mehr. Ich hätte das Thema doch erst nach dem Essen ansprechen sollen. »Was redest du denn nur? Natürlich bin ich da für dich.« Ich räuspere mich. »Solange es eben dauert.«
»Und deine Firma?«
»Mein Geschäftspartner hat alles im Griff. Außerdem kann ich auch von hier aus arbeiten.« Den Laptop habe ich dabei, und als Grafikprogrammierer ist es kein Problem, mich jederzeit ins Business einzuklinken. »Hast du eigentlich Schmerzen?«
»Mit den Medikamenten geht es meistens.« Sie hat heute schon einige Tabletten genommen, wie ich gesehen habe, auch wenn sie versucht hat, sie möglichst diskret einzunehmen. Wenigstens kennt sie sich aus. Sie ist Apothekerin und hat über Jahre mit meinem Vater die einzige Apotheke in Friedberg geführt. Später auch allein. »Ich habe dich vermisst«, sagt sie jetzt.
Ich senke den Blick. Auch wenn sie das behauptet, glaube ich es ihr nicht so recht. Ich weiß, wen sie eigentlich vermisst. Mehr als alles und jeden anderen auf dieser Welt.
»Hast du noch Kontakt zu deinem Vater?«, fragt sie mich.
Leicht gereizt schiebe ich den Stuhl zurück und erhebe mich. Greife nach den Tellern, um sie abzuräumen. »Du isst nichts mehr, oder?« Ich möchte nicht über ihn reden, es tut zu sehr weh.
»Robert, tut mir leid. Setz dich wieder hin. Bitte. Ich möchte nur nicht, dass du später etwas bereust.«
»Du weißt, dass ich ihn nicht mehr sehen möchte.« Habe ich auch nicht, seit er uns sitzen gelassen hat.
»Er ist dein Vater. Und er liebt dich.«
Ich stehe immer noch mit den Tellern in der Hand am Tisch. »Ich fasse nicht, dass du noch mit ihm sprichst. Nach allem, was er uns angetan hat.«
»Es war für uns alle nicht leicht«, sagt sie traurig.
Schnaufend räume ich Teller und Besteck in den Geschirrspüler und frage mich, wie ich überhaupt eine Woche mit ihr in diesem Haus aushalten soll, wenn wir schon nach den paar wenigen Stunden, die wir zusammen sind, streiten.
»Setz dich und erzähl mir was von dir«, fordert sie mich auf. »Du hast eine Freundin, oder?«
Ich nicke, habe jedoch keine Lust, über Kanada mit ihr zu sprechen. Das Leben dort hat mit dem hier in der Gemeinde nichts zu tun. Friedberg ist Geschichte, und ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas aus dieser Vergangenheit mein jetziges Leben berührt. Ich habe sehr lange gebraucht, um mit dem, was uns vor 20 Jahren passiert ist, abzuschließen und mir etwas Neues aufzubauen.
»Warum hast du sie mir nie vorgestellt?«
»Über Skype?« Ich schüttle den Kopf.
»Besser als gar nicht. Wie heißt sie denn und wie ist sie so?«
»Ava. Sie ist …« Süß. Umwerfend. Meine Traumfrau. »Müssen wir über sie sprechen?« Ich setze mich zurück an den Tisch. »Es geht doch um dich jetzt.« Vorsichtig greife ich nach ihrer Hand.
»Ach, ich will nicht immer nur über diese Krankheit sprechen. Ich möchte was von dir wissen. Wie es dir geht. Wie du so lebst. Wie lange du mit deiner Freundin schon zusammen bist. Ich weiß darüber so wenig.«
»Mir geht es gut«, antworte ich, damit sie aufhört, mich zu löchern. »Meine Firma ist sehr erfolgreich, mit Ava bin ich seit etwas mehr als zwei Jahren in einer Beziehung. Wir wohnen aber nicht zusammen.«
»Wieso nicht?«
»Ach Mama, es ist kompliziert.«
»Dann bist du dir nicht sicher mit ihr, oder?«
»Doch, natürlich«, antworte ich lauter als beabsichtigt, aber warum kann meine Mutter sich nicht einfach mal mit den Antworten zufriedengeben? »Es ist nicht mehr so wie früher, dass man nach einem Jahr heiratet und im nächsten eine Familie gründet.«
»Na, so schnell ging es bei deinem Vater und mir auch nicht.« Sie lächelt flüchtig bei der Erinnerung. »Hauptsache, du bist glücklich mit ihr.«
Ich schweige.
»Was macht deine Ava denn? Also, beruflich, meine ich.«
»Sie ist Lektorin bei einem großen Publikumsverlag. Wir arbeiten beide gern«, betone ich. »Unsere Jobs sind uns wichtig.«
»Hmm«, meint sie nur und steht mühsam auf. »Es tut mir leid, aber ich muss mich hinlegen. Diese Medikamente machen mich immer fertig.« Sie berührt mich an der Schulter – oder stützt sie sich ab? – und läuft in Richtung Schlafzimmer.
»Ich werde ein paar Erledigungen machen«, rufe ich ihr hinterher. »Einkäufe und so.« Hauptsache, ich komme mal raus aus diesem Haus. »Brauchst du etwas?«
Sie antwortet nicht, also inspiziere ich Kühlschrank und Vorratskammer, mache mir ein paar Notizen ins Handy, schnappe mir meinen Rucksack und verlasse das Haus.
Ohne Koffer und bergab bin ich schnell unten im Dorfkern angekommen. Schon nach wenigen Schritten sehe ich, dass sich einiges getan hat in den letzten acht Jahren. Neues Pflaster bei den Gehwegen, auch ein paar Straßen wurden neu asphaltiert. Die Sparkasse hat Konkurrenz von einer Volksbank-Filiale erhalten, die Metzgerei ist hingegen verschwunden. Die ehemalige Apotheke meiner Eltern heißt jetzt nicht mehr Friedberg-Apotheke, sondern Neue Apotheke. Sehr einfallsreich, denke ich und öffne die Tür zur Bäckerei daneben, um Brot zu kaufen.
»Grüß Gott«, begrüßt mich eine Frau in den 30ern. »Sie wünschen bitte?«
»Hi«, sage ich nur und sehe an ihr vorbei ins Regal, in dem die Brote aufgereiht sind. Obwohl ich erst gegessen habe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich das deutsche Brot vermisst habe.
»Robert? Robert Muth?«
Ich schrecke auf. Die Verkäuferin hat mich angesprochen. Woher kennt sie meinen Namen?
Ich mustere sie. Auch sie kommt mir bekannt vor, doch fällt mir nicht gleich ein, woher.
»Ich bin es, Sandra. Sag bloß, du erkennst mich nicht mehr.« Mit gespielter Empörung stemmt sie die Fäuste in die Hüften.
»Ach, Sandra, sorry, ich war so auf die Brote konzentriert, dass ich es gar nicht gecheckt habe.« Ich bemühe mich mit einem Lächeln, den Fauxpas wieder gutzumachen. Sie hat sich ja auch verändert, denke ich. Hat kinnlange Haare, dabei reichte ihre blonde Mähne früher fast bis zum Po. Ein paar Falten auf der Stirn und in den Mundwinkeln hat sie auch bekommen und an Gewicht zugelegt, was ihr gut steht. Aber an den silbergrauen Augen, von denen ich schon als Teenager fasziniert war, erkennt man sie eigentlich sofort. Natürlich hätte ich mich auch daran erinnern können, dass diese Bäckerei mal ihren Eltern gehörte und nun wohl von ihr geführt wird.
Lachend kommt sie hinter der Theke hervor und umarmt mich. Was ich nach so langer Zeit übertrieben finde, deshalb versteife ich mich ein wenig. »Marlenes kleiner Bruder. Lange nicht gesehen.«
Ich zucke zusammen. »Ja. Ist eine Weile her.« Als ich vor acht Jahren hier war, haben wir uns, glaube ich, nur kurz gesehen und nicht gesprochen. Damals war sie hochschwanger.
Sandra schaut mich so prüfend an, wie ich es soeben bei ihr getan habe, und ich frage mich, ob sie denkt, dass auch ich mich sehr verändert habe. »Lebst du noch immer in Kanada?«
Ich nicke. »Vancouver. Bin dort nach dem Auslandsjahr hängen geblieben.«
»Wahnsinn.« Sie schüttelt lächelnd den Kopf. »Ich könnte nie so weit von zu Hause wegziehen.« Sie geht zurück hinter den Tresen, weil eine ältere Dame den Laden betritt. »Wohl deshalb lebe ich noch immer in Friedberg.«
Ich zucke mit den Mundwinkeln. Menschen, die nie etwas anderes als ihre Heimatgemeinde gesehen haben, kann ich nicht verstehen. »Gehen Sie ruhig vor«, sage ich zu der Kundin, da ich noch keine Zeit hatte, mich für ein Brot zu entscheiden. Auch der Kuchen in der Auslage sieht lecker aus.
Sandra packt zwei Stücke Aprikosen-Käse-Kuchen für die Dame ein. Nachdem sie kassiert hat, wendet sie sich wieder mir zu. »Welches Brot darf es denn nun sein?«
»Ein Graubrot und ein Dinkelbrot bitte.«
Sie packt beides in Papiertüten und reicht sie mir. »Macht neun Euro 20.«
Ein Blick in mein Portemonnaie verrät mir, dass ich etwas Entscheidendes vergessen habe. »Oh, ich habe gar kein Bargeld. Nur Dollar.« Wie unangenehm. »Ich gehe eben zur Bank und komme gleich wieder.«
»Schon gut.« Sandra kichert und sieht dabei aus wie das junge Mädchen, als das ich sie kennengelernt habe. »Kartenzahlung geht bei uns leider nicht, aber ich nehme an, du fliegst nicht gleich morgen wieder weg. Zahle einfach das nächste Mal, wenn du vorbeikommst.«
»Danke.« Das Dorfleben hat auch seine positiven Seiten. Ich greife nach den Tüten und packe sie in den Rucksack. Sie schaut mich erwartungsvoll an, und mir fällt ein, dass ich mich gar nicht nach ihr erkundigt habe. Zumindest aus Höflichkeit hätte ich sie etwas über ihr Leben fragen sollen. »Bis dann«, verabschiede ich mich dennoch.
»Bis bald«, sagt sie, und ich mache schnell, dass ich aus dem Laden komme.
Valentina
Mit den zwei Einkaufstaschen quetsche ich mich durch die Wohnungstür. »Hallo, ich bin wieder zu Hause.«
Schön, dass du da bist, antworte ich mir selbst im Geiste und stelle den Einkauf neben dem Schuhschrank ab. Einen Moment lehne ich mich gegen die geschlossene Tür. Der Tag war anstrengend, und ich habe es gerade noch so vor Ladenschluss geschafft, ein paar Lebensmittel zu besorgen. Putzen müsste ich auch mal wieder, wie mir die Flusen auf den Fliesen im Flur verraten.
Morgen, beschließe ich und trage die Taschen in die Küche. Ich habe großen Hunger und keine Lust, mir etwas zu kochen, also entscheide ich mich für die Gnocchi aus dem Supermarkt. Angeblich brauchen die keine fünf Minuten. Im Kühlschrank finde ich noch einen Rest Tomatensoße. Prima. Meine Ernährung lässt in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig, aber darüber würde ich mir ein andermal den Kopf zerbrechen.
Ich mache es mir mit einem Teller auf dem Sofa gemütlich, da vernehme ich ein lautes Maunzen aus Richtung der Terrassentür. Sofort stelle ich den Teller zur Seite und begrüße den Streuner, der durch die Katzenklappe in die Wohnung schleicht.
»Doktor Watson!« Erfreut hebe ich den schwarzen Kater hoch und vergrabe mein Gesicht im warmen Fell. »Da bist du ja.« Mein kleiner Freund ist mindestens so viel unterwegs wie ich, aber er scheint immer zu merken, wenn ich wieder zu Hause bin. »Hast du Hunger?«
Doktor Watson antwortet mit einem Schnurren und springt von meinem Arm. Eindeutiges Zeichen dafür, dass er mich verstanden hat und auf das Auffüllen seines Napfes wartet. Ich beobachte ihn, während er die Stücke Truthahn verschlingt. Ihm beim Fressen zuzuschauen hat auf mich eine ebenso beruhigende Wirkung wie für andere eine Yogaeinheit.
Anschließend begleitet Doktor Watson mich aufs Sofa. Meine Gnocchi sind kalt, schmecken aber trotzdem.
Eine WhatsApp reißt mich aus dem Feierabendmodus. Richtig, Melissa, unsere Assistentin in der Detektei, wollte mir ja noch den Auftrag für morgen schicken.
Ich lese den Namen und die Adresse eines Mannes sowie das Thema. Mehr Informationen erhalten wir in der Observation nicht, das verlangt der Datenschutz unserer Auftraggeber. Es wird strikt getrennt zwischen Mitarbeitern im Außendienst und denen, die die Kunden betreuen. Diesmal geht es um eine Untreueermittlung, bei Privatkunden mit Abstand die häufigste Anfrage.
»Du bist allein im Einsatz«, teilt Melissa mir noch mit. Das kommt zwar selten vor, aber am Wochenende haben eben doch einige Kollegen frei, und die Aufträge stapeln sich momentan.
»Kein Problem«, schreibe ich zurück und freue mich sogar, mich allein behaupten zu dürfen. Mein Traum ist es nämlich, in ein paar Jahren eine eigene Detektei zu führen. Auch wenn ich das meinem Arbeitgeber natürlich nicht auf die Nase binde.
»Zeit zu zeigen, was ich kann«, sage ich zu Doktor Watson und streichle sein Köpfchen. Sein Schnurren interpretiere ich als Zustimmung.
Erneut ist es mein Handy, das mich aus den Gedanken reißt.
»Hallo, Papa.« Eigentlich wäre es an mir gewesen, mich mal wieder zu melden.
»Hallo, Tinchen. Wie geht es dir?«
Ich hasse es, wenn er mich so nennt, aber egal, wie oft ich es erwähne, er liebt diesen Spitznamen einfach. »Gut. Und dir?«
»Kann nicht klagen. Kommst du morgen zum Essen?«
»Sehr verlockend, aber ich muss arbeiten.«
»Am Wochenende? Schon wieder?« Er klingt nicht enttäuscht, eher besorgt.
»Sonntag habe ich frei. Ginge das auch?«
»Na klar. Ich freue mich. Was hast du denn für einen Fall, dass du dich an einem Samstag darum kümmern musst?« Mein Vater ist eine von zwei Personen, die wissen, was ich beruflich tue. Allen anderen erzähle ich, dass ich immer noch in der Verwaltung arbeite. Diskretion ist wichtig, schließlich weiß man nie, wen man mal observieren muss. Auch in den sozialen Netzwerken treten die Kollegen und ich niemals unter richtigem Namen auf. Wobei ich von Social Media ohnehin nicht viel halte.
»Untreue. Nichts Spannendes. Aber ich darf sogar allein losziehen.« Ich bin ja schon ein bisschen stolz, dass die Detektei mir so etwas mittlerweile zutraut. Das war in der praktischen Ausbildung lange Zeit nicht der Fall.
»Ist das ratsam?« Wieder höre ich die Besorgnis in seiner Stimme. »Was, wenn einer mal misstrauisch wird und dich angreift?«
Ich denke an den Typen von heute Mittag. Es war echt knapp, doch aufgeflogen bin ich trotzdem nicht. »Da fällt mir schon was ein. Wir sind darauf trainiert, mit solchen Situationen klarzukommen.« Außerdem bin ich kreativ und habe keine Angst.
Mein Vater stößt einen Seufzer aus. »Ich werde wohl nie verstehen, warum du ausgerechnet Privatdetektivin geworden bist.«
»So weit weg von deinem Beruf ist es nun auch nicht«, antworte ich. Er ist pensionierter Polizist, war jahrzehntelang auf Streife. Der Job hat ihn oft fertig gemacht, besonders die Fälle von Suizid und häuslicher Gewalt.
»Eben«, sagt er. »Daher war es ja auch vernünftiger, Jura zu studieren.«
Ich stöhne auf, da ich das Studium nach zwei Semestern geschmissen habe. »Ich hätte das Examen niemals geschafft. Meine Noten waren zu schlecht.«
»Ach, du hast nur zu früh aufgegeben.« Mein Vater hat mir den Abbruch des Studiums nie vorgeworfen, war aber froh, dass ich mich zeitnah danach für die Ausbildung zur Verwaltungswirtin entschieden habe. Ein sicherer Job als Beamtin, bei dem mir die Jurakenntnisse zugutekamen. Den Abschluss schaffte ich mit links, aber die fast drei Jahre danach in der Kämmerei waren zum Abgewöhnen. Warum man jemanden wie mich ausgerechnet in die Finanzverwaltung gesetzt hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Als ich dann die Ausschreibung der Detektei gesehen habe, zögerte ich keine Sekunde und schickte eine Bewerbung. Meine Erfahrungen aus Studium und Beamtenlaufbahn wurden sogar anerkannt, und so konnte ich die Ausbildung zur Privatdetektivin auf ein Jahr verkürzen. »Ich liebe meine Arbeit, Papa. Endlich habe ich genau das gefunden, was zu mir passt.« Und in zwei Jahren habe ich meine eigene Detektei. Dann wäre ich 30.
Mein Vater gibt auf. »Na schön. Wir sehen uns Sonntag um 12.30 Uhr. Was möchtest du essen?«
Etwas Gesundes wäre gut. Gemüse. »Makkaroni mit Käse?«, schlage ich vor. Fast bilde ich mir ein, Doktor Watson schüttelt tadelnd den Kopf.
Robert
Bei meiner Rückkehr ins Haus sitzt sie im Sessel im Wohnzimmer, ein Fotoalbum auf dem Schoß.
»Ich habe Brot gekauft.« Demonstrativ halte ich eine der Papiertüten in die Höhe. »Graubrot und Dinkel.«
»Danke. Komm, setz dich zu mir.«
Ich packe den Rucksack mit dem restlichen Einkauf aus, dann setze ich mich auf die Couch neben ihr. »Konntest du dich ausruhen?«
»Ein wenig«, sagt sie. »Erinnerst du dich an unseren Urlaub in Frankreich?« Mit einem Lächeln deutet sie auf ein Foto im Album. Es zeigt mich in Badehose am Strand. »Da warst du sieben.« Ich starre auf das zehnjährige Mädchen, das auf dem Bild neben mir steht und mich mit Sand eincremt.
Ich nicke, obwohl ich mich kaum erinnere. Nicht erinnern will. Was natürlich Unsinn ist angesichts der Tatsache, dass in diesem Haus alles an Marlene erinnert. Ihr verschlossenes Zimmer, die Alben, das Foto auf dem Kaminsims. Meine Brust wird eng, am liebsten würde ich wieder zurück ins Freie laufen.
»Wieso tust du dir das an?«, frage ich schroff. »Sie kommt nicht zurück.« Warum suhlt sie sich im Schmerz?
Meine Mutter wird blasser, als sie ohnehin schon ist. »Wie kannst du das nur sagen? Deine Schwester wird immer ein Teil von uns sein. Warum willst du sie vergessen?«
»Papa hat sie ganz schnell vergessen«, antworte ich. »Für ihn war es so leicht.«
Mutter schüttelt den Kopf. »Das ist nicht wahr«, sagt sie mit erstickter Stimme. »Das weißt du.«
»Er hat sie ersetzt. Und mich. Durch zwei neue Töchter. So wie er dich durch eine neue Frau ersetzt hat.« Es ist fies, was ich sage. Doch es ist die Wahrheit. Zumindest habe ich es immer so empfunden.
Meine Mutter schließt das Album. Tränen glitzern in ihren Augen.
»Es tut mir leid.« Ich lege eine Hand auf ihre. »Ich wollte dir nicht wehtun.«
Sie sieht mich aus ihren dunkelbraunen Augen an. Marlenes Augen, die ich auch jedes Mal sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. »Ich habe dich nicht nur hergebeten, um dich noch mal zu sehen«, gibt sie zu.
Ich schnaufe unwillig, da ich glaube zu wissen, was jetzt kommt. »Ich sollte noch etwas arbeiten.« Demonstrativ stehe ich auf.
»Du musst herausfinden, was damals passiert ist«, bittet sie mich. »Bevor ich sterbe.«
Mein Herz setzt zum Sprint an. Da haben wir sie. Die Konversation, vor der ich mich gefürchtet habe, seit ich Vancouver verlassen habe. Ich sehe auf die Uhr. Es ist früh am Morgen in Kanada, doch ist es längst an der Zeit, Ava anzurufen. Selbst wenn auch das ein unangenehmes Gespräch werden wird, ist es diesem hier auf jeden Fall vorzuziehen. »Ich muss telefonieren. In meinem Zimmer.« Ich drehe mich um.
»Bitte, Robert. Ich möchte nicht sterben, ohne es zu wissen.«
Die Traurigkeit in ihrer Stimme versetzt mir einen Stich. Trotzdem möchte ich mich nicht mit Marlenes Tod befassen, also stelle ich meine Ohren auf Durchzug und verlasse den Raum.
Ava geht gleich nach dem ersten Klingeln ran. Ich habe die Kamera auf meinem iPhone eingeschaltet, weil sie ohnehin darauf bestehen wird, mich nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.
»Good morning.« Sie lächelt sogar. Keine Selbstverständlichkeit, so wie ich mich zuletzt ihr gegenüber verhalten habe.
»Hier ist es Nachmittag«, antworte ich auf Englisch. Überflüssigerweise, denn natürlich hat sie sich gleich nach meiner Ankündigung, nach Deutschland zu fliegen, über den Zeitunterschied informiert. Sie sieht müde aus, und ihr schulterlanges hellblondes Haar wirkt so, als sei sie gerade erst aufgestanden. Für mich gibt es nichts Schöneres, als neben Ava aufzuwachen. Sie fehlt mir, und ich frage mich, warum ich ihr das nicht sagen kann.
»Entschuldige, dass ich es gestern nicht mehr geschafft habe, dich anzurufen«, sage ich stattdessen.
»Möchtest du mir nicht langsam mal erzählen, warum du in Deutschland bist?«, fragt sie. »Rory meint, es sei nicht geschäftlich.«
Na, das wäre was. Leider ist unsere winzige Firma nur national unterwegs. Ich hole tief Luft. »Nein. Ich bin bei meiner Mutter. Sie ist schwer krank.«
Ava verzieht ungläubig das Gesicht. Ich sehe, wie verletzt sie ist, und mein Magen zieht sich zusammen. »Bei deiner Mutter? Ich dachte, deine Eltern sind beide tot.«
Ja, das habe ich ihr erzählt. Weil es einfacher war. Jedenfalls solange ich in Vancouver war und Deutschland ausblenden konnte. »Es tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Wenn ich zurück bin, erkläre ich dir alles.«
»Ja, und wann kommst du wieder?« Ihre Stimme ist ein Flüstern. Bestimmt hält sie die Tränen zurück. Dabei haut meine Ava sonst nichts so schnell um.
»Leider kann ich das noch nicht sagen. Ich möchte nicht, dass meine Mutter allein ist, wenn sie …«
Ava nickt. Sie versteht es. Manchmal ist sie zu verständnisvoll. »Und wann reden wir über uns und …?« Auch sie lässt den Rest des Satzes unausgesprochen.
Ich beiße auf meine Unterlippe. Ich bin nicht gut darin, Gefühle zu zeigen, und wenn ich ehrlich bin, ist mir die ganze Situation mit uns gerade zu viel. Ich liebe Ava, auch wenn ich es ihr zu selten sage und zeige, doch warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist? »Das ist nichts, was man am Telefon bespricht, meinst du nicht?«
Sie schnauft leise und schüttelt den Kopf. »Du bist so ein Arschloch, Robert«, sagt sie und legt auf. Sie hat ja so recht.
Kapitel 3 Samstag, 10. August 2019
Valentina
Der Auftrag ist erst für den Abend angesetzt. Gar nicht gut, denn so bin ich den ganzen Tag über hibbelig.