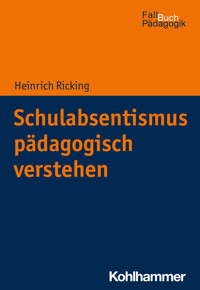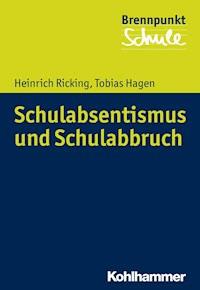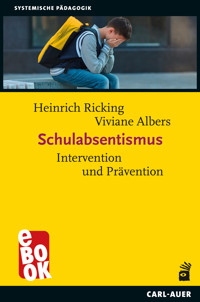
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Systemische Pädagogik
- Sprache: Deutsch
"Alle Lehrerinnen und Lehrer kennen das Problem: Schülerinnen oder Schüler fehlen mit oder ohne Grund im Unterricht. Wie soll ich mich verhalten? Wie auf Schulversäumnisse reagieren. Heinrich Ricking und Vivien Albers haben dazu nun ein Buch vorgelegt, das allen Praktikern ein wichtiges Arbeitsmittel sein kann." Prof. Dr. Kerstin Popp, Universität Leipzig "Diese Veröffentlichung plädiert nachdrücklich dafür, Schulverweigerer als pädagogische Herausforderung anzunehmen und dauerhaft einen professionellen Umgang damit zu etablieren. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt in der Zusammenstellung der Basiselemente zur Entwicklung einer präventiven Handlungskonzeptes zur Vermeidung von Schulabsentismus, in dem diagnostisches sowie didaktisches Handeln aufeinander abgestimmt werden." Dipl. Päd. Claudia Hermens, TH Köln Nur wer da ist, ist auch dabei! Fehlzeiten von Schüler:innen können vielfältige Erscheinungsformen und Hintergründe haben. Wer ihnen erfolgreich begegnen will, steht gleich vor mehreren Aufgaben. An erster Stelle steht, dass die Betreffenden zeitnah wieder in den Unterricht integriert werden. Dabei sind nicht nur formale rechtliche Vorgaben zu beachten. Tragfähige Lösungen müssen mit verschiedenen Beteiligten erarbeitet werden, die unterschiedliche Interessen verfolgen: Erziehungsberechtigte, Fachkräfte und natürlich die Jugendlichen selbst. Am ehesten gelingt dieser Prozess, wenn Schüler:innen den Schulbesuch wieder als positives Erlebnis erfahren und in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen Unterstützung finden. Heinrich Ricking und Viviane Albers vermitteln praxisbezogene Instrumente zur Einschätzung der Hintergründe von Schulversäumnissen und präsentieren darauf abgestimmte Handlungsansätze. Sie reichen von geeigneten Beobachtungskriterien über Vorschläge zu alternativen Beschulungsmaßnahmen bis zu Formulierungshilfen für Gespräche mit betroffenen Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigten. Neben der akuten Intervention geht es den Autoren auch um die langfristige Prävention. Sie nehmen dazu sowohl die pädagogische Arbeit im Unterricht als auch die organisatorische Ebene im "System Schule" in den Blick. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es pädagogischen Fachkräften, die mit Schulabsentismus konfrontiert sind, eigene Maßnahmen zu reflektieren, Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen und Erfolge langfristig zu sichern. Die Autor:innen: Heinrich Ricking, Prof. Dr. phil. Ausbildung und langjährige Berufserfahrung als Förderschullehrer. Hochschullehrer für Sonder- und Rehabilitationspädagogik mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Viviane Albers, Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik im Fachbereich Pädagogik bei Verhaltensstörungen / emotionale und soziale Entwicklung. Honorarkraft in der Leinerstift Akademie GmbH.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
Heinrich Ricking/Viviane Albers
Schulabsentismus
Intervention und Prävention
Zweite, überarbeitete Auflage, 2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Umschlagmotiv: © Roman Bodnarchuk/shutterstock.com
Redaktion: Nicola Offermanns
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Zweite, überarbeitete Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0595-4 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8545-1 (ePub)
© 2019, 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Einleitung
1 Formen und Begriffe
1.1 Erscheinungsformen von Schulabsentismus
1.1.1 Schulschwänzen
1.1.2 Angstbedingte Schulmeidung/Schulverweigerung
1.1.3 Elternbedingte Schulversäumnisse/Zurückhalten
1.1.4 Zusammenfassung
1.2 Beobachtungskriterien zu den einzelnen Formen
1.3 Reflexionsimpulse zur Einordnung in die Erscheinungsformen von Schulversäumnissen
Selbstreflexion in der Interaktion mit Schülern, die Schulversäumnisse zeigen
2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3 Schulversäumnisse: Häufigkeit und Verteilung
4 Schulische Prävention und Intervention
4.1 Bedeutsamkeit schulischer Prävention
4.2 Elemente schulischer Prävention und Intervention
4.2.1 Präventive Ansatzpunkte auf pädagogischunterrichtlicher Ebene
Ziel: Partizipation
Haltung und Gegenstandsverständnis
Lehrer-Schüler-Beziehung
Fehlzeiten wahrnehmen und registrieren
Warnsignale beachten
Hochwertiger Unterricht und kompetente Klassenführung
Sicherheit und soziale Einbindung
Lernerfolge
Mentoring
Schüler und Eltern beraten
Experte im Kollegium
Rückkehrgestaltung
Intensive Elternkooperation
4.2.2 Präventive Ansatzpunkte auf organisatorischer Ebene
Monitoring von Schulversäumnissen
Zielsetzung systematischer elektronischer Erfassungssysteme
Exkurs: Botschaften an Schüler
Exkurs: Botschaften an Lehrkräfte
5 Schulische Handlungskonzepte
5.1 Aufmerksamkeit für Anwesenheit und Anwesenheitskontrolle
Ziel: Sensibilisierung und Aufmerksamkeit für das Schulbesuchsverhalten der Schüler
5.2 Dokumentation von Fehlzeiten
Ziel: Verstehens- und Handlungsräume schaffen durch Verknüpfung statistischer Informationen mit pädagogischen Fragestellungen
5.3 Unterrichtsversäumnissen unverzüglich nachgehen
Ziele: Signal an den Schüler senden (»Deine Anwesenheit zählt«), Voraussetzungen für ein gutes Management von Schulabsentismus schaffen
5.4 Gespräche mit dem Schüler und den Erziehungsberechtigten führen
Ziele: Interesse zeigen am Schüler und seiner Lebens- und Lernsituation, Klärung der Bedingungen und Risiken für Schulversäumnisse
5.5 Schulische Maßnahmen planen und umsetzen
Ziel: Fallorientierte, individuelle Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen
5.6 Kooperative Förderung unter besonderer Berücksichtigung außerschulischer Dienste
Ziele: Interdisziplinäre Betrachtung des jeweiligen Schülers und seiner Problemlagen sowie gemeinsames Entwickeln der besten Lösungswege
5.7 Rückkehrgestaltung
Ziele: Reintegration in die Schule, Rückkehr zu regelmäßigen Schulbesuchsgewohnheiten
5.8 Rechtliche Zwangsmaßnahmen
Ziel: Durchsetzung der Schulpflicht
Exkurs: Alternative Beschulungseinrichtungen
Ziel: Bildungs- und beziehungswirksame Alltagssituationen schaffen
6 Mögliche Hürden im schulischen Rahmen
7 Hinweise für die Zusammenarbeit mit Eltern
Exkurs: Botschaften an Eltern
Schluss
Literatur
Über die Autoren
Einleitung
Sie als Lehrkraft nehmen eine Schlüsselrolle dabei ein, die Schulanwesenheiten Ihrer Schüler zu fördern!Die gute Nachricht: Es obliegt nicht Ihnen allein.
Die regelmäßige Anwesenheit von Schülern im Unterricht ist essenziell für einen guten schulischen Erfolg. Zu oft realisieren Schüler1, Eltern und Schulen nicht, wie schnell sich Schulversäumnisse – ob entschuldigt oder nicht – aufaddieren und in schulische Probleme münden. Sie führen häufig dazu, dass z. B. Drittklässler nicht richtig lesen können, Sechstklässler Fächer nicht bestehen oder Neuntklässler die Schule ganz abbrechen. Aber Schulabsentismus beschränkt sich in den Auswirkungen nicht auf den Bereich der Schule, sondern zeigt erhebliche Langzeitfolgen, u. a. einen geringen oder fehlenden Schulabschluss, die deutlich erschwerte berufliche Integration, eingeschränkte Verdienstmöglichkeiten oder ein hohes Risiko für Kriminalität (Kearney 2016). Schulabsentismus umreißt als Fachbegriff alle Verhaltensmuster, bei denen Schüler ohne ausreichende Berechtigung der Schule fernbleiben. Dabei verletzen sie nicht nur die Schulpflicht und begehen so eine Ordnungswidrigkeit, sondern blockieren i. d. R. auch den eigenen Lernfortschritt und begrenzen ihre Zukunftschancen. Die besondere Relevanz dieser Frage ergibt sich somit aus den Konsequenzen für die Lebensperspektive der Betroffenen (Stamm et al. 2009).
Schulabsentismus umfasst in allen Schulformen und Jahrgängen auffindbare Verhaltensmuster von Kindern und Jugendlichen, die oft in problematische Lebens- und Lernbezüge eingebunden sind. Das gelegentliche Aussetzen des Schulbesuchs – selten und in geringem zeitlichen Umfang – kommt bei einem großen Teil der Schülerschaft vor und wird zumeist als Bagatelle oder vorübergehende und entwicklungstypische Randerscheinung interpretiert. Schwierig wird es, wenn sich die Fehlzeiten häufen und in der schulischen Leistungsbilanz niederschlagen, wenn weitere problematische und eskalierende Verhaltensmuster damit einhergehen und generell die psychosoziale Entwicklung des Heranwachsenden gefährdet ist. Dabei ist von einem beträchtlichen Anteil der Schulpflichtigen auszugehen, die bereits deutlich erkennbare und z. T. verfestigte schulabsente Verhaltensmuster aufweisen. Die Untersuchungsergebnisse bestärken die Einschätzung von Schulabsentismus als Wegbereiter sozialer Negativkarrieren mit kumulierenden und interagierenden Lebensproblemen, überschattet von psychischen, psychiatrischen und familiären Schwierigkeiten (Ricking u. Dunkake 2017).
Daher sollte es ein pädagogisches Ziel sein, der Prävention von Schulabsentismus einen hohen Stellenwert einzuräumen, schulaversive Entwicklungen möglichst zu verhindern und desintegrative Verhaltensmuster nicht voll wirksam werden zu lassen (Ricking 2023). Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die mangelnde Teilhabe an schulischer Bildung erschwert ein integriertes Leben in der heutigen Gesellschaft eminent. Schüler, die trotz Schulpflicht nur unregelmäßig oder gar nicht mehr am Unterricht teilnehmen, verschlechtern zumeist ihre Lebensperspektiven deutlich.
Lehrkräfte nehmen eine Schlüsselrolle in der Vermittlung regelmäßiger Schulbesuchsgewohnheiten ein. Infolgedessen ist die Prävention von Schulversäumnissen bzw. ihre Reduzierung im pädagogischen Handeln keinesfalls als nachrangig zu betrachten. Jede Fehlzeit ist ernst zu nehmen – ob entschuldigt oder nicht. Die Handlungsbereiche einer Lehrkraft erstrecken sich vom Erkennen schülerbezogener Erscheinungsformen über Kenntnisse schulrechtlicher Vorgaben bis zum Wissen über Handlungsmaßnahmen schulischer Prävention und Intervention.
Die folgende Abbildung soll die zentralen Handlungsbereiche einer Lehrkraft zusammenfassen und gibt gleichermaßen einen Überblick über die folgenden Inhalte:
Abb. 1: Zentrale Handlungsbereiche (eigene Darstellung)
Die Autoren bedanken sich herzlich bei Frau Maj-Britt Klein für Ihre tatkräftige Unterstützung.
1Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir bei der Bezeichnung von Personengruppen nur die männliche Form. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gleichermaßen gemeint.
1 Formen und Begriffe
1.1 Erscheinungsformen von Schulabsentismus
Der Erfolg präventiver und interventiver Handlungsmaßnahmen bei Schulversäumnissen ist davon abhängig, wie spezifisch sie an die unterschiedlichen Erscheinungsformen angepasst werden. Die folgende Klassifikation von Schulabsentismus bezieht sich auf die ursächlichen Faktoren, legitimiert sich durch deutlich unterscheidbare Bedingungen und ist international anerkannt (Thambirajah, Grandison a. De-Hayes 2013; Kearney 2016; Reid 2014). Demnach lassen sich grundlegend drei Erscheinungsformen voneinander abgrenzen: (1) Schulschwänzen, (2) angstbedingte Schulmeidung und (3) elternbedingte Schulversäumnisse/Zurückhalten, bei dem die Fehlzeiten von Eltern herbeigeführt oder toleriert werden.
Abb. 2: Synoptischer Blick auf die Erscheinungsformen (Ricking 2014)
Um sich als Lehrkraft den Fragestellungen des Schulabsentismus gegenüber gut zu positionieren, ist es unabdingbar, sich eingehend mit diesem vielschichtigen Phänomen auseinanderzusetzen. Dabei ist das Problem Schulabsentismus nicht einfach einzuschätzen bzw. zu diagnostizieren. Individuelle Problemkonstellationen setzen sich aus dem Zusammenwirken von Bedingungsfaktoren beim Schüler, der Familie, der Schule und den Peers zusammen und resultieren schließlich in Schulmeidung. Übergänge in neue sozial-ökologische Kontexte (Transitionen) – wie Umzüge oder Schulwechsel – stellen ein besonderes Risiko für gefährdete Schüler dar. Beeinträchtigungen im Lernen und/oder Verhalten wie auch psychische Störungen sind als weitere Risikofaktoren für Schulabsentismus und Schulabbruch zu nennen (Sosu, Dare, Goodfellow a. Klein 2021; Gubbels, van der Put a. Assink 2019).
Schulabsentismus umfasst als Oberbegriff alle Formen und Intensitäten illegitimer Schulversäumnisse. Es ist somit ein facettenreiches Phänomen mit vielen möglichen Ursachen, Entwicklungsverläufen, Intensitäten und Folgen und lässt sich folgendermaßen definieren:
»Schulabsentismus umfasst diverse Verhaltensmuster illegitimer Schulversäumnisse multikausaler und langfristiger Genese mit Einflussfaktoren der Familie, der Schule, der Peers, des Milieus und des Individuums, die einhergehen mit weiteren emotionalen und sozialen Entwicklungsrisiken, geringer Bildungspartizipation sowie einer erschwerten beruflichen und gesellschaftlichen Integration und die einer interdisziplinären Prävention und Intervention bedürfen« (Ricking, Albers u. Dunkake 2016, S. 147; Ricking u. Hagen 2016, S. 18).
Der Begriff Schulabsentismus ist in diesem Kontext charakterisiert durch die physische Abwesenheit eines Schülers aus dem Wirkbereich der Schule. Er beschreibt verschiedene Formen und Ursachen von Schulversäumnissen und umreißt als Fachbegriff alle Verhaltensmuster, bei denen Schüler ohne Berechtigung der Schule fernbleiben. Im weiteren Sinn verdichtet sich hier auch die Frage der Teilhabe von Heranwachsenden am Bildungssystem. Im Folgenden soll ein Überblick über die wesentlichen Merkmale verschiedener Formen von Schulabsentismus gegeben werden.
1.1.1 Schulschwänzen
Beim Schulschwänzen handelt es sich um ein Verhaltensmuster, bei dem Schüler im Rahmen einer ablehnenden Einstellung die Schule, den Unterricht oder die Lehrer missbilligen und dies regelmäßig durch Fernbleiben vom Unterricht oder Zuspätkommen deutlich machen (Ricking 2014). Dabei gehen sie vormittags einer attraktiveren Beschäftigung oft außerhalb des elterlichen Hauses nach. Der Begriff des Schulschwänzens ist somit bei Schulversäumnissen einschlägig, die auf einer aversiven Haltung gegenüber der Schule basieren, von denen die Erziehungsberechtigten häufig keine Kenntnis haben und die auf das Betreiben des Schülers zurückgehen. Lehrkräfte berichten zudem nicht selten von Schülern, die zwar dem Unterricht fernbleiben, sich jedoch auf dem Gelände der Schule, z. B. in der Raucherecke oder im Schulcafé aufhalten. Für sie spielt die Schule als sozialer Raum eine wichtige Rolle, der den Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglicht, weniger als Bildungseinrichtung. Schüler, die häufig die Schule schwänzen, haben i. d. R. eine negative Einstellung zur Schule, fühlen sich in der Schule unwohl (Thambirajah, Grandison a. De-Hayes 2013) und denken häufig, dass es sinnlos ist, dem Unterricht beizuwohnen. Die Antizipation dieser negativen Schulsituation schließt immer mögliche Alternativen ein. Damit sind alle Situationen und Ereignisse von Bedeutung, die Schüler statt des Schulbesuchs am Vormittag erleben könnten – alle Aktivitäten und Anreize für