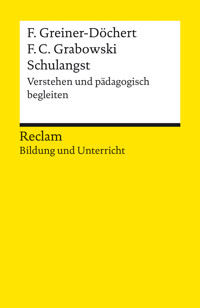
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Leistungsangst, Prüfungsangst, soziale Phobien bei Schülerinnen und Schülern nehmen zu – was können Lehrkräfte tun? Psychische Belastungen und Störungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Das gilt insbesondere für Leistungs- bzw. Prüfungsangst und soziale Phobien. Diese können zu Isolation, Schulabsentismus, ja sogar Schulabbruch führen – ein gravierendes Problem mit ernsten Folgen. Was müssen Lehrkräfte wissen, und was können sie tun? Der Band informiert: Woher kommen Schulängste? Wie erkenne ich sie bei Schülerinnen und Schülern? Wie gehe ich als Lehrkraft angemessen damit um? Mit vielen Tipps für die Schulpraxis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Franziska Greiner-Döchert / Friederike Carlotta Grabowski
Schulangst
Verstehen und pädagogisch begleitenBildung und Unterricht
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962405
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962405-1
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014670-5
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Einleitung
1 Psychische Belastungen im Schulalter
1.1 Aufgaben von Schule und Lehrkräften im Umgang mit psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen
1.2 Entstehung psychischer Störungen
2 Schulbezogene Ängste
2.1 Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängsten
2.2 Schulbezogene Ängste und Schulabsentismus
2.3 Trennungsangst
Symptome
Häufigkeit und Verlauf
Entstehungsbedingungen
Fallbeispiel Max
2.4 Soziale Angst
Symptome
Häufigkeit und Verlauf
Entstehungsbedingungen
Fallbeispiel Laura
2.5 Leistungsangst
Symptome
Häufigkeit und Verlauf
Entstehungsbedingungen
Fallbeispiel Tom
3 Pädagogischer Umgang mit schulbezogenen Ängsten
3.1 Gestaltung einer angstfreien Lern- und Prüfungsumgebung
3.2 Umgang mit dysfunktionalen Gedanken
Gezieltes Nachfragen
Aktivierung von Stärken
Aufmerksamkeitssteuerung
3.3 Reflexion von Situationen
3.4 Angstskala und Konfrontation
3.5 Entspannungstechniken
Progressive Muskelrelaxation
Autogenes Training
Achtsamkeit
Aktive Pausen
3.6 Kommunikation und Psychoedukation mit schulängstlichen Schülerinnen und Schülern
Kommunikation bei Trennungsangst
Psychoedukation zu Trennungsangst
Kommunikation mit sozial ängstlichen Schülerinnen und Schülern
Psychoedukation zu sozialer Angst
Kommunikation mit leistungsängstlichen Schülerinnen und Schülern
Psychoedukation zu Leistungsangst
3.7 Kommunikation mit den Sorgeberechtigten
Gesprächsführung
Psychoedukation zu schulbezogenen Ängsten
4 Multiprofessionelle Teamarbeit
5 Take-Home-Messages
Literaturverzeichnis
Zu den Autorinnen
[7]Einleitung
Wahrscheinlich haben Sie dieses Buch in der Hand, weil Sie bereits wahrgenommen haben, dass viele Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind und diese Belastungen nicht vor der Schultür bleiben. Diese Sensibilität ist der erste und notwendige Schritt, um psychisch belastete Kinder im Allgemeinen und Kinder und Jugendliche mit schulbezogenen Ängsten im Speziellen bestmöglich pädagogisch unterstützen zu können (Kap. 1). Mit dem Buch möchten wir Sie dazu ermutigen, auf Ihrer Sensibilität aufbauend, Wissen über schulbezogene Ängste zu vertiefen, mit dem Sie die Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängsten im Schulalter besser verstehen und Hinweise auf schulbezogene Ängste wahrnehmen können (Kap. 2). Darüber hinaus stellen wir dar, wie Sie betroffene Schülerinnen und Schüler und deren Eltern beraten können (Kap. 3).
Im Buch richten wir immer wieder den Blick auf den Schulalltag und geben konkrete, niedrigschwellige Anregungen für die pädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit schulbezogenen Ängsten, die sich in den Unterricht integrieren lassen und von denen auch der Rest der Klasse profitiert. Abschließend skizzieren wir, welche Aufgaben im multiprofessionellen Team verteilt werden können, um Schülerinnen und Schüler mit schulbezogenen Ängsten bestmöglich zu unterstützen (Kap. 4).
Alle Kapitel sind so geschrieben, dass sie prinzipiell auch einzeln gelesen werden können.
[9]1 Psychische Belastungen im Schulalter
Im Schulalter durchlaufen Kinder wichtige Entwicklungsschritte, in denen sie nicht nur intellektuell, sondern auch sozial und emotional wachsen. Während dieser Zeit begegnen sie vielen Herausforderungen, darunter sozialen und familiären Problemen, gesellschaftlichen Konflikten sowie körperlichen und hormonellen Veränderungen, die zu psychischen Belastungen führen können. Jedoch fällt es vielen Kindern und Jugendlichen – genauso wie Erwachsenen – nicht immer leicht, ihre Gefühle in Worte zu fassen und mit Bezugspersonen darüber zu sprechen. So äußern sich psychische Belastungen in der Schule oft indirekt durch Verhaltensänderungen wie Rückzug, Aggressivität oder Leistungseinbruch. Eine genaue Beobachtung durch Eltern, Lehrkräfte und andere Betreuungspersonen sowie ein Verständnis für mögliche Belastungen sind daher entscheidend, um rechtzeitig reagieren und Kinder und Jugendliche bestmöglich unterstützen zu können.
1.1 Aufgaben von Schule und Lehrkräften im Umgang mit psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche können eine Vielzahl von psychischen Belastungen erleben, die sich auf ihre emotionale, soziale und schulische Entwicklung auswirken. Wie stark Schülerinnen und Schüler in Deutschland psychisch belastet sind, zeigen bundesweite Befragungen von Kindern und Jugendlichen wie das Deutsche Schulbarometer (Robert Bosch Stiftung, 2024) oder die COPSY-Studie[10](Ravens-Sieberer et al., 2023) sowie der Präventionsradar derDAK (Hansen et al., 2024), für den kassenärztliche Abrechnungsdaten ausgewertet werden. Alle Studien verdeutlichen, dass knapp ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland psychisch belastet ist. Neben Erschöpfung und Einsamkeit leiden Kinder und Jugendliche im Schulalter häufig unter körperlichen Beschwerden wie Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen sowie Schlafproblemen. Noch mehr Schülerinnen und Schüler haben eine niedrige Lebensqualität, gepaart mit vielen Sorgen um die eigene Zukunft. Auch hinsichtlich des schulischen Wohlbefindens ist die Lage alarmierend, denn etwa jede fünfte Schülerin bzw. jeder fünfte Schüler fühlt sich in der Schule nicht wohl. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die psychische Gesundheit und der schulische Lernerfolg nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Wenn wir wollen, dass Kinder und Jugendliche ihr Leistungspotenzial voll ausschöpfen, müssen wir Wert darauf legen, dass sie sich in der Schule wohlfühlen. Denn psychische Belastungen haben direkte Auswirkungen auf das Lernverhalten und den Schulerfolg. Psychisch belastete Kinder und Jugendliche haben oft Schwierigkeiten, sich im Unterricht und bei der Bearbeitung von Hausaufgaben zu konzentrieren, sich sozial zu integrieren und ihre Leistungen abzurufen. Dadurch kann ein Strudel aus sinkender Motivation, schulischen Misserfolgen und zunehmenden Fehlzeiten entstehen, die wiederum eine hohe psychische Belastung darstellen. Besonders Mädchen und Kinder aus sozial benachteiligten Familien lassen sich über alle Studien hinweg als Risikogruppen identifizieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Belastung, einer geringen [11]Lebensqualität und/oder eines niedrigen schulischen Wohlbefindens besonders hoch ist.
Im Gegensatz zu einer starken Erkältung, deren Symptome wie Husten und Schnupfen auch für Außenstehende gut sichtbar sind, gehen Kinder und Jugendliche jedoch sehr unterschiedlich mit psychischen Belastungen um. So zeigen Jungen häufig aggressives Verhalten als Katalysator für ihre Emotionen, während Mädchen häufig unauffällig und ruhig wirken, sodass Eltern und Lehrkräfte oft gar nicht bemerken, dass es ihnen nicht gutgeht. In dem vorliegenden Buch werden schulbezogene Ängste thematisiert, die in ihren Vorläufern nicht direkt ins Auge von Eltern und Lehrkräften springen. Allerdings können die Konsequenzen verheerend sein, da sie nicht selten in schulvermeidendem Verhalten münden, was auf langfristige Sicht wiederum die Lebensqualität aufgrund eingeschränkter Teilhabe am Sozial- und Berufsleben stark einschränken kann. Daher ist es wichtig, auch den »stillen« Kindern Gehör zu schenken und sensibel für ihr psychisches Wohlbefinden zu sein. Den Schulen kommt dabei als zentraler Lebens- und Entwicklungsraum von Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle zu: Zum einen können ein positives Schul- und Klassenklima sowie eine gute Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen / Schülern wichtige Protektoren im Umgang mit psychischen Belastungen sein, zum anderen nehmen Lehrkräfte eine Schlüsselrolle in der frühzeitigen Wahrnehmung von »ungünstigen« Veränderungen im Verhalten von Schülerinnen und Schülern ein (siehe Kap. 2). Denn viele psychische Störungen entstehen im Kindes- und Jugendalter. Zudem sind die gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, die in dieser [12]Lebensphase erworben werden, prägend bis ins Erwachsenenalter hinein. Darüber hinaus gehören die Prävention von psychischen Belastungen und Gesundheitsförderung inzwischen zu den integralen Aufgaben von Schulen (KMK, 2012).
Allerdings ist es nicht die Aufgabe von Schulen und Lehrkräften, klinische Diagnosen zu stellen und psychotherapeutisch zu arbeiten. Vielmehr sollten Schulen und ihre Akteurinnen und Akteure ein Umfeld schaffen, in dem sich Kinder und Jugendliche sicher und wohlfühlen,
weil sie in die Gruppe integriert sind und nicht gemobbt werden,
weil sie stabile und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen können und es Personen gibt, an die sie sich wenden können, wenn es ihnen nicht gutgeht,
weil sie in einem störungsarmen Unterricht konstruktives Feedback zu ihrem Lernprozess erhalten und ermutigt werden, sich auch herausfordernden Aufgaben zu stellen,
weil sie das Schulleben mitgestalten können,
weil Lehrkräfte und Eltern zusammenarbeiten.
1.2 Entstehung psychischer Störungen
Inzwischen besteht in der Forschung Einigkeit darüber, dass die Entstehung von psychischen Störungen nicht monokausal (»Durch Ereignis E folgt Störung S«) ist.
Vielmehr lässt sich die Entstehung psychischer Störungen durch das Zusammenspiel von individueller Verletzlichkeit (Vulnerabilität) und äußeren Stressoren [13]beschreiben. Im Kontext psychischer Belastungen im Schulalter bietet das Vulnerabilitäts-Stress-Modell, auch Diathese-Stress-Modell genannt, eine hilfreiche Grundlage, um zu verstehen, warum manche Kinder und Jugendliche psychische Probleme entwickeln, während dies andere unter ähnlichen Bedingungen nicht tun. Die Vulnerabilität bezieht sich auf individuelle Faktoren, die ein Kind oder einen Jugendlichen anfälliger für psychische Störungen machen. Diese Anfälligkeit kann genetisch bedingt sein (z. B. Mutter leidet unter Ängsten), aber auch durch frühkindliche Erfahrungen wie Traumata oder persönliche Merkmale wie eine hohe Sensibilität der Kinder geprägt sein.
Abb. 1: Vulnerabilitäts-Stress-Modell. – CC BY-SA 3.0 Wikimedia/Iroqu
Stressoren sind äußere Belastungen oder Herausforderungen, die die psychische Gesundheit potenziell [14]beeinflussen können und individuell unterschiedlich wahrgenommen werden. In Kombination mit einer erhöhten Vulnerabilität können sie zu psychischen Belastungen oder Störungen führen. Solche Stressoren können im Schulalter sein:
hoher schulischer Leistungsdruck – seitens der Eltern, der Schule oder der Gesellschaft,
Konflikte im Freundeskreis, Ausgrenzung (z. B. in der Klasse), (Cyber-)Mobbing,
familiäre Konflikte wie Streitigkeiten der Eltern, finanzielle Schwierigkeiten oder Scheidung der Eltern,
Veränderungen und Übergänge wie der Wechsel in eine neue Schule – insbesondere der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule –, ein Umzug oder die Pubertät.
Ein Trauma entsteht, wenn Kinder oder Jugendliche eine überwältigende, bedrohliche oder erschütternde Erfahrung machen, die ihre psychische Belastbarkeit überfordert. Schwere Traumata wie körperlicher oder sexueller Missbrauch sowie akute Traumata wie Unfälle oder plötzliche Verluste können langfristige Auswirkungen auf die emotionale und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben. Betroffene erleben häufig Flashbacks, Albträume oder Erinnerungen an das Trauma, die starke Angst auslösen können. Kinder, die ein Trauma erlebt haben, entwickeln zudem oft eine dauerhafte und übermäßige Sorge um verschiedene Bereiche des Lebens. Da ein Trauma das Nervensystem beeinflusst und es in erhöhte »Alarmbereitschaft« versetzt, zeigen Betroffene häufig eine körperliche Anspannung (Muskelanspannung im Nacken, Rücken, Kiefer oder in den Schultern, Herzrasen und erhöhten Blutdruck oder flache Atmung mit Enge-Gefühl in der Brust, Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit) und haben Schwierigkeiten sich zu entspannen.
[15]Trifft also eine hohe Vulnerabilität auf starke Stressoren, steigt das Risiko dafür, eine psychische Störung zu entwickeln. So hat ein Kind, das von Natur aus ängstlich ist und gleichzeitig schulischem Leistungsdruck und Mobbing ausgesetzt ist, ein deutlich höheres Risiko, eine Angststörung zu entwickeln. Ist die Vulnerabilität eines Kindes jedoch gering, können derartige Stressoren besser bewältigt werden, ohne dass psychische Probleme entstehen. Für Kinder und Jugendliche sind vor allem stabile soziale Beziehungen – Familie, Freunde, Lehrkräfte –, die emotionale Unterstützung bieten können, wichtige Protektoren. Ein weiterer Schutzfaktor ist eine positive Selbstwirksamkeitserwartung, d. h. die Überzeugung, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können. Damit Schülerinnen und Schüler eine positive Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln können, benötigen sie konstruktives und ehrliches Feedback. Dieses sollte sich im schulischen Kontext möglichst auf die individuellen Lernfortschritte beziehen und an Zwischenergebnisse gekoppelt sein und ist nicht mit pauschalem Lob wie »gut gemacht« zu verwechseln.
»Ich sehe, dass du mittlerweile viel genauer arbeitest! Bei deiner letzten Präsentation hattest du noch Schwierigkeiten, die Informationen verständlich zu strukturieren. Diesmal hast du alles klar gegliedert und deine Argumente logisch aufgebaut, sodass es leicht war, dir zu folgen. Das zeigt, dass du an deiner Strukturierung gearbeitet hast und nun sicherer bist, Inhalte anschaulich zu vermitteln – das macht wirklich einen großen Unterschied! Du kannst stolz auf deinen Fortschritt sein.«
[16]Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell zeigt auf, dass psychische Belastungen im Schulalter oft das Ergebnis eines Zusammenspiels zwischen individueller Verletzlichkeit (Vulnerabilität) und äußeren Stressoren sind. Das Modell kann dazu beitragen, mögliche Stressoren in den Blick zu nehmen – auch in Gesprächen mit Kindern und Eltern – und Unterstützungsmaßnahmen wie Team-Building-Übungen, z. B. in enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, anzubieten.
[17]2 Schulbezogene Ängste
Dass man in gefährlichen Situationen oder bei drohender Gefahr Angst verspürt, ist nicht nur normal, sondern auch sehr sinnvoll. Der Körper stellt sich dann darauf ein, sich in irgendeiner Weise zu schützen (z. B. durch Flucht oder Kampf), und das Angstsystem wird aktiviert. Die Angst ist dabei eine der Basisemotionen, die den Menschen evolutionär betrachtet das Überleben gesichert haben, beispielsweise durch Angst vor Fressfeinden oder vor dem Springen aus großer Höhe. Definiert werden kann Angst dabei als »Zustand emotionaler Erregung, welche auf die Wahrnehmung einer Person zurückzuführen ist, die sich physisch oder psychisch bedroht fühlt« (Fröhlich, 2017, S.





























