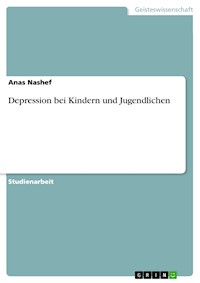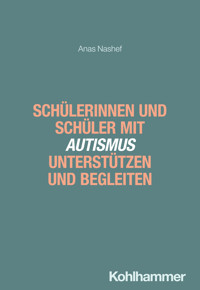
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Für Kinder im Autismus-Spektrum ist die Schule oft ein herausfordernder Ort. Das Wissen über die Besonderheiten dieser Lernenden und vor allem über den Umgang mit ihnen ist für pädagogische Fachkräfte elementar. Um Lehrende in ihrer Arbeit mit diesen Schülerinnen und Schülern zu stärken, erörtert der Band die schulische Situation von Kindern im Autismus-Spektrum und bietet grundlegende Informationen. Er betrachtet, wie individuelle Handlungs- und Interventionsstrategien geplant und umgesetzt werden können - basierend auf der Erhebung differenzierter Daten, etwa anhand ressourcenorientierter Verhaltensanalysen und diagnostischer Verfahren. Mögliche Hilfestellungen, die schulische Rahmenbedingungen sowie die familiäre Situation in den Fokus nehmen, werden besprochen. Umfassende Fallvignetten verdeutlichen die Durchführung pädagogischer Interventionen, ihre kritische Reflexion und Evaluation praxisnah. Die Fallvignetten behandeln verschiedene Altersstufen und unterschiedliche Ausprägungen syndromimmanenter Verhaltens- und Erlebensmuster sowie das darauf abgestimmte pädagogische Handeln der Fachkräfte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einleitung
1 Autismus-SpektrumStörungen
1.1 Ein historischer Abriss
1.2 Klassifikation
1.3 Differenzialdiagnostik und Komorbiditäten
1.4 Epidemiologie
1.5 Fachliche Vertiefung: Ätiologie autistischer Störungen
1.6 Fachliche Vertiefung: Therapie- und Förderansätze
1.7 Schulische Situation
2 Grundlagen pädagogischen Handelns
2.1 Autismus und Schule: Herausforderungen und Chancen
2.2 Pädagogische Diagnostik
2.2.1 Elterngespräch(e)
2.2.2 Gespräch mit dem/der Schüler*in
2.2.3 Austausch mit anderen Fachleuten
2.2.4 Verhaltensbeobachtung
2.2.5 Verhaltensanalyse
2.2.6 Ressourcenanalyse
2.2.7 Einschätzung der Emotionalität
2.2.8 Test- und Fragebogenverfahren
2.2.9 Hypothesenbildung
2.3 Interventionen und Handlungsempfehlungen
2.3.1 Schüler*innen-bezogene Interventionen
2.3.2 Interventionen bei Mitschüler*innen
2.3.3 Lehrkräfte-bezogene Interventionen
2.3.4 Elternbezogene Interventionen
2.3.5 Rahmenbedingungen und unterrichtsbezogene Hilfen
2.3.6 Nachteilsausgleich(e)
2.3.7 Schulbegleitung
3 Fallvignetten
3.1 Paul
3.1.1 Ausgangslage und Fragestellung
3.1.2 Informationen zum Schüler/pädagogische Diagnostik
3.1.3 Pädagogische Intervention
3.1.4 Evaluation
3.2 Karl
3.2.1 Ausgangslage und Fragestellung
3.2.2 Informationen zum Schüler/Pädagogische Diagnostik
3.2.3 Pädagogische Intervention
3.2.4 Evaluation
3.3 Berta
3.3.1 Ausgangslage und Fragestellung
3.3.2 Informationen zur Schülerin/Pädagogische Diagnostik
3.3.3 Pädagogische Intervention
3.3.4 Evaluation
3.4 Theo
3.4.1 Ausgangslage und Fragestellung
3.4.2 Informationen zum Schüler/Pädagogische Diagnostik
3.4.3 Pädagogische Intervention
3.4.4 Evaluation
4 Abschließende Anmerkungen
5 Auswahl hilfreicher Ressourcen und Literatur
5.1 Ressourcenauswahl
5.1.1 Interessenvertretungen
5.1.2 Autismus-Therapiezentren
5.1.3 Schulbehördliche Unterstützungsstellen
5.1.4 Praktische Informationen und Materialien für Lehrkräfte
5.2 Literaturauswahl
5.2.1 Einführungsliteratur
5.2.2 Autismus und Schule
5.2.3 Klassenaufklärung
5.2.4 Weitere Aufklärungsliteratur
Literaturverzeichnis
Fallbuch Pädagogik
Herausgegeben von Armin Castello
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/fallbuch-paedagogik
Der Autor
Anas Nashef, geb. 1973, Dr. phil., Dipl.-Psych., Studium und Promotion in Bremen; Leiter der Autismus-Therapiezentren in Bremerhaven, Debstedt (Geestland), Cuxhaven und Hagen im Bremischen; kommissarischer Leiter des Autismus-Therapiezentrums in Bremen-Mitte; Geschäftsführer bei Autismus Bremen e. V.; Lehrbeauftragter am Institut für Sonderpädagogik, Abteilung Sonderpädagogische Psychologie, an der Europa-Universität Flensburg; freiberufliche Fortbildungstätigkeit; Mitglied des Verbandsrates des Paritätischen im Land Bremen; langjährige Tätigkeit in Diagnostik, Beratung und Therapie bei Autismus-Spektrum-Störungen; Weiterbildungen und Zertifizierungen in Multifamilientherapie, mentalisierungsbasierter Therapie und Autismustherapie; Veröffentlichungen zu den Themenkomplexen Autismus-Spektrum-Störungen, Multifamilientherapie und analytische Sozialpsychologie.
Anas Nashef
Schülerinnen und Schüler mit Autismus unterstützen und begleiten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043624-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-043625-1epub:ISBN 978-3-17-043626-8
Einleitung
Autismus ist ein Thema, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Neben den insgesamt angestiegenen Prävalenzzahlen, den Fortschritten in der Forschung und der Zunahme der Diagnostik- und Förderangebote zeichnet sich ein Anstieg medialer Präsenz ab, der sich nicht nur durch dokumentarische Berichterstattungen präsentiert, sondern auch in diversen Film- und Serienproduktionen. Letztere generieren überwiegend einerseits Mehrwissen, andererseits jedoch ein nur begrenzt differenziertes Wissen, indem bestenfalls nur gewisse Facetten des Autismus einen Platz finden bzw. hervorgehoben werden. Obgleich der Beitrag der Medien zur Sensibilisierung für Autismus überaus anerkennenswert ist, trägt der öffentliche Diskurs bisweilen auch zu einem verzerrten Bild des Autismus bei. Die neue Nomenklatur eines Spektrums offenbart jedoch, dass es sich nicht um ein einziges Bild, sondern um viele Bilder des Autismus handelt. Diese Diversität geht über die bloß klassifikatorischen Kategorien der Sprachentwicklung und der Intelligenzentwicklung hinaus und sind in der schulischen, klinischen und anderweitigen Alltagspraxis evident.
Wenn wir uns trotz der vorausgegangenen Ausführung mit der gebotenen Vorsicht um eine Art gemeinsamen Nenner des Autismus bemühen, dann lässt sich en bloc postulieren, dass viele Menschen mit Autismus interaktionelle und systembezogene Herausforderungen teilen. Beim Thema »systembezogene Herausforderungen« angelangt, muss vorab daran erinnert werden, dass kein institutionelles System für die Menschen so bedeutsam und zudem so prägend ist wie die Institution Schule. Bezogen auf Menschen mit Autismus lässt sich diese Aussage wie folgt modifizieren: Das System Schule ist nicht nur für Menschen mit Autismus, sondern auch für deren Familien prägender als für die Mehrheit der anderen Schüler*innen. Dieser Umstand lässt sich kaum besser zusammenfassen als durch die Worte einer Mutter eines Schülers mit Autismus: »Die Schulzeit meines Kindes habe ich als Mutter damit verbracht, mich zuhause neben dem Telefon aufzuhalten und auf den Anruf der Schule zu warten.«
Das Thema Autismus im Kontext Schule zu behandeln, löst trotzdem zunächst gemischte Gefühle aus. Einerseits ermöglicht die Auseinandersetzung mit diesem Thema einen Zugewinn an Sicherheit im Umgang mit betroffenen Schüler*innen. Andererseits ist die Gefahr des Abdriftens in ein Bedienungsanweisungs-Format überaus groß. Diese Gefahr ist insofern präsent, als dass Diagnosen und deren Fokussierung die Erwartungshaltung ebenso fokussierter Lösungsstrategien mit sich bringen und beinahe automatisch Schüler*innen mit Autismus zu Objekten jener Lösungsstrategien machen. Dennoch eilen die praktischen Fallvignetten einem zu Hilfe, denn gerade diese ermöglichen eine offene, unvoreingenommene und ent-fokussierte Abhandlung jenseits eines pauschalen diagnoseimmanenten Maßnahmenkatalogs. Die Fallvignetten stellen respektive Sonderlösungen für besondere Schüler*innen dar, die sich die Klasse, die Schule und das Schulsystem insgesamt mit anderen Schüler*innen teilen, die ebenfalls auf ihre je eigene Art besonders sind.
Dessen ungeachtet muss eine Abhandlung mit definitorischen Einführungen zu verschiedenen Teilaspekten des Gegenstandes beginnen und sich somit zunächst mit übergeordneten Kategorien befassen, welche der Didaktik geschuldet sind. Naturgemäß sagen diese Einführungen jedoch nur mit Einschränkungen etwas über den Einzelfall aus. Hier kann die Auseinandersetzung und Reflexion des Einzelfalls eine wertvolle Ergänzung sein. Das erste Kapitel dieses Bandes der Reihe »Fallbuch Pädagogik« führt in Aspekte des Autismus ein und dient der Vermittlung von Basiswissen, etwa zur historischen Entwicklung des Autismuskonzepts und zu klassifikatorischen Aspekten (▸ Kap. 1). Als fachliche Vertiefung für Lehrkräfte wurden in die Einführung ebenfalls ätiologische Informationen sowie ein Überblick über die gängigen Therapieansätze aufgenommen. Da im Zentrum des vorliegenden Bandes die schulische Förderung von Schüler*innen mit Autismus steht, wird bereits in diesem ersten Kapitel die Schulsituation in Deutschland für diese Schüler*innen skizziert. Das anschließende zweite Kapitel stellt eine Vertiefung des Handlungsfelds Schule dar und umfasst sowohl die pädagogische Diagnostik als auch Handlungsmöglichkeiten (▸ Kap. 2). Im dritten Kapitel werden vier Fallvignetten nach einer einheitlichen Struktur wiedergegeben (▸ Kap. 3), wobei sich diese Vignetten nicht nur hinsichtlich Alter, Geschlecht und Diagnose unterscheiden; vielmehr zeigen diese Fälle deutlich, dass es keine allgemeingültigen und automatistischen Handlungsempfehlungen gibt und dass die (Inter-)Subjektivität des Einzelfalles die Basis jeglicher Intervention unter Beachtung zentraler Grundsätze unseres pädagogischen Handelns (▸ Kap. 4) ist.
Bremerhaven, Oktober 2024Anas Nashef
1 Autismus-SpektrumStörungen
1.1 Ein historischer Abriss
Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler (1857 – 1939), der eng in Verbindung mit der Schizophrenie-Forschung stand, scheint der erste Wissenschaftler zu sein, bei dem der Begriff »Autismus« Erwähnung fand (vgl. Feinstein 2010), den er als Symptom der Schizophrenie bei Erwachsenen und als »Loslösung von der Wirklichkeit zusammen mit dem relativen und absoluten Überwiegen des Binnenlebens« (Bleuler, 1911, 52) verstand. Die russische Kinder- und Jugendpsychiaterin Grunja E. Ssucharewa (1891 – 1981) war jedoch diejenige, die in Abgrenzung zur Schizophrenie ein klinisches Bild beschrieb, das weitgehend mit Hans Aspergers Beschreibungen übereinstimmend ist und von ihr als »schizoide Psychopathie« bezeichnet wurde (Ssucharewa, 1926). Diese Kinder teilten nach Ssucharewa das Symptom einer »autistischen Einstellung«. Ssucharewa war zudem die erste Forscherin, die Bezug auf die Schulsituation autistischer Schüler*innen nahm und die gemeinsame Beschulung mit nichtautistischen Schüler*innen als erschwerend beschrieb (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, 15).
Zwei weitere Namen, die sehr eng mit Autismus verbunden sind, sind die aus Österreich stammenden Kinder- und Jugendpsychiater Leo Kanner (1896 – 1981) und Hans Asperger (1906 – 1980). 1943 veröffentlichte Kanner eine Abhandlung zum Autismus, die auf Beobachtungen von elf Kindern mit folgenden beschriebenen Auffälligkeiten fußte: Defiziten in sozialer Interaktion und Kommunikation, Stereotypien, eingeschränkten Interessen und Bestehen auf Gleichheit (Kanner, 1943). Bei diesen als »sonderbar« beschriebenen Kindern unterstrich Kanner zudem eine günstige Entwicklung vor allem dann, wenn der Spracherwerb vor dem fünften Lebensjahr erfolgt und wenn es zu keiner Institutionalisierung kommt (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, 15). Auch Asperger beschrieb in den 1940er Jahren auf der Grundlage eigener Beobachtungen und Untersuchungen von Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren ein klinisches Bild, das er mit der Bezeichnung »autistische Psychopathie« zusammenfasste (Asperger, 1944). Asperger und Kanner gingen gleichermaßen ursächlich insgesamt von einer Vererbung aus.1
Obgleich sowohl Asperger als auch Kanner von Autismus sprachen, beziehen sie sich auf zwei Kategorien mit deutlichen deskriptiven Unterschieden, aber auch mit Unterschieden in deren Grundverständnis des Autismus. Während Kanner Kinder beschrieb, bei denen es sich um abgekapselte von der personalen Welt handelte und welche in der Regel erheblich entwicklungsverzögert wirkten, bezog sich Asperger auf eine Gruppe mit schweren Beziehungsproblemen, stark reduzierter Affektivität und eher leichten Auffälligkeiten in puncto Kontaktaufnahme. Diese Kinder verfügten nach Asperger über eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz. Eine Besonderheit des Aspergerschen Verständnisses dieser Kinder lässt sich so formulieren, dass er sie nicht ausschließlich als defizitär begriff, sondern deren Wesenszügen auch Positives abgewinnen konnte (Asperger, 1944, 135). Aspergers Befunde fanden erst durch die zusammenfassende Übersetzung seiner Arbeit durch Lorna Wing (1981) Anschluss an den wissenschaftlichen Diskurs, weshalb diese auch später als der Frühkindliche Autismus Platz in den Klassifikationssystemen fand. Während der Frühkindliche Autismus bereits in der 9. Revision der Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation, ICD-9 (1978), aufgenommen wurde, wurde das Asperger-Syndrom erstmalig in der ICD-10 (WHO, 1992) klassifiziert, dort unter den »Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen«.
Insgesamt erfuhr die Klassifikation des Autismus in den letzten Dekaden deutliche Modifikationen: Während der Autismus als kindliche Psychose in der ICD-9 (Remschmidt et al., 1977) erfasst wurde, begreift das DSM-III (Koehler & Saß, 1984) den frühkindlichen Autismus als eine massive Entwicklungsstörung. Erstmalig im DSM-III-R (Wittchen et al., 1989) wird die »Autistische Störung« als tiefgreifende Entwicklungsstörung kategorisiert, wobei sich die Kriterien an einer von Wing (vgl. Wing & Gould, 1979) vorgeschlagenen Triade orientieren. In der ICD-10 (Dilling et al., 1994) und im DSM-IV (Saß, Wittchen & Zaudig 1996) wird das Asperger-Syndrom erstmalig unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen subkategorisiert. Im DSM-V (2015) und ICD-11 wird auf die Kategorienbildung verzichtet und alle Autismusformen werden dimensional unter dem Begriff der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zusammengefasst.
Neben den Veränderungen in der Klassifikation erfuhr ebenfalls die therapeutische Arbeit mit Kindern mit Autismus viele Weiterentwicklungen in den letzten Dekaden. Eine zentrale Rolle spielt seit den 1960er Jahren die Verhaltenstherapie, wobei diese sowohl über die Zeitspanne als auch in Abhängigkeit von der jeweiligen institutionellen Ausrichtung unterschiedliche Akzentuierungen offenbart. Breite Öffentlichkeit erfuhr die Arbeit von Lovaas, der Erfolge in der intensiven verhaltenstherapeutischen Arbeit mit 20 Kindern beschrieb (Lovaas, 1973), woraus Therapieansätze wie ABA (Applied Behavior Analysis) oder AVT (Autismusspezifische Verhaltenstherapie) entstanden sind und auch heute angewendet werden (vgl. Bernard-Opitz & Nikopoulos, 2017). Eric Schopler gehörte zu denjenigen, die dem Ansatz von Lovaas kritisch gegenüberstanden (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, 21 f.). Schoplers Ausgangspunkt war die stärkere Beachtung von Stärken und Potenzialen der Kinder mit Autismus, deren Früchte in der Entwicklung des TEACCH-Programms (Treatment an Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) gipfelten (vgl. Mesibov et al., 2004). Auch heute spielt Schoplers Ansatz eine wichtige Rolle in der Förderung von Kindern mit Autismus, die nachgewiesenermaßen von der Strukturierung und Visualisierung ihrer Umgebung profitieren und an Sicherheit gewinnen können (Mesibov, 1997). Weitere wichtige theoretische Ansätze, die in Trainingsprogrammen für hochfunktionalen Klient*innen mündeten, bilden der Theory-of-Mind-Ansatz (Baron-Cohen et al., 1985) und der Ansatz der »schwachen zentralen Kohärenz« (Happé & Frith 2006). Eine ausführliche Skizzierung methodischer Entwicklungen findet sich bei Schwarz (2020, 39 ff.). Der Reichtum an Methoden sowie die stetige Entwicklung und Erprobung neuer therapeutischer Zugänge zeigen sich zudem deutlich in der Arbeit der Autismus-Therapiezentren bzw. Autismus-Institute, welche die regionale therapeutische Versorgung von Menschen mit Autismus verantworten (Rittmann & Rickert-Bolg, 2017).
1.2 Klassifikation
Störungen des autistischen Formenkreises sind in ICD-10 unter den »tiefgreifenden Entwicklungsstörungen« (F84) zusammengefasst, die von Geburt an vorliegenden, persistierenden Charakter haben und auf biologische Ursachen sowie »genetische Vulnerabilität« (vgl. Grabrucker & Schmeißer 2015) zurückzuführen sind. Gemeinsam für alle tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sind sowohl in dem Klassifikationssystem als auch in verschiedenen Forschungsarbeiten Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation sowie Verhaltenseinschränkungen durch stereotype und repetitive Muster. Nach der ICD-10-Klassifikation handelt es sich hierbei um vor allem drei Kategorien: den Frühkindlichen Autismus, den Atypischen Autismus und das Asperger-Syndrom. Der Frühkindliche Autismus ist wohl die bekannteste autistische Kategorie und geht auf den Wiener Kinderarzt Leo Kanner zurück. Die diagnostischen Kriterien der ICD-10 (Remschmidt et al., 2006) umfassen nach Remschmidt (2006) zusammengefasst folgende Symptome:
1.
Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion in mindestens zwei der folgenden Bereiche: a. Unfähigkeit, Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen zu verwenden; b. Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen; c. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit; d. Mangel, spontan Freude, Interessen und Tätigkeiten mit anderen zu teilen.
2.
Qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation in mindestens einem der folgenden Bereiche: a. Verspätung oder vollständige Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache, die nicht begleitet ist durch einen Kommunikationsversuch durch Gestik oder Mimik als Alternative zur Kommunikation; b. relative Unfähigkeit, einen sprachlichen Kontakt zu beginnen oder aufrechtzuerhalten (auf dem jeweiligen Sprachniveau), bei dem es einen gegenseitigen Kommunikationsaustausch mit anderen Personen gibt; c. stereotype und repetitive Verwendung der Sprache oder idiosynkratischer Gebrauch von Worten oder Phrasen; d. Mangel an verschiedenen spontanen Als-ob-Spielen oder (bei jungen Betroffenen) sozialen Imitationsspielen.
3.
Begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche: a. umfassende Beschäftigung mit gewöhnlich mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, die in Inhalt und Schwerpunkt abnorm sind; b. offensichtlich zwanghafte Anhänglichkeit an spezifische, nicht funktionale Handlungen oder Rituale; c. stereotype und repetitive motorische Manierismen mit Hand- und Fingerschlagen oder Vorbiegen oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers; d. vorherrschende Beschäftigung mit Teilobjekten oder nicht funktionalen Elementen des Spielmaterials.
Hierbei müssen insgesamt sechs der genannten Symptome vorliegen, davon mindestens zwei Symptome von 1. und mindestens je eines von 2. und 3. Auch wird dort unterstrichen, dass eine auffällige Entwicklung vor dem dritten Lebensjahr in mindestens einem der Bereiche »rezeptive und expressive Sprache«, »Entwicklung reziproker sozialer Interaktion« und »funktionales und symbolisches Spielen« vorliegen muss. Eine Abgrenzung wird in ICD-10 unter anderem in Bezug auf andere tiefgreifende Entwicklungsstörungen, eine spezifische Störung der rezeptiven Sprache, eine Bindungsstörung mit Enthemmung sowie eine Intelligenzminderung gefordert.
Die Kategorie des atypischen Autismus (ebd.) entspricht den Kriterien des frühkindlichen Autismus mit Unterschieden im Manifestationsalter (Beginn im oder nach dem dritten Lebensjahr) und/oder in der Anzahl auffälliger Bereiche (die Kriterien entsprechen denen für Autismus, abgesehen von der Zahl der gestörten Bereiche). Nach Remschmidt et al. »findet sich [der atypische Autismus] am häufigsten bei schwerst intelligenzgeminderten Personen, deren sehr niedriges Funktionsniveau kaum spezifisch abweichendes Verhalten zulässt« (2006, 25).
Neben dem frühkindlichen Autismus ist das Asperger-Syndrom seit der Aufnahme in die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV die medial und im wissenschaftlichen Diskurs bekannteste tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich als eine autistische Störung mit einer dimensional höheren kognitiven und anderen Funktionsweisen sowie altersgemäß entwickelter Sprache definieren lässt. Das Störungsbild ist durch qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktion (entsprechend den Kriterien für den Frühkindlichen Autismus) und ein ungewöhnlich intensives umschriebenes Interesse oder begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten gekennzeichnet (Remschmidt, 2006). In verschiedenen Forschungsarbeiten werden die Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion (Gillberg, 1991, 2002, Szatmari et al., 1989, Klein et al. 2005), in der Kommunikation (ebd.) sowie durch stereotype Verhaltensmuster und Interessen (Gillberg 1991, 2002, Klein et al., 2005) beim Asperger-Syndrom beschrieben. In ICD-10 werden differenzialdiagnostisch neben anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen folgende Störungen genannt: schizotype Störung, Schizophrenia simplex, reaktive Bindungsstörung des Kindesalters oder eine Bindungsstörung mit Enthemmung, zwanghafte Persönlichkeitsstörung und Zwangsstörung.
Im Zuge des Weggangs vom kategorialen Verständnis des autistischen Phänotyps wird im DSM-V (APA, 2015) auf die verschiedenen Kategorien wie das Asperger-Syndrom, den Frühkindlichen Autismus etc. verzichtet und alle Autismusformen werden als Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zusammengefasst. Faktorenanalytisch begründet wurde die autistische Triade in eine Dyade eingeführt, die nun aus Domäne A (Defizite in der sozialen Interaktion und der Kommunikation) und Domäne B (repetitive Verhaltensweisen und Interessen) besteht (siehe Kasten). Alternativ zu der kategorialen Klassifizierung wird im DSM-V Bezug auf den Ausprägungsgrad der Symptome genommen.
Zusammenfassung der Domänen A bis D der ASS nach DSM-V
A.Persistierende Defizite in sozialer Interaktion und Kommunikation über verschiedene Kontexte hinweg in allen folgenden drei Bereichen:
a.Defizite in der sozial-emotionalen Reziprozität
b.Defizite in der nonverbalen Kommunikation
c.Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen
B.Begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens zwei der folgenden Kategorien:
a.Stereotype und repetitive Sprache
b.Exzessives Festhalten an Routinen und Ritualen
c.Beschäftigung mit restriktiven und begrenzten Interessen
d.Hyper- oder Hyporeaktivität hinsichtlich sensorischer Reize
C.Die Auffälligkeiten müssen in der frühen Kindheit beginnen, die volle Ausprägung ist jedoch nicht notwendig.
D.Die Auffälligkeiten müssen den normalen Alltag einschränken und beeinträchtigen
Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) soll die am 01. 01. 2022 in Kraft getretene ICD-11 in Deutschland nach einer Übergangsphase von mehreren Jahren eingeführt werden. Eine Printversion der ICD-11 ist noch nicht veröffentlicht worden. Autismus-Spektrum-Störungen werden in der ICD-11 unter den »neuronalen Entwicklungsstörungen« klassifiziert und als 6 A02 kodiert mit Kodierungsbezug auf die Intelligenz- und Sprachentwicklung (z. B. 6 A02.0: Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne Beeinträchtigung der funktionalen Sprache; 6 A02.1: Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne Beeinträchtigung der funktionalen Sprache). Folgende Störungen werden neben dem Autismus unter den »neuronalen Entwicklungsstörungen klassifiziert: Störungen der Intelligenzentwicklung, Störungen der Sprech- und Sprachentwicklung, Entwicklungsstörungen des Lernens, Entwicklungsstörungen der motorischen Koordination, Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS), stereotype Bewegungsstörung.
1.3 Differenzialdiagnostik und Komorbiditäten
Zwei zentrale Begriffe im Rahmen der Klassifikation/Diagnostik autistischer Störungen sind die der Differenzialdiagnostik und der Komorbiditäten. Diese bilden zwar keinen Schwerpunkt der vorliegenden Abhandlung, sollen jedoch aufgrund ihrer besonderen Bedeutung, auch im Zusammenhang mit der Interventionsindikation und -planung, komprimiert besprochen werden.
Die Differenzialdiagnostik beschreibt die Abgrenzung von anderen – vor allem psychischen – Störungen und ist ein integraler Bestandteil jedweder Diagnostik. Diese ist insofern unverzichtbar, als dass eine festgestellte Diagnose die bestmögliche Abbildung bzw. Exemplifikation des Symptomkomplexes unter Berücksichtigung biografischer und anamnestischer Daten sowie unter Einsatz geeigneter diagnostischer Instrumente gewährleisten muss. Sowohl falsch negative als auch falsch positive Diagnosen führen zu keinen oder zu falschen Interventionen, die dann mit einer Verfestigung der Symptomatik bzw. einer Pathologisierung und Fokussierung des Kindes bei fehlender Indikation einhergehen.
Indes beschreiben Komorbiditäten zusätzlich vorliegende, sekundäre Störungsbilder, die neben der Hauptdiagnose stehen und einen zusätzlichen bzw. einen anderen nicht rein akkumulierten Einfluss auf das Verhalten und Erleben des Kindes haben. Komorbide Störungen bilden eher die Regel als die Ausnahme bei Menschen mit Autismus und treten eminent oft bei diesen auf. Simonoff et al. (2008) kommen zum Ergebnis, dass 70 % der betroffenen Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren mindestens eine zusätzliche Störung aufweisen. Hohe Prävalenzraten zeigen sich hierbei für das komorbide Auftreten von Angststörungen, oppositioneller Sozialverhaltensstörungen sowie Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (ebd.). Eine Metaanalyse (Lai et al., 2019) bestätigt die deutlich hohen Prävalenzen psychischer Erkrankungen bei Menschen mit ASS im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung und ermittelt Prävalenzzahlen von 28 % für ADHS, 20 % für Angststörungen, 13 % für Schlafstörungen, 12 % für disruptive Impulskontroll- und Sozialverhaltensstörungen, 11 % für depressive Störungen, 9 % für Zwangsstörungen, 5 % für bipolare Störungen und 4 % für Psychoseerkrankungen. Ein weiterer Befund dieser Übersichtsarbeit offenbart einen altersabhängigen Prävalenzanstieg für depressive, bipolare und psychotische Störungen.