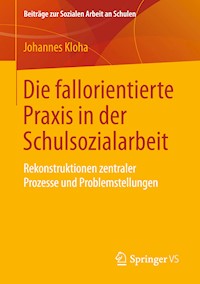Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Schulsozialarbeit sieht sich in Praxis und Theorie widersprüchlichen Herausforderungen gegenüber: Sie muss ihre Aufgaben, Funktionen und Methoden immer wieder in Alltagssituationen in einem komplexen institutionellen Beziehungsnetz aushandeln. Dem Ansatz der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit folgend werfen die AutorInnen einen genauen Blick auf unterschiedliche Fallsituationen aus der Praxis, sodass LeserInnen anhand konkreter Beispiele wesentliche Themen der Schulsozialarbeit selbst entdecken können. Auf diese Weise bietet das Lehrbuch einen neuen und eigenständigen Zugang zum Handlungsfeld Schulsozialarbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
1 »Doing Schulsozialarbeit« als zentrale Perspektive oder: Was macht Schulsozialarbeit (aus)?
1.1 Was tun Schulsozialarbeiter*innen?
1.1.1 Doing Schulsozialarbeit
1.1.2 Die Modi der Herstellung Sozialer Arbeit in der Schulsozialarbeit
1.2 Zugrunde liegende Forschungsmethodologie
1.2.1 Ethnographische Methoden für die Praxisanalyse
1.2.2 Narrative Interviews
1.2.3 Grounded Theory als übergreifendes Leitkonzept
1.3 Zur Nutzung des Lehrbuchs: eine »Gebrauchsanweisung«
2 Anknüpfen an Traditionen: Kurze Geschichte der Schulsozialarbeit
2.1 Das Verhältnis von Schule und Jugendhilfe bis 1945
2.2 Entwicklung nach 1945
2.3 Entwicklung in der DDR
2.4 Aufbruch ab den 1970er Jahren
3 Herausforderungen der institutionellen Einbindung
3.1 Die Frage der Trägerschaft
3.2 Institutionelle Verwobenheit mit schulischen Konzepten als Herausforderung
3.3 »Zweckgebundes Handeln« und das Spannungsfeld der Schulsozialarbeit
3.4 Ein umfunktioniertes Schulsozialarbeitsbüro und damit zusammenhängende Folgen
3.5 Institutionelle Öffnungen – ein offenes Schulsozialarbeitsbüro als Chance
3.6 Raumnutzung gestaltet (inhaltlich) Räume in der Institution Schule
4 Schulsozialarbeit als »Zwischenbühne« – eine Denkfigur
4.1 Zwischen zwei Polen des Auftrags
4.1.1 Die Perspektive auf die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen
4.1.2 Die Perspektive der Zielrichtung der Schule und der darin verorteten Schulsozialarbeit
4.2 Zwischen der Förderung von Selbstbestimmung und den Erwartungen der Fremdbestimmung
4.3 Von welchem »Zwischen« sprechen wir hier eigentlich?
4.4 Fazit
5 Innerschulische interprofessionelle Kooperation
5.1 Vielfalt der Zusammenarbeit
5.2 Begründungen für interprofessionelle Kooperation
5.3 Bedeutung der Zusammenarbeit aus Sicht der Schulsozialarbeiter*innen
5.3.1 Erteilung eines allgemeinen Mandats
5.3.2 Aushandlungsprozesse während der Fallkonstitution
5.3.3 Lehrkräfte als »Gatekeeper«
5.4 Kooperation als Aushandlung
6 Was tun Schulsozialarbeiter*innen?
6.1 Die Methoden der Schulsozialarbeit
6.2 Der Prozess der Fallarbeit
6.2.1 Was ist das: ein »Fall«?
6.2.2 Wie wird eine Situation zum Fall?
6.2.3 Unterschiedliche Typen der Fallbearbeitung
6.2.4 Fazit
6.3 Arbeit mit Gruppen
6.3.1 Sozialpädagogische Gruppenarbeit im Kontext schulischer Erwartungen
6.3.2 Entlastung von der schulischen Ordnung
6.3.3 Die Themen der Schüler*innen zum Thema machen
6.3.4 Fazit
7 Zentrale Themen des Handlungsfeldes
7.1 Schulsozialarbeit und ihre Verortung im Kontext Inklusion
7.1.1 Inklusion – immer im Prozess?
7.1.2 Das System Inklusion: Widerspruch zum Schulsystem oder perspektivisch machbar?
7.1.3 Zur Verortung der Schulsozialarbeit im Kontext Inklusion
7.1.4 Schulsozialarbeit in multiprofessionellen Teams – Arbeit am »System Kind«
7.1.5 Fazit
7.2 Arbeit mit geflüchteten und migrierten Menschen
7.3 Kinderrechte wahren
7.3.1 Das Ermöglichen von besonderen Freizeitbereichen als Kinderrechtspraxis?
7.3.2 Diskriminierende Alltagssituationen und Reaktionen als Kinderrechtspraxis?
7.3.3 Fazit: Kinderrechte im Schulalltag – Chancen und Fallstricke
7.4 Partizipation
7.4.1 Die Sache mit dem Spinat oder: Anliegen der Selbst- und Mitbestimmung
7.4.2 Partizipation als Anlass für Solidarität und Verantwortung
8 Spuren der Schulsozialarbeit
8.1 Was heißt hier Wirkung?
8.2 Ergebnisse von Wirkungsforschung
8.3 Wirkungsforschung »in eigener Sache«
8.4 Wirkungsebenen
9 Anregungen zur Weiterarbeit
9.1 Formen des Forschenden Lernens während der grundständigen Ausbildung
9.2 Aneignung einer forschenden Haltung
9.2.1 Verbale Methode: Partner*inneninterviews zu erlebten Praxissituationen
9.2.2 Methoden zur Verschriftlichung von Praxiserfahrungen: Ethnographische Praxisprotokolle
9.2.3 Interpretationswerkstatt: Arbeit mit schriftlichen Datenmaterialien
9.2.4 Szenisches Arbeiten
10 Ausblick
Literatur
Übersicht Datenmaterial
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Grundwissen Soziale Arbeit
Begründet von Rudolf Bieker
Herausgegeben von Michael Domes
Das gesamte Grundwissen der Sozialen Arbeit in einer Reihe: theoretisch fundiert, immer mit Blick auf die Arbeitspraxis, verständlich dargestellt und lernfreundlich gestaltet – für mehr Wissen im Studium und mehr Können im Beruf.
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/grundwissen-soziale-arbeit
Die Autor*innen
Johannes Kloha ist Professor für Theorien und Handlungslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere bei schulbezogenen Angeboten Sozialer Arbeit. Besondere Interessensfelder sind dabei Prozesse der Fallarbeit in der Schulsozialarbeit, Schulsozialarbeit in ganztägigen Schulsettings sowie der schulische Kinderschutz. Mit Anja Reinecke-Terner ist er Co-Sprecher der bundesweiten AG Schulsozialarbeit im Fachbereichstag Soziale Arbeit.
Anja Reinecke-Terner ist Professorin für Sozialarbeitswissenschaft mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulsozialarbeit an der Hochschule Hannover, Fakultät V. Besondere Schwerpunkte und Interessen sind: Schulsozialarbeit im »Zwischen« zu diskutieren, Inklusion und Schulsozialarbeit, Erlebnispraxis in der Schulsozialarbeit sowie Forschung in der Sozialen Arbeit im Kontext des Masters. Mit Johannes Kloha ist sie Co-Sprecher der bundesweiten AG Schulsozialarbeit im Fachbereichstag Soziale Arbeit.
Kathrin Aghamiri ist Professorin für Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Soziale Arbeit und Schule an der FH Münster, University of Applied Sciences. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Erziehung und Bildung in sozialpädagogischer Perspektive, Partizipation und Demokratie in Handlungsfeldern Sozialer Arbeit, Adressat*innen- und Nutzer*innenforschung sowie ethnografische Forschungsansätze.
Johannes Kloha/Anja Reinecke-Terner/Kathrin Aghamiri
Schulsozialarbeit entdecken
Ein Lehrbuch für rekonstruktives Praxisverstehen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-038456-9
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-038457-6epub: ISBN 978-3-17-038458-3
Vorwort zur Reihe
Liebe Leser*innen,
die Idee zu der Reihe Grundwissen Soziale Arbeit, als deren Herausgeber ich ab dem 51. Band, in der Nachfolge von Prof. Dr. Rudolf Bieker, fungiere, ist vor dem Hintergrund der bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen im Zuge der Bologna-Reform entstanden.
Band 1 Soziale Arbeit studieren bildete den Auftakt, der nach und nach erscheinenden Bände, deren Gemeinsamkeit ist, das für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen bedeutsame Grundwissen sukzessive abzubilden. Dabei ist dreierlei zu beachten:
Grundwissen meint mehr als »reine Theorie«. Es umfasst, unabhängig vom je spezifischen Gegenstand, neben Wissen auch immer Aspekte des Könnens und der Haltung als Bestandteile sozialarbeiterischer/sozialpädagogischer Professionalität.
Grundwissen hat eine gewisse zeitlose Komponente. Grundwissen ist zugleich aber nicht etwas Statisches, das ein für alle Mal festgelegt ist. Das Grundwissen Sozialer Arbeit verändert sich in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Entwicklungen bzw. Rahmenbedingungen, so wie sich auch die professionelle Praxis Sozialer Arbeit verändert.
Grundwissen bietet für die Leser*innen eine Orientierung. Es dient als Navigationsinstrument für Soziale Arbeit, die, wie der Vorstand der DGSA 2024 festgehalten hat, wahrlich »ein komplexes Themenfeld« ist. Und wie bei einem solchen Gerät üblich: Es gibt immer mehrere Wege, ans Ziel zu kommen. Blind zu folgen bzw. zu vertrauen, ist nur bedingt eine hilfreiche Strategie. Das Navi ist eine – (ge)wichtige – Komponente, die aber nur im Zusammenspiel mit dem eigenen Denken (der Fachkraft) und dem Kontext (Gesellschaft und Adressat*innen) ihre Wirkung entfalten kann.
Die Bände der Reihe zeichnen sich durch ihre Lesefreundlichkeit, auch für das Selbststudium Studierender, besonders aus – oder, wie es der verstorbene C. W. Müller in einem Interview auf die Frage nach Kritik an seiner fachlichen Positionierung auf den Punkt gebracht hat: »Ich will auch allgemein gut verständlich sein und bleiben. Das ist kein Widerspruch zur Wissenschaftlichkeit.« Die Autor*innen verpflichten sich diesem übergeordneten Ziel auf unterschiedliche Weise: eine Begrenzung der Stoffmenge auf einen überschaubaren Umfang, Verständlichkeit der Sprache, Theorie-Praxis-Bezüge, (weiterführende) Literaturhinweise und Anschaulichkeit durch Gestaltungselemente, wie Graphiken, Hervorhebungen oder Schaukästen. Jeder Band bietet in sich abgeschlossen eine grundlegende Einführung in das jeweilige Themenfeld.
Im Fokus steht dabei immer, welche professionellen (Handlungs-)Kompetenzen ausgebildet werden können bzw. welche Bedeutung das jeweilige Thema/Themenfeld für die professionelle Praxis Sozialer Arbeit hat.
Die Bände verstehen sich als Einladung, sich auf (neues) wissenschaftliches Wissen einzulassen und die Themen kritisch weiterzudenken, um so auf dem Weg der eigenen Professionalitätsentwicklung weitere Schritte zu gehen. Oder wie es Alice Salomon schon 1932 formuliert hat: »Wir lernen ja nicht da, wo wir feststellen, daß der andere alles ebenso macht wie wir, sondern wir lernen, wenn er es anders macht. Denn das allein führt uns zur Selbstbesinnung, zur Selbstkritik und daraus erwächst lebendiges Leben, lebendiger Geist, lebendige Formkraft«.
Prof. Dr. Michael Domes, Nürnberg
Zu diesem Buch
Schulsozialarbeit hat sich, 50 Jahre nach der Einrichtung erster Stellen, in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem zentralen Handlungsfeld der Sozialen Arbeit entwickelt. Alle Bundesländer verfügen inzwischen über Stellen unterschiedlicher Bezeichnungen in überwiegend kommunaler und Landesträgerschaft für die Schulsozialarbeit oder Soziale Arbeit in Schulen. Oft werden diese Stellen immer wieder über spezifische Förderprogramme finanziert. Damit einhergehend sind umfassende Professionalisierungsprozesse sichtbar. Dies betrifft u. a. eine breite konzeptionelle Ausdifferenzierung im Hinblick auf die Aufgaben, Zuständigkeitsbereiche und Themen von Schulsozialarbeit. Gerade in der Abgrenzung gegenüber Schule und Schulpädagogik – als die größere, auch mächtigere institutionelle Akteurin – wurden umfangreiche Bemühungen angestellt, Schulsozialarbeit professionell zu etablieren. Auch die Forschungslandschaft zu Schulsozialarbeit hat deutlich an Dynamik und thematischer Vielfalt gewonnen, worauf eine ganze Reihe von Sammelbänden hinweisen, in denen empirische Ergebnisse zum Handlungsfeld gebündelt wurden (u. a. Speck/Olk 2010; Zipperle/Baur 2023). Mit anderen Worten: Schulsozialarbeit ist – so könnte man meinen – eben nicht mehr der »Gast in einem fremden Haus«, wie Florian Baier in seiner wegweisenden Studie 2007 noch provokant formulierte (Baier 2007).
Gleichzeitig stellen wir fest, wenn wir den Blick auf die Praxis richten, dass die vermeintlich gut begründete konzeptionelle Klärung vieler Fragen des Handlungsfeldes immer wieder brüchig erscheint. Aufgaben, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten sind – man reibt sich fast die Augen – dann eben doch konzeptionell nicht so festgezurrt, wie dies angesichts der erwähnten konzeptionell-programmatischen Arbeit erwartet werden könnte. Die Praxis bildet somit immer etwas anderes ab, als Theorie lehrt und lehren kann. Letztlich lieferte diese Feststellung den Anstoß für das Konzept des vorliegenden Lehrbuches, nämlich konzeptionelle Überlegungen systematisch der erfahrbaren und erlebten Praxis gegenüberzustellen und sie vor diesem Hintergrund zu diskutieren. Wir nehmen damit einen »rekonstruktiven« Blick ein. Das heißt, wir geben Anregungen, die Ereignisse in der Praxis der Schulsozialarbeit im Interview oder in Beobachtungen nachzuvollziehen und sich über die Bedeutungen, die dahinter zu entdecken sind, zu verständigen. Aus der Praxis lernen wir so etwas über die zentralen Themen, Methoden und Herausforderungen in der Schulsozialarbeit.
Deshalb freuen wir uns als Autor*innen dieses vorliegenden Lehrbuchs zunächst sehr, dass Sie – als Studierende, Praktiker*innen, Lehrende – Interesse an diesem wichtigen und anspruchsvollen Handlungsfeld haben.
Da wir, die Autor*innen, selbst aus der Praxis der Schulsozialarbeit kommen, bevor wir in die Lehre und Forschung wechselten, wollen wir dieses Buch mit einer Unterhaltung zwischen uns dreien beginnen, in der wir diese Erfahrungen reflektieren:
Johannes Kloha: Ich weiß nicht, wie es Euch ging. Ich empfand die Arbeit in der Schule als äußerst spannend und intensiv. In keinem anderen Handlungsfeld, in dem ich gearbeitet habe, war ich im Alltag so nah an den Menschen dran, für die ich mich zuständig fühlte. Das war sehr schön, man konnte Entwicklungen mitbekommen, auch kleine Schritte, weil man sich ja fast täglich über den Weg lief. Das betraf auch die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften oder zumindest mit einem Teil von ihnen. Man hatte wirklich kurze Wege, konnte schnell Eindrücke austauschen.
Anja Reinecke-Terner: Mir hat die Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin auch wirklich großen Spaß gemacht, es gab so viele vielfältige Möglichkeiten, mit und für Schüler*innen kreativ und gestaltend tätig zu sein. Sei es in speziellen Projekten, bei den Settings des Sozialen Lernens im Klassenkontext, bei der räumlichen Gestaltung der Freizeitbereiche usw. In diesen Erlebnissen baute sich immer wieder Beziehung auf und verfestigte sich. Eine gute Grundlage für die Beratung.
Kathrin Aghamiri: Was mich immer beeindruckt und auch motiviert hat, war die Zusammenarbeit mit den Kindern. Es ging da auch gar nicht immer um »große« Themen. Allein, dass die schulbezogene Jugendhilfe ein Ort war, an dem man quatschen konnte, mal in den Arm genommen wurde oder die Sozialarbeiterinnen zugehört haben, was so passiert ist am Tag oder zu Hause, hat oft für gute, entspannte Stimmung gesorgt. Ich fand es in diesem Sinn auch immer ein »dankbares« Handlungsfeld.
Anja: Und ja, so wie du es gesagt hast, Kathrin, die Zusammenarbeit und »Arbeits«beziehung mit Kindern und Jugendlichen hat ja immer auch durch den oftmals auch sehr komplexen und belastenden Alltag getragen. Insbesondere ging es mir so, wenn ich Schulleitungen hatte (und ich hatte in den Jahren vier verschiedene Vorgesetzte), die mich eben nicht mein Handlungsfeld so gestalten ließen, wie ich es für professionell richtig erachtete, sondern mir mitunter sehr unreflektierte Handlungsanweisungen gaben und meinen Auftrag nicht mal richtig kannten. Dabei die Perspektiven und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen im Blick zu behalten, war immer auch herausfordernd. Wahrscheinlich war das auch der Motor, um später auf die »Theorieseite« zu wechseln. Zum Glück hatte ich aber auch zwei Schulleiter*innen, die den Möglichkeitsrahmen der Schulsozialarbeit und ihren lebensweltorientierten Auftrag in der Schule erkannt und respektiert und mir bei der Umsetzung den Rücken gestärkt haben.
Kathrin: Ja, Anja, da sprichst du mir aus der Seele. Auch ich habe immer wieder erlebt, wie wenig die Schulleitung oder die Lehrkräfte über die Jugendhilfe oder die Soziale Arbeit wussten. Nach dem Motto: »Was fehlt eigentlich noch zur Heimeinweisung?« Ich sah mich auch des Öfteren mit ziemlich technokratischen Vorstellungen von Pädagogik konfrontiert. In den Klassenseminaren zum Sozialen Lernen haben wir diese Vorstellungen manchmal ja sogar bedient. Indem wir diese Klassenaktionen z. B. »Sozialtrainings« genannt haben. Dabei weiß eigentlich jede Sozialarbeiterin, dass Kids Konflikte nicht besser lösen, weil sie gemeinsam über Teppichfliesen balanciert sind. Entscheidend ist, was z. B. zwischen solchen Übungen möglich wird. Dass es mehr Freiräume gibt für eigene Themen und Begegnung und Spaß. Diese Möglichkeiten einer lebensweltorientierten Perspektive waren leichter zu vermitteln, wenn man auch mal was zusammen mit den Lehrkräften in diesem Bereich gemacht hat.
Johannes: Da kann ich mit meinen eigenen Erfahrungen gut anschließen. Neben all den Handlungsräumen, die sich für mich gerade durch den unmittelbaren Kontakt mit Schüler*innen eröffneten, gab es immer wieder Momente, in denen es sehr anstrengend war. Und das lag meistens nicht an den – sicherlich auch immer kräftezehrenden – Interaktionen mit den Kids, sondern insbesondere an den immer wieder aufs Neue zu tätigenden Aushandlungen mit Schulleitung, Lehrkräften und – in meinem Fall – dem freien Träger, bei dem ich formell angestellt war. Immer wieder stellte sich die Frage: Ist das jetzt meine Aufgabe, ist sie das nicht und wenn nicht, wie positioniere ich mich, um mir dennoch die Kooperationsbereitschaft von Lehrkräften zu erhalten. Ich habe erst gemerkt, wie anstrengend das ist, als ich nicht mehr als Schulsozialarbeiter arbeitete. Im neuen Arbeitsumfeld, das vorwiegend ebenfalls aus Sozialarbeiter*innen bestand, musste ich mich bezüglich meiner Zuständigkeiten plötzlich nicht mehr permanent erklären. Das war sehr erleichternd.
Anja: Ja genau, diese strategische Arbeit ist wirklich sehr kräftezehrend und wir brauchten einen langen Atem, nach einigen Jahren und auch nach vielen Absagen in Bezug auf mandatswidrige Vorstellungen an uns hatte sich auch sichtbar etwas verändert. Letztlich bleibt es aber ein ständiger Prozess und ist nie »fertig«. Entscheidend war deshalb die Reflexion dessen, was wir selbst dort eigentlich tun. Zum Glück gab es, zumindest anteilig, Supervision und innerhalb der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit den Austausch, den es brauchte und der uns alle gestärkt hat. Diese kollegialen Netzwerke sind es doch, die die Schulsozialarbeit fachlich voranbringen, auch politisch, wenn wir an die Rolle der Gewerkschaften denken. Wissenschaft, Fortbildung und auch Lehre vor der Praxis im Studium können immer wieder »nur« Vorschläge zur Reflexion der Fachlichkeit anbieten. Deshalb finde ich es ja auch so schön, dass wir drei jetzt aus dieser Perspektive weiterhin eng mit der Praxis zu tun haben und diese empirischen Ergebnisse hiermit wieder an die Praxis und auch an angehende Praktiker*innen im Studium zurückgeben können.
Wenn wir nun also unsere eigenen Praxiserfahrungen anschauen und diese systematisieren, zeigt sich ein Handlungsfeld, das einerseits vielfältige und relevante Handlungsmöglichkeiten bietet und andererseits voller institutioneller Spannungen, Missverständnisse und Konflikte steckt, aus denen sich eine permanente Notwendigkeit zur Aushandlung und Absicherung des eigenen Handlungsspielraums ergibt. Diesen Spannungen und zugleich Möglichkeitsräumen wollen wir im folgenden Lehrbuch nachgehen. Bevor wir aber beginnen, wollen wir in den folgenden Abschnitten etwas ausführlicher darlegen, wie wir uns der Idee eines Lehrbuchs genähert haben. Dafür werden wir zunächst verdeutlichen
was die grundlegende Perspektive ist, aus der wir auf das Handeln von Schulsozialarbeiter*innen blicken (▸ Kap. 1.1),
wie die Datenmaterialien zustande kamen, mit denen wir immer wieder in diesem Lehrbuch arbeiten (▸ Kap. 1.2) und
und was aus unserer Sicht bei der »Nutzung« des Lehrbuches zu beachten ist (▸ Kap. 1.3).
Bevor wir einsteigen, würden wir gerne einigen Personen besonderen Dank aussprechen. Thomas Markert danken wir für wertvolle Hinweise zur Entwicklung in der DDR (▸ Kap. 2.3). Niklas Feuerriegel hat uns bei der Erfassung von Sekundärliteratur geholfen. Ganz besonders wichtig wurde für uns die Hilfe von Melina Riebisch, die in der Endphase äußerst wertvolle und kompetente Unterstützung bei der Korrektur, Formatierung und dem Einpflegen von Quellen in das Literaturverwaltungsprogramm geleistet hat.
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude, spannende Auseinandersetzungen und neue Erkenntnisse bei der Lektüre.
Nürnberg, Hannover, Münster im Mai 2025Johannes Kloha, Anja Reinecke-Terner, Kathrin Aghamiri
1 »Doing Schulsozialarbeit« als zentrale Perspektive oder: Was macht Schulsozialarbeit (aus)?
T Was erwartet Sie in diesem Kapitel?
Sie erfahren etwas über die zugrunde liegende Perspektive des Lehrbuches: das »Doing Schulsozialarbeit« und die damit verbundene Erkenntnis, dass Soziale Arbeit am Ort Schule erst in der Praxis verstehbar wird. Außerdem informieren wir über die Art und Weise der Gewinnung der Daten, auf denen viele Texte dieses Lehrbuches basieren. Abschließend schlagen wir eine »Gebrauchsanweisung« für die Arbeit mit diesem Lehrbuch vor.
Wenn man sich in Studium oder Weiterbildung mit unterschiedlichen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit auseinandersetzt, begegnet man zumeist einer an ethisch-normativen Handlungsorientierungen ausgerichteten Sichtweise. Vor allem wird beschrieben, wie Soziale Arbeit mit Blick auf eine professionelle Grundhaltung sein soll. Nun ist es von großer Bedeutung, dass sich Schulsozialarbeiter*innen damit beschäftigen, was gute Soziale Arbeit im Kontext Schule wäre. Professionelle Handlungstheorien wie die Lebensweltorientierung in Form einer »lebensweltorientierten Schulsozialarbeit« (Bolay 2008, S. 147 ff. Speck 2022), Schulsozialarbeit als »Anwältin sozialer Gerechtigkeit« (Baier 2011, S. 87) oder als »Akteurin ganzheitlicher Bildung und Teil kommunaler Bildungslandschaften« (Pötter 2018, S. 26) dienen mit der Formulierung ihrer Ansprüche einer professionsethischen Verortung, geben Orientierung und beugen Fehlern und Missbrauch pädagogischer Macht vor. Ansätze wie eine »stärkenorientierte Schulsozialarbeit« (Wagner/Strohmeier 2023) versuchen Konzepte der Sozialpädagogik in normativer Setzung auf die Schule zu übertragen.
Wir wollen mit unserem Lehrbuch allerdings noch einen anderen Aspekt betonen: Wir werden zeigen, wie die zu Beginn angesprochenen Spannungsfelder, Ansprüche und Widersprüche in der Praxis verhandelt werden oder auch verhandelt werden können. Dabei greifen wir auf den Ansatz des »Doing Social Work« (Aghamiri et al. 2018; Aghamiri 2023) zurück, der als Erfahrungstheorie verstanden werden kann, weil er sich damit beschäftigt, welche Muster, Bedeutungen, Aushandlungen und Vorgehensweisen in der Praxis Sozialer Arbeit sichtbar werden. Dies geschieht in der Praxis mit dem Rückgriff auf Professionstheorien der Sozialen Arbeit, aber auch jenseits von ihnen, z. B. unter Einbezug des Wissens und der Tätigkeit der Adressat*innen oder in Auseinandersetzung mit den Organisationen, in denen Soziale Arbeit agiert. In unserem Fall wären das die Schulsozialarbeiter*innen, aber auch die Kinder und Jugendlichen als Schüler*innen, die Lehrkräfte als Berufsrollenträger*innen sowie die Bedingungen des gesellschaftlichen Systems Schule selbst.
Die Grundfrage, die wir mit dem Lehrbuch bearbeiten wollen, könnte man so formulieren:
Was tun Schulsozialarbeiter*innen in ihrer alltäglichen Praxis?
Wie gehen die Schüler*innen mit dem Angebot Schulsozialarbeit um?
Wie verhandelt die Schulsozialarbeit Interessen und Anliegen mit der Institution Schule?
Und letztlich: Wie können wir daraus Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit ableiten? Wie können wir aus Theorie und Felderfahrung für eine zukünftige Praxis lernen?
1.1 Was tun Schulsozialarbeiter*innen?
Ein Kennzeichen professioneller Sozialer Arbeit ist die Reflexion ihres Handelns vor dem Hintergrund wissenschaftlich fundierten Wissens. Dabei verweist aber z. B. Schütze (1992) darauf, dass
»es die empirischen Tatbestände des professionellen Handelns, der professionellen Handlungsprobleme, (...) der Paradoxien professionellen Handelns, der intuitiv vollzogenen interpretativen Fallanalysen im Arbeitsfeld der Sozialarbeit und Sozialpädagogik – jenseits aller Wünschbarkeit oder Nicht-Wünschbarkeit – immer schon gibt« (Schütze 1992, S. 134).
Das heißt, neben allen normativen und ethisch begründeten Orientierungen und wissenschaftlichen Konzepten findet Soziale Arbeit im Alltag jeweils schon statt, und zwar neben, parallel oder auch verwoben mit wissenschaftlichem Wissen (s. o.). Wie sich Soziale Arbeit in der Praxis nämlich ereignet, ist ein äußerst komplexer Prozess der wechselseitigen Versicherung und Aushandlung von Bedeutung zwischen Professionellen, Adressat*innen und Auftraggeber*innen vor dem Hintergrund struktureller, sozialer Bedingungen und Verabredungen. Wenn man also verstehen möchte, was Schulsozialarbeiter*innen tun, erscheint es geboten, sich der Herstellung von Schulsozialarbeit über eine neugierige Erkundung und Reflexion konkreter Praxissituationen zu nähern.
In diesem Lehrbuch interessiert uns genau diese interaktionistische Perspektive. Es geht uns weniger darum, wie Schulsozialarbeit sein sollte, als vielmehr darum, wie sie sich in der jeweils konkret situierten Praxis ereignet bzw. herstellt. Dabei ist uns bewusst, dass jegliche professionelle Praxis normative Handlungstheorien als Orientierung braucht. Ohne Professionstheorien der Sozialen Arbeit und ihre ethischen und rechtlichen Grundlegungen (vgl. Domes/Sagebiel 2024) wären weder Aufträge noch Ziele und Methoden in der Schulsozialarbeit bestimmbar. Schulsozialarbeit wäre lediglich ein Spielball verschiedenster Anliegen und Wünsche. Allerdings vollzieht sich die professionelle Praxis nicht allein von den wissenschaftlichen Grundlagentheorien inspiriert: Wie wir oben schon angedeutet haben, wird die Praxis der Schulsozialarbeit darüber bestimmt, welche Vorstellung und welches Wissen die Schulsozialarbeiter*innen, die Lehrkräfte, die Schüler*innen, die Schulleitung oder auch die Eltern von einem sozialpädagogischen Angebot, einem nicht formellen Bildungssetting oder allgemein von Sozialer Arbeit im Kontext Schule bereits haben oder vor dem Hintergrund ihres jeweiligen Wissens miteinander entwickeln. Konflikte oder Besonderheiten professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit sind maßgeblich gekennzeichnet durch das Hervorbringen einer Praxis in der Aushandlung zwischen dem professionellen Auftrag, aber auch des Alltagswissens aller Beteiligten und unterschiedlicher Erfahrungen. Damit wird ernst genommen, dass die Praxis der Schulsozialarbeit nicht die bloße Umsetzung konzeptionell-programmatischer Überlegungen ist, sondern ein lebensweltliches Ereignis, das von allen Beteiligten in der Praxis realisiert wird. Dabei ist es bemerkenswert, dass Schulsozialarbeit – ähnlich wie Schütze es oben beschreibt – aber auch schon mit Bezug auf die jeweiligen Ideen darüber hergestellt wird, was sie kann, soll und tut. Dabei greifen die beteiligten Personen auf das zurück, womit sie sich bereits auskennen, was sie für Erfahrungen gemacht haben und welche Handlungsmöglichkeiten ihnen vertraut erscheinen. Dies gilt für junge Menschen im Kontext Schulsozialarbeit genauso wie für Eltern, Lehrer*innen, Politiker*innen, Sozialarbeiter*innen und andere (die im Übrigen alle auch einmal Schüler*innen waren). Wir wollen Schulsozialarbeit demnach nicht in erster Linie über normative Orientierungen Sozialer Arbeit beschreiben, sondern darüber, was sie (aus-)macht bzw. wie sie gemacht wird.
Dieses Lehrbuch zeigt also aus einer rekonstruktiven Perspektive, was Schulsozialarbeiter*innen tun. Dies lässt sich als Entwurf eines Praxiskonzepts, als »Doing Schulsozialarbeit« verstehen. Das Ist der Praxis kann wertvolle Hinweise auf das Soll geben, ohne die Perspektive des Soll bleibt Praxis aber auch beliebig. Wir werden also aus Praxisbeispielen und Praxiserfahrungen jeweils die zentralen Themen der Schulsozialarbeit ableiten und die Aussagen und Ereignisse zu und aus der Praxis vor dem Hintergrund von handlungsleitenden Theorien diskutieren.
1.1.1 Doing Schulsozialarbeit
Wie wir bereits in der Hinführung zu Idee und Aufbau des Lehrbuches begründet haben, betrachten wir das Handlungsfeld Schulsozialarbeit mit dem Fokus darauf, welche Themen und Herausforderungen in konkreten Praxissituationen als zentrale, wiederkehrende Problemstellungen und Handlungsmuster auftauchen und wie sie von den beteiligten Akteur*innen erlebt und gedeutet werden. Dafür führen wir zunächst in aller Kürze in das Konzept des »Doing Social Work« (Aghamiri et al. 2018) ein, das Soziale Arbeit aus einer ethnographisch zugänglichen Praxis heraus theoretisiert und eine sensibilisierende Sicht auf die Verfasstheit Sozialer Arbeit zur Verfügung stellt.
Theorien erklären die Welt: Warum funktioniert etwas so, wie es funktioniert? Was passiert typischerweise in einem bestimmten Handlungsfeld der Sozialen Arbeit? Die Wissensperspektive des »Doing« lehnt sich an die ethnomethodologische Arbeit von Garfinkel (1967) zum »Doing Gender« an, die von Kessler und McKenna (1978) und West und Zimmermann (1987) weiterentwickelt wurde. Doing Gender bezieht sich darauf, dass Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern unter Rückgriff auf sozial geteiltes Wissen gemeinsam vorgenommen und festgelegt werden. Im »Doing« setzen sich die Interaktionspartner*innen mit sozialem Wissen sowie mit ihren Interessen und ihrer Interpretation der Situation auseinander. In der Interaktion zwischen den Beteiligten werden Unterscheidungen, etwa über Machtquellen, Rollenerwartungen oder Chancen beständig neu hergestellt, wiederaufgelegt oder angepasst. Dies geschieht unter Bezugnahme auf geteiltes lebensweltliches Wissen, aber auch in der Konfrontation mit ungewohnten Situationen, in denen dieses Wissen getestet, neutralisiert, moduliert oder erweitert wird.
Da Soziale Arbeit jedoch in sehr unterschiedlichen Alltagskontexten stattfindet, müssen die beteiligten Akteure das, was als Soziale Arbeit dort stattfindet, zunächst als solche interpretieren und ihr Handeln an dieser Interpretation ausrichten. In diesem Zusammenhang sind Rollenerwartungen und die Möglichkeiten des eigenen Handelns von besonderem Interesse. Wer hat die Macht, welche Definition der Situation durchzusetzen? Und wie kann er*sie dies in den gegebenen Interaktionsrahmen tun? Mit Blick auf die Schulsozialarbeit oder »Doing Schulsozialarbeit« schauen wir in den verschiedenen Abschnitten des Lehrbuchs also beispielsweise auf die unterschiedlichen Rollen und damit verbundene Machtquellen, die die Institution Schule zur Verfügung stellt, und zwischen denen sich Schulsozialarbeit bewegen und positionieren muss. Lehrkräfte haben z. B. in der Schule recht umfassende strukturelle Machtmittel, wie Notenvergabe oder die Möglichkeit, jemanden aus dem Unterricht zu ›entfernen‹. Schüler*innen haben eher informelle, persönliche Machtmittel, wie Lästern, Unterrichtsstörungen oder Verweigerung. Aber welche Machtquellen hat die Schulsozialarbeit, die sich meist zwischen diesen Akteur*innen bewegt?
Hier zeigt sich eine Besonderheit von Doing Social Work in Bezug auf das »geteilte Wissen«: Sozialarbeiter*innen gehören einer Berufsgruppe an, die ihr professionelles Wissen nicht nur im Zuge des praktischen Handelns (als Berufserfahrung), sondern auch durch wissenschaftlich basierte Ausbildung und Training erwirbt. Dies gilt in der Schule auch für Lehrkräfte, allerdings haben sie dieses Wissen in anderen Curricula als die Sozialarbeiter*innen erworben. Im Gegensatz dazu beziehen sich die Adressat*innen der Sozialen Arbeit hauptsächlich auf lebensweltliches Wissen. Dazu gehören in der Schule alle Schüler*innen und ihre Familien, aber auch Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen waren einmal Kinder und besitzen auch Wissen über Schule aus dieser Zeit. Dieses Wissen ist ihnen quasi ,unter die Haut' gegangen und hat Einzug in das Doing auch über Emotionen und andere körperliche und seelische Wissensbestände gehalten.
Schaut man also auf das »Doing Schulsozialarbeit« spielt die institutionelle Einbettung der Schulsozialarbeit in die Schule eine zentrale Rolle (▸ Kap. 3). In der Schule bezieht sich letztlich jede konkrete Situation in der einen oder anderen Weise auf die gesellschaftliche Funktion der Institution Schule, einschließlich der gebündelten Erwartungen an ihre Mitglieder bzw. Rollenträger*innen. So werden Kinder und Jugendliche in der Schule vor allem in ihrer Schüler*innenrolle (Böhnisch/Lenz 2014, S. 38 ff.) adressiert und müssen sich u. a. den Erfordernissen des Unterrichts anpassen. Das Wissen über und um Schule bestimmt ihre Vorstellung und ihre Handlungsmöglichkeiten, auch in Bezug auf andere Interessen und Bedürfnisse. Wenn Sozialarbeiter*innen z. B. in eine Klasse kommen und dort Übungen zur Stärkung der Klassengemeinschaft machen, greifen die Schüler*innen auf ihr besonderes Institutionenwissen zurück. Was darf man dort tun? Gelten die Unterrichtsregeln noch? Wer sind die ,neuen', »anderen Erwachsenen« (vgl. Wolf 2002)? Und auch die Schulsozialarbeiter*innen knüpfen an die Möglichkeiten der schulischen Ordnung an bzw. müssen sich an ihr orientieren.
1.1.2 Die Modi der Herstellung Sozialer Arbeit in der Schulsozialarbeit
Mit dem Konzept des »Doing Social Work« (Aghamiri/Streck/Unterkofler 2023) fragen wir also: Wie verhandeln die Beteiligten Soziale Arbeit und welche typischen Interaktionsmuster lassen sich rekonstruieren bzw. verstehend wiederherstellen?
Merkmale der Sozialen Arbeit – die sogenannten »Modi der Herstellung« (Streck et al. 2018, S. 237 ff.) – werden im Sinne der Grounded Theory durch den Vergleich von Feldprotokollen und Interviewdaten rekonstruiert. Sie können auch dem Verständnis und der Reflexion von professionellem Handeln in der Schulsozialarbeit dienen.
Hier lassen sich im Anschluss an Streck et al. (2018) mehrere grundlegende »Modi der Herstellung« von Schulsozialarbeit identifizieren, die eine Leitschnur für die Reflexion und das Verständnis von professionellem Handeln in der Schulsozialarbeit dienen können.
a)
Entscheiden in UngewissheitWas hilft den Adressat*innen der Sozialen Arbeit? Was schadet ihnen aber möglicherweise auch? Oft geht es darum, ein Problem zu beheben. Gerade in der Schule ist dies die Erwartung vieler Eltern, Lehrkräfte oder auch Schüler*innen an die Soziale Arbeit. Der Umgang mit Zuschreibungen und die Erwartung von Störungen und Risiken bestimmen das Handeln von Professionellen in vielen Feldern der Sozialen Arbeit. Daher ist es ein wichtiger Teil des Auftrags der Fachkräfte, schädliche soziale Situationen zu verhindern. Diese Grundstimmung lässt sich sehr leicht auf die Schule übertragen. Sozialarbeiter*innen erfüllen diese Aufgabe, indem sie zum einen allgemeine Regeln einer besonderen Organisation oder des Zusammenlebens auf die jeweilige Situation anwenden und gleichzeitig versuchen, auf die Einzigartigkeit der Situation einzugehen. Das Handeln ist geprägt durch das ständige Balancieren von Risiken und Verantwortung auf der einen Seite und der Autonomie der Betroffenen auf der anderen Seite. In dieser Ungewissheit sind die Sozialarbeiter*innen gezwungen, Entscheidungen zur Bearbeitung der Situation zu treffen, ohne wissen zu können, was tatsächlich passieren wird.
b)
Verwendung von DifferenzkategorienSozialarbeiter*innen nutzen typisierendes, kategoriales Wissen über Verschiedenheiten. So beziehen sie sich in unterschiedlicher Weise auf Kategorien wie Geschlecht, ethnische Herkunft oder Klasse. Sozialarbeiter*innen nutzen diese Unterscheidungen z. B., um ihre Situationsdefinitionen zu untermauern, Arbeitsaufträge zu legitimieren oder ihre Position als Expert*innen zu unterstreichen. Dabei ist ihr Handeln mit Diskursen und materiellen Bedingungen sozialer Gerechtigkeit verknüpft. Auch diese Bedingung finden wir in Schulen, wenn z. B. benachteiligte Gruppen von Schüler*innen über Differenzmerkmale wie ethnische Herkunft oder soziale Milieus benannt werden und in den Fokus der Schulsozialarbeit geraten.
c)
Die Disziplinierung des AlltagsSoziale Arbeit umfasst Settings, die einen unterschiedlichen Grad an Formalisierung von Alltagswelten aufweisen. Dies ist oft gepaart mit ambitionierten pädagogischen Absichten. So werden z. B. beim Essen, Wohnen oder Arbeiten Settings geschaffen, die Machtverhältnisse überhöhen und die Erziehung durch Disziplinierung betonen. Auch solche Situationen kommen in der Schulsozialarbeit vor, wenn z. B. Unterrichtsregeln für die Schulsozialarbeiter*innen zu Bezugspunkten werden.
d)
Diffusitäten bespielenSoziale Arbeit ist durch eine relative Unbestimmtheit gekennzeichnet. Die Fachkräfte müssen umfangreiche Arbeitsaufgaben in unterschiedlichsten Alltagssituationen bewältigen. Diese spiegeln sich auch in unterschiedlichen Rollenmustern sowie in flexiblen räumlichen und zeitlichen Arrangements wider (s. o.). So agieren Sozialarbeiter*innen mitunter wie Freund*innen, Eltern oder Vermittler*innen. In der Schulsozialarbeit sind sie Vertraute, Spielpartner*innen oder auch Erzieher*innen. Die Unbestimmtheit von Situationen ermöglicht es sowohl den Erwachsenen als auch den Kindern und Jugendlichen, Freiräume zu entdecken und für ihre eigenen Angelegenheiten zu nutzen.
Ähnliche Bedingungen der Herstellung von Schulsozialarbeit werden wir in diesem Buch sichtbar machen, reflektieren (vgl. etwa das Konzept der »Zwischenbühne« ▸ Kap. 4) und gemeinsam überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten sich für die Schulsozialarbeit ergeben.
1.2 Zugrunde liegende Forschungsmethodologie
Dieses Lehrbuch basiert – anders als andere Lehrbücher – in hohem Maß auf qualitativ-empirischen Daten und deren Analyse. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in knapper Form damit auseinandersetzen, welche grundlegende Idee der Erkenntnisgewinnung damit verbunden ist.
Das generelle Anliegen des Bandes, an den konkreten Interaktionen der Akteur*innen in der Schulsozialarbeit anzusetzen und daraus etwas über die allgemeinen Strukturen des Handlungsfeldes zu lernen, korrespondiert mit der Methodologie der verwendeten Daten.
Forschungsmethodologie
Unter einer Forschungsmethodologie verstehen wir grundlegende Annahmen bezüglich empirischer Erkenntnisprozesse. Etwas zugespitzt: Eine Forschungsmethodologie formuliert aus, »wie wissenschaftliche Arbeit zu erfolgen hat, um Befunde zu erbringen, die mit der Realität übereinstimmen« (Häder 2019, S. 14 f.). Das betrifft sowohl die Datenerhebung, das Sampling (also die Auswahl der Situationen, die beobachtet werden, oder die Personen, die befragt werden sollen) als auch die Analyse der Daten. Aus diesen grundlegenden Annahmen leiten sich dann konkrete Forschungsmethoden (wie beispielsweise die Erhebung quantitativer Daten mit Hilfe eines quantitativen Fragebogens oder die Erhebung qualitativer Daten im Rahmen von narrativen Interviews) ab.
Die verwendeten Daten entstanden in Forschungsprojekten, denen allen ein starkes Interesse an den konkreten Alltagsinteraktionen in unterschiedlichen Segmenten des Handlungsfelds Schulsozialarbeit zugrunde lag. Aus diesem Grund wurden Forschungsmethoden gewählt, mit denen die konkreten Interaktionsprozesse und das subjektive Erleben der Akteur*innen im Zentrum standen. Das waren in verschiedenen Fällen (Reinecke-Terner 2017; Aghamiri 2015) ethnographische Methoden und des Weiteren narrative Interviews mit Schulsozialarbeiter*innen und Schüler*innen (Kloha 2018).
Am Ende jedes Datenauszuges befindet sich ein Verweis auf die Quelle bzw. das Forschungsprojekt, in dem die Daten erhoben wurden. Eine Übersicht über die verwendeten Quellen des Datenmaterials finden Sie im Anhang.
Im Folgenden werden wir zunächst einen kleinen Einblick in die Besonderheiten der verwendeten Forschungsmethoden geben, um die Aussagekraft der verwendeten Beispiele deutlich zu machen. Eine Bemerkung vorab: Im Lehrbuch werden Ihnen einige der Personen aus den Interviews begegnen. Die persönlichen Informationen zu diesen Personen – also deren Namen, Orte, Institutionen etc. – wurden natürlich sorgfältig nach forschungsethischen Grundsätzen (vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit 2020) anonymisiert und maskiert.
1.2.1 Ethnographische Methoden für die Praxisanalyse
Eine zentrale Perspektive ethnographischer Forschung ist, dass soziale Wirklichkeit – in diesem Fall Schulsozialarbeit – eine interaktive Konstruktionsleistung ist. Soziale Wirklichkeit wird also im gemeinsamen Handeln der beteiligten Akteur*innen hergestellt. Das heißt, ein sozialer Ort wie Schule oder Schulsozialarbeit ist nicht einfach objektiv und materiell vorhanden, sondern besteht aus Absprachen, Routinen, Praktiken, Rollen und Bedeutungen, die die Menschen, die sich dort aufhalten, kennen oder teilen müssen, um sich orientieren zu können. Insofern ist der Gegenstand ethnographischer Forschung die soziale Interaktion in spezifischen Situationen (vgl. z. B. Spradley 1980). Ethnograph*innen versuchen nun, die Bedeutungen, die in diesen Handlungen sichtbar werden, nachvollziehbar zu beschreiben und analytisch zu systematisieren. Ethnographische Forschung hat in der Sozialen Arbeit eine lange Tradition, wenn es darum geht, praktische Zustände zu erfassen und so weit zu theoretisieren, dass sie als Denk- und Handlungsgrundlage für eine wissenschaftlich reflektierte Praxis dienen können – so etwa um die Bedeutungszusammenhänge der bürgerlichen Sozialreformen sichtbar zu machen (vgl. Hoff 2012) oder im Rahmen der Chicago School, insbesondere in den Beschreibungen und Analysen von Jane Addams in Hull-House (vgl. Miethe 2012).
Dafür begeben sich die Forschenden direkt in die jeweiligen sozialen Situationen und Handlungsfelder, die auch der Forschungsgegenstand sind. In unseren Fällen waren das beispielsweise Sitzungen eines Gruppenprojektes und eines Klassenrats von Sozialpädagog*innen in einer Grundschule (Aghamiri 2015) oder eine Begleitung über mehrere Monate im Alltag der Schulsozialarbeit an verschiedenen Schulen, im Zuge derer nahezu alle Angebote und Interaktionen der Schulsozialarbeit beobachtet wurden (Reinecke-Terner 2017). Aber auch anderes Datenmaterial aus ethnographischen Praxisforschungs- und Lehrprojekten haben wir in das vorliegende Lehrbuch einbezogen (z. B. Aghamiri et al. 2018; Aghamiri 2023).
Bei ihren teilnehmenden Beobachtungen machen sich die Forscher*innen zunächst Feldnotizen, die sie dann später in detaillierten »dichten« Beobachtungsprotokollen bzw. Beschreibungen dokumentieren (vgl. z. ,B. Breidenstein et al. 2020, S. 85 ff.). Diese Beobachtungsprotokolle dienen neben anderen Materialien, wie Interview- oder Feldgesprächstranskripten sowie Artefakten bzw. Gegenständen und ,Fundstücken' aus dem Feld, im Anschluss als Grundlage der Analyse. Beobachtungsprotokolle sind dabei immer schon durch die persönlichen Erfahrungen der Forschenden als Teilnehmer*innen in den jeweiligen Feldern bestimmt. Die Forschenden schreiben das auf, was ihnen sozusagen ins Auge fällt. Eine große Herausforderung besteht dabei in der Verschriftlichung von komplexen sozialen Handlungen, die letztlich immer eine Reduzierung und Auswahl erfordert. Hirschauer nennt diese auch die »Schweigsamkeit der Sozialen« (2001, S. 437). Beobachtungsprotokolle beinhalten also immer schon Interpretationen und damit Bedeutungshinweise, die die Forschenden in ihrer Vertrautheit mit dem Feld (manchmal sogar unwissentlich) hineingeschrieben haben. In der Analyse werden diese Bedeutungen später de-, aber vor allem rekonstruiert. Die sozialen Bedeutungen von Handlungen im institutionell gerahmten Kontext können so erst deutlich gemacht werden.
Beispiel
Wenn in Beobachtungsprotokollen aus der Schule oft die Lautstärke beschrieben wird, kann dies als Hinweis darauf verstanden werden, dass es in der Schule eben auch von zentraler Bedeutung ist, wie laut (unruhig) oder leise (konzentriert) eine Klassengruppe wirkt. Dahinter steht nicht nur eine einzelne Regel für eine besondere Klasse, sondern eine komplexe Idee von schulischer Ordnung und Schüler*innenrolle (Aghamiri 2015, S. 125 ff.).
1.2.2 Narrative Interviews
Bei einem weiteren qualitativen Forschungsprojekt, das eine Grundlage für unsere Beispiele bietet (Kloha 2018), bestand die Datengrundlage zum einen aus narrativen Interviews mit Schulsozialarbeiter*innen, in denen sie in ausführlicher und detaillierter Weise über ihre Arbeit mit spezifischen Schüler*innen erzählten. Zum anderen wurden autobiographisch-narrative Interviews (Schütze 1983) mit Schüler*innen, die von Schulsozialarbeiter*innen betreut wurden, geführt.
Die Grundannahme ist hier, dass Erzählungen selbst erlebter Ereignisse (wie etwa eine Fallgeschichte mit einer Schülerin, aber auch Prozesse in der eigenen Lebensgeschichte dieser Schülerin) einen guten Zugang dazu liefern können, wie diese Ereignisse sich im Erleben des*der Erzähler*in widerspiegeln, wie die einzelnen Elemente des interessierenden Prozesses sich im Sinne einer »Erfahrungsaufschichtung« (Schütze 1981, S. 79) aneinanderreihten. Mit anderen Worten: Über solche Erzählungen ist es besonders gut möglich, Prozesse zu rekonstruieren, die sich (anders als dies meistens durch ethnographische Methoden möglich ist) über einen längeren Zeitraum erstreckten, und gleichzeitig dabei die spezifische Perspektive, die subjektiven »Eigentheorien« (Riemann 2010, S. 229) des*der Erzähler*in herauszustellen. Mit anderen Worten: Wie erlebt jemand etwas und welchen Reim macht er sich daraus im Moment, in dem er über diese Erlebnisse erzählt? Gerade der letzte Aspekt erscheint uns hervorhebenswert, da es hierüber u. a. möglich ist, etwas über die Kategorisierungen zu erfahren, die Professionelle im Hinblick auf die Lebenssituationen der Adressat*innen heranziehen (s. o.).
Beispiel
In zahlreichen Interviews mit Schulsozialarbeiter*innen wurden Schüler*innen als »auffällig« kategorisiert. Hier lässt sich nun genauer der Frage nachgehen, ob sich diese Kategorie in erster Linie auf schulische Kriterien (z. B. abfallende Leistungen), die in der Schule sichtbar werdenden Verhaltensweisen oder auf die Alltags- und Familiensituation, von der der*die Schulsozialarbeiter*in erfährt, bezieht (z. B. durch Informationen über familiäre Konflikte).
1.2.3 Grounded Theory als übergreifendes Leitkonzept
Alle drei Forschungsprojekte orientierten sich an dem methodologischen Zugang der grounded theory (Glaser/Strauss 1967). Dieser Forschungsansatz, der in den 1960er Jahren von den amerikanischen Soziologen Strauss und Glaser entwickelt wurde (und in der Folgezeit in unterschiedlicher Form von diesen beiden Autoren und weiteren (u. a. Strauss/Corbin 1996) weiterentwickelt wurde), betont die Möglichkeit, aus den erhobenen Daten selbst durch genaue, vergleichende Analysen allgemeine Erkenntnisse (also Theorie) über einen Sachverhalt zu gewinnen. Damit stellt sich dieser Forschungsansatz gegen eine Vorstellung, dass zunächst rein theoretische Modelle von einem Phänomen (also etwa dem Ablauf eines Beratungsgespräches in der Schulsozialarbeit) entwickelt werden, die dann in der Folge »nur noch« empirisch überprüft werden. Eine solche Perspektive entspricht in hohem Maße unserem Ansatz, dass sich die Praxis Sozialer Arbeit nicht auf vorher eindeutig beschreibbare Muster und Methoden reduzieren lässt, sondern dass das, was Soziale Arbeit (und damit eben auch Schulsozialarbeit) ausmacht, in einer jeweils konkreten interaktiven Praxis, die es zu entdecken gilt, »hergestellt« wird.
1.3 Zur Nutzung des Lehrbuchs: eine »Gebrauchsanweisung«
Die einleitenden Bemerkungen haben bereits deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht professionelles Handeln in der Schulsozialarbeit, also das Handeln von Personen in ihrer jeweiligen professionellen Rolle, in hohem Maße Ergebnis von konkreten Interaktionen und Aushandlungen in einem spezifischen Feld ist. Damit einher geht die Überzeugung, dass dieses Handeln − das, was ein*e Schulsozialarbeiter*in in seiner*ihrer Rolle tut − nicht gänzlich in normativen Richtwerten, konzeptionellen Leitlinien, institutionellen Strukturen oder methodischen Handlungsanleitungen aufgeht. Um nicht missverstanden zu werden: Dies bedeutet keineswegs, dass diese Aspekte zu vernachlässigen wären. Im Gegenteil, sie sind äußerst bedeutsam, um die Handlungsspielräume in einem Praxisfeld wie dem der Schulsozialarbeit abzustecken. Aus diesem Grund stellen Lehrbücher wie das von Speck (2022), Spies und Pötter (2011), Stüwe et al. (2017) oder das Praxisbuch von Baier und Deinet (2011) und (Hollenstein et al. 2017) wichtige Eckpunkte im Professionalisierungsprozess des Handlungsfeldes dar. Hier werden Handlungsspielräume ausformuliert, Zuständigkeiten abgesteckt und methodische Zugänge entwickelt. Wie zentrale Leitplanken tragen solche Perspektiven einerseits nach »innen« zur Selbstvergewisserung der Professionellen, andererseits nach »außen« zur Profilbildung und auch Abgrenzung im Kontext des interprofessionellen Handlungsfeldes Schule bei.
Mit dem vorliegenden Lehrbuch verfolgen wir allerdings ein etwas anderes Leitziel. Wir fragen nicht primär danach, welche normativen und konzeptionellen Leitideen das Handlungsfeld prägen, sondern wie innerhalb dieses Feldes und in der Interaktion mit Angehörigen anderer Professionen professionelles Handeln eigentlich entsteht. Dies hat fundamentale Folgen für die grundlegende Anlage dieses Buches. Denn aus einer solchen Perspektive kann es nicht genügen, Lernende mit »fertigen« Konzepten zu konfrontieren. Vielmehr folgt aus dem eben dargestellten Leitziel das didaktische Ziel, Lernende dazu anzuregen, sich Aspekte des Handlungsfeldes eigenständig zu erschließen. Dies sind die Grundlagen für die Bildung einer professionellen Haltung, die sich immer erst im Prozess des konkreten Tuns und der Reflexion dieses Handelns entwickeln kann.
Damit ist auch bereits die grundlegende Struktur der einzelnen Kapitel des Lehrbuchs angedeutet. Je nach thematischer Ausrichtung bestehen diese aus einer unterschiedlich gewichteten Mischung aus zentralem Orientierungswissen zum Handlungsfeld Schulsozialarbeit einerseits und Ausschnitten aus qualitativen Datenmaterialien andererseits, die zeigen, wie die Aushandlung im Feld jeweils vor sich geht oder verstanden wird. In der Beschäftigung mit Letzteren eröffnen sich – so unsere Hoffnung – Möglichkeiten zur Entwicklung eigener ganz praktischer Sichtweisen und der Entdeckung jeweils spezifischer Aspekte von professionellem Handeln, die nicht durch konzeptionelle Rahmungen allein bereits erfasst sind.
Die Teile, in denen die Beschäftigung mit Datenmaterialien im Vordergrund steht, haben eine durchlaufende Struktur:
Zunächst wird der Datenauszug kontextualisiert: In der Regel handelt es sich hierbei um Auszüge aus ethnographischen Beobachtungsprotokollen oder Interviewtranskripten. An wenigen Stellen werden auch andere, vor allem schriftliche Materialien zur Analyse herangezogen. Es gibt mal mehr, mal weniger umfangreiche Hintergrundinformationen zum*zur Informant*in, zu der konkreten Situation, um die sich der Datenauszug dreht, zum zentralen Thema etc.
Daraufhin wird der Datenauszug wiedergegeben.
Daran anschließende Erschließungsfragen stellen ein orientierendes Angebot in der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial dar. Im Sinne unseres Verständnisses von Fallverstehen als einem grundsätzlich offenen Prozess, der viele Überschneidungen mit dem Analyseprozess in qualitativen Forschungsprozessen zeigt (Schütze 1994a), sind diese Fragen aber nur als Einstieg gedacht. Die Hoffnung ist, dass sich Lernende darüber hinaus auch dazu anregen lassen, jeweils eigene Fragen an das Material zu richten. Auch eigene Praxiserfahrungen können vor diesem Hintergrund reflektiert werden und als mögliche Kontrastierungen zu den von uns angebotenen Datenauszügen dienen. Vorschläge, wie eigene Praxiserfahrungen systematisch festgehalten und reflektiert werden können, geben wir im Kapitel 9.
Die Passage schließt jeweils mit einem Interpretationsangebot, welches wir aufgrund unserer Beschäftigung mit dem Datenmaterial zur Verfügung stellen. Auch hier ist wichtig zu betonen, dass es hier nicht um die »Auflösung« der vorher gestellten Fragen gehen kann und soll, sondern um die Präsentation einer möglichen Perspektive auf das Material.
Abschließend noch ein Hinweis zum didaktischen Setting: Sicherlich kann die Beschäftigung mit den Datenauszügen auch jeweils für sich erfolgen. Gerade für Verstehensprozesse wie dem hier skizzierten hat es sich aber bewährt, diese Prozesse in Gruppensettings zu verankern. Der gemeinsame Blick auf solche Daten und die damit einhergehenden Fragen eröffnen zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten: Sie ermöglichen eine größere Vielfalt von Perspektiven auf das Material, die Teilnehmer*innen regen sich gegenseitig an und Ideen können gemeinsam »weitergesponnen« werden. Sie sind natürlich auch für Einzelpersonen nutzbar.
Wir beziehen uns hier auf vielfältige Erfahrungen, die insbesondere im Zusammenhang mit dem sozialen Setting der Forschungswerkstatt (Beneker 2015; Mangione 2022; Schütze 2015a; Riemann 2006a) gemacht wurden. Somit kann das Format dieses Lehrbuchs auch als Anregung verstanden werden für die Lehre zur Schulsozialarbeit – an Hochschulen, aber auch in Fort- und Weiterbildungen −, damit aus der Perspektive des entdeckenden und forschenden Lernens wichtige Erkenntnisse entstehen können.
Das Buch endet deshalb auch mit einem Kapitel mit konkreten Vorschlägen, wie sich Lernende selbst – auf der Grundlage qualitativ-rekonstruktiver Verfahren der Datenerhebung und -analyse – auf die forschende Suche nach dem machen, was das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit ausmacht.
Gut zu wissen – gut zu merken
Die anspruchsvolle Praxis der Schulsozialarbeit braucht ethisch-normative Grundlagentheorien, um ihr Handeln zu bestimmen.
Um dieses Handeln aber reflexiv aufzubrechen, zu überprüfen, anzupassen und für eine lebendige interaktive Schulsozialarbeit zu lernen, braucht es den Blick auf konkrete Situationen, wie sie im Alltag des Handlungsfeldes vorkommen.
Ein forschender Blick hilft uns, die Prozesse in der Praxis besser nachzuvollziehen und ggf. Handlungsalternativen zu entwickeln. Wir entdecken die Schulsozialarbeit auf der Grundlage von Praxis- und Forschungsbeispielen.
Weiterführende Literatur
Aghamiri, K./Reinecke-Terner, A./Streck, R./Unterkofler, U. (Hrsg.) (2018): Doing social work – ethnografische Forschung in der Sozialen Arbeit. Opladen/Farming Hills, MI: Budrich.
Aghamiri, K./Streck, R./Unterkofler, U. (2023): Handlungsfeldübergreifend beobachten und rekonstruieren: Doing Social Work als theoriebildende Perspektive auf Soziale Arbeit. In: Köttig, M./Kubisch, S./Spatschek, C. (Hrsg.): Geteiltes Wissen – Wissensentwicklung in Disziplin und Profession Sozialer Arbeit. Opladen/Berlin/Toronto: Budrich, S. 55 – 66.
Riemann, G. (2005): Zur Bedeutung ethnographischer und erzählanalytischer Arbeitsweisen für die (Selbst-)Reflexion professioneller Arbeit. Ein Erfahrungsbericht. In: Völter, B./Dausien, B./Lutz, H./Rosenthal, G. (Hrsg.): Biographieforschung im Diskurs. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 248 – 270.
2 Anknüpfen an Traditionen: Kurze Geschichte der Schulsozialarbeit
T Was erwartet Sie in diesem Kapitel?
Sie bekommen einen Überblick über zentrale historische Entwicklungsstränge der Schulsozialarbeit. Sie werden angeregt, darüber nachzudenken, welche Themen im Verhältnis von Schule und Jugendhilfe die historische Entwicklung durchziehen.
2.1 Das Verhältnis von Schule und Jugendhilfe bis 1945
Die Schulsozialarbeit hat geschichtliche Bezüge, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Von einer professionalisierten Schulsozialarbeit können wir ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts sprechen. Damit ist die Soziale Arbeit an Schulen – entgegen einem Verständnis als »neues« Handlungsfeld – eines der ersten zentralen Tätigkeitsfelder von Sozialarbeiter*innen gewesen und somit aufs Engste mit der allgemeinen Professionsentwicklung Sozialer Arbeit verbunden.