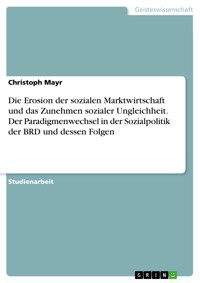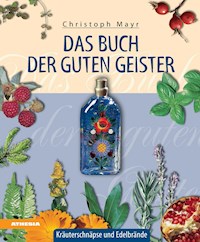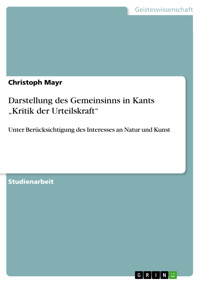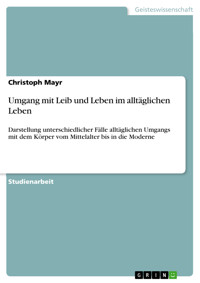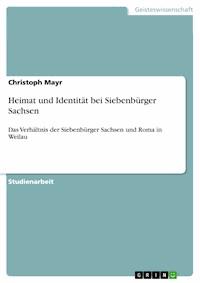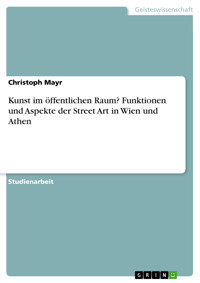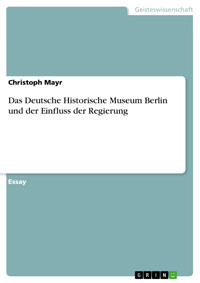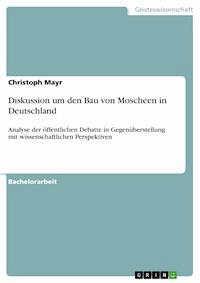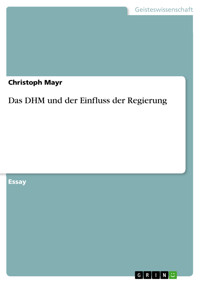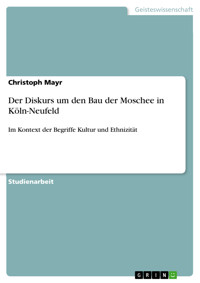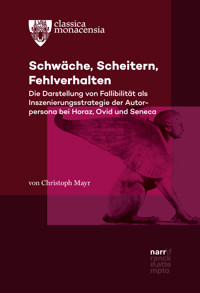
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Classica Monacensia
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum dieser Monographie steht die Frage, wie die römischen Autoren Horaz, Ovid und Seneca die Darstellung eigener Schwäche, eigenen Scheiterns und eigenen Fehlverhaltens als Mittel ihrer literarischen Selbstinszenierung einsetzen. Anhand ausgewählter Passagen der Satiren, der Tristia und Epistulae ex Ponto sowie der Epistulae morales wird untersucht, welche unterschiedlichen Ausprägungen von Schwäche, Scheitern und Fehlverhalten in den Texten jeweils dargestellt werden, mit welchen sprachlichen Mitteln diese Darstellung erfolgt und welche persuasiven Effekte durch sie erzielt werden. Es wird gezeigt, dass alle drei Autoren diese Darstellung nutzen, um sich bestimmte Kompetenzen und somit letzten Endes positiv konnotierte Eigenschaften zuzuschreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Mayr
Schwäche, Scheitern, Fehlverhalten
Die Darstellung von Fallibilität als Inszenierungsstrategie der Autor-persona bei Horaz, Ovid und Seneca
Umschlagabbildung: Marmorsphinx als Basis. Neapel, Museo Nazionale, Inv. 6882. Guida Ruesch 1789. H: 91 cm INR 67. 23. 57. Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381129829
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-4274
ISBN 978-3-381-12981-2 (Print)
ISBN 978-3-381-12983-6 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Die vorliegende Monographie ist die geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die im Wintersemester 2023/2024 an der Ludwig-Maximilians-Universität München eingereicht wurde. Später erschienene Forschungsliteratur wurde für die Publikation nicht mehr berücksichtigt.
Viele Menschen haben auf unterschiedliche Art und Weise dazu beigetragen, dass ich an meinem Promotionsvorhaben, das lange Zeit den Arbeitstitel „Schwäche und Scheitern“ trug, nicht selbst gescheitert bin. Ihnen allen sei an dieser Stelle von Herzen gedankt.
Therese Fuhrer hat mich zur Fragestellung und Textauswahl der Arbeit angeregt und mir durch die langjährige Anstellung an ihrem Lehrstuhl ermöglicht, viele wertvolle Erfahrungen im universitären Lehr- und Forschungsbetrieb zu sammeln. Lisa Cordes hat die Arbeit von Beginn an mit sehr großem Interesse verfolgt und am Ende ohne zu zögern die Mühen des Zweitgutachtens auf sich genommen. Gerade in schwierigen Phasen stand sie mir nicht nur mit ihrer fachlichen Expertise, sondern immer auch mit privatem Rat zur Seite.
Andreas Ammann hat unzählige meiner Fragen mit der ihn auszeichnenden Geduld und Hilfsbereitschaft beantwortet. Mit ihm verbindet mich weit mehr als der Umstand, dass wir uns vier Jahre lang ein Büro geteilt haben. Auch Oliver Schelske und Tobias Uhle sind mir schnell zu guten Kollegen und noch schneller zu sehr guten Freunden geworden. Manuela Wunderl war mir stets eine verständnisvolle und gleichermaßen motivierende Gesprächspartnerin. Bianca Schröder und Janja Soldo haben Teile der Arbeit kommentiert und mir mehrfach nicht nur in fachlicher Hinsicht geholfen. Tobias Gräbert hat das Manuskript Korrektur gelesen. Für eventuell verbliebene Fehler bin freilich ich allein verantwortlich. Während meines Studiums habe ich viel durch die engagierte und begeisternde Lehre von Petra Riedl und Tobias Uhle gelernt.
Martin Hose hat die Aufgabe des Drittprüfers in meiner Disputatio übernommen. Claudia Wiener hat mich während und nach der Promotion unterstützt. Beide habe sich zudem dazu bereit erklärt, dieses Buch in die Reihe Classica Monacensia aufzunehmen. Tillman Bub vom Narr Francke Attempto Verlag hat die Publikation äußerst zuvorkommend und kompetent betreut.
Mein größter Dank gilt drei Menschen, die nichts von Latein verstehen, ohne die dieses Buch aber nicht denkbar wäre. Meinen Eltern verdanke ich mehr, als ich hier in Worte fassen kann. Ohne Jasmin Knorr hätte ich die Arbeit an dieser Dissertation zwar begonnen, aber mit Sicherheit niemals zu Ende gebracht.
München, im November 2024 Christoph Mayr
1Einleitung: Fallibilität als anthropologisches Phänomen
Da das zeitgenössische Lesepublikum antiker lateinischer Texte zur biographischen Interpretation von Literatur neigte, konnte „die Vorstellung, Gedichte würden von Zeitgenossen und Nachwelt biographisch gelesen und interpretiert [werden], kaum ohne Folgen für das Dichten bleiben.“1 Das lässt den Schluss zu, dass antike Autoren darum bemüht waren, ihre Autor-persona möglichst vorteilhaft darzustellen, um Leserinnen und Leser zu möglichst vorteilhaften Rückschlüssen auf ihre eigene Person zu bewegen.2 Angesichts dieses Bemühens und des teils erheblichen rhetorischen Aufwands, mit dem entsprechende Darstellungen betrieben werden, ist Folgendes bemerkenswert: Auch in Texten, in denen eine Autor-persona in Erscheinung tritt und die dem Lesepublikum dadurch ein bestimmtes Autorbild vorführen beziehungsweise das Angebot machen, ein solches zu konstruieren, spricht diese Autor‑persona häufig selbst über eigene Schwäche, eigenes Scheitern und eigenes Fehlverhalten und bringt damit ihre eigene Fallibilität offen zur Sprache.3
Unter den bewusst breit gefassten Begriff der Fallibilität subsumiere ich in dieser Arbeit Eigenschaften und Handlungen, die allgemein für negativ befunden oder in einem Text negativ konnotiert werden.4 Darunter zähle ich beispielsweise Verhalten, das als moralisch falsch zu beurteilen ist, Schwäche im Sinne charakterlicher Unvollkommenheit, Schwäche im Sinne körperlicher Mängel, Defekte oder Krankheiten, psychische Schwäche wie geringe Resilienz oder Depression, Scheitern im Erreichen eines angestrebten Ziels,5 oder ganz allgemein Defizite und Unzulänglichkeiten im Sinne eines Mangels an Perfektion.6 Der Begriff der Fallibilität soll verdeutlichen, dass jeder Mensch mit moralischen, intellektuellen, physischen und psychischen Defiziten und Defekten unterschiedlicher Art behaftet ist, dass die Möglichkeit, schwach zu sein, zu scheitern und Fehler zu begehen also in jedem Menschen von Natur aus angelegt ist.7
Der Umstand, dass Fallibilität ein anthropologisches Phänomen ist, erklärt, dass literarische Texte Schwäche, Scheitern und Fehlverhalten ihrer Autor-persona zur Sprache bringen, obwohl diese auf Grund der zeitgenössischen Neigung zur biographischen Interpretation als grundsätzlich positiv konzipierte Figur angesehen werden kann. Denn es wäre auch innerhalb einer im Text entworfenen Welt nicht glaubwürdig, würde eine Autor-persona als Mensch ohne Fehl und Tadel dargestellt werden. Mit den Satiren des Horaz und den Epistulae morales Senecas teilen zwei der drei Werke, die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, diese Auffassung.8 Die Autor-persona der Satiren behauptet des Öfteren, dass jeder Mensch mit Schwächen und Fehlern behaftet sei, und nutzt diesen Allgemeinplatz auch als Entschuldigung für eigenes Fehlverhalten.9 Die Epistulae morales sind wie andere philosophische Schriften Senecas von einer „Anthropologie der Schwäche“ geprägt und führen immer wieder als Konstante des menschlichen Lebens vor Augen, „dass der Mensch einen ständigen Kampf mit physischen und psychischen Schwächen zu führen habe.“ Senecas „Exempla illustrieren körperliche Schwächen, Hässlichkeit, Armut, Schande, Exil, materielle und ideelle Verluste als reale Möglichkeiten des menschlichen Daseins.“10
1.1Die Fallibilität der Autor-persona bei Horaz, Ovid und Seneca: Fragestellung und Aufbau der Untersuchung
Als anthropologisches Phänomen ist Fallibilität eine Grundkonstante des menschlichen Lebens und wird, wie soeben für die Satiren und die Epistulae morales skizziert, in antiken Texten auch als solche beschrieben.1 In Bezug auf die Inszenierung einer Autor-persona hat sich die bisherige Forschung jedoch vor allem damit beschäftigt, wie literarische Texte deren positiv konnotierte Eigenschaften und Verhaltensweisen hervorheben.2 Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung soll hingegen die Darstellung von Schwäche, Scheitern und Fehlverhalten der Autor-persona der Satiren, der Tristia und Epistulae ex Ponto sowie der Epistulae morales stehen.
Die Analysen ausgewählter Textstellen dieser Werke in den Kapiteln 2–4 gehen weder im Detail darauf ein, welche Begründungen oder Erklärungsversuche für die fallible Natur des Menschen in den Texten beschrieben werden, noch, welche Strategien für den Umgang mit dieser falliblen Natur und den aus ihr resultierenden Folgen empfohlen werden. Mich interessiert vielmehr, wie die jeweilige Autor-persona die Darstellung ihrer eigenen Fallibilität als Inszenierungsstrategie einsetzt, das heißt, wie sie die Darstellung ihrer eigenen Fallibilität nutzt, um ein Bild von sich zu präsentieren, das andere zu bestimmten Einstellungen oder Handlungen bewegen soll. Ich will also fragen, welche Ausprägungen ihrer Fallibilität eine Autor-persona darstellt, mit welchen sprachlichen Mitteln diese Darstellung erfolgt und welche persuasiven Effekte durch diese Darstellung erzeugt werden.3
Die Satiren, die Tristia und Epistulae ex Ponto sowie die Epistulae morales eignen sich für eine solche Untersuchung, da sie sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufweisen. Ihnen ist vor allem gemeinsam, dass sie aus der Perspektive einer Autor-persona verfasst sind, die in zahlreichen Passagen durch Ich-Aussagen und/oder Aussagen anderer Figuren als schwach, scheiternd und fehlerbehaftet dargestellt wird. Verssatire, (im Exil verfasste) Elegie und philosophisch-paränetischer Brief sind jedoch von unterschiedlichen literarischen Traditionen und Konventionen geprägt, evozieren unterschiedliche Kommunikationssituationen und lassen die Autor-persona unterschiedliche Rollen einnehmen sowie unterschiedliche Persuasionsziele verfolgen. Das bietet die Möglichkeit, nach der eigenständigen Analyse ausgewählter Passagen der jeweiligen Werke einen textübergreifenden Vergleich anzustellen, welche persuasiven Effekte die Darstellung von Fallibilität erzeugen und inwiefern diese Darstellung eingesetzt werden kann, um eine Autor-persona zu inszenieren.4
In der bisherigen Forschung wurden mehrere persuasive Effekte beschrieben, die die Darstellung eigener Schwäche, eigenen Scheiterns und eigenen Fehlverhaltens durch eine Person haben kann. Insbesondere zu nennen sind die im Folgenden nur knapp umrissenen, durch die Reihenfolge ihrer Nennung nicht gewichteten und teils nicht klar voneinander abgrenzbaren Effekte: Gibt eine Person zu, fallibel zu sein, kann sie das nahbar wirken lassen und Sympathie hervorrufen. In der römischen Gesellschaft sprach man nur selten öffentlich über eigene Unzulänglichkeiten.5 Das Sprechen beziehungsweise Schreiben über die eigene Fallibilität ist deshalb dazu geeignet, das Verhältnis und die Kommunikation mit einem Gegenüber als intim und vertraulich darzustellen. Denn nur in einem solchen vertraulichen Rahmen kann man offen über eigene Schwäche, eigenes Scheitern und eigenes Fehlverhalten sprechen.6 Abgesehen davon, dass die Behauptung, frei von Fehlern zu sein, auf Grund des Status des Menschen als Mängelwesen unglaubwürdig wäre, sind die bereits genannten Punkte auch dazu geeignet, die Aussagen einer Person authentisch und glaubwürdig wirken zu lassen.7 Durch das Eingeständnis der eigenen Fallibilität kann man zudem Vorwürfe vorwegnehmen, sie im Voraus entkräften und sich so gegen echte oder potentielle Angriffe verteidigen.8
Ausgehend von diesen Beobachtungen und vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Neigung des zeitgenössischen Lesepublikums, literarische Texte biographisch zu deuten und aus ihnen Rückschlüsse auf deren historische Autoren zu ziehen, will ich mit dieser Arbeit für folgende These argumentieren: Die Darstellung der Fallibilität einer Autor-persona dient nie dazu, sie als Figur zu inszenieren, die in Gänze mit negativ konnotierten Eigenschaften ausgestattet ist und die ausschließlich als falsch zu bewertende Verhaltensweisen zeigt. Vielmehr nutzen ‚Horaz‘, ‚Naso‘ und ‚Seneca‘ die Darstellung von Schwäche, Scheitern und Fehlverhalten ihrer eigenen Person, um sich letzten Endes positiv konnotierte Qualitäten zuzuschreiben.9 Sie bringen ihre Fallibilität zur Sprache, um sich als kompetente Verfasser eines Textes zu präsentieren und um andere zu bestimmten Einstellungen und Handlungen zu bewegen.10 Beispielsweise gesteht ‚Horaz‘ Schwächen und Fehler ein, um nicht als Moralist zu erscheinen, der Forderungen an andere stellt, die er selbst nicht erfüllen kann, und um Kritik anderer an seiner eigenen Person vorwegzunehmen. Der verbannte ‚Naso‘ wiederum beschreibt eigene physische und psychische Krankheiten nicht nur, um auf vordergründiger Textebene an das Mitleid und die Unterstützung seiner Adressatinnen und Adressaten und seines Lesepublikums zu appellieren, sondern auch, um sein innovatives Können als Dichter hervorzuheben. ‚Seneca‘ gibt als Absender der Epistulae morales eigenes Fehlverhalten nicht nur offen zu, um auf Erfahrung beruhende Expertise im Umgang mit diesem Fehlverhalten zu beanspruchen, sondern auch, um seinen Adressaten Lucilius dazu zu motivieren, sich selbst aktiv um ethischen Fortschritt zu bemühen und sich nicht von ‚Seneca‘ als seinem zwar weiter fortgeschrittenen, aber dennoch falliblen Briefpartner abhängig zu machen.
1.2Theoretische Grundlagen und zentrale Begriffe
1.2.1Historischer Autor, Autor-persona und biographische Informationen
Autoren inszenieren die Figuren ihrer Texte so, dass die persuasive Wirkung dieser Texte unterstützt wird. Dazu können sie diese Figuren mit bestimmten Merkmalen, Charakterzügen und einer Biographie ausstatten und so Ähnlichkeiten und/oder Übereinstimmungen mit einer historischen Person konstruieren oder behaupten, dass die im Text vergebenen Informationen auf eine historische Person rekurrieren. Durch die Vergabe solcher biographischer Informationen wird dem Lesepublikum das Angebot gemacht, literarische Figur und historische Person im Prozess der Lektüre miteinander zu identifizieren. Jede Figur eines Textes bleibt gleichwohl immer literarisches Konstrukt und darf nicht mit der historischen Person gleichgesetzt werden, auf die im Text referenziert wird. Das gilt auch für eine Autor‑persona. Als Autor-persona bezeichne ich eine Figur, die als Verfasser des Textes dargestellt wird, als dessen Ich-Sprecher sie in Erscheinung tritt, und die beispielsweise durch die Vergabe biographischer Informationen das Angebot macht, sie mit dem historischen Autor dieses Textes zu identifizieren.1
Durch die Inszenierung einer solchen Autor-persona entwirft der historische Autor ein Autorbild.2 Er fungiert dabei gewissermaßen nur als Regisseur des auf der ‚Bühne des Textes‘ vorgeführten Geschehens und der darin involvierten Figuren und tritt im Text nicht selbst als Akteur in Erscheinung.3 Literarische Texte zeigen also nicht, wer ihr Autor tatsächlich ist beziehungsweise war, sondern wie eine potentiell Ähnlichkeiten und/oder Übereinstimmungen mit ihm aufweisende Figur im Text inszeniert wird, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.4 Spricht oder schreibt eine Autor-persona über ihre eigene Fallibilität, heißt das also nicht, dass auch der historische Autor in entsprechender Hinsicht fallibel war, sondern dass er eine Figur seines Textes als fallibel inszeniert, um die persuasive Wirkung des Textes zu unterstützen. Diese Wirkung kann auch darauf abzielen, dem Lesepublikum das Angebot zu machen, ein bestimmtes Autorbild zu konstruieren.
Die Inszenierung einer Autor-persona erfolgt häufig über die Vergabe biographischer Informationen. In den Texten, die in dieser Arbeit behandelt werden, finden sich diesbezüglich unter anderem folgende Informationen: Name,5 soziale Abstammung,6 geographische Herkunft,7 Ausbildung,8 Alter,9 soziale Beziehungen,10 berufliche Laufbahn11 und körperliche Konstitution.12 Auf Grund der zeitlichen und räumlichen Nähe zur Entstehung eines Textes bestand für das zeitgenössische antike Lesepublikum die Möglichkeit, die Faktizität solcher Informationen zu kennen. Das macht es zwar plausibel, dass diese Informationen zumindest in ihren Grundzügen mit der Lebenswirklichkeit des historischen Autors übereinstimmen. Sie ermöglichen trotz dieser potentiellen Übereinstimmungen aber keine Rückschlüsse auf diese Lebenswirklichkeit des historischen Autors, sondern entwerfen lediglich ein Autorbild. Die nicht zu beantwortende und damit wenig gewinnbringende Frage nach dem Realitätsgehalt biographischer Informationen wird im Folgenden deshalb nicht gestellt.13
Aussagen, die wie biographische Informationen als Referenzen auf die außertextuelle Welt gelesen werden können (aber nicht müssen), sind vielmehr in die andere Richtung zu denken. Die Kenntnis biographischer Fakten ist für ein Verständnis der zu untersuchenden Texte nicht notwendig, eröffnet dem Lesepublikum je nach Vorwissen und Lektürehaltung aber bestimmte Deutungsmöglichkeiten. Denn die Vergabe biographischer Informationen kann dazu eingesetzt werden, die im Text entworfene Welt und die in ihr agierenden Figuren zu inszenieren. Beispielsweise lässt sich nicht rekonstruieren, ob es Folgen für die historische Person Horaz hatte, dass in den Satiren oftmals auf die niedrige soziale Herkunft der Autor-persona verwiesen wird. Der Hinweis auf diese Herkunft wird jedoch wiederholt für die Inszenierung der Autor-persona ‚Horaz‘ genutzt.14
1.2.2(Selbst-)Inszenierung durch Rollen
Das Denken in und Übernehmen von Rollen war in der römischen Gesellschaft nicht nur zentraler Bestandteil des konkreten, häufig politischen Handelns1 und der rhetorischen Ausbildung und Praxis.2 Es ist unter dem Konzept der persona auch in philosophisch-theoretischen Schriften fassbar.3 Ausgehend von diesem antiken Denken und Handeln wurden die Begriffe der Rolle und der Inszenierung in die Theatersprache übernommen und haben über die Sozialwissenschaften Einzug in die Literaturwissenschaft gefunden und sich dort etabliert, um soziale Interaktions- und Kommunikationsprozesse zu beschreiben.4
Das in den Sozialwissenschaften beschriebene und von den Literaturwissenschaften übernommene Rollenkonzept beruht auf der Auffassung, dass sich jeder Mensch mit Erwartungen konfrontiert sieht, die von außen an ihn gestellt werden oder die er an sich selbst stellt, und in der Regel versucht, sich diesen Erwartungen gemäß zu verhalten.5 Auch Figuren literarischer Texte übernehmen eine oder mehrere Rollen oder bekommen eine oder mehrere Rollen zugeschrieben, an die sie selbst, andere Figuren und das Lesepublikum bestimmte Erwartungen stellen können.6 Sind Menschen oder literarische Figuren nicht im Stande, die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen, oder wollen sie diese nicht erfüllen, können Konflikte entstehen, die den ‚dramaturgischen Erfolg‘ ihres Agierens in einer bestimmten Rolle, also die Beeinflussung ihres ‚Publikums‘ in ihrem Sinne, erschweren können.7
Auch die Autor-personae ‚Horaz‘, ‚Naso‘ und ‚Seneca‘ nehmen Rollen ein oder bekommen Rollen zugeschrieben, deren Nichterfüllung zu Rollenkonflikten führen kann. Von ‚Horaz‘ als Verfasser von Verssatiren ist beispielsweise zu erwarten, dass er aus einem moralischen Standpunkt heraus Kritik am Verhalten anderer üben wird und dass er das Verhalten, das er bei anderen kritisiert, selbst nicht zeigt. Kann er diese Erwartungen nicht erfüllen, wirkt er in der Rolle des satirischen Kritikers unglaubwürdig.8 ‚Naso‘ wiederum übernimmt die Autorschaft früherer Ovidiana und präsentiert sich damit als Dichter, der auf dem Höhepunkt seiner literarischen Karriere aus Rom verbannt wurde.9 Deshalb ist für das Lesepublikum die Erwartung naheliegend, dass er weiterhin nach literarischer Anerkennung streben und sich insbesondere um eine Rückkehr nach Rom bemühen wird. ‚Seneca‘ stellt sich zu Beginn jeden Briefs mit dem Namen der persona anderer Werke des historischen Autors Seneca vor. In der Rolle des Briefschreibers erweckt er dadurch die Erwartung, dass er eine stoische Grundhaltung sowie einen kompetenten Umgang mit philosophischem Gedankengut zeigen und zumindest versuchen wird, sein Denken und Handeln an den eigenen Ratschlägen auszurichten. Kommt er diesen Erwartungen nicht nach, wirkt er als Verfasser philosophisch-paränetischer Briefe unglaubwürdig und nimmt seinen Paränesen einen Großteil ihrer Überzeugungskraft.10
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, wie eine Autor-persona durch die Darstellung ihrer Fallibilität inszeniert, das heißt ‚in Szene gesetzt‘, ‚gezeichnet‘ oder dargestellt wird. Als Inszenierung bezeichne ich die Zuschreibung beziehungsweise Übernahme von Rollen an beziehungsweise durch Figuren, die in einem Text agieren.11 Der Begriff der Inszenierung umfasst dabei auch immer einen in aktiver Art und Weise gestalteten Akt der (Rollen-)Präsentation.12 Dieser Akt erfolgt in literarischen Texten meistens nicht getrennt von der Rollenzuschreibung oder -übernahme, da die Zuschreibung, Übernahme und Präsentation von Rollen durch die sprachliche Gestaltung des Textes vollzogen und somit vom Lesepublikum ‚gleichzeitig‘ wahrgenommen werden.13
Rüdiger Ontrup und Christian Schicha verstehen Inszenieren als den Vorgang, durch den „Handlungen oder Zusammenhänge absichtsvoll mit einer bestimmten Wirkungsabsicht zur Erscheinung gebracht werden“, wobei „ein kalkuliertes Auswählen, Organisieren und Strukturieren von Darstellungsmitteln“ stattfindet, „das in besonderer Weise strategisch auf Publikumswirkung berechnet ist.“14 Jeder Inszenierung liegt somit eine Intention der inszenierenden Instanz zu Grunde, die in der Regel darauf abzielt, andere Menschen zu bestimmten Einstellungen oder Handlungen zu bewegen. Als ein maßgebliches Ziel jeder Inszenierung lässt sich somit Persuasion bestimmen.15
In literarischen Texten finden Inszenierungen auf unterschiedlichen Ebenen statt. Auf der höchsten Ebene schreibt der historische Autor den Figuren im Text Rollen zu beziehungsweise lässt die Figuren Rollen einnehmen, die er durch die sprachliche Ausformulierung des Textes modelliert.16 Auf auktorialer Ebene ist die Sprecher-Instanz für diese Zuschreibung und Modellierung von Rollen zuständig, auf figuraler Ebene können sie auch die Figuren eines Textes vornehmen.17 Die Zuschreibung beziehungsweise Übernahme sowie die Präsentation von Rollen kann dabei direkt (z. B. durch explizite Aussagen) oder indirekt (z. B. durch das Zeigen bestimmter Verhaltensweisen) erfolgen.
Beispielsweise inszeniert sich ‚Horaz‘ in den Satiren selbst, indem er sich als Sohn eines Freigelassenen und Freund des Maecenas bezeichnet (1,6,45–55) und dadurch die Rolle eines sozialen Aufsteigers übernimmt oder indem er über sein eigenes Verhalten in dieser Rolle schreibt (1,5; 1,6; 1,9; 2,6). Er inszeniert aber auch andere, indem er über die Erziehungs‑ und Bildungsbemühungen seines Vaters spricht (1,6,71–87) oder indem er das Verhalten des Maecenas bei ihrer ersten Begegnung (1,6,54–64) und nach Jahren der Freundschaft (2,6,40–46) schildert. Mit Damasippus und Davus treten in sat. 2,3 und 2,7 auch andere Figuren als inszenierende Instanzen in Erscheinung: Beide Figuren sind jeweils Hauptredner eines Dialogs mit ‚Horaz‘ und inszenieren durch ihre direkten Reden nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Gesprächspartner ‚Horaz‘. Da ‚Horaz‘ wiederum in beiden Dialogen auch als Autor-persona identifizierbar ist und somit als Verfasser der Satiren vorgestellt wird,18 ist das im Text beschriebene Sprechen und Handeln des Damasippus und Davus, mit dem sie sich auf ‚Horaz‘ beziehen, immer auch eine (Selbst‑)Inszenierung des ‚Horaz‘.
Durch die Grußformel am Beginn jedes Briefs schreibt ‚Seneca‘ sich selbst die Rolle des Absenders, dem Lucilius die Rolle des Adressaten der Epistulae morales zu. Durch Aussagen über sich und über Lucilius inszeniert er sowohl sich selbst als auch seinen Briefpartner. In der evozierten brieflichen Kommunikationssituation wird ‚Seneca‘ auch durch direkt oder indirekt zitierte Aussagen oder Nachfragen des Lucilius inszeniert.19 Da solche Aussagen aus der Feder ‚Senecas‘ stammen, ist auch das eine Form der Selbstinszenierung.20
Ovids Tristia und Epistulae ex Ponto sind gewissermaßen eine Mischform: Die Bücher trist. 1–3 enthalten mehrere Elegien, die nicht als Briefe markiert sind. Für sie gilt vor allem das zu den Satiren Gesagte, für die als Briefe gestalteten Tristia und für die Epistulae ex Ponto das zu Senecas Epistulae.21
2Die Fallibilität des Satirikers ‚Horaz‘
Vorbemerkungen
Bevor ich näher auf die Fragestellung und das Textcorpus dieses Kapitels eingehe, will ich kurz darlegen, wie ich Begriffe verwende, die sich vom lateinischen Wort satura ableiten lassen. Mit der kursiv gedruckten Bezeichnung Satiren beziehe ich mich auf eines oder auf beide Bücher der ursprünglich wohl unter dem Titel Sermones publizierten Gedichte des Horaz.1 Mit den recte gedruckten Begriffen Satire und Satiren beziehe ich mich auf ein einzelnes beziehungsweise auf mehrere dieser Gedichte.
Das Adjektiv satirisch verwende ich zur Bezeichnung einer Schreibart, die in unterschiedlichen Gattungen Anwendung finden kann.2 Als satirisch bezeichne ich einen Text, in dem eine Person aus ihrer Sicht gegebene Schwächen und Fehler anderer oder ihrer selbst herausstellt. Im Zuge dessen kann diese Person zu wohlwollendem Lachen über diese Schwächen und Fehler einladen, sie der Lächerlichkeit preisgeben und/oder kritisieren. Als satirische Kritik bezeichne ich also Äußerungen, mit denen eine Person das Verhalten ihrer selbst, primär jedoch anderer – oftmals durch überspitzt formulierten Spott – als falsch darstellt, als satirische Dichtung poetische Texte, in denen solche Kritik geübt wird. Zur Bezeichnung der Zugehörigkeit eines Textes zu einer Gruppe satirischer Dichtungen, die auf Grund verbindender Elemente als eine ‚Gattung‘ aufgefasst werden können, verwende ich den Begriff der römischen Verssatire.3
Mit der Bezeichnung Satiriker meine ich immer die im Text inszenierte Autor-persona ‚Horaz‘ in der Rolle als Darsteller, Beobachter und Kritiker seiner eigenen Person und anderer.4 Auch mit dem Ausdruck Verfasser satirischer Dichtung und vergleichbaren Formulierungen beziehe ich mich immer auf ‚Horaz‘, der auf textimmanenter Ebene der Satiren als deren Verfasser dargestellt wird.5
2.1Fragestellung und Textcorpus
In den Werken des Quintus Horatius Flaccus treten häufig Ich-Sprecher auf, die als Autor‑persona konfiguriert sind.1 Die starke Präsenz dieser Autor-persona in den Satiren lässt sich zum einen damit erklären, dass Spott über und Kritik an falschem Verhalten als ein zentraler Inhalt der römischen Verssatire in der Regel in Form von Monologen und aus der Perspektive einer ersten Person heraus geäußert werden.2 Zum anderen ist satirisches Schreiben in der literarischen Tradition, in die sich die Satiren stellen beziehungsweise die sie konstruieren, durch die häufige Vergabe biographischer Informationen geprägt.3 Die Autor-persona der Satiren, im Folgenden auch als ‚Horaz‘ bezeichnet, nennt insbesondere im ersten Buch mehr solcher Informationen als in jedem anderen Werk des historischen Autors.4
‚Horaz‘ geht in der Rolle des Beobachters und Kritikers menschlichen Verhaltens nicht nur auf andere, sondern immer wieder auch auf seine eigene Person ein und stellt dabei wiederholt auch eigene Schwächen, eigenes Scheitern und eigenes Fehlverhalten ins Zentrum der Satiren. In 1,3, 1,4 und 1,6 verwendet er den unbestimmt bleibenden Begriff vitia, um diese eigenen Schwächen und Fehler zu bezeichnen.5 In den dialogischen Satiren 2,3 und 2,7 hingegen lässt er sich von anderen Figuren, die als seine Dialogpartner fungieren, unter anderem Jähzorn, übertriebenen Ehrgeiz, sexuelle Ausschweifung, übermäßigen Alkoholkonsum, Inkonsistenz und Doppelmoral und damit genau das Fehlverhalten vorwerfen, das er in vorausgehenden Satiren selbst als falsch kritisiert hatte. Mit seiner niedrigen sozialen Herkunft spricht ‚Horaz‘ in 1,6 über eine gänzlich andere Form von Fallibilität im Sinne einer Eigenschaft, die nicht er selbst, sondern andere als Defizit ansehen. Auch in 2,6 kommt er auf seine soziale Stellung zu sprechen, indem er seinen gesellschaftlichen Aufstieg als etwas beschreibt, das ihn am Verfassen satirischer Dichtung scheitern lässt.
Die Forschung hat mehrfach erwähnt, dass ‚Horaz‘ das Eingeständnis seiner Fallibilität als Strategie einsetzt, um sich in eine Position zu versetzen, aus der heraus er Kritik an anderen üben kann.6 Denn man würde einer Autor-persona, die sich als perfekt geriert, nur wenig Sympathie und noch weniger Glauben schenken, so dass ihre Aussagen und insbesondere ihre Kritik an anderen ins Leere laufen würden. Die englischsprachige Forschung verwendet zur Bezeichnung dieser Strategie des Öfteren den Begriff der ‚Selbst-Herabsetzung‘ („self‑deprecation“),7 geht in der Regel davon aus, dass ‚Horaz‘ diese ‚Selbst-Herabsetzung‘ einsetzt, um zum Lachen über sich selbst aufzufordern, und bezeichnet das häufig mit Begriffen wie „self-mockery“, „self-humour“ oder „self-irony“.8
Der Ansatz, ‚Horaz‘ als selbstironischen Satiriker zu betrachten, geht auf William S. Anderson zurück. Er bezeichnet die Autor-persona insbesondere des ersten Buchs der Satiren als „Roman Socrates“:9 ‚Horaz‘ wende Ironie im Stile des Sokrates an, um Menschen zur Selbstprüfung zu bewegen, ohne sie öffentlich anzuprangern oder auf unfaire Art und Weise lächerlich zu machen; dabei ignoriere er eigene Fehler nicht, sondern hebe sie selbstironisch hervor.10 Die Ausführungen von Anderson und in seiner Nachfolge stehender Forscherinnen und Forscher mögen in Bezug auf die Haltung des ‚Horaz‘ gegenüber anderen zutreffen. In Bezug auf ‚Horaz‘ selbst können sie jedoch oft nicht deutlich machen, worin diese Selbstironie genau besteht und welche Schwächen und Fehler ‚Horaz‘ selbstironisch eingesteht.11
Kirk Freudenburg setzt einen anderen Schwerpunkt als Anderson. Er versteht die Inszenierung der Autor-persona insbesondere in den Satiren 1,1, 1,2, 1,3 und 1,4 als eine Form von „self-parody“, durch die sich ‚Horaz‘ selbst der Lächerlichkeit preisgebe.12 Nach Freudenburgs zentraler These erinnere ‚Horaz‘ in vielfacher Hinsicht an lächerlich wirkende Typen der Komödie und trete vor allem in den ersten drei Satiren als ein philosophisch inkompetenter Straßenprediger („street preacher“) auf, der dazu auffordere, über ihn zu lachen, da er den Dogmatismus philosophischer Denkweisen nicht korrekt wiedergebe und sich dadurch als „inept moralizer“ offenbare, so dass er auch als Kritiker anderer nicht ernst genommen werden könne.13
Dem stehen jüngere Arbeiten gegenüber, die nachweisen, dass ‚Horaz‘ philosophische Themen ernsthaft und fundiert behandelt.14 Hinzu kommt, dass sich ‚Horaz‘ im Kontext des vielzitierten programmatischen Diktums ridentem dicere verum eine ernst zu nehmende Intention zuschreibt (1,1,23–27): Zwar weist die Häufung entsprechenden Vokabulars in dieser Passage der Komik eine große Bedeutung zu (iocularia; zwei Mal ridens; ludus). Sie wird aber primär als didaktisch wirksame Methode vorgestellt, gewissermaßen als süßes Lockmittel (crustula), hinter dem (amoto […] ludo) das Anliegen stehe, wie Lehrer (blandi doctores) Lernprozesse anzustoßen ([sc. pueri] velint ut discere) im Hinblick auf ernste Themen (seria).15
Im Zentrum des vorliegenden Kapitels steht deshalb nicht die Frage, wie ‚Horaz‘ das im Englischen häufig als „self-deprecation“ bezeichnete Eingeständnis eigener Schwäche, eigenen Scheiterns und eigenen Fehlverhaltens nutzt, um zum Lachen über sich selbst einzuladen, sondern wie er dieses Eingeständnis einsetzt, um sich als kompetenter Satiriker zu inszenieren,16 wie er sich durch die Behauptung, seine Fallibilität anzuerkennen und sich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, als aufrichtige und selbstreflektierte Person inszeniert,17 und wie er durch die Darstellung unterschiedlicher Ausprägungen seiner Fallibilität die Kompetenz beansprucht, eigenes und fremdes (Fehl-)Verhalten beobachten und beurteilen zu können.18
2.2Die satirische Kompetenz des ‚Horaz‘ – Satiren 1
Das erste Buch der Satiren setzt sich mit Ausnahme von 1,8 formal aus Monologen der Autor‑persona zusammen,1 so dass ‚Horaz‘ alle Aussagen über seine Person entweder selbst tätigt oder anderen Sprecherfiguren in den Mund legt. Geht es um die Schwäche, das Scheitern und das Fehlverhalten des ‚Horaz‘, dann spricht er also selbst über seine Fallibilität oder sagt, dass sie ihm vorgeworfen worden sei oder werde. Dabei stellt er Aussagen über seine Fallibilität immer wieder in engen Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Verfasser satirischer Dichtung. Im Folgenden soll deshalb untersucht werden, wie ‚Horaz‘ solche Aussagen einsetzt, um seine Rolle als Satiriker zu beschreiben und um die Fragen zu beantworten, welches und wessen Verhalten er in seinen Satiren herausstellt, wieso er dies tut und was ihn dazu qualifiziert.
‚Horaz‘ selbst wirft diese Fragen erstmals in 1,3 auf und kommt auch in 1,4 und 1,6 auf sie zu sprechen. In diesen drei Satiren behauptet er ausdrücklich nicht, das Ideal eines Menschen ohne Fehl und Tadel zu erfüllen oder dieses Ideal erfüllen zu müssen, um als satirischer Kritiker anderer auftreten zu können. Um diese Rolle glaubwürdig übernehmen zu können, hält es ‚Horaz‘ vielmehr für entscheidend, dass man nur unbedeutende Schwächen und Fehler hat, um deren Beseitigung man sich bemüht und die von positiv konnotierten Qualitäten und Handlungen aufgewogen werden. Vor diesem Hintergrund will ich fragen, wie sich ‚Horaz‘ in 1,3, 1,4 und 1,6 als Satiriker inszeniert, der nur mit harmlosen Schwächen und Fehlern behaftet ist und der dazu fähig und bereit ist, sich kritisch und konstruktiv mit seiner eigenen Fallibilität auseinanderzusetzen, und sie sogar als Impetus und Ausgangspunkt seiner Arbeit an den Satiren zu nutzen weiß. Des Weiteren will ich zeigen, wie ‚Horaz‘ auch die Erwähnung seiner im zeitgenössischen Kontext als minderwertig zu beurteilenden sozialen Herkunft einsetzt, um sich als kompetenter Satiriker zu inszenieren.
2.2.1Die Fähigkeit des ‚Horaz‘ zur Unterscheidung schwerer und leichter Schwächen und Fehler – sat. 1,3
Der programmatische Charakter der Satire macht 1,3 zum Bindeglied zwischen 1,1 und 1,2 auf der einen und 1,4 auf der anderen Seite.1 Zum einen rechtfertigt ‚Horaz‘ in 1,3 rückblickend sein souveränes Auftreten als Kritiker des Verhaltens anderer in den beiden vorausgehenden Satiren. Zum anderen wirft er selbst die Frage auf, was ihn dazu befähigt, als ein solcher Kritiker aufzutreten, und greift damit auf die folgende programmatische Satire 1,4 voraus.
Die Satire 1,3 hat drei Hauptthemen: (1) die Forderung nach Maßhalten, insbesondere in der Reaktion auf die Schwächen und Fehler anderer, da diese (2) unterschiedliche Schweregrade aufwiesen, weshalb man (3) insbesondere gegenüber Freunden eine wohlwollende Haltung einnehmen müsse.2 Die einzelnen Sinnabschnitte der Satire greifen meist ineinander, so dass deren exakte Abgrenzung nicht möglich ist. Ich strebe im Folgenden keine vollständige Analyse des Texts an, sondern behandle nur ausgewählte und für die Inszenierung der Autor‑persona relevante Passagen.3
2.2.1.1Die Rechtfertigung des ‚Horaz‘ für sein Auftreten als satirischer Kritiker
Die Satire beginnt mit einer generalisierenden Kritik am inkonsistenten Verhalten von Sängern (1–3), die ab V. 3 auf einen Tigellius verengt wird, dessen Inkonsistenz sich nicht nur im Singen, sondern auch in anderen Lebensbereichen beobachten lasse (3–19).4 Durch die anfängliche Verallgemeinerung (1: Omnibus hoc vitium est cantoribus) erweckt ‚Horaz‘ dabei wie schon in 1,1 und 1,2 den Eindruck, ohne Differenzierung alles und jeden zum Ziel von Spott und Kritik zu machen. Mit der Schilderung extremen, das heißt immer auch maßlosen Verhaltens führt er die beiden vorausgehenden Satiren in 1,3 auch inhaltlich fort.5 In 1,1 tadelt er die Unzufriedenheit der Menschen, die aus dem extremen und nutzlosen Streben nach materiellen Gütern resultiere.6 Der Beginn von 1,2 rekurriert mit der Erwähnung von Verschwendung und Habgier auf die erste Satire und greift dann ein neues Thema auf, das in 1,1 bereits mitinbegriffen ist: das Unvermögen und die Weigerung der Menschen, ein vernünftiges Mittelmaß einzuhalten.7 Auch strukturell knüpft 1,3 an die beiden vorausgehenden Gedichte an: ‚Horaz‘ greift mit der Widersprüchlichkeit des Tigellius zunächst auf die Thematik der goldenen Mitte und damit auf 1,2 zurück, um daraufhin mit der Reaktion auf das Fehlverhalten anderer einen neuen Gegenstand zu behandeln.8 Auf Grund dieser Bezüge kann 1,3 als rückblickende Rechtfertigung der Haltung des ‚Horaz‘ in 1,1 und 1,2 gelesen werden.9
Nach dem anfänglichen Spott über Sänger im Allgemeinen und Tigellius im Speziellen antizipiert ‚Horaz‘ eine mögliche Reaktion anderer, indem er sich von einem Interlocutor wie folgt unterbrechen lässt (19–20):
Nunc aliquis dicat mihi ‚quid tu?
20
nullane habes vitia?‘ immo alia et fortasse minora.10
Jetzt könnte einer zu mir sagen: „Was ist mit dir? Hast du gar keine Fehler?“ Natürlich, aber andere und vielleicht kleinere.
Die hier formulierte Frage kann als Ausdruck der Auffassung verstanden werden, man dürfe die Schwächen und Fehler (20: vitia) anderer nur kritisieren, wenn man selbst keine habe. Indem ‚Horaz‘ diese Frage einem Interlocutor in den Mund legt (19: aliquisdicat), stellt er selbst zur Diskussion, was ihn dazu befähigt, in 1,1, 1,2 und insbesondere hier am Beginn von 1,3 die Rolle des Kritikers anderer einzunehmen. Seine Antwort liefert eine knappe Beschreibung, wie er sich in dieser Rolle sieht: Er gesteht zwar offen ein, fallibel zu sein (20: immo), doch würden sich seine Schwächen und Fehler sowohl in ihrer Qualität als auch in ihrer Größe von denjenigen unterscheiden, die er bei anderen kritisiere (20: alia et fortasse minora). ‚Horaz‘ unterscheidet also Fehler, die – wie im vorausgehend beschriebenen Falle des Tigellius – als schwerwiegend getadelt werden müssen, und solche, die – wie in seinem Falle – toleriert werden können.11 Allerdings deutet er durch die Verwendung der einschränkenden Partikel fortasse auch Zweifel an, ob seine Fehler tatsächlich geringer als die des Tigellius sind,12 und verdeutlicht so, über die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion zu verfügen, die in der folgenden Programmsatire 1,4 als entscheidend für einen Satiriker vorgeführt wird.13
Das Eingeständnis des ‚Horaz‘ bleibt jedoch vage, was des Öfteren als Versuch gedeutet wurde, über schwerwiegende Fehler hinwegzutäuschen.14 In der Forschung wurde seine direkte Rede in V. 20 (immo alia et fortasse minora) sogar mit dem Verhalten eines Maenius gleichgesetzt, das ‚Horaz‘ selbst in den unmittelbar folgenden Versen scharf kritisiert: Die Passage der V. 19–24 führe vor Augen, dass er nicht besser als Maenius handle, also Doppelmoral zeige (21–24):15
Maenius absentem Novium cum carperet, ‚heus tu‘
quidam ait, ‚ignoras te an ut ignotum dare nobis
verba putas?‘ ‚egomet mi ignosco‘ Maenius inquit.
stultus et improbus hic amor16est dignusque notari.
Als Maenius den abwesenden Novius scharf kritisierte, sagte einer: „He du, kennst du dich selbst nicht oder glaubst du, dass du uns täuschen kannst, als ob wir dich nicht kennen würden?“ „Ich selbst verzeihe mir“ sagte Maenius.17 Dumm und unverschämt ist diese Selbstgefälligkeit und sie verdient, gerügt zu werden.
In der Tat gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Maenius und ‚Horaz‘. Maenius habe, so die Behauptung des ‚Horaz‘, kein gutes Haar an einem Novius gelassen, der sich als Abwesender nicht habe verteidigen können (21). ‚Horaz‘ selbst wiederum verspottet am Beginn von 1,3 mit dem toten Tigellius ebenfalls jemanden, der sich nicht wehren kann. Zudem werden Maenius und ‚Horaz‘ nach ihrer Kritik an anderen mit der Frage nach eigenen Schwächen und Fehlern konfrontiert (19–20, 22–23).
Doch im Gegensatz zu Maenius, der sich nicht mit eigenen Fehlern auseinandersetzen kann oder will, zeigt sich ‚Horaz‘ darum bemüht, seine vitia aufrichtig und selbstreflektiert einzugestehen.18 Die erste an Maenius gerichtete Teilfrage (22: ignoras te?) lässt sich verstehen als „Kennst du dich selbst und deine Fehler nicht?“. Die zweite Teilfrage (22–23: ut ignotum dare nobis / verba putas?) suggeriert, dass Maenius dem Fragenden und anderen mitnichten unbekannt ist. Obwohl andere ihn mit ihren Fragen gezielt darauf hinweisen, dass sie um seine Fehler wissen, sieht Maenius vollkommen über sie hinweg (23: egomet mi ignosco). Genau damit unterscheidet er sich grundlegend von ‚Horaz‘, der sich deutlich von dieser „dummen, unverschämten und [satirische] Rüge verdienenden Selbstgefälligkeit“ abgrenzt (24: stultus et improbus hic amor est dignusque notari) und sich gegenteiliges Verhalten zuschreibt. Ein weiterer, für die Inszenierung des ‚Horaz‘ jedoch wichtiger Unterschied wird am Ende der hier untersuchten Satire deutlich: Maenius ‚verzeiht sich selbst‘ (23), dem ‚Horaz‘ hingegen, so behauptet er zumindest, seine Freunde (139–140: mihi dulces / ignoscent, si quid peccaro stultus, amici).19
Der Umstand, dass ‚Horaz‘ hier nicht genauer auf eigene Fehler eingeht, ist deshalb nicht als Anzeichen dafür zu verstehen, dass er auf kritische Aussagen über seine Person so reagiert wie Maenius. Vielmehr lässt er sich damit erklären, dass jede Spezifizierung eigener Schwächen die satirische Kompetenz des ‚Horaz‘ untergraben würde, da er Verhalten, das er selbst zeigt, kaum bei anderen kritisieren könnte. Durch die inhaltlich sehr eingeschränkte Informationsvergabe kann ‚Horaz‘ das Lesepublikum zudem dazu anhalten, nach weiteren Fehlern zu suchen und deren Bewertung als unbedeutend (20: alia et minora) nach der Lektüre von 1,3 zu bestätigen.20
2.2.1.2Der Ausgleich schlechter Eigenschaften durch gute Eigenschaften
Die Kritik des ‚Horaz‘ an Maenius endet mit einer direkten Du-Ansprache: Maenius sehe mutwillig über eigene Unzulänglichkeiten hinweg, betrachte die Verfehlungen anderer aber mit sprichwörtlichen Adleraugen (25–26).21 Der angeführte Grund, weshalb dieses Verhalten „dumm und unverschämt ist und verdient, gerügt zu werden“ (24), leitet mit der Beurteilung anderer auf ein neues Thema über: Wer zu sehr nach Fehlern anderer sucht, muss damit rechnen, dass auch andere wiederum das Gleiche tun (26–27). ‚Horaz‘ fordert im Folgenden dazu auf, genau das nicht zu tun und beschreibt eine unbestimmte dritte Person, um zu verdeutlichen, dass harmlose schlechte Eigenschaften durch gute Eigenschaften ausgeglichen werden können (29–34):
iracundior est paulo, minus aptus acutis
30
naribus horum hominum; rideri possit eo quod
rusticius tonso toga defluit22 et male laxus
in pede calceus haeret: at est bonus, ut melior vir
non alius quisquam, at tibi amicus, at ingenium ingens
inculto latet hoc sub corpore.
Einer ist ein wenig zu aufbrausend, zu wenig angepasst an die feinen Nasen der Menschen.23 Man könnte ihn dafür auslachen, dass er einen bäurischen Haarschnitt hat, dass seine Toga schlampig herabhängt und dass der weite Schuh schlecht am Fuß sitzt: Aber er ist ein guter Mensch, so dass kein anderer Mann besser ist, er ist dir ein Freund und ein großartig geartetes Wesen24 verbirgt sich unter dieser rauen Oberfläche.
Den insgesamt fünf Eigenschaften, die hier als schlecht präsentiert werden, sind durch die dreimal verwendete kontrastive Konjunktion at nur drei positiv konnotierte Qualitäten gegenübergestellt. Diese sind somit wesentlich schwerer zu gewichten: Ein aufbrausendes Wesen werde durch einen Charakterzug aufgewogen, der im Text mit bonus (32) bezeichnet wird und der als moralische Integrität zu verstehen ist. Über Nonkonformismus könne man auf Grund enger Freundschaft hinwegsehen. Nachlässiges Äußeres, das sich in einem schlechten Haarschnitt, unordentlicher Kleidung und zu großen Schuhen manifestiere, werde durch ein „großartig geartetes Wesen“ (33: ingenium ingens) ausgeglichen.
Entgegen der communis opinio lese ich diese Passage nicht als Selbstbeschreibung des ‚Horaz‘, verstehe sie aber dennoch als wichtigen Bestandteil seiner Strategie, sich als kompetenter Satiriker zu inszenieren.25 Anders als in V. 20 spricht ‚Horaz‘ hier nicht über sich selbst, sondern über eine unbestimmte dritte Person. Dadurch fordert er das Lesepublikum implizit dazu auf, sich mit dieser Person zu identifizieren und deshalb der Argumentation, schlechte Eigenschaften ließen sich durch gute ausgleichen, zuzustimmen, um sie auch für sich selbst in Anspruch nehmen zu können,26 insbesondere da die Charakterzüge und Äußerlichkeiten, die hier als negativ vorgeführt werden, kaum als allzu gravierend angesehen werden können.27 Auf diese Weise wird die in V. 20 getroffene Unterscheidung schwerwiegender und unbedeutender Fehler gestützt und das Lesepublikum dazu aufgefordert, ‚Horaz’‘ Fehler, von denen man in V. 20 keine konkreten, im weiteren Verlauf jedoch genauere Informationen erhält, als geringfügig anzusehen und deshalb zu entschuldigen.
2.2.1.3Fehlverhalten im engen Umfeld des ‚Horaz‘
Dass es möglich ist, unbedeutende Fehler zu tolerieren, verdeutlicht ‚Horaz‘ im Folgenden anhand der Beispiele eines Liebhabers und eines Vaters, die über körperliche Mängel ihrer Geliebten beziehungsweise ihres Sohnes nicht nur hinwegsehen, sondern diese sogar als Vorzüge betrachten (38–48).28 Diese euphemistische Beurteilung solle man auch auf kleinere charakterliche Mängel anderer übertragen, was insbesondere bereits bestehende Freundschaften vertiefe (49–54).29 Doch rechnet sich ‚Horaz‘ im Folgenden selbst einer Gruppe zu, die das genaue Gegenteil dieser Forderung praktiziert (55–66). Zwar bestimmt er diese Gruppe nicht genauer. Es liegt jedoch nahe, sie als sein näheres Umfeld zu identifizieren.30 Wie in V. 55–56 formuliert, „gibt“ diese Gruppe positiv konnotierten Charakterzügen und daraus resultierenden Handlungen eine „böse Deutung“ (at nos virtutes ipsas invertimus atque / sincerum furimus vas incrustare).31 Sie macht auszeichnende Eigenschaften zum Ausgangspunkt spöttischer Spitznamen, indem sie beispielsweise moralische Integrität und Bescheidenheit als Einfalt oder Dummheit bezeichnet (56–58) oder Vorsicht und Voraussicht als Heuchelei und Hinterlist (56–62).32 Auch die in V. 52 als positiv bezeichnete Eigenschaft der Direktheit (simplicitas) deute die Gruppe als Mangel an Taktgefühl (63–66).33
Durch die kontrastive Konjunktion at (55) stellt ‚Horaz‘ dieses Verhalten demjenigen gegenüber, das er unmittelbar zuvor als wünschenswert bezeichnet hat (29–54), und markiert so Handlungen seines Umfelds und seiner selbst als falsch. Es bleibt letzten Endes offen, ob er damit diejenigen Fehler beschreibt, die er in V. 20 minora nennt. Fest steht jedoch, dass er falsches Verhalten zugibt, indem er hier darüber spricht, worin es genau besteht – freilich auch, um zu betonen, dass es harmlos ist. Denn das Verleihen spöttischer Spitznamen ist als gegenseitige Neckerei einander nahestehender Menschen, nicht als scharfe Kritik zu verstehen, zumal ‚Horaz‘ am Ende der Satire beteuert, dass die Mitglieder des hier erwähnten Freundeskreises gerne dazu bereit seien, sich harmlose Vergehen gegenseitig zu verzeihen (139–141).
‚Horaz‘ selbst nennt die Forderung, das Verhalten anderer stets wohlwollend zu beurteilen, eine lex iniqua (67), da jeder Mensch fallibel sei (68: nam vitiis nemo sine nascitur). Er fordert dadurch nicht nur dazu auf, seine eigenen, freilich als harmlos bezeichneten Schwächen und Fehler mit seinen guten Eigenschaften aufzuwiegen (69–71: amicus dulcis, ut aequum est, / cum mea compensat vitiis bona, pluribus hisce, / si modo plura mihi bona sunt, inclinet). Er exkulpiert sich auch selbst, charakterisiert Fallibilität als condicio humana und spricht sich so erneut gegen die Auffassung aus, er müsse als Satiriker das Ideal der Fehlerfreiheit erfüllen. Doch entschuldigt er falsches Verhalten dabei keineswegs pauschal, sondern differenziert durch die Verwendung von Superlativen erneut unterschiedliche Schweregrade (68–69: optimus ille est / qui minimis [sc. vitiis] urgetur).34
Da seine Inszenierung als kompetenter Satiriker in 1,3 maßgeblich auf dieser Differenzierung beruht, bemüht sich ‚Horaz‘ am Ende der Satire erneut um den Nachweis, dass es unterschiedliche Schweregrade von Fehlverhalten gibt. Dazu führt er ab V. 76 stark überzeichnete Beispiele aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben an, mit denen er die stoische Auffassung, dass alle Vergehen als gleichwertig anzusehen seien, widerlegen und dazu auffordern will, auf unterschiedliches Fehlverhalten jeweils unterschiedlich zu reagieren.35 Er stellt seine Aussagen dabei als allgemeingültig dar, indem er ausführlich darauf eingeht, dass die von ihm getroffene Unterscheidung der Vernunft (ratio), dem ‚gesunden Menschenverstand‘ (sensus), der allgemeinen Moral (mores) und dem Nutzen (utilitas) entsprächen (76–98)36 und unabdingbare Voraussetzung für das soziale Zusammenleben einer funktionierenden Gesellschaft seien (99–124).37
‚Horaz‘ nutzt die Erwähnung der Stoa auch, um ein Kontrastbild zu seiner eigenen Person zu schaffen: Überspitzt schildert er, wie ein Stoiker als Folge seines Rigorismus soziale Ausgrenzung erfährt (133–139), und stellt der Ablehnung und Ausgrenzung dieses Stoikers die Situation innerhalb seines eigenen Umfelds gegenüber: Wie in V. 20 behauptet und in V. 55–66 vorgeführt, verhalte er sich nur in geringem Ausmaß falsch. Seine Freunde würden das als Folge von Leichtsinn erkennen und deshalb verzeihen (139–140: et mihi dulces / ignoscent, si quid peccaro stultus, amici).38 Anders als der am Beginn der Satire erwähnte Maenius (21–24) verzeihe er sich also nicht selbst, sondern andere täten dies. Er wiederum sei fähig und willens, im Gegenzug auch anderen zu verzeihen (141: inque vicem illorum patiar delicta libenter). Wäre dem nicht so, würde er also gravierendes Fehlverhalten zeigen und zugleich nicht über unbedeutendes Fehlverhalten anderer hinwegsehen, wäre er isoliert wie der ab V. 124 karikierte Stoiker. So aber kann er sich als Mitglied einer funktionierenden sozialen Gruppe präsentieren.
Zwar fordert ‚Horaz‘ in der hier besprochenen Satire 1,3 Toleranz und wohlwollende Beurteilung anderer nur im Kontext von Freundschaften ein und behauptet lediglich, die Bereitschaft zu verzeihen im eigenen Umfeld und unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit in die Tat umzusetzen. Das schränkt aber nur seine Bereitschaft zu verzeihen auf Menschen, die ihm nahe stehen, ein. Seine Fähigkeit zur Unterscheidung schwerer und leichter Fehler wird dadurch nicht vermindert. Im Gegensatz zum Rigorismus der Stoa, wie er ihn kritisiert, nimmt ‚Horaz‘ also eine moderate Haltung ein und stellt sich dadurch nicht als strenger Moralist dar, der unerfüllbare Forderungen erhebt. Vielmehr führt er seine Auffassung vor Augen, dass es unterschiedliche Schweregrade von Schwächen und Fehlern gibt, und inszeniert sich als Mensch, der diese Schweregrade differenzieren und deshalb tatsächliches Fehlverhalten erkennen kann und der deshalb weder Schwächen und Fehler anderer übertreibt oder ungerechtfertigt kritisiert, noch eigene ignoriert.39 Die Satire 1,3 stärkt ‚Horaz‘ somit nicht nur in der Rolle des satirischen Kritikers, die er schon in 1,1 und 1,2 eingenommen hat. Sie dient auch der Verteidigung gegen die in der folgenden Satire 1,4 vorgebrachten Vorwürfe, er erfreue sich daran, andere zu verletzen (1,4,34–38, 78–79).
2.2.2Die Auseinandersetzung des ‚Horaz‘ mit eigenen Schwächen und Fehlern – sat. 1,4
Die am Beginn von 1,3 aufgeworfene Frage, wer satirische Kritik üben könne, wird in 1,4 aufgegriffen. Die Satire gliedert sich in zwei größere Abschnitte (1–102, 103–143). Die folgende Analyse beschränkt sich auf den zweiten Teil, in dem ‚Horaz‘ eigene Schwächen und Fehler zugibt, jedoch erneut als harmlos bezeichnet, und soll zeigen, wie er seine satirische Kompetenz ausdrücklich auf die konstruktive Auseinandersetzung mit diesen Schwächen und Fehlern zurückführt. Im ersten Teil spricht ‚Horaz‘ über literaturtheoretische Aspekte seiner Dichtung, indem er zunächst eine von der Alten Komödie ausgehende und von Lucilius aufgegriffene Tradition satirischen Schreibens konstruiert (1–7), sich dann deutlich von der Vielschreiberei des Lucilius abgrenzt (7–21) und schließlich der Frage nachgeht, was einen poetischen Text ausmacht (38–62).1 Insbesondere verteidigt er aber sich selbst und seine Dichtung gegen Vorwürfe eines Interlocutors (23–38, 64–103):2 Anders als von diesem Interlocutor behauptet wird, stelle ‚Horaz‘ das Verhalten anderer in seiner Dichtung weder als falsch und lächerlich dar, um schallendes Gelächter zu erregen (34–38, 81–85), noch um sich daran zu erfreuen, Unschuldige böswillig und absichtlich zu verletzen (78–103). Vielmehr erklärt ‚Horaz‘, dass alle Menschen mit Schwächen und Fehlern ganz unterschiedlicher Art behaftet seien und er nur Menschen tadle, die das verdient hätten (22–33). Als Verteidigung gegen die Vorwürfe des Interlocutors lässt sich auch ‚Horaz’‘ Aussage verstehen, nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur auf eindringliche Aufforderung hin und nur vor seinen Freunden zu rezitieren.3 Denn würde er lediglich dichten, um Lachen zu erregen oder um seiner Boshaftigkeit freien Lauf zu lassen, würde diese Motivation ins Leere laufen angesichts des Umstands, dass er seine Dichtung nur vor sehr kleinem Publikum und nur „unter Zwang“ (73: coactus) vortrage.
2.2.2.1Das Verhältnis zwischen Erziehung und satirischer Kritik des ‚Horaz‘
Der Aspekt der Verteidigung verbindet die beiden Hauptteile der Satire, da der zweite Teil durch konditionale Formulierungen und die Bitte um Nachsicht ebenfalls in apologetischem Ton beginnt (103–108):
Liberius si
dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi iuris
105
cum venia dabis. insuevit pater optimus hoc me,
ut fugerem exemplis vitiorum quaeque notando.
cum me hortaretur parce, frugaliter atque
viverem uti contentus eo quod mi ipse parasset,
[sc. aiebat …]4
Wenn ich etwas zu freimütig, wenn ich zufällig etwas zu spöttisch gesagt habe, wirst du mir das Recht dazu nachsichtig zugestehen. Daran hat mich mein hervorragender Vater gewöhnt, indem er jedes falsche Verhalten mit Beispielen rügte, damit ich es vermeide. Wenn er mich aufforderte, sparsam, wirtschaftlich und mit dem zufrieden zu leben, was er selbst mir verschafft hatte, [sc. sagte er …]
Die Grundsätze der Erziehung, wie sie hier und im Folgenden geschildert werden, und die Grundsätze der Art und Weise, wie ‚Horaz‘ in den Satiren die Schwächen und Fehler anderer herausstellt, haben eine Reihe an Gemeinsamkeiten.5 Zu nennen sind zunächst der freimütige und scherzhaft‑spöttische Ton (103: liberius; 104: iocosius) sowie die schon von der Alten Komödie und Lucilius ausgeübte Rüge falschen Verhaltens (5: multa cum libertate notabant; 106: notando; vgl. auch 1,3,24: dignusque notari). Diese Rüge erfolgt sowohl beim Vater als auch beim Sohn meist nicht nominatim, sondern primär anhand beispielhafter Typen (106: exemplis; 126–128).6 Beide fordern zu einer genügsamen Lebensführung auf (107–108: parce, frugaliteratque / viverem uti contentus),7 oftmals in paränetischer Form (107: hortaretur).8 Beide sind um die Vermittlung praktischer Ethik bemüht, die auf traditionellen Werten beruht, und verzichten auf ausufernde theoretische Begründungen (115–117: sapiens, vitatu quidque petitu / sit melius, causas reddet tibi: mi satis est si / traditum ab antiquis morem servare).9 Wie in 1,4,107–115 geschildert, spricht der Vater über stadtrömische Laster, die auch ‚Horaz‘ aufs Korn nimmt, beispielsweise verschwenderischen Lebensstil und Habgier (1,1) oder sexuelle Maßlosigkeit (1,2).10 Häufige Beschreibungen akustischer und optischer Wahrnehmung sowie der oft deiktische Charakter dieser Beschreibungen sind der väterlichen Erziehung und den Satiren ebenfalls gemeinsam (109: nonne vides).11 Die Verwendung zahlreicher Verba dicendi stellt die Erziehung als eine dezidiert mündliche dar (notare; hortari; deterrere; aio; formare dictis; iubere; obicere; vetare), was an die Gestaltung der Satiren als sermo erinnert.12 ‚Horaz‘ führt dadurch nicht nur die inhaltliche Ausrichtung seiner Dichtung, sondern auch deren sprachliche Gestaltung und das von ihm verwendete pädagogische Vokabular auf die Erziehung durch seinen Vater zurück, und kann so seine vom zeitgenössischen Lesepublikum als Makel angesehene soziale Herkunft als etwas Positives darstellen.13
2.2.2.2Die Selbstkritik des ‚Horaz‘ als Ausgangspunkt seiner Kritik an anderen
‚Horaz‘ macht die Erziehung durch seinen Vater auch unmittelbar dafür verantwortlich, frei von „Verderben bringenden Schwächen und Fehlern“ zu sein, führt also auch seine moralische Integrität auf seinen Vater zurück (129–131: Ex hoc ego sanus ab illis / perniciem quaecumque ferunt, mediocribus et quis / ignoscas vitiis teneor). Er behauptet im Folgenden, die im Vorausgehenden ausführlich beschriebene Erziehungsmethode seines Vaters übernommen zu haben, um sich selbstkritisch zu hinterfragen und mit eigenen Schwächen und Fehlern auseinanderzusetzen (131–140).14 Dabei ersetzt er die mündlichen Unterweisungen des Vaters durch Selbstgespräche (137–138: haec ego mecum / compressis agito labris), in denen er den dozierenden Part übernimmt und sich exemplarisch auf falsche Handlungen anderer aufmerksam macht (134–138).15 Als Ziel seiner Beobachtungen und Selbstgespräche, die er im privaten und öffentlichen Raum anzustellen behauptet (133: lectulus; 134: porticus), bestimmt ‚Horaz‘ nicht die Kritik an anderen, sondern Selbstkritik. Denn wie auf ihn bezogene Verben, Partizipien und Pronomina in V. 135–137 deutlich machen (hoc faciens vivam; occurram; ego […] imprudens […] faciam), beschreibt er hier vor allem das kritische Hinterfragen seines eigenen Verhaltens. Damit kann er sich nicht nur erneut gegen die Vorwürfe verteidigen, die er in der ersten Hälfte der Satire anspricht. Er kann vor allem betonen, durch die Beobachtung und Beschreibung des Verhaltens anderer in erster Linie sich selbst auf bessere Handlungsalternativen hinweisen zu wollen. ‚Horaz‘ gibt seine Gedichte dadurch als Texte aus, durch die er sich primär selbst moralisch verbessern und auf bessere Handlungsalternativen hinweisen (134–136: rectius hoc est; / hoc faciens vivam melius; sic dulcis amicis / occurram),16 nicht jedoch andere von etwas überzeugen will, und macht so die Reflexion über seine eigene Fallibilität zum Ausgangspunkt seiner Beobachtung von und seiner Kritik am Verhalten anderer. Seine eigenen Schwächen und Fehler, die er offen bekennt, wenn auch nicht näher spezifiziert, werden so als Voraussetzung für die Arbeit an den Satiren vorgeführt.17