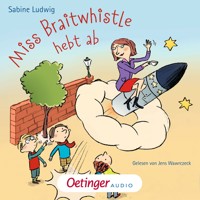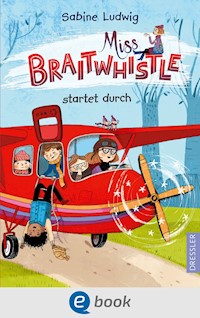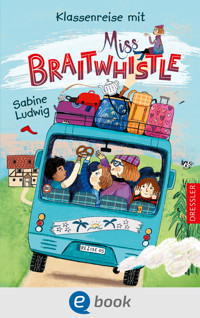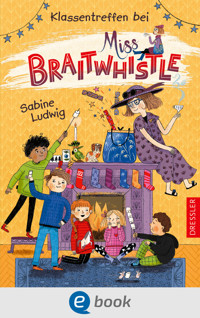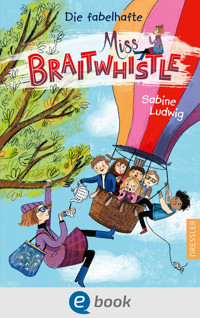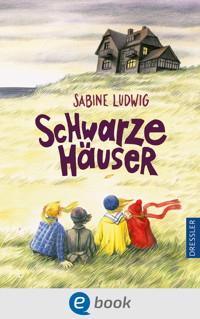
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Packend und berührend - das persönlichste Buch von Sabine Ludwig. Die zwölfjährige Uli kommt sechs Wochen zur Erholung auf eine Nordseeinsel. Dort erwartet sie jedoch alles andere als ein Urlaub. Denn keins der Kinder ist freiwillig im Kurheim. Das Heimweh ist groß, der Wind heult ums Haus, das Essen schmeckt schrecklich. Trost findet Uli bei ihren neuen Freundinnen Fritze, Freya und Lieschen. Gemeinsam bibbern sie im kalten Waschraum, helfen sich beim Schuheputzen und überstehen auch die gemeinsten Strafen. Doch eines Tages ist Freya verschwunden. Heimlich machen sich die Mädchen auf die Suche und finden sie weit draußen im Watt... Sensibler Umgang mit einem bewegenden Thema - eine spannende Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte mit vielen Vignetten von Tochter Emma Ludwig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch
Die zwölfjährige Uli kommt sechs Wochen zur Erholung auf eine Nordseeinsel. Dort erwartet sie jedoch alles andere als ein Urlaub. Denn keins der Kinder ist freiwillig im Kurheim. Das Heimweh ist groß, der Wind heult ums Haus, das Essen schmeckt schrecklich. Trost findet Uli bei ihren neuen Freundinnen Fritze, Freya und Lieschen. Gemeinsam bibbern sie im kalten Waschraum, helfen sich beim Schuheputzen und überstehen auch die gemeinsten Strafen. Doch eine Tages ist Freya verschwunden. Heimlich machen sich die Mädchen auf die Suche und finden sie weit draußen im Watt …
Vorwort
Oft werde ich gefragt, ob meine Geschichten wahr sind. Ob ich alles selbst erlebt oder mir ausgedacht habe. Ich vergleiche meine Geschichten dann gern mit einem bunten Flickenteppich. Manches habe ich gehört, gesehen, geträumt, anderes hat mir jemand erzählt und einiges habe ich wirklich selbst erlebt. So hatte ich eine Lehrerin wie Frau Schmitt-Gössenwein, leider ist es mir nie gelungen, sie zu schrumpfen. Das habe ich mir ausgedacht.
Was ich jedoch in diesem Buch erzähle, ist nicht ausgedacht, sondern wahr. Als ich zehn Jahre alt war, wurde ich auf eine Nordseeinsel »verschickt«. So nannte man es, wenn Großstadtkinder für sechs Wochen in ein Kinderkurheim auf dem Land oder am Meer gesteckt wurden, wo sie sich erholen sollten. Und wie ein Paket einen Adressaufkleber hat, so trug auch ich eine Karte mit meinem Namen und meiner Anschrift darauf um den Hals.
Obwohl das nun schon lange her ist, habe ich diese Wochen im Kinderheim nie vergessen. Es gab fiese Erwachsene und noch fieseres Essen und nachts habe ich oft vor Heimweh ins Kissen gebissen, damit mich niemand weinen hört. Damals gab es kein Handy, mit dem ich meine Eltern hätte anrufen können. Und die Briefe, die ich schrieb, wurden von den Erzieherinnen gelesen und wehe es stand darin, dass es einem im Heim nicht gefiel, dann wurde der Brief nicht abgeschickt oder die »Tanten« schrieben einen Kommentar dazu. In einem meiner Briefe stand dann: »Sabine geht es gut, heute hat sie noch nicht geweint«, was gelogen war.
Zum Glück gab es im Heim andere Kinder, denen es genauso ging wie mir und die mir geholfen haben, diese schlimme Zeit zu überstehen. Kinder wie Uli, Fritze, Anneliese und Freya, die du in diesem Buch kennenlernst. Du kannst dabei sein, wenn sie im eisigen Waschraum vor Kälte zittern, ausgehungert in die Speisekammer einbrechen, bei Windstärke zwölf auf einen toten Wal klettern, fürchterlich bestraft werden und doch nie den Mut verlieren. Und den brauchen sie auch, denn am Ende wartet das größte und gefährlichste Abenteuer ihres Lebens auf sie.
Aber lies selbst.
Sabine Ludwig
1. Kapitel
»Stell dich nicht so an und gib dein Brot her!«
»Nein, das ist meins!«
»Du bekommst ja eins. Ein anderes.«
»Aber ich will meins! Warum kann ich das nicht behalten?«
»Damit es gerecht zugeht. Stell dir vor, einer hat lecker Leberwurst drauf und der andere nur Harzer.«
»Ich hasse Leberwurst!«
Uli stößt ihre Nachbarin an, ein Mädchen, an dem alles dünn ist. Die Haare, das Gesicht, vor allem die Nase. »Wie die sich anstellt wegen ihrer doofen Stulle.«
Das dünne Mädchen nickt. »Die hat im Bus hinter mir gesessen und die ganze Zeit geheult.«
Die große, hagere Frau, die sich im Bus als Frau Sowieso vom Jugendamt vorgestellt hatte, reißt jetzt dem Mädchen das Brot aus der Hand und wirft es in einen Wäschekorb. Dann kommt sie an Ulis Tisch, sagt nichts, sondern hält ihr nur auffordernd den Korb hin. Uli sieht sie zum ersten Mal bei Licht. Im Bus ist es fast die ganze Zeit dunkel gewesen, sogar die Grenzer hatten kein Licht gemacht, sondern ihnen nur mit Taschenlampen in die Gesichter geleuchtet. Die Frau sieht aus wie eine Nebelkrähe mit ihrem grauen Mantel, dem grauen Haar und der gebogenen, gelblich verfärbten Nase.
Uli öffnet ihre Stullendose, ganz vorsichtig, damit nicht noch mehr vom Rand abbricht. Sie hätte gerne eine aus Aluminium gehabt statt aus bröckeligem Bakelit, aber Oma meinte, die würde noch mindestens drei Reisen überstehen. Eins der beiden Brote hat Uli schon gegessen, zum Glück das mit dem Käse, auf dem anderen ist eh nur Tomatenmark.
Das dünne Mädchen neben ihr legt eine Packung Kekse in den Korb. Die Krähe runzelt die Stirn. »Ich wickle sie besser in Butterbrotpapier. Sonst sieht man ja gleich, was es ist.«
Das Mädchen zuckt gleichgültig mit den Schultern.
Als alle ihre Brote in den Korb gelegt haben, läuft die Krähe zwischen den Tischen hindurch, und jeder darf sich eins der Päckchen nehmen. Uli grabbelt ausgiebig in dem Korb, um das mit den Keksen zu erwischen. Die Krähe schlägt ihr auf die Finger. »Nicht lange suchen! Nimm irgendeins.«
Sie sitzen unter Deck. Das Schiff stampft und schlingert. Ulis Brot, das sie schließlich aus dem Korb gefischt hat, rutscht über den Tisch und fällt auf den Boden. Es hat schon vorher nicht sehr appetitlich ausgesehen. Am liebsten hätte sie es liegen gelassen, aber die Krähe hat sie im Blick, also hebt sie es widerwillig auf.
Das dünne Mädchen neben Uli wickelt langsam sein Brot aus und schaut dabei aus dem Fenster, gegen das Wasser klatscht. Nicht irgendein Wasser. Das Meer, die Nordsee.
»Sollte jemandem schlecht werden, Bescheid sagen, aber bitte rechtzeitig.« Die Krähe schwenkt steife Papiertüten.
»Kotzbeutel«, murmelt Uli. Sie hat endlich das Brot von dem durchweichten Papier befreit. Pumpernickel mit Quark. Eine einzige Pampe.
»Freya«, sagt da das dünne Mädchen. »Ich heiße Freya. Und du?«
»Uli.«
»Ist das die Abkürzung für Ursula?«
»Für Ulrike.«
Freya, was für ein seltsamer Name, denkt Uli. Noch nie hat sie ein Mädchen mit so einem winzigen Gesicht gesehen, die Nase ist noch das Größte darin. Und die Hände erst. Schmal mit langen Spinnenfingern, die Adern schimmern blau durch den Handrücken.
»Bist du adlig?«, fragt Uli.
»Nein, warum?«
»Nur so. Willst du dein Brot nicht?«
Uli hätte niemals zugegeben, dass sie ihr Wissen über den Adel aus den alten »Gartenlaube«-Heftchen bezieht, die Oma seit ewigen Zeiten aufbewahrt. Die Baronessen und Prinzesschen darin sehen alle so aus wie Freya.
»Magst du?« Freya hält ihr ein Vollkornbrot hin. Es sieht nicht mal schlecht aus. Uli nimmt es schnell und schiebt ihr matschiges Päckchen unauffällig hinter den Vorhang, der das Fenster halb bedeckt und ganz steif ist vor Staub und fettigem Dunst.
»Guck mal, die Heulsuse.« Uli zeigt auf das Mädchen, das jetzt mit dem Kopf auf dem Tisch liegt, seine Schultern zucken.
»Sie heißt Elfriede«, sagt Freya. »Elfriede Klotz.«
Uli nickt. »Schlimm genug.«
Als sie am Abend in den Bus gestiegen waren, hatte jedes der Kinder eine Pappkarte mit seinem Namen darauf um den Hals getragen. Uli hatte ihr Schild auf dem Schiff abgenommen und Freya hat es unter ihren Pulli gesteckt. Es ist ein schicker Pulli, nicht eins von diesen selbst gestrickten Teilen aus dreimal aufgerebbelter Wolle, wie Uli sie tragen muss.
Freya wendet sich ab und blickt wieder aufs Meer, das sich bleigrau am Fenster entlangwälzt, und Uli hat Gelegenheit, sie in Ruhe anzuschauen. Durch ihre weißblonden Haare schimmert die Kopfhaut, so fein sind sie. Das könnte hässlich aussehen, tut es aber nicht, denn Uli erkennt sofort, dass da ein richtiger Friseur am Werk war und nicht wie bei ihr Tante Gertie, eine Freundin von Oma, die vor hundert Jahren mal eine Friseurlehre gemacht hat. Als sie Uli einmal mit einer Brennschere den Pony locken wollte, waren dabei die Haare abgebrochen. Es hat ewig gedauert, bis sie wieder so lang waren, dass sie bis zu den Augenbrauen reichten. Eigentlich mag Uli ihre Haare. Sie haben die Farbe von Karamellbonbons und fallen bis auf die Schultern. Meistens trägt sie Rattenschwänze. Und ihre Lieblings-Zopfgummis, die mit den roten Kugeln. Aber jetzt kommt ihr die Frisur fast kindlich vor.
Auch Freyas schwarze Hose sieht schick aus, eine echte Lastexhose. Da beult nichts. Uli zupft an der abgesteppten Bügelfalte ihrer blauen Wollhose, die am Knie schon ganz blank ist. Von allen Kindern, die hier im Bauch des Schiffes sitzen und übermüdet an fremden Klappstullen herumkauen, ist Freya am besten angezogen.
Warum wird die wohl verschickt?, überlegt Uli. Nun, sie würde sechs Wochen Zeit haben, das herauszufinden.
Flügelschlagend flattert die Krähe an den Tischen vorbei und sammelt das Butterbrotpapier ein. »Wo sind eure Namensschilder? Ihr müsst sie sichtbar tragen, bis wir im Heim angekommen sind.«
Freya greift in ihren Pulli und zieht das Schild heraus.
Freya Freiberg steht mit Schreibmaschine getippt darauf. Auch ihr Name ist schick. Jedenfalls schicker als Ulrike Bandekow.
»Freya Freiberg«, murmelt Uli.
»Wie bitte?« Freya sieht sie fragend an.
»Ich finde deinen Namen schön«, sagt Uli. Freya lächelt, aber nur ganz kurz. Es ist eher ein Zucken im Mundwinkel.
»In Zweierreihen anstellen!«, kräht es. »Und dann gehen wir nacheinander hoch an Deck.«
»Sind wir schon da?«, fragt Freya.
Uli späht aus dem Fenster. »Sieht so aus.« Sie steht auf und muss sich gleich darauf am Tisch festhalten, denn es gibt einen Rumms. Und noch einen.
Nun kann man auch die Möwen hören.
Das heulende Mädchen verlässt als Letzte das Schiff, und wenn die Krähe ihr keinen Schubs gegeben hätte, wäre sie wohl auch nicht in die altmodische kleine Bahn gestiegen, die am Hafen steht und sie in den Ort bringen soll.
Auf der Bank gegenüber von Freya und Uli ist zwischen zwei sommersprossigen Jungs, offensichtlich Brüdern, ein Platz frei, da quetscht sie sich hin. Elfriede Klotz sieht schlimm aus. Ihre Augen sind rot verquollen, unter ihrer Nase läuft eine Rotzspur, die aussieht wie getrockneter Schneckenschleim. Jetzt bohrt sie sich die Fingerknöchel in die Augen, was die Sache auch nicht besser macht.
Der Junge, der rechts von ihr sitzt, brüllt plötzlich: »He, Klausi, kiek mal, der Vogel hat ’nen Fisch im Maul!«, und zeigt aus dem Fenster auf eine Möwe. »Lass mal sehen, Hansi!« Klausi drängelt sich rücksichtslos an Elfriede Klotz vorbei ans Fenster, doch die scheint es gewohnt zu sein, rüde behandelt zu werden, sie schnieft nur kurz auf.
Uli schiebt den Jackenärmel ein Stückchen hoch und schielt auf ihre Uhr. Fast Mittag. Die Uhr ist ihr peinlich. Sie hat ihrem Opa gehört und ist eine Männeruhr, was sonst. Das Glas hat einen Sprung und das Lederarmband ist vom Schweiß ganz steif und dunkel geworden. Schweiß von jemandem, der seit Jahren tot ist. Wenn sie angekommen sind, wird sie sie gleich wegpacken. Im Heim braucht man keine Uhr, das weiß Uli.
Die Kinder werden langsam munter, sie zeigen sich gegenseitig, was es draußen zu sehen gibt. Dabei ist da erst einmal nicht viel. Die Bahn zuckelt über einen Damm. Zur Linken erstreckt sich eine graue Wasserfläche bis zum Horizont, zur Rechten glänzt und schimmert das Wattenmeer.
Oma hat Uli die Insel auf einer Karte gezeigt und erklärt, was Ebbe und Flut sind. Bei Flut ist das Wasser da und bei Ebbe ist es weg. Vor zwei Jahren hat es im Februar eine große Flut gegeben, eine Sturmflut. Uli erinnert sich noch an ein Bild in der Zeitung. Aus den Wassermassen ragte ein Hausdach, darauf saß jemand und schwenkte ein weißes Tuch. »Wie im Krieg«, hatte Oma gesagt. »Wie im Krieg.« Und dann fing sie an zu weinen, wie immer, wenn sie vom Krieg sprach.
Uli seufzt. Freya sieht sie fragend an.
»Glaubst du, wir bekommen eine Sturmflut?«
»Hoffentlich nicht«, sagt Freya.
»Warum nicht? Könnte doch aufregend sein. Überall Wasser. Wasser und Wind. Und wir mittendrin.«
»O nein, das wäre ja schrecklich!«
Rechts und links tauchen nun Häuser auf, spitzgiebelige Häuser aus rotem Backstein. Uli stellt sich vor, wie sie auf einem der Dächer hocken und verzweifelt eine weiße Fahne schwenken würde. Immer höher stiege das Wasser, leckte schon an ihren Füßen. Und da! Ein Hubschrauber! Immer näher kommt er, bis die Rotorblätter dicht über ihrem Kopf dröhnen und ihre Haare durcheinanderwirbeln. Die Tür geht auf, eine Strickleiter fällt herab und ein Mann klettert herunter, hält ihr mit einem Lächeln seine Hand hin. Einem breiten Filmschauspielerlächeln. Uli kann sich nicht entscheiden, ob der Mann mehr aussieht wie Horst Buchholz oder James Dean.
»Nicht träumen, Fräulein.« Die Krähe stößt sie in die Seite. »Aussteigen!«
Uli stolpert den anderen hinterher aus dem Zug. Es regnet, hoffentlich weicht ihr Koffer nicht auf. Freyas Koffer ist mit Stoff im Schottenkaro bezogen, Ulis dagegen aus brauner Pappe, und kariert ist nur das Papier, mit dem er innen ausgeschlagen ist. Ein Kofferaufkleber zeigt den Eiffelturm, aber natürlich sind weder Uli noch der Koffer je in Paris gewesen. Den Kofferaufkleber hat sie von Fräulein Wernicke aus dem zweiten Stock geschenkt bekommen. Bleischwer ist das Ding noch obendrein, denkt Uli, als sie jetzt hinter den anderen über die Gleise trottet und Ausschau nach einem Karren hält, auf den sie ihr Gepäck laden können.
»Nicht stehen bleiben!«
»Müssen wir alles selber tragen?«, fragt Uli. Sie blickt nach oben in den grauen Niesel.
»Bist du aus Zucker?« Die Krähe läuft den Kindern voraus, es geht eine gepflasterte Straße entlang, der Bürgersteig ist so schmal, dass Uli auf dem Fahrdamm läuft. Sie nimmt den Koffer mal in die eine, mal in die andere Hand, der Blechgriff hinterlässt eine tiefe rote Spur.
»Soll ich dir helfen?«
Uli dreht sich um, hinter ihr stapft die Heulsuse. Auf dem Rücken trägt sie einen unförmigen Rucksack aus grauem Segeltuch. »Hab die Hände frei.«
Uli zögert, sie möchte mit dem Mädchen eigentlich nichts zu tun haben. Elfriede Klotz sieht aus wie eine aus dem Obdachlosenasyl, von denen Oma immer sagt, die seien selbst schuld, keiner müsse heute mehr in einer Nissenhütte hausen. Ihr Pony ist viel zu kurz und unregelmäßig, als hätten die Motten daran genagt. Und ihr Mantel – wo doch fast jedes Kind hier einen Anorak trägt – sieht auch vermottet aus. Womöglich hat sie Läuse. Uli schielt auf ihren Kopf, aber abgesehen davon, dass die Haare verschnitten sind, sehen sie sauber aus.
Elfriede Klotz hat Ulis Blick bemerkt, sie fährt sich über den Kopf. »Hat mein Papa gemacht. Er setzt mir einen Topf auf und schneidet dann an der Kante entlang.«
Nein, die stammt nicht aus dem Obdachlosenasyl, die berlinert ja noch nicht mal.
»Wollen wir uns abwechseln?«, fragt Uli, denn sie hat das Gefühl, ihre Handinnenfläche platzt gleich auf.
Das Mädchen nickt und greift nach dem Koffer.
Uli bewegt die schmerzenden Finger. »Ich heiße Uli, also eigentlich Ulrike, und du?«, fragt sie, obwohl sie es schon weiß.
»Ich hab viele Namen. Mein Onkel nennt mich Friedchen, meine Lehrerin sagt Elfriede, meine Freundin nennt mich Elfi, wenn wir mal nicht verkracht sind, und Frieda, wenn sie sauer auf mich ist, und mein Papa …«, sie schnieft laut, »… mein Papa nennt mich Fritze.«
Fritze. Der Name passt zu ihr, denkt Uli. Denn eigentlich sieht sie überhaupt nicht wie ein Mädchen aus. Die kurzen Haare, die dichten Augenbrauen, die tiefe Falte über der Nasenwurzel und dann dieser Mantel, der aussieht wie aus einer Pferdedecke genäht.
Jetzt heult sie schon wieder. Ein Junge dreht sich zu ihnen um, tippt sich an die Stirn und grinst.
»Gib mir den Koffer«, sagt Uli, und die Heulsuse lässt auf der Stelle den Griff los, der Koffer knallt auf den nassen Gehsteig. Jetzt hat auch die zweite Ecke eine dicke Delle. Uli geht schneller und direkt auf einen Turm zu. Sein rotes Dach sieht aus wie eine Pudelmütze mit Bommel. Der Turm steht leicht erhöht auf einem Rasenplatz, der von einer Buchsbaumhecke umgeben ist.
»Ist das ein Leuchtturm?«, fragt sie und bleibt stehen.
»Was denn sonst?« Die Krähe wedelt hektisch mit den Flügeln. »Nicht trödeln dahinten, es gibt gleich Mittagessen!«
Im Laufschritt kommt ihnen nun ein junges Mädchen entgegen, es zieht einen Leiterwagen hinter sich her.
»Bisschen spät«, knurrt die Krähe.
»Entschuldigung, die Bahn muss heute früher gekommen sein.«
Das Mädchen lädt die Koffer der jüngeren Kinder auf den Leiterwagen.
»Ist es noch weit?«, fragt Uli.
»Das Haus da vorn.« Das Mädchen zeigt auf ein weißes Haus schräg gegenüber einem seltsamen Monument. Es sieht aus wie ein Bogen aus Stein. Darunter liegt auf einem ebenfalls steinernen Sockel ein Helm.
»Was ist das?«
»Das Kriegerdenkmal. Für die Gefallenen.« Das Mädchen lächelt Uli an. »Ich heiße Greetje und du?«
»Uli.«
Greetje ist älter als Uli, bestimmt schon sechzehn oder siebzehn. Sie hat weizenblonde Haare und das Blau ihrer Augen ist so durchscheinend wie Wasser. Der Leiterwagen muss schwer sein, doch Greetje zieht ihn so mühelos, als wäre er mit Stroh beladen und nicht mit vollen Koffern.
Sie sind da.
Das Haus sieht ganz anders aus als das Kinderheim im Fichtelgebirge, in dem Uli das letzte Mal war. Wie ein großer weißer Kasten. Zwei Stockwerke, das Hochparterre besteht links aus einem verglasten Wintergarten, rechts aus einer überdachten Veranda.
Sie gehen eine gewundene Treppe hoch und durch eine Tür, deren eine Milchglasscheibe einen Sprung hat.
Suppengeruch schwappt ihnen entgegen … Uli seufzt. Erbsen mit Einlage. Und dazu noch angebrannt.
In der Eingangshalle werden sie von drei Frauen erwartet. Die in der Mitte ist klein und dick, die zwei Frauen rechts und links von ihr sind groß und dünn.
»Zwillinge?«, flüstert Freya, die sich neben Uli gestellt hat.
Uli schüttelt den Kopf. Das machen nur die weißen Schürzen, dass die sich ähnlich sehen. Sie kennt das.
Die Dicke trägt keine Schürze, sondern einen grauen Rock und einen rosa Pulli. Ihre Augenbrauen sind zwei gemalte schwarze Bögen. Auf ihrem ausladenden Busen baumelt an einer goldenen Kette eine Brille. Sie lächelt und breitet die Arme aus. »Herzlich willkommen im Kinderkurheim Kiebitz, meine Lieben. Hattet ihr eine gute Fahrt?«
»Nein«, sagt Uli leise.
»Wir mussten ganz lange im Bus sitzen bleiben, bis wir aufs Schiff durften«, sagt ein kleines Mädchen neben ihr und nickt wichtig, bevor es sich wieder seinen Daumen in den Mund steckt.
»Ich bin Frau Butt, die Kleinen unter euch dürfen mich ruhig Tante nennen, und das hier sind Schwester Hildegard und Schwester Waltraud. Schwester Hildegard wird sich um die Mädchen kümmern und Schwester Waltraud um die Jungs. Greetje habt ihr ja schon kennengelernt. Sie hilft bei den Jüngsten und übernimmt die Nachtwache bei den Mädchen.«
Das kleine Mädchen schmiegt sich an Greetje und schaut vertrauensvoll zu ihr hoch. »Du siehst lieb aus.« Greetje streicht ihr über den Lockenkopf.
»Ich mache jetzt die Zimmeraufteilung«, spricht Frau Butt weiter. »Eure Koffer kommen in den Gepäckraum.«
»Prima, wir haben Zimmer«, sagt Uli zu Freya. »Im Kinderheim, wo ich vorher war, gab’s nur zwei Schlafsäle. Einen für Jungs und einen für Mädchen.«
Freya wirft Uli einen fragenden Blick zu, und Uli bereut sofort, dass sie das gesagt hat. Nicht dass Freya denkt, sie sei so eine Asoziale, die von Heim zu Heim wandert.
»Freya Freiberg, Ulrike Bandekow, Elfriede Klotz, Petra Püschel und Anneliese Reiter, ihr habt Zimmer elf im ersten Stock.«
Frau Butt macht Häkchen hinter ihre Namen.
»Das kann doch nicht wahr sein«, murmelt ein Mädchen mit blonden Krisselhaaren. »Ausgerechnet die.«
Uli weiß, wen sie meint: die Heulsuse.
Zu fünft gehen sie die Treppe hoch. Uli fährt mit dem Finger über die Tapete an der Wand, sie ist dunkelblau, fast schwarz und hat ein erhabenes Muster. An einigen Stellen löst sie sich von der Wand, Putzhäufchen liegen auf der Scheuerleiste.
Das Zimmer mit der Nummer elf ist ziemlich groß, das braune Linoleum auf dem Boden abgetreten. Aus beiden Fenstern schaut man auf den Leuchtturm mit der Bommelmütze. Die große Blonde, die Uli für Anneliese Reiter gehalten hat, weil sie genau so aussieht, wie sich Uli eine Anneliese vorstellt, heißt Petra. Anneliese ist das Mädchen, das die ganze Zeit am Daumen nuckelt. Ein kleiner Pummel mit dunklen Locken und dunklen Augen, bestimmt nicht älter als sechs, höchstens sieben.
Fritze wirft ihren Rucksack auf das äußerste von den drei Betten am Fenster. Als einziges hat es eine Lampe auf dem Nachttisch. Anneliese setzt sich auf das dritte Bett in der Reihe. Uli bleibt unschlüssig stehen, sie möchte ungern ein Bett in der Mitte, aber Petra hat bereits ihr Nachthemd auf das Bett gelegt, das der Tür am nächsten ist, und Freya hat das an der Wand mit Beschlag belegt.
Uli geht zu dem Bett, dessen Fußende durch einen schmalen Gang vom Fußende des gegenüberliegenden Bettes getrennt ist.
»Immerhin keine Doppelstockbetten«, sagt Petra und beginnt, ihre Sachen in den winzigen Nachtschrank zu räumen.
Fritze wühlt in ihrem Rucksack herum und verteilt verknitterte Kleidungsstücke auf dem Bett.
Die Tür wird aufgerissen. Schwester Hildegard steht im Zimmer. »Habt ihr den Gong nicht gehört? Mittagessen ist fertig. Einräumen könnt ihr später.«
Die Mädchen folgen ihr die Treppe hinunter in einen großen Raum, der an den Wintergarten grenzt.
Auf jedem der Tische stehen tiefe Teller. Daneben Löffel und Gabeln, die ganz leicht sind, als Uli sie hochhebt. Leicht und verbogen.
Stühle schurren über den Boden, Teller klappern auf dem zerkratzten Resopal der Tische. Uli kennt die Geräusche und kennt die Gerüche. Und sie kennt auch den Anblick, als sich jetzt eine Kelle voll graugrünem Matsch mit einem fetten Rülpsen in ihren Teller ergießt.
2. Kapitel
Nach dem Mittagessen geht es wieder ans Auspacken. Uli schielt hinüber zu Freya. Was die für schicke Sachen aus ihrem Koffer zieht! Bisher hat Uli immer gedacht, Fräulein Wernicke sei von allen Frauen, die sie kennt, am besten angezogen. Doch was Freya jetzt sorgfältig zusammengelegt im Schrank verstaut, kann sich sehen lassen. Ein echter Schottenrock ist dabei mit so einer großen Sicherheitsnadel vorne und eine blaue Bluse mit kleinen Blümchen und weißem Pikeekragen. Die würde Uli bestimmt auch gut stehen. Blau ist ihre Lieblingsfarbe.
Lautes Schniefen reißt sie aus ihren Gedanken. Fritze hält einen kleinen Elefanten in der Hand und heult. »Den hat mir mein Papa geschenkt.«
»Den hat mir mein Papa geschenkt«, äfft Petra sie nach und stopft Pullis und Unterwäsche in ein Schrankfach.
Uli hat kein Kuscheltier dabei, mit fast zwölf ist sie auch viel zu alt dafür.
Anneliese steht ratlos vor ihrem Koffer, den Daumen im Mund, einen schon ziemlich abgewetzten Teddy an sich gepresst. Uli wundert sich, warum sie nicht bei den jüngeren Mädchen schläft.
»Wie alt bist du?«, fragt sie.
»Acht«, nuschelt Anneliese.
»Und da lutschst du noch am Daumen?«, fragt Petra abfällig.
»Ich bin zehn«, sagt Fritze. »Und ich hab auch ganz lange genuckelt. Aber dann wollte ich mir einen Flitzebogen schnitzen und hab mich geschnitten.« Sie hält den rechten Daumen hoch. »Pflaster schmeckt nicht gut.«
Petra verdreht die Augen.
»Komm, ich helfe dir beim Einräumen«, sagt Freya zu der Kleinen und klappt ihren leeren Koffer zu.
Die Tür öffnet sich. »Während des Mittagsschlafs bleiben die Türen auf«, sagt Schwester Hildegard.
»Ich denke, wir sollen auspacken«, sagt Uli.
»Auch dafür müssen die Türen nicht zu sein.«
Schwester Hildegard geht auf Anneliese zu und reißt ihr den Teddy aus dem Arm. »Kuscheltiere sind im Heim verboten. Das ist unhygienisch.«
»Mein Teddy! Mein Teddy!«, ruft das Mädchen verzweifelt.
»Ganz ruhig, du bekommst ihn ja nach den sechs Wochen wieder.« Schwester Hildegard sieht von einem Mädchen zum anderen. »Hat noch jemand von euch ein Stofftier dabei? Oder eine Puppe?«
Alle schütteln den Kopf. Auch Fritze. Petra macht schon den Mund auf, aber Fritze wirft ihr einen so finsteren Blick zu, dass sie nichts sagt.
»Gut, wenn ihr fertig seid, bringt ihr eure Koffer nach unten, und danach kommt ihr in den Speisesaal.«
»Müssen wir schon wieder essen?«, fragt Fritze mit ängstlich aufgerissenen Augen.
Schwester Hildegard beachtet sie nicht. »Nehmt euer Schreibzeug mit.«
»Gibt’s hier Unterricht?«, fragt Freya, als Schwester Hildegard das Zimmer verlassen hat.
Uli schüttelt den Kopf. Das einzig Gute an der Verschickung ist, dass man sechs Wochen lang keine Schule hat.
»Wir sollen bestimmt nach Hause schreiben. Dass wir gut angekommen sind.«
»Meine Mutter will aber, dass ich sie anrufe«, sagt Freya.
»Anrufen? Das ist bestimmt nicht erlaubt.«
Uli könnte Oma gar nicht anrufen, sie haben kein Telefon. Zum Telefonieren müssen sie hoch zu Fräulein Wernicke gehen. Aber das passiert höchstens ein-, zweimal im Jahr.
»Ich rufe auch zu Hause an«, mischt sich Fritze ein. »Ich sage meinem Papa, dass er mich sofort abholen soll. Es ist schrecklich hier!«
»Das glaubst du doch nicht im Ernst, dass dein Vater dich holen kommt«, sagt Petra und guckt Fritze abschätzig an. »Oder hat der etwa keine Arbeit?«
»Mein Papa arbeitet zu Hause, er malt Bilder.«
Petra sieht Fritze an, als hätte die gesagt, er würde auf der Straße den Müll einsammeln. »Bilder, aha. Und was ist da drauf?«
»Kreise. Kreise und Quadrate.«
Petra knallt den Kofferdeckel zu. »Die spinnt doch.«
Uli stellt ihren Koffer zu den anderen in den Verschlag unter der Treppe und überlegt, wie sie sich wohl fühlt, wenn sie ihn in sechs Wochen wieder hervorholt. Ob Freya und sie dann Freundinnen geworden sind? Vielleicht so gute Freundinnen, dass sie sich in Berlin treffen? Aber sie weiß ja noch nicht einmal, wo Freya wohnt. Womöglich jwd in Rudow oder Spandau.
Der Speisesaal der Mädchen ist durch eine Glasschiebetür von dem der Jungen abgetrennt. Das sieht Uli jetzt erst. Hansi und sein Bruder Klausi drücken sich die Nasen an der Scheibe platt und machen Faxen. Sie drehen den Mädchen lange Nasen und strecken die Zunge raus. Da taucht hinter den beiden ein Junge auf, der Uli schon auf dem Schiff aufgefallen war, weil er so einen ulkigen Wirbel über der Stirn hat. Jetzt redet er auf die Brüder ein und zeigt ihnen einen Vogel. Dann schaut er zu Uli und grinst. So breit, dass sie die Lücke zwischen seinen Vorderzähnen sieht. Sie lächelt und hebt schon die Hand, um ihm zu winken, lässt es dann aber und geht zu ihrem Tisch.
Da sitzen schon Anneliese und Freya. Fritze liegt mit ihrem Oberkörper auf der Tischplatte und schluchzt. Petra unterhält sich am Nebentisch mit zwei Mädchen und alle drei gucken immer wieder zu Fritze und kichern.
Schwester Hildegard betritt den Saal und schlägt einen kleinen Gong.
»Ruhe! Ruhe bitte! Setzt euch ordentlich hin.« Damit ist offensichtlich Fritze gemeint. Doch die reagiert nicht. Schwester Hildegard geht zu ihr und zieht sie am Kragen ihres Pullis hoch. »Was hast du?«
Fritze kann kaum sprechen. »Ich will … nach Hau… Hau… Hause …«
Schwester Hildegard schüttelt den Kopf und lässt Fritze so plötzlich los, dass die mit dem Gesicht auf die Tischplatte knallt. Uli erschrickt. Das hat bestimmt wehgetan. Doch Fritze heult ja sowieso.
»Ich werde euch jetzt mit ein paar Regeln vertraut machen und erwarte, dass ihr euch daran haltet«, sagt Schwester Hildegard.
»Aufstehen um Viertel nach sieben. Danach Waschen und Bettenmachen. Um acht gibt es Frühstück. Von neun bis zwölf werdet ihr rausgehen oder bei schlechtem Wetter euch drinnen beschäftigen. Um halb eins ist Mittag. Danach Mittagsschlaf bis um drei. Kaffee gibt es um halb vier. Abendbrot ist um sechs. Um acht seid ihr im Bett. Um halb neun wird das Licht gelöscht. Habt ihr mich verstanden?«
Zustimmendes Gemurmel ertönt.
»Außerhalb der Ruhezeiten habt ihr auf den Zimmern nichts verloren, ist das klar? Und während der Schlafenszeit ist es verboten, die Zimmer zu verlassen.«
»Und wenn man mal muss?«, fragt ein Mädchen.
»Keiner muss nachts müssen. Seine Blase kann man erziehen«, sagt Schwester Hildegard. »Und nun zum Wochenplan: Sonntagnachmittag werden Briefe geschrieben. Am Mittwochmorgen wird geduscht, freitags werden Schuhe geputzt und samstags bekommt ihr Anwendungen.«
»Was für Anwendungen?«, fragt ein Mädchen.
»Das erfahrt ihr früh genug«, sagt Schwester Hildegard knapp. Dann klatscht sie in die Hände. »Wenn sich alle an meine Anweisungen halten, werden wir sicher gut miteinander auskommen. Ausnahmsweise dürft ihr heute schon euren Eltern schreiben. Und denkt dran: Die Briefe werden nicht zugeklebt!«
Fritze hebt den Kopf. »Warum nicht?«
»So ist die Regel.«
Freya hebt langsam den Arm. Wie in der Schule. »Ich habe meiner Mutter versprochen, sie anzurufen, wenn ich angekommen bin. Wo ist bitte das Telefon?«
Schwester Hildegard runzelt die Stirn, als hätte sie noch nie von einem Apparat namens Telefon gehört.
»Deine Mutter weiß sicher, dass Telefonate nicht erlaubt sind. Da machen wir keine Ausnahme. Du kannst deiner Mutter schreiben. Die Fähre nimmt die Briefe morgen früh mit rüber zum Festland. Dann hat sie deinen Brief am Mittwoch.«
»Erst am Mittwoch?«, ruft Fritze.
Auch Freya sieht verstört aus, aber sie sagt nichts. Die beiden haben eben keine Ahnung, denkt Uli. Sie kennt das alles schon: die nicht zugeklebten Briefe, das Telefonverbot.
Sie muss nicht lange überlegen, was sie schreiben soll.
Liebe Oma,
wir sind gut angekommen. Leider konnte man auf dem Schiff nicht viel sehen, weil wir nicht an Deck durften. In meinem Zimmer sind noch vier Mädchen. Eine heult die ganze Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut.
Viele Grüße von Ulrike
Uli schreibt die Adresse auf den Briefumschlag und klebt eine 20-Pfennig-Marke darauf. Auf der ist das Berliner Stadtschloss zu sehen und davor das Denkmal vom Alten Fritz. Dabei ist das Schloss längst abgerissen. Und selbst wenn es das Schloss noch gäbe, Uli könnte es sich sowieso nicht anschauen, weil es ja drüben ist, hinter dem Eisernen Vorhang, wie Oma immer sagt.
Anneliese sitzt da und starrt hilflos auf einen Bogen Briefpapier, der mit Märchenmotiven bedruckt ist. »Schneewittchen und die sieben Zwerge« erkennt Uli.
»Weißt du nicht, was du schreiben sollst?« Anneliese nickt.
»Schreib, dass du mit einem Schiff gefahren bist, dass es Erbsensuppe gab und –«
Mit einem Plop zieht Anneliese ihren Daumen aus dem Mund. »Die Tante hat meinen Teddy weggenommen!«
»Das schreibst du lieber nicht. Dann sind deine Eltern nur traurig.«
»Dann male ich ein Bild. Ein ganz schönes Bild.«
Fritze schreibt eine Seite voll und noch eine. Was hat die bloß alles zu erzählen, überlegt Uli, so viel ist doch noch gar nicht passiert.
Schwester Hildegard geht mit einem Korb durch die Reihen und sammelt die Briefe ein. »Ihr bleibt sitzen, bis ich euch rufe. Doktor Claassen kommt nach seiner Sprechstunde und schaut jede von euch an. Wenn sich eine von euch vorher noch die Hände waschen möchte, dann darf sie ausnahmsweise nach oben gehen.«
Das ist neu, in keinem der Heime, in denen Uli bisher war, hatte es einen Arzt gegeben, der sie angeschaut hätte.
Schweigend sitzen sie am Tisch. Nur Fritze zieht immer wieder die Nase hoch oder wischt sich mit dem Ärmel über die Augen.
Im Speisesaal der Jungen herrscht Bewegung. Anscheinend sind die schon dran mit Angeschautwerden.
Nun wird die Glastür aufgeschoben und Frau Butt und ein Mann in weißem Kittel kommen herein. Uli bemerkt erst jetzt, dass Frau Butt ein ganz klein wenig das linke Bein nachzieht. Sie weiß nicht, warum, aber dieses Hinken macht ihr Angst.
Schwester Hildegard trägt die Arzttasche und stellt sie auf einen der Tische. Dann reicht sie dem Doktor eine Namensliste. Er setzt eine Brille auf und studiert sie. »Was steht hier?«
Schwester Hildegard beugt sich über das Papier. »Isst kein Fleisch.«
Der Arzt schiebt seine Brille auf die Stirn und mustert die Mädchen. »Elfriede Klotz, komm nach vorn.«
Fritze wischt sich noch einmal über die verheulten Augen, dann geht sie zu dem Arzt.
»Wieso isst du kein Fleisch?«
»Ich muss immer weinen, wenn ich an die armen Tiere denke und –«
Der Arzt runzelt die Stirn.
»– und außerdem schmeckt es mir nicht. Fleisch ist eklig.«
»Fleisch ist nicht eklig, merk dir das. Wenn du kein Fleisch isst, wirst du krank. Sehr krank sogar.«
Im Moment sieht Fritze zwar aus, als würde ihr Gesicht sich gleich auflösen, aber krank wirkt sie nicht. Im Gegenteil. Sie ist nicht dick, aber kräftig und längst nicht so blass wie andere Kinder hier.
»Ich esse aber kein Fleisch. Nur Wiener Würstchen«, sagt Fritze trotzig.
Der Arzt dreht sich zu Schwester Hildegard um. »Sie sorgen dafür, dass das Mädchen genug Proteine bekommt. Von mir aus auch Würstchen. Oder Quark.«
»Quark mag ich. Am liebsten mit Schnittlauch.«
Schwester Hildegard macht den Mund auf und wieder zu.
»Ulrike Bandekow«, liest der Arzt von seinem Zettel ab.
Als sie vor ihm steht, sieht Uli, dass er schon ziemlich alt sein muss. Aus seinen Ohren quellen dichte graue Haarbüschel. Er hat wässrige, rot geränderte Augen. Uli muss »A« sagen und er schiebt ihr einen Spatel in den Rachen. Sie hustet und würgt.
»Umdrehen.« Uli dreht dem Arzt den Rücken zu, er schiebt ihren Pulli und das Unterhemd hoch und sie spürt das kalte Stethoskop zwischen ihren Schulterblättern. »Einatmen, Luft anhalten, ausatmen.«
Der Reihe nach geht das so. Spatel in den Mund, Stethoskop auf den Rücken. Abtreten. Manchmal macht er sich ein paar Notizen auf der Liste.
Er tastet Freyas knochige Schulterblätter ab: »Jeden Morgen zwei Löffel Lebertran.«
Uli atmet auf, wie gut, dass er das bei ihr nicht gesagt hat. Oma hatte auch mal den Flitz mit Lebertran. Irgendwo hatte sie gelesen, wie gesund das sein soll, und Uli musste jeden Morgen einen Löffel voll nehmen. Es schmeckte nach fauligem Fisch und ranzigem Öl.
Zu Anneliese sagt der Arzt: »Hier steht, dass du noch am Daumen lutschst, stimmt das?« Anneliese nickt heftig. »Damit werden wir ganz schnell aufhören.« Er wirft Schwester Hildegard einen Blick zu. »Handschuhe.«
Zum Schluss müssen sie sich auf eine Waage stellen und Schwester Hildegard trägt das Gewicht in eine Tabelle ein.
Beim Abendbrot ist es still. Allen ist die Erschöpfung nach der anstrengenden Reise anzumerken. Der Pfefferminztee ist lauwarm. Auch das kennt Uli. Immerhin ist er hier ohne Zucker, so schmeckt er zwar auch nicht, aber im letzten Heim war er so stark gesüßt, dass sie die ganze Nacht Durst hatte.
Es gibt Schwarzbrot belegt mit Mettwurst oder Schmelzkäse. Fritze greift sofort nach dem Brot mit Käse. Petra, die ebenfalls eins nehmen wollte, faucht: »Du hast doch gehört, was der Doktor gesagt hat. Du sollst Fleisch essen!«
»Und Quark«, sagt Fritze. »Und wenn’s keinen gibt, ess ich eben Käse. Iss du doch die Wurst.«
Aber Petra mag Mettwurst anscheinend auch nicht. Sie zerrt an dem Käsebrot und schließlich landet es mit der beschmierten Seite auf dem Tisch. Fritze isst es trotzdem.
Als das Abendbrot beendet ist, kommt eine kleine, bucklige Frau in einer grellbunt geblümten Schürze in den Saal und stellt Teller und Becher auf einen Wagen.
»Das ist Frau Poppinga«, sagt Schwester Hildegard. »Unsere Köchin. Ausnahmsweise räumt sie heute das Geschirr für euch ab, ab morgen macht ihr das.«
»Ob die kochen kann?«, flüstert Uli Freya zu.
Fritze hat es gehört. »Sie sieht genauso aus wie die Hexe aus ›Zwerg Nase‹ und die konnte gut kochen.«
Wieder wird die Glastür aufgeschoben. Uli schaut, ob sie den Jungen mit der Zahnlücke entdecken kann. Er sitzt an einem Tisch mit dem sommersprossigen Brüderpaar und einem großen Jungen mit Bürstenschnitt, der ein Gesicht hat, das Oma »durchtrieben« nennen würde, aber vielleicht liegt das auch an der leicht eingedrückten Boxernase.
Im Speisesaal der Jungen steht ein Klavier. Schwester Hildegard nimmt davor Platz und nickt Schwester Waltraud zu. Die schnallt sich ein Akkordeon um.
Die Melodie von Der Mond ist aufgegangen ertönt. Nicht sehr rein und nicht sehr schön, trotzdem bekommt Uli einen Kloß im Hals. Sie weiß gar nicht, warum. Oma hat nie mit ihr gesungen, jedenfalls kann Uli sich nicht daran erinnern. Und ihre Mutter? Der Kloß im Hals wird dicker. Ein dumpfer Misston unterbricht das Spiel. Schwester Waltraud hat kräftig danebengegriffen. Sie spielt schneller, um Anschluss an das Klavierspiel zu bekommen, aber es scheint, als ob Schwester Hildegard ebenfalls schneller spielen würde. Es klingt wie ein Wettrennen und auf alle Fälle nicht gut. Uli sieht Freya an, die runzelt fragend die Augenbrauen. Fritze zieht die Nase hoch und starrt ungläubig auf die beiden Frauen, die nun verbissen ihre Instrumente bearbeiten, dass es nur so kracht. Schließlich knallt Schwester Hildegard den Klavierdeckel zu, durchquert mit großen Schritten den Speisesaal der Jungen, schließt klirrend die Schiebetür und stellt sich wie ein Wächter davor.
»Nach oben mit euch, waschen und Zähne putzen und ab ins Bett!«, ruft sie den Mädchen zu.
Für die Jungs scheint das nicht zu gelten, denn Schwester Waltraud spielt weiter. Durch die geschlossene Glastür ist deutlich Ach, du lieber Augustin, alles ist hin zu hören und die Jungen singen mit und klatschen begeistert.
Die Zimmer der Mädchen liegen im ersten Stock, die der Jungen im zweiten. Der Waschraum ist nicht beheizt. In einer Reihe ziehen sich Waschbecken an der Wand entlang. Die Spiegel darüber sind angeschlagen und teilweise blind.
»Immerhin gibt es überhaupt welche«, murmelt Uli.
»Was meinst du?«, fragt Freya, die neben ihr ihren Kulturbeutel auspackt. Auch sehr schick, aus rotem Kunstleder.
»Es gibt Spiegel hier.«
»Warum sollte es keine Spiegel geben?«, fragt Freya.
Uli verkneift es sich, zu bemerken, dass sie schon mal in einem Heim war, in dem sie nur ihren Taschenspiegel hatte.
Plötzlich taucht das rot verquollene Gesicht von Fritze zwischen ihnen auf. »Ihr seid jedenfalls keine Vampire.«
Freya und Uli drehen sich zu ihr um.
»Wenn ihr Vampire wärt, dann könnte man euch im Spiegel nicht sehen. Daran kann man sie erkennen.«
»Vampire?«, fragt Freya. »Sind das nicht große Fledermäuse, die Blut saugen?«
»Nicht nur Fledermäuse«, sagt Fritze düster. »Es gibt auch Menschen, die sich nachts in Vampire verwandeln. Mein Papa hat mir Graf Dracula vorgelesen und da –« Sie bricht ab und wieder stürzen ihr die Tränen aus den Augen. Sie heult, als sie sich wäscht, sie heult beim Zähneputzen, sie heult, als sie sich ins Bett legt.
Anneliese weint auch. »Mein Teddy! Ohne mein’ Teddy kann ich nich einschlafen. Ich will mein’ Teddy haben.«
Petra richtet sich im Bett auf. »Könnt ihr endlich mit der Heulerei aufhören, ich kann nicht schlafen!« Sie wirft Fritze und Anneliese böse Blicke zu, woraufhin Fritze sich die Decke über den Kopf zieht und Anneliese nur noch lauter schluchzt.
Freya steht auf und zieht aus ihrem Schrankfach einen Waschhandschuh aus rosa Frottee. Sie zupft Watte aus einem Beutel, der mit einem bunten Band verschlossen ist, stopft sie in den Waschlappen und bindet mit dem Band eine Kugel ab.
»Hat jemand Nähzeug dabei?«, fragt sie. Uli hat welches. Ein mit bunten Kreuzstichen verziertes Täschchen, das sie im Handarbeitsunterricht machen mussten.
Freya öffnet es vorsichtig. »Farbiges Garn hast du nicht?«
»Nur weiß und schwarz.«
»Kann ich die beiden Knöpfe haben?« Es sind zwei Knöpfe aus grauem Perlmutt, die Oma ihr als Ersatz für die an ihrer Strickjacke mitgegeben hat.
»Wozu brauchst du die?«
Freya antwortet nicht, sondern feuchtet das Ende eines schwarzen Fadens an und hält eine Nadel gegen das Licht der Deckenlampe. Mit wenigen Stichen näht sie die Knöpfe an die Frotteekugel, dann stickt sie eine Nase auf, eine kleine Schnauze, bindet rechts und links zwei Zipfel ab …
»Hier«, sagt sie und gibt Anneliese den Waschlappen. »Das ist dein neuer Teddy.«
Anneliese wischt sich die Tränen ab und nimmt das Stofftier so vorsichtig entgegen, als wäre es zerbrechlich.
Leise wird die Tür geöffnet und Greetje kommt herein. »Wieso ist bei euch denn noch Licht?«, flüstert sie. »Es ist schon nach halb neun.«
»Mein Teddy is weg«, sagt Anneliese. »Aber Freya hat mir einen neuen gemacht.«
»Der ist ja süß«, sagt Greetje und setzt sich auf Annelieses Bett. »Aber zeig ihn bloß nicht Schwester Hildegard. Ihr wisst ja, dass ihr keine Kuscheltiere haben dürft.«
Sie zieht eine Art Fäustling aus weißer Baumwolle aus ihrer Schürzentasche. »Den muss ich dir umbinden. Damit du nicht nuckelst. Welcher Daumen ist es denn?«
Anneliese hält brav ihren feuchten Nuckeldaumen hoch, aber Greetje nimmt die andere Hand. »Ich pass auf, dass es dich nicht zu sehr einschnürt. Tut das weh?«
Anneliese schüttelt den Kopf.
Fritze schluchzt laut auf.
Greetje geht zu ihr. »Heimweh? Das geht vorüber, glaub mir.«
»Niemals!«, stößt Fritze hervor.