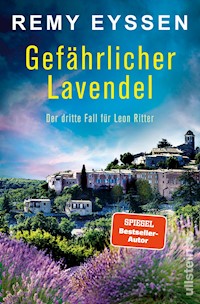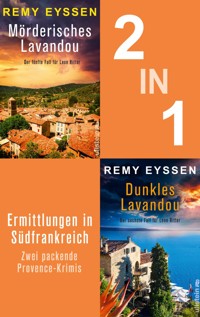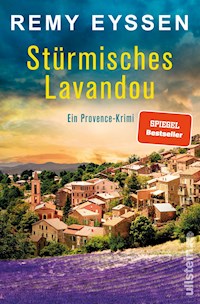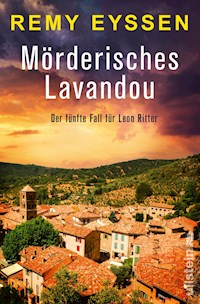9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter gewöhnt sich nach und nach in der Provence ein. Dass die Uhren hier langsamer ticken, stört ihn kaum noch, und er genießt die ruhige Zeit nach der hitzigen Sommersaison. Jetzt im Herbst beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou die Weinlese, und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Er ist begeistert, doch die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell konserviert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinlese in die Provence kamen. Hängen die beiden Fälle zusammen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Ritter erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Der Autor
Remy Eyssen (Jahrgang 1955), geboren in Frankfurt am Main, arbeitete zunächst als Redakteur bei der Münchner Abendzeitung, später als freier Autor für Tageszeitungen und Magazine. Anfang der 90er Jahre entstanden die ersten Drehbücher. Bis heute folgten zahlreiche TV-Serien und Filme für alle großen deutschen Fernsehsender im Genre Krimi und Thriller.
Von Remy Eyssen sind in unserem Hause bereits erschienen:
Tödlicher Lavendel
REMY EYSSEN
SCHWARZERLAVENDEL
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1271-2
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage April 2016
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Meiner Frau und meiner Tochterfür ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Susan wollte nur noch schlafen. Schlafen, schlafen und irgendwann in ihrem gemütlichen Pensionszimmer aufwachen, mit dem Blick auf den Hafen. Und den warmen Wind in ihren Haaren spüren, der nach Meer und Sonnenöl roch. Aber die schönen Bilder wollten nicht in ihrem Kopf haftenbleiben. Sie wurden verschluckt von einem Nebel aus Schmerz. Ein scharfer Schmerz, der wie mit Nadeln von innen gegen ihre Augen stach. Bei dem Gedanken, die Augen jetzt öffnen zu müssen, wurde ihr schwindlig. Ein galliger Geschmack stieg in ihrer Kehle hoch. Susan versuchte, flach durch den Mund zu atmen, aber das ging nicht. Irgendetwas klebte an ihrem Gaumen. Sie schmeckte rauen Stoff, der gegen ihre Zunge drückte. Sie wollte stöhnen, aber nicht mal das gelang ihr. Jetzt spürte sie den Knoten des Knebels im Nacken. Panik stieg in ihr auf. Sie fing an, hektisch durch die Nase zu atmen, und jeder Atemzug schickte eine neue Schmerzwelle durch ihren Kopf.
»Du musst dich beruhigen«, sagte sie sich. Ruhig atmen, so wie sie das im Yoga gelernt hatte. Dich auf deine innere Mitte konzentrieren. Atmen, ein und aus, ein und aus. Aber Susan konnte sich nicht konzentrieren, denn da war diese Stimme in ihr, und die hämmerte und drängte. »Mach deine Augen auf, verdammt noch mal. Du bist nicht in deinem Pensionszimmer. Du bist an einem ganz beschissenen Ort. Und du musst etwas unternehmen, irgendwas, jetzt gleich.«
Susan wollte die Augen nicht öffnen, noch nicht. Bitte, nur noch einen Augenblick, dachte sie. Sie zitterte. Ihr war kalt. Ihre Mutter war von Anfang an gegen diese Reise gewesen. Aber wenn es nach ihrer Mutter ginge, würden sie und ihre Schwester Hamburg nie verlassen. In den Augen ihrer Mutter waren sie noch immer die beiden kleinen, hilflosen Mädchen und keine vierundzwanzigjährigen Studentinnen kurz vor ihrem Examen. »Wir fahren doch nicht nach Afghanistan, Mama«, hatten sie ihre Mutter beschworen. »Wir fahren in die Provence, zur Weinlese. Das Schlimmste, was man sich da holen kann, ist ein Sonnenbrand.«
Und jetzt war sie hier, und alles war falsch. Sie spürte wieder Angst in sich aufsteigen. Spürte, wie ihr Puls raste. Ruhig atmen, um Himmels willen, du musst ruhig atmen, sagte sie sich wieder und wieder. Aber ihr Körper schien ein Eigenleben entwickelt zu haben. Als wäre ihr Wille abgeschaltet worden. Das ist die Panik, sagte sie sich. »Wenn du in Panik gerätst, dann hast du verloren«, hatte ihre Schwester Anna einmal zu ihr gesagt. Damals, als sie zusammen in der Bretagne waren. Als sie trotz der roten Fahne schwimmen gegangen waren und sie die Strömung ins Meer hinausgezogen hatte. Da war sie auch in Panik geraten. Aber damals war Anna neben ihr gewesen, und die blieb ganz ruhig. »Lass dich treiben. Spar deine Kräfte.« Da hatte sie sich treiben lassen. Und nach einer halben Stunde hatte sie eine andere Strömung zurück zum Strand getragen. Aber jetzt war ihre Schwester nicht da, und sie war ganz alleine.
Warum war sie hier? Was hatte der Mann zu ihr gesagt? Da war die fröhliche Runde in dem Bistro gewesen. Und dann war etwas auf dem Parkplatz passiert, aber was? Warum erinnerte sie sich an nichts mehr? Warum konnte sie nicht einfach aufwachen aus diesem Alptraum, aufstehen und davonlaufen?
Susan versuchte, sich zu bewegen, aber etwas hielt sie fest, spannte sich um ihre Handgelenke. Sie riss die Augen auf. Schmerz schoss ihr in den Kopf, und eine Welle der Übelkeit rollte über sie hinweg. Susan sah zu ihren Händen. Sie war gefesselt, an Händen und Füßen. Festgebunden an den Tisch, auf dem sie lag. Hartes, kaltes Resopal. Sie sah an ihrem Arm entlang, sah ihre Hüfte, ihr Bein – sie war nackt. Susan versuchte, ruckartig den Kopf zu heben. Der Schmerz war so heftig, dass sie glaubte, ihr Schädel würde platzen. Sie musste sekundenlang die Augen schließen und warten, dass die Qual nachließ und sie einen klaren Gedanken fassen konnte. Sie blinzelte. Der Raum war düster. Über ihr an der Decke flackerte eine Neonröhre und tauchte alles in mattes grünliches Licht.
Wenn sie den Kopf ganz vorsichtig nach rechts drehte, konnte sie die Wände sehen. Die Kacheln waren einmal weiß gewesen. Jetzt waren sie staubig und überzogen von schmutzigen Rissen. Der Raum hatte etwa die Größe einer Garage. In der Ecke stand ein Kühlschrank, der mit leisem Brummen ansprang. Das war das einzige Geräusch in diesem fensterlosen Verlies. Gleich neben ihr an der Wand stand ein Regal, in dem Plastikcontainer aufgereiht waren, die offenbar Flüssigkeiten enthielten. Susan versuchte, die Aufschriften zu entziffern. »Formol« stand auf den braunen Kunststoffbehältern und »Méthanol«. Unter der Schrift befanden sich Aufkleber. Susan kannte die Symbole darauf aus dem Universitätslabor: Das schwarz-gelbe Dreieck war das Zeichen für Säure, und das rote Rechteck mit dem Totenkopf warnte vor lebensgefährlichem Gift. Wo war sie hier? Wieder kroch die Angst in ihr hoch.
Bitte, ich will hier raus, flehte sie innerlich. Sie war doch nur eine Biologie-Studentin aus Deutschland, die in ihrem Urlaub ein wenig Spaß haben wollte. Flirten, Party machen. Eine Woche in den Weinbergen arbeiten, zusammen mit ihrer Schwester und anderen Studenten. Anschließend wollten sie weiterfahren nach Arles und in die Camargue. Aber jetzt war sie hier.
Das ist alles falsch, ganz falsch. Wollte ihr jemand Angst machen? Sie musste herausfinden, wo sie war. Susan versuchte, sich aufzurichten, nur ein paar Zentimeter. In diesem Moment spürte sie einen stechenden Schmerz an der Innenseite ihres linken Arms. Sie zwang ihren Kopf höher. Nur noch ein kleines Stück nach vorn, dann sah sie den Verband. Er war um ihre linke Armbeuge geschlungen, und zwischen den Bahnen aus Gaze ragte ein kleiner Anschluss aus Plastik heraus, der mit einem blauen Ventil verschlossen war. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Susan begriff: Das war ein Zugang zu ihrer Vene. Sie hatte so etwas schon gesehen, als sie vor Jahren mit einer Blutvergiftung in einer Klinik in Hamburg lag. Da hatte man ihr auch einen Zugang gelegt und eine Infusion nach der anderen verpasst. Aber jetzt war sie nicht krank, und das hier war auch keine Klinik.
Aber warum hatte sie dann diesen Zugang im Arm, und warum standen neben dem Tisch diese verchromten Ständer mit den Haken, die waren doch für Infusionen? In diesem Moment spürte Susan, wie eine neue Welle von Angst sie durchlief. Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten und schluchzte tonlos, denn sie wusste plötzlich, dass sie in diesem Raum sterben würde.
In diesem Moment registrierte sie, dass sie nicht alleine war. Im Schatten neben der Tür stand ein Mann und beobachtete sie aus kalten, dunklen Augen. Er kam auf sie zu. Sie hatte diesen Mann schon gesehen. Er war so freundlich gewesen. Was wollte er jetzt von ihr? In diesem Moment legte sich ein Tuch auf ihr Gesicht. Die Welt wurde schwarz, dann spürte sie einen Stich im Arm, und Sekunden später durchlief ihre Adern etwas wie Feuer. Ihr Körper bäumte sich ein letztes Mal auf.
1. KAPITEL
Es roch schon nach Herbst, die Sonne stand jeden Tag flacher über dem Horizont, und die Nächte wurden spürbar kühler, dabei war erst Ende September. Jetzt am Vormittag schwebte über manchen Senken noch der feine Dunst der vergangenen Nacht. Die Weintrauben hingen prall und glänzend an den Reben. Eigentlich hätten sie dringend abgeerntet werden müssen, aber in der vergangenen Woche hatte es geregnet, und während des Regens die Trauben zu ernten wäre ein Frevel. Das Wasser entzog den Früchten ihre Süße. Darum hatten die Winzer noch gewartet. Eine gefährliche Wette gegen die Zeit, denn irgendwann würden die Trauben so reif werden, dass sie durch ihr Gewicht von den Stielen abfielen, und dann gab es da ja auch noch die Vögel und die Käfer. Aber heute war es so weit. Der Wetterbericht hatte Sonne und blauen Himmel für die ganze kommende Woche vorausgesagt. Und mit einem Schlag hatte überall in der Provence die Weinlese begonnen.
Dr. Leon Ritter, Rechtsmediziner aus Frankfurt, hatte die schmale Landstraße über Bormes-les-Mimosas und La Mole genommen. Und jetzt zuckelte er mit seinem Peugeot Cabriolet, Baujahr 1993, hinter einem Traktor mit Anhänger her. An Überholen war nicht zu denken. Aber Leon verspürte auch keine Lust, Gas zu geben. Er genoss die Ruhe und die Langsamkeit. Er hatte das Verdeck aufgeklappt, und in seinem Lieblingssender, Radio Nostalgie, sang Jacques Brel »Ne me quitte pas«.
Der Wind wehte den Geruch von warmer Erde und frischem Laub durch den Wagen. Ein Tag wie im Paradies, dachte Leon. Natürlich hätte er von Le Lavandou aus auch direkt die Autobahn nach Nizza nehmen können, aber Leon wollte unbedingt in Grimaud auf einen Café crème Station machen. An jedem anderen Tag hätte das nur einen lästigen Umweg bedeutet, aber nicht heute, nicht am 26. September. Nicht an dem Tag, an dem Sarah verschwunden war.
»Können wir nicht diese Opa-Musik abschalten?« Lilou sah vom Beifahrersitz hinüber. Die Fünfzehnjährige hatte ihre Sneakers weggekickt und die nackten Füße gegen das Handschuhfach gestemmt.
»Das ist Jacques Brel. Der beste Chansonnier, den es je gegeben hat.«
»Er jammert doch nur rum, dass sie ihn nicht verlassen soll«, sagte Lilou mit gespieltem Pathos. »Und dann will er ihr Gold und Licht auf den Körper legen – wie schräg ist das denn? Der Typ hat doch echt einen an der Klatsche.«
»Er ist schon über dreißig Jahre tot.«
»Was, so lange, na dann …«, sagte Lilou in einem Ton, als wäre der Song zu Zeiten Napoleons aufgenommen worden.
»Nimmst du bitte deine Füße da runter«, sagte Leon geduldig.
»Hilfe, Herzinfarkt, das wunderbare Auto!« Lilou wischte übertrieben mit der Hand das Armaturenbrett ab, als müsste sie ihre Spuren beseitigen. »Die Kiste ist so was von 80er«, sagte sie, und in ihrer Stimme schwang die Erkenntnis mit, dass alte Leute wie Leon irgendwie schrullig, aber harmlos sind.
»Ich mag die Achtziger.« Leon korrigierte die Position des Rückspiegels, den Lilo zu sich gedreht hatte, um ihre Augenbraue zu betrachten.
»Bist du sauer oder was?«, fragte sie.
»Nein, wieso?«
»Du machst ein Gesicht, als wäre dir dein Eis in den Sand gefallen«, meinte Lilou. Leon musste grinsen. Er hatte keine eigenen Kinder, aber Lilou war genau so, wie er sich eine Tochter gewünscht hätte. Aber er wusste auch, wie »uncool« es wäre, so einen Gedanken auszusprechen. Er sah mit einem warmen Blick zu Lilou hinüber.
Eine halbe Stunde später parkten sie den Peugeot in Grimaud am Place Neuve, gingen hinüber zum Café de France und setzten sich auf die Terrasse in den Schatten der Platanen. Von hier oben hatte man einen eindrucksvollen Blick über die Ebene und auf die Ausläufer des Massif des Maures und weiter nach Osten auf den Golf von Saint-Tropez. Der kleine Ort Grimaud hatte sich in den letzten Jahren stark verändert, aber dabei doch seinen speziellen Charme nicht verloren. Ein trutziges Dorf mit mittelalterlichen Wurzeln, das auf der Kuppe eines Hügels lag, von wo aus die Bewohner die Ebene bis zum Meer kontrollieren konnten. Kein Wunder, dass die Sarazenen den Ort nie erobert hatten. Aber was den Kriegern aus dem Morgenland nicht gelungen war, hatten tausend Jahre später die Touristen geschafft. Sie kauften den Einwohnern ein Haus nach dem anderen ab und verwandelten das beschauliche Örtchen in ein überlaufenes Ausflugsziel.
»Café crème pour monsieur et le Coca pour mademoiselle«, die Hand des Kellners zitterte leicht, als er die Getränke servierte. Leon beobachtete den großen, schmalen Mann mit den dunklen Augenringen. Raucher, dachte er, als er den leicht gelblich verfärbten Fingernagel der rechten Hand bemerkte. Die Schatten um die Augen konnten auf eine nicht ausgeheilte Hepatitis hinweisen.
In Sekunden hatte Leon den Fremden mit dem analytischen Blick des Rechtsmediziners diagnostiziert. Eine Berufskrankheit, die ihn gelegentlich daran hinderte, sich auf seine Gesprächspartner zu konzentrieren, weil er seinen Gegenüber am liebsten fragen würde, ob er mit seiner Diagnose richtiglag. Schließlich konnte er mit seinen »Patienten«, so nannte er die Toten, die er zu obduzieren hatte, nicht mehr über ihre Beschwerden reden. Bei seinen Gutachten über die Todesursachen verließ er sich gerne auf seinen Instinkt und sein Gefühl. Dabei waren es keineswegs nur Mord und Totschlag, die unsere Kulturgesellschaft dezimierten. Die größten Killer des täglichen Lebens waren Zigaretten, Alkohol, Stress und ungesunde Ernährung.
»Kannst du nicht mal mit Maman reden?« Lilou riss Leon aus seinen Gedanken.
»Worüber soll ich denn mit deiner Mutter reden?«
»Du weißt doch, wie sie ist in letzter Zeit.« Lilou schubste mit ihrem Finger die Eiswürfel durch die Cola. »Manchmal komm ich mir vor wie im Gefängnis, echt.« Leon sah das Mädchen an.
»Weißt du, wer mich vom Hockeyturnier in St. Claire abgeholt hat? Didier, mit dem Streifenwagen.« Sie sah zu Leon hinüber. »Das war so was von uncool. Die anderen denken schon, ich wär ’ne Koks-Dealerin oder dass ich anschaffen geh.«
»Keiner denkt so was.« Leon lächelte. Aber er wusste, dass Lilou recht hatte. Seit der Entführung war Isabelle, ihre Mutter, übervorsichtig. Das hatte sich zwar in letzter Zeit etwas gelegt, aber gelegentlich schien die Erinnerung sie einzuholen, und dann neigte die stellvertretende Polizeichefin von Le Lavandou zu Überreaktionen. Für ihre Tochter hieß das: Kontrollen per Handy, kein spätes Nach-Hause-Kommen von Partys und Überprüfung aller neuen Freunde.
»Was soll ich tun?«, fragte Leon.
»Überrede sie, dass ich mal wieder bei Inès übernachten darf.«
»Was du aber in Wirklichkeit gar nicht vorhast …«, sagte Leon entspannt.
»Wieso?« Lilou sah ihn unschuldig an. »Was denkst du denn?«
»Ich denke, dass es um Lucas geht. Wie alt ist er?«
»Du bist nicht mein Vater.«
»Nein. Ich bin dein Freund, und du bittest mich um Hilfe.«
Lilou beobachtete eine Frau, die einen frisierten Pudel wie ein Baby im Arm vorbeitrug und ihn dabei mit Keksen fütterte. Dann richtete sie den Blick wieder auf Leon.
»Wie alt warst du, als du deine erste Freundin hattest? Ich meine, eine richtige Freundin?«
»Du bist ganz schön neugierig.«
»Ich dachte, Erwachsene wollen ständig über Sex reden?«, sagte sie mit provozierendem Unterton.
»Wenn du es genau wissen willst: Ich war achtzehn.«
»Und sie?« Lilou sah ihn prüfend an.
»Also, ich weiß wirklich nicht, was das damit zu tun haben soll.« Was rechtfertigte er sich überhaupt vor diesem frechen Biest, dachte Leon.
»Wie, war sie so jung?«, bohrte Lilou hartnäckig nach.
»Quatsch, sie war sechzehn.«
Triumphierender Blick von Lilou. »Ich bin auch fast sechzehn. Und Lucas ist zweiundzwanzig.«
»Bring ihn mal mit.«
»Damit du ihn sezieren kannst?«
»So etwas würde ich nie tun.«
Lilou verdrehte die Augen. Die beiden beobachteten eine Weile, wie eine Gruppe chinesischer Touristen an dem Café vorbeidrängte, gegen die Stühle rempelte und wie eine Horde Schafe die Straße hinaufgetrieben wurde – zur Burgruine, von der aus man einen sensationellen Blick hatte.
Lilou unterbrach das Schweigen. »Warum wolltest du unbedingt hierher?«
»Nur so.«
»Jetzt schwindelst du aber«, sagte Lilou. »Es ist wegen ihr, stimmt’s?« Leon sah sie an, sagte aber nichts. »Bist du mit ihr hier gewesen?« Leon nickte. »Wann war das?«
»Wir müssen los, sonst kommen wir zu spät zu Tante Odette nach Nizza.« Er winkte dem Kellner zu. »L’addition s’il vous plaît.«
2. KAPITEL
Wenn am Ende des Sommers die meisten Touristen Le Lavandou verlassen hatten, wurde auch die Arbeit für die Frauen und Männer der Gendarmerie nationale wieder ruhiger. Ein paar Autoaufbrüche, gestohlene Motorroller und geklaute Handtaschen auf dem Wochenmarkt gehörten schon zu den größeren Verbrechen, die es aufzuklären galt. Dazu kamen noch die Autounfälle, meistens Blechschäden, die um diese Jahreszeit allerdings signifikant anstiegen. Das wiederum hing mit der Weinlese zusammen. Denn wenn tagsüber in den Weinbergen hart gearbeitet wurde, gab es abends immer etwas zu feiern, und der Rosé der letzten Saison wartete nur darauf, getrunken zu werden.
In der Regel drückten die Flics beide Auge zu, sie wussten, dass der durchschnittliche Blutalkoholspiegel der Südfranzosen während der Weinlese höher war als an den meisten anderen Tagen des Jahres. Aber wenn sie doch mal einen Autofahrer bei einer Alkoholkontrolle erwischten, konnten die Strafen empfindlich sein. Was wiederum für ausgiebige Diskussionen in Cafés und Bistros sorgte, bei denen über die sturen und uneinsichtigen Flics hergezogen wurde.
Im Polizeirevier in der Avenue Paul André del Monte gab es an diesem Vormittag nur kleine Probleme zu lösen. Capitaine Isabelle Morell, stellvertretende Polizeichefin, legte ihre Hand beruhigend auf den Arm von Madame Auteuil. Die pensionierte Lehrerin hatte ihr rosagefärbtes Haar auf dem Kopf so stark toupiert, dass die Frisur Isabelle an Zuckerwatte erinnerte. Madame Auteuil sah die Polizistin durch ihre großen Brillengläser zornig an. Es ging um Roger, ihren achtjährigen Siamkater, der hinter der rolligen Nachbarskatze her war. Isabelle musste die erzürnte Tierfreundin enttäuschen. Die Gendarmerie nationale hatte keine rechtliche Handhabe, die Katze der Nachbarin wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aus dem Verkehr zu ziehen.
»Mein Roger ist ein anständiger Kater«, sagte Madame im Brustton der Überzeugung und hielt Isabelle ein Foto der Katze hin. »Es ist diese Mimi von gegenüber mit ihrem lüsternen Gejaule, die macht ihn ganz verrückt. Eine ordinäre Straßenkatze, wenn Sie mich fragen. Ohne jede Klasse. Aber wen wundert’s – bei der Besitzerin.«
Isabelle hatte die pensionierte Lehrerin gerade zur Tür gebracht, als sie die junge Frau entdeckte, die sich ans äußerste Ende der Besucherbank gesetzt hatte. Eine außergewöhnliche Schönheit, die ihre Attraktivität mit einer ausgewaschenen Jeans und einem braven T-Shirt zu verbergen schien. Die blonde Besucherin war Anfang zwanzig. Sie wirkte verunsichert und warf verstohlene Blicke in Richtung der vorbeigehenden Polizisten, wie jemand, der etwas Wichtiges sagen will, sich aber nicht traut. Isabelle, in blauer Uniformhose und hellblauer Bluse mit der Aufschrift »Gendarmerie« und dem Flammensignet auf dem Ärmel, hielt der Besucherin die Hand hin.
»Isabelle Morell«, sagte sie, »kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Die Besucherin zögerte einen Augenblick, dann ergriff sie Isabelles Hand. »Anna Winter«, sagte sie, »ich suche meine Schwester. Ich … komme aus Deutschland, Hamburg. Verzeihen Sie, aber ich spreche nicht gut Französisch … meine Schwester ist fort, verschwunden, verstehen Sie?«
»Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Gleich hier drüben.« Isabelle deutete auf eine Tür im Gang, auf der »Capitaine Isabelle Morell« stand. Anna erhob sich und folgte Isabelle. Ihnen kam ein Polizist mit nordafrikanischen Gesichtszügen entgegen, den die Schulterklappen mit den zwei Streifen als Lieutenant auswiesen.
»Moma, könntest du bitte für unseren Gast und mich einen Cappuccino besorgen«, sagte sie und wendete sich an Anna. »Sie mögen doch Cappuccino?«
»Sehr gerne, aber Sie brauchen sich nicht extra wegen mir so viel Mühe zu machen.«
Moma winkte ab. »Kein Problem. Kaffee kommt sofort, Isabelle«, sagte er mit einem breiten Lächeln.
Isabelles Büro war nicht besonders groß, und der Blick ging auf den Hof , wo das Boot des Chefs auf einem Trailer stand, aber es war ihr eigenes Büro, und das bedeutete eine Menge in Le Lavandou. Schließlich war sie die erste Frau, die es in dem Ferienort zur Stellvertreterin des Polizeichefs gebracht hatte.
Moma hatte zwei Pappbecher mit Cappuccino und eine Untertasse mit Zuckerstücken vorbeigebracht. Anna saß auf dem Besucherstuhl, und Isabelle hatte ihren Stuhl hinter dem Schreibtisch hervorgezogen, so dass die beiden Frauen sich jetzt wie im Café gegenübersaßen und nicht wie in einem Polizeibüro.
»Ihre Schwester Susan war also schon vor Ihnen hier in Le Lavandou.«
»Sie hat ein Zimmer bei den Pelletiers genommen. Das ist so ein kleiner Feinkostladen.«
»Ich kenne Pelletier«, sagte Isabelle. »Und dort hat sie auch gejobbt?«
»Nur für ein paar Tage. Wir wollten bei der Weinernte mithelfen. Aber Susan hat mir am Telefon gesagt, es würde sich alles verzögern.«
»Es hat zu viel geregnet in den letzten Wochen, aber heute fangen sie an. Wann sind Sie hier in Le Lavandou angekommen?«, fragte Isabelle.
»Vor drei Tagen. Ich war noch bei Freunden in Orange. Aber Susan ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Wenn sie eine Verabredung nicht einhält und nichts von sich hören lässt, dann …« Sie unterbrach sich, um ihren Verdacht nicht aussprechen zu müssen.
»Aber Sie haben doch erzählt, Ihre Schwester hätte Ihnen eine Nachricht hinterlassen.«
»Nur eine einzige SMS, sonst haben wir jeden Tag miteinander telefoniert.«
»Was genau stand in der Nachricht?«
»Warten Sie«, Anna griff in ihre Handtasche und zog ihr Handy heraus. Sie tippte auf dem Display, während sie weitersprach. »Hier: Mit einem Freund nach Arles. Ich nahm das Auto. Bis dann.« Sie hielt Isabelle das Handy mit der kurzen Botschaft hin. »Das klingt irgendwie seltsam.«
»Was meinen Sie?«, fragte Isabelle.
»Die Formulierung: Ich nahm das Auto.«
»Ist das nicht richtig geschrieben?«
»Doch schon, aber es klingt irgendwie so steif. Nicht so, wie sie schreiben würde.«
»Sie haben natürlich versucht, sie anzurufen?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Isabelle gab Anna das Handy zurück.
»Es meldet sich nur die Mailbox.«
»Vielleicht möchte Ihre Schwester mit ihrem neuen Freund ein paar Tage ungestört sein.«
Anna schüttelte den Kopf. »Susan weiß, dass ich mir Sorgen mache. Und dass sie unser Auto mitnimmt. Einfach so, ohne das mit mir abzusprechen.«
»Was für ein Wagen ist es denn?«
»Ein Golf. Ist schon ein paar Jahre alt. Er ist blau«, sie griff in ihre Tasche und zog einen Zettel heraus, den sie vor Isabelle auf den Tisch legte. »Ich habe das Kennzeichen für Sie aufgeschrieben.«
Isabelle beobachtete die junge Frau genau. Sie spürte, wie Anna versuchte, ihre Angst zu unterdrücken und ruhige, vernünftige Angaben zu machen, während sie am liebsten losheulen würde. Und jetzt musste Isabelle ihr auch noch sagen, dass die Polizei im Moment nichts für sie tun konnte.
Tausende von Frauen wurden jedes Jahr in Frankreich als vermisst gemeldet. Frauen, die ihre Männer nicht mehr ertragen konnten, Frauen, die ihre Familien verließen, um in ihre Heimatländer zurückzukehren, Frauen, die vor ihren Schulden flohen, und Frauen, die sich in einen anderen verliebten. Und immer hinterließen sie fassungslose und verzweifelte Freunde und Angehörige. Aber die Statistik sagte auch, dass die allermeisten von ihnen innerhalb eines Jahres wieder auftauchten. Isabelle hatte einige solcher Fälle bearbeitet, und alle waren gut ausgegangen. Aber bei dieser jungen Frau, die so verstört und zerbrechlich wirkte, hatte sie vom ersten Moment an das Gefühl, dass sich deren dunkle Ahnungen bewahrheiten könnten.
»Es ist etwas passiert«, sagte Anna und sah aus dem Fenster, dann drehte sie sich zu Isabelle um. »Etwas sehr Schlimmes …« Ihre Stimme versagte.
Isabelle sah, wie der jungen Frau Tränen in die Augen stiegen.
»Wie gut kennen Sie Ihre Schwester?«
»Wir sind Zwillinge. Eineiige Zwillinge.« Sie nahm ein Foto aus der Tasche und reichte es Isabelle. »Bitte, Sie müssen sie suchen. Jetzt gleich.«
»Wir können nicht einfach auf einen Verdacht hin …« Isabelle unterbrach sich, als sie den unglücklichen Ausdruck in Annas Gesicht sah. Dann griff sie zum Hörer der Telefonanlage auf ihrem Schreibtisch und drückte einen Knopf.
»Moma, könntest du bitte mal eine Abfrage machen? Es geht um eine Touristin: Susan Winter … ja, aus Deutschland. Verkehrsunfälle und Kliniken … Sie wollte nach Arles … Golf, blau … deutsches Kennzeichen«, sie sah zu Anna, die nickte, »ja, Hamburger Nummer, danke.« Isabelle legte den Hörer auf und sah wieder ihre Besucherin an.
»Sie wollen gar nicht nach ihr suchen?« Anna klang so, als hätte sie Isabelle eben bei einer großen Lüge ertappt.
»Das können wir nicht, selbst wenn wir es wollten«, sagte Isabelle freundlich. »Ihre Schwester ist über achtzehn Jahre alt. Da dürfen wir nur tätig werden, wenn es Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Zum Beispiel, dass sie entführt wurde, oder Spuren einer Gewalttat, verstehen Sie?«
»Sie wollen mir nicht helfen.« Das war eine Feststellung. »Aber Sie machen einen Fehler. Einen ganz großen Fehler.«
3. KAPITEL
Wenn man in Nizza die Promenade des Anglais entlangfuhr, kam einem das Hotel Negresco immer so vor, als wäre es aus der Zeit gefallen. Es erinnerte Leon an alte Schwarzweißfotos mit Damen in langen Sommerkleidern und großen Hüten, die mit ihren Begleitern die Seepromenade entlangflanierten, in Zeiten, als man den Autoverkehr noch nicht fürchten musste.
Um in die Empfangshalle des Negresco zu gelangen, musste man unter den großen goldenen Blechbuchstaben durchgehen, die aussahen, als schwebten sie über dem Eingang eines Zirkuszelts. Und eigentlich war es ja genau das: ein Zirkus der Reichen und Schönen.
Das Negresco war ein Grandhotel, das seinen Namen verdiente, dachte Leon. Es strahlte diesen unvergleichlich morbiden Charme der Belle Époqueaus, den kein Innenarchitekt künstlich herstellen konnte. Es war diese ganz besondere Atmosphäre, die in den alten Wänden zu stecken schien. Das Flair, das von Generationen von Filmstars, Spielern, Zarentöchtern, Schriftstellern und Hochstaplern seit über hundert Jahren hier hineingetragen wurde. Das Grandhotel vermittelte ein wunderbares Gefühl der Ruhe, so als wollte dieses Haus seine Gäste vor dem grellen, lauten Leben außerhalb seiner Mauern beschützen. Ein Platz zum Entspannen und damit genau Leons Geschmack.
Nicht dass Leon je eine Nacht im Negresco verbracht hätte, aber seine Mutter hatte ihn, als er noch ein Kind war, gelegentlich mit hierhergenommen, um sich mit ihrer Schwester Odette auf einen Tee zu treffen. Tante Odette hatte Anthony, einen Lebemann – wie man damals sagte –, geheiratet, und der bot seiner Frau zumindest zeitweise ein ausgesprochen komfortables Leben. Anthony betrieb seine Geschäfte rund um den Globus. Geschäfte, über die manche Leute die Nase rümpften. Er handelte mit Olivenöl aus Griechenland und mit alten Schienen der Transsibirischen Eisenbahn. Und es ging das Gerücht, dass das kleine Hotel, das er in Marseille gekauft hatte, in Wahrheit ein Bordell war. Onkel Anthony war ein charismatischer Mann, dessen Charme man sich nur schwer entziehen konnte. Er war ein Mann, den die Frauen liebten. Immer aufmerksam, stets elegant gekleidet und nie um ein Kompliment verlegen. Und er verabredete sich grundsätzlich im Negresco. Leon mochte seinen Onkel Anthony, und er war vom ersten Moment an fasziniert von diesem Hotel.
»Sag mal, haben die hier überhaupt Internet?« Lilou hielt ihr Smartphone in die Höhe, drehte sich und warf einen kritischen Blick in die holzgetäfelte Empfangshalle.
Sie trug Cargo-Pants und ein knappes Top. Auf ihren Sandalen glitzerten Plastikblümchen. Leon ertrug diese Verkleidung mit Fassung. Es war Lilous Art, den Leuten zu zeigen, dass sie an gesellschaftlicher Etikette nicht interessiert war. Zu seiner Verwunderung hatte der Portier ihr trotzdem die Tür aufgehalten. Und der Concierge, der Leon ausrichtete, dass seine Tante ihn in der Royal Lounge erwartete, tat so, als hielte er Lilous Outfit für modische Extravaganz.
»Merkst du was?«, sagte Lilou zu Leon.
»Was denn?«
»Hier gibt’s nur alte Leute«, sagte Lilou und erntete einen vorwurfsvollen Blick von Leon.
»Was denn? Hier ist doch keiner unter vierzig«, sagte Lilou, ohne die Stimme zu senken. »Willst du dich nicht mit deiner Tante alleine treffen? Wir können uns doch dann später wieder in der Halle sehen?«
»Tante Odette möchte dich aber gerne kennenlernen«, sagte Leon. Lilou verzog das Gesicht. »Pass auf, du sagst ihr guten Tag, und dann kannst du verschwinden.«
»Echt?« In Lilous Stimme klang Hoffnung auf.
Die beiden betraten die Royal Lounge, einen großen, ovalen Raum. Die Nischen mit den alten Ölgemälden wurden von Säulenpaaren getragen, und über allem wölbte sich ein Glasdach. Der Saal war in strahlendem Weiß gehalten mit goldenen Stuckapplikationen, so dass sich Leon vorkam wie im Inneren einer riesigen Sahnetorte. Der einzige Bruch in diesem noblen Ambiente war eine quietschbunte »Nana«, eine Figur der Künstlerin Niki de Saint Phalle, die dem Raum etwas Verruchtes gab.
Tante Odette saß an einem der runden Tische, vor sich einen Tee. Eine gepflegte Dame von Anfang achtzig, mit bläulich schimmerndem Haar. Elegant gekleidet und mit sympathischen Falten im Gesicht und jungen blauen Augen.
»Du bist eine Viertelstunde zu spät, mein lieber Leon«, sagte Tante Odette.
»Ich freu mich auch, dich zu sehen, Tante Odette.« Leon beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie rechts und links auf die Wangen. »Das hier ist Lilou«, stellte er das Mädchen vor.
Lilou reichte Odette die Hand. »Bonjour, Madame«, sagte sie so artig, dass Leon irritiert zu ihr herübersah.
»Schicke Hose«, sagte Tante Odette, als sie dem Mädchen die Hand schüttelte. »Ich wette, da musste der Concierge ganz schön schlucken.«
»Er hat so getan, als hätte er nichts gesehen«, meinte Lilou.
»Das erinnert mich daran, wie ich hier einmal dem belgischen König begegnet bin«, sagte Tante Odette. »Damals war ich ungefähr so alt wie du, das war Ende der vierziger Jahre. Meine Schwester und ich waren mit unseren Eltern hier verabredet. Und da tauchte plötzlich König Leopold von Belgien auf. Und ich habe mit meiner Schwester gewettet, dass ich mitten in der Eingangshalle vor dem König ein Rad schlagen würde.«
»Im Kleid?«, fragte Lilou neugierig.
»Natürlich im Kleid«, sagte Odette, »wir hätten doch niemals in Hosen ins Negresco gehen dürfen.«
»Und?«, fragte Lilou neugierig. »Haben Sie’s getan?«
»Natürlich hab ich’s getan.« Die Tante grinste bei der Erinnerung. »Mitten in der Halle. Den Concierge hat fast der Schlag getroffen. Der König hat applaudiert, und die Gäste hatten Gesprächsstoff für Tage.«
»Wow«, sagte Lilou beeindruckt.
»Ich kann auch heute noch ein Rad schlagen«, sagte Odette.
»Bitte nicht«, sagte Leon schnell und war sich nicht sicher, ob sie es ernst meinte.
In diesem Moment brachte der Kellner ein Tablett mit zwei Gläsern Champagner und einer Cola.
»Du magst doch Cola«, sagte Odette zu Lilou.
»Danke, gerne.«
Der Ober stellte die beiden Champagnergläser auf den kleinen, runden Tisch.
»Bitte nicht für mich, Tante Odette«, versuchte Leon vergeblich, den Champagner abzulehnen.
»Ach, komm schon, Junge«, Odette ergriff die beiden Gläser und reichte eines ihrem Neffen. »Du kennst doch die Redensart: Wer nein zu Champagner sagt, sagt nein zum Leben.« Dann fixierte sie Leon mit ihrem Blick. »Und außerdem musst du dich stärken, denn wir haben etwas Wichtiges zu besprechen.«
4. KAPITEL
Der Mann schlich sich vorsichtig an der niedrigen Mauer entlang. Nur eine hektische Bewegung würde alles zunichtemachen. Seit über einer Stunde wartete er schon auf den richtigen Augenblick. Bei dieser Jagd kam es auf Geduld an. Auf Geduld und auf Schnelligkeit. Seine Beute würde der Mann hier in den Murets finden, den aus Naturstein gemauerten Stufen, die seit Jahrhunderten die Weinberge in Terrassen unterteilten. Von hier oben hatte man einen grandiosen Blick auf die Ebene, wo sich der kleine Fluss Réal Collobrier glitzernd zwischen den Feldern entlangschlängelte, auf denen die Weinlese begonnen hatte. Aber der Mann interessierte sich nicht für die Aussicht. Er interessierte sich nur für die Jagd.
Die Mauereidechse war vorsichtig. Ihre größten Feinde waren Bussarde und Marder. Darum zog sie sich nachts tief in die Spalten zwischen den Steinen zurück. Jetzt, Ende September, konnte es nach Sonnenuntergang schon empfindlich kühl werden. Und wenn ihre Körpertemperatur sank, wurden die Bewegungen der Eidechse träge. Sie war nicht in der Lage, durch Stoffwechsel für eine ausreichende Körpertemperatur zu sorgen. Was die Eidechse mehr als alles andere benötigte, war das wärmende Licht der Sonne. Die Wärme war ihr Lebenselixier. Die machte sie schnell und zu einem geschickten Jäger, der sogar eine Fliege im Vorbeiflug schnappen konnte. Aber jetzt war die Eidechse noch nicht aufgewärmt, und darum bewegte sie sich wie in Zeitlupe. Vorsichtig schob sie sich aus der Mauerritze und kroch auf den Stein, den die Mittagssonne gerade erst erreicht hatte. Nur ein paar Minuten in der Wärme, und sie wäre bereit, nach Beute zu suchen.
Der Mann hatte die Eidechse längst entdeckt. Er schien sich selber wie ein Reptil zu bewegen. Immer wieder blieb er stehen und verharrte regungslos.
Eine Mauereidechse, genau das, wonach er gesucht hatte. Langsam schob er die Hand nach vorn, ohne die Steine zu berühren. Die Eidechse bewegte den Kopf hin und her, um ihre Umgebung zu sondieren. Für schnelle Bewegungen fehlte ihr im Moment noch die Kraft. Darum sah sie auch nicht die Hand des Mannes, die sich ihr von hinten näherte. Der Jäger achtete darauf, keinen Schatten auf das Tier zu werfen. Die Eidechse würde den Temperaturunterschied sofort bemerken und wieder zwischen den Steinen verschwinden.
Der Mann wusste, dass er schnell zupacken musste. Ein falscher Griff, und die Eidechse würde ihren Schwanz abstoßen. Ein Trick, um mögliche Angreifer zu verwirren und fliehen zu können. Aber eine Eidechse ohne Schwanz war für den Mann wertlos. Er brauchte dieses Tier in seiner ganzen vollkommenen Schönheit. Die Bewegung seiner linken Hand erfolgte so plötzlich und schnell, dass die Eidechse ihn erst bemerkte, als er sie schon gepackt hatte und ihren Kopf zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. Er spürte die glatte, kühle Haut des Reptils auf seiner Handfläche und die scharfen kleinen Krallen, mit denen es verzweifelt versuchte, sich aus der Falle zu befreien. Für einen Moment betrachtete der Mann das Tier, wie es sich da hilflos in seiner Hand wand. Dann drückte er mit einer kurzen Bewegung des Daumens den Kopf der Eidechse über den Zeigefinger nach vorne, und mit einem leisen Knacken brach er dem Reptil das Genick.
5. KAPITEL
»Oh bitte, jetzt chill mal wieder«, Lilou hatte die Knie angezogen und es sich auf dem Beifahrersitz bequem gemacht. In der Hand hielt sie ihr Smartphone, das mit Kopfhörern verbunden war, die sie sich in die Ohren gesteckt hatte.
»Wir hatten siebzehn Uhr ausgemacht«, Leon sah zu dem Mädchen hinüber.
»Häää?«, fragte Lilou und nahm sich demonstrativ einen der beiden Stöpsel aus dem Ohr.
»Siebzehn Uhr. Wir hatten siebzehn Uhr ausgemacht.«
»Ja, Chef. Tut mir voll leid, echt.«
»Ich habe über vierzig Minuten auf dich gewartet«, sagte er. »Odette musste sogar mit dem Taxi zurück in ihr Stift fahren.«
Es war inzwischen später Nachmittag, und Leon fuhr auf der A8, die sich von Nizza aus durch das Hinterland zog. Leon mochte die Strecke. Besonders den Teil, wenn sich die Autobahn an den Felsen von Roquebrune vorbeischwang, die in der späten Nachmittagssonne dunkelrot leuchteten. Nachdem er bei Le Cannet auf die Autobahn nach Süden abgebogen war, wurde der Verkehr ruhiger. Über Kilometer schienen sie überhaupt das einzige Fahrzeug zu sein. Die Straße nahm noch eine letzte Höhe, dann konnte man kilometerweit in die Ebene von Gonfaron schauen. Überall auf den Feldern waren die Erntehelfer bei der Weinlese zu sehen. Schwerbeladene Traktoren schafften Container mit frisch geschnittenen Reben zu den Weingütern mit ihren Pressen, Filtern und Tanks. Für die Weinbauern würde es eine lange Nacht werden, dachte Leon. Ein guter Wein war wie eine schöne Frau, hatte ihm mal ein Winzer erklärt. Er brauchte Aufmerksamkeit und Zuwendung. Leon lächelte.
»Ich fand Tante Odette echt nett. Wirklich.« Lilou sah nicht auf, sondern tippte eifrig eine Nachricht in ihr Smartphone.
»Kannst du das Ding nicht mal weglegen? Schau nach draußen. Du wohnst in einer der schönsten Gegenden Europas, und du siehst nicht mal hin.« Jetzt rede ich wirklich schon wie meine Mutter, dachte Leon.
»Ja, ja, ganz toll«, sagte Lilou betont gelangweilt und starrte weiter auf das Display ihres Handys. »Bin gespannt, was du sagst, wenn du hier erst mal ein paar Jahre gewohnt hast.«
Leon brummelte vor sich hin. Vielleicht war es doch ganz gut, dass er keine Tochter hatte. Mädchen in Lilous Alter konnten wirklich anstrengend sein.
»Wer war eigentlich der Typ, der dich vorm Negresco abgesetzt hat?«
»Keine Ahnung. Ich hab ihn nur gefragt, wie ich zurück zum Hotel komm. Da hat er mich mitgenommen.«
»Du bist zu ihm aufs Motorrad gestiegen? Einfach so?«
»Meine Güte, er hat mich ja nicht vergewaltigt«, sagte Lilou. »Er hat mich nur vor dem Hotel abgesetzt. Ich fand’s cool.«
Leon hatte sich schon Sorgen gemacht. Er fühlte sich für Lilou verantwortlich. Sicher, sie war nicht seine Tochter. Aber sie war ihm ans Herz gewachsen in dem Jahr, in dem er jetzt das Zimmer im Haus ihrer Mutter bewohnte. Er wusste auch, wie besorgt Isabelle um ihre Tochter war. Besonders nach der Entführung und dem großen Feuer im letzten Sommer.
Er hatte schon überlegt, Isabelle anzurufen, als Lilou nicht aufgetaucht war. Er wollte ihr sagen, dass sie sich wahrscheinlich verspäten würden. Aber dann hätte er erklären müssen, dass Lilou irgendwo allein in Nizza unterwegs war und nicht an ihr Handy ging, und das hätte bei Isabelle für Panik gesorgt.
Aber seine Sorge war unberechtigt gewesen. Offenbar regelten sich manche Dinge von alleine, wenn man ein hübsches Mädchen und fünfzehn Jahre alt war. Nachdem Leon fast eine Dreiviertelstunde unruhig in der Halle gewartet hatte, war plötzlich dieser Kerl mit der Harley aufgetaucht. Lederjacke, dunkle Sonnenbrille, schwarzer Helm und Vollbart. Und hinter ihm, zart wie eine Elfe, saß Lilou. In der Hand eine nachtblaue Papiertüte mit goldenem Aufdruck. Küsschen rechts und links, und dann war der Rocker davongeknattert.
Lilou löste eines ihrer bunten Bändchen vom Handgelenk und legte es Leon auf den rechten Arm.
»Was ist das?«, fragte Leon.
»Halt still«, sagte Lilou und knotete das Bändchen fest. »Das ist ein Freundschaftsband. Das tragen alle diesen Sommer. Lass mal sehn … Sieht doch cool aus.«
»Ich weiß nicht.« Leon betrachtete skeptisch das Bändchen an seinem Handgelenk.
»Damit siehst du viel jünger aus«, meinte Lilou.
»Wirklich?« Leon betrachtete noch einmal das Bändchen. »Also cool und jünger. Hast du noch eins?« Leon lächelte und griff wieder ans Steuerrad.
Die Sonne stand jetzt flach über dem Horizont und brachte die Grün- und Rottöne in der Natur zum Leuchten. An manchen Stellen hatten die Bauern die Artischocken nicht geerntet, sondern sie ausblühen lassen. Jetzt leuchteten diese Felder in einem überirdischen Violett.
»Du hast noch gar nicht erzählt, was deine Tante von dir wollte.«
Leon lächelte geheimnisvoll. »Das erfährst du, wenn wir bei deiner Mutter sind.«
»Jetzt komm schon, Leon. Ich bin extra mitgekommen, um dir mit deiner Tante zu helfen. Da kannst du mir auch verraten, was sie von dir wollte.«
»Nein, du bist mitgekommen, weil du shoppen wolltest.«
»Du bist so doof«, sagte Lilou, steckte sich wieder den Kopfhörer ins Ohr und tippte weiter in ihr Smartphone. Leon nahm es nicht persönlich.
6. KAPITEL
Das Abendessen war improvisiert, aber lecker. Es gab Pizza von Chez Sylvia. Sogar Leon, der sich nicht viel aus Pizza machte, musste zugeben, dass die Pizza aus dem Steinofen der Korsin göttlich schmeckte. Eigentlich durfte Pizza bei Isabelle zu Hause nur in Notfällen gegessen werden. Zum Beispiel, wenn sie mal überraschend länger als sonst im Polizeirevier bleiben musste oder wenn sich, wie heute Abend, alles verzögerte und zum Kochen keine Zeit blieb.
»Schickes Bändchen«, hatte Isabelle gesagt, als Leon mit Lilou nach Hause kam.
»Hab ich von deiner Tochter bekommen«, sagte Leon. »Macht mich angeblich jünger.«
»Unbedingt«, sagte Isabelle mit einem Lächeln und nahm ihm den Karton mit der Pizza ab.
Leon hatte bemerkt, dass Isabelle in letzter Zeit nur noch selten kochte. Dabei liebte Lilou den Couscous ihrer Mutter. Natürlich gab es im Sommer bei der Gendarmerie immer viel zu tun, aber Leon hatte das Gefühl, dass Isabelle an manchen Tagen absichtlich länger im Büro blieb, als wollte sie ihren Erinnerungen ausweichen. Aber heute Abend war die Stimmung gut, und alle warteten darauf, dass Leon verriet, warum seine Tante ihn in Nizza unbedingt hatte sprechen wollen.
»Jetzt mach es nicht so spannend«, sagte Lilou.
»Na gut, dann werde ich euch einen kleinen Hinweis geben.« Leon sah in die Runde. Dann griff er in die Tasche seines Leinensakkos und zog etwas heraus, das er leicht in der Hand verbergen konnte.
»Es ist keine Uhr«, sagte Leon und zu Lilou gewandt. »Und mit dem Gold lagst du auch falsch.«
Vor einer Woche hatte Tante Odette Leon angerufen und Andeutungen gemacht, es gäbe da etwas, das sie ihm anvertrauen wollte. Etwas, das seinem Onkel Anthony zu Lebzeiten sehr am Herzen gelegen hatte. Isabelle und Lilou hatten sich in wilden Spekulationen übertroffen, was die Tante Leon wohl zu verschenken hätte.
Leon öffnete mit einer theatralischen Geste die Hand, und man hörte etwas auf den Tisch klappern. Es war ein alter verschrammter Schlüssel mit Bart, an dem ein Anhänger befestigt war, eine kleine Eidechse aus Kunststoff.
Lilou griff mit spitzen Fingern nach dem Schlüssel. »Wofür ist der denn?« Sie rümpfte die Nase.
»Für ein Haus bei Collobrières«, sagte Leon, »ein Haus mit einem eigenen Weinberg.«
»Im Ernst? Zeig mal.« Isabelle nahm Lilou den Schlüssel ab und drehte ihn in der Hand, als könnte sie auf diese Weise abschätzen, zu welcher Art von Haus er wohl passen würde.
»Ist bestimmt nur so ’ne verwanzte Garage«, sagte Lilou.
»Ein ganzer Weinberg – wie groß ist der?«, fragte Isabelle.
»Tante Odette hat was von einem Hektar gesagt.«
»Ist das viel?«, fragte Lilou.
»Für ein paar Flaschen Rosé sollte es reichen«, erwiderte Leon.
»Na toll, ein Weinberg mit einer Garage«, sagte Lilou.
Leon musste an Tante Odette denken. Wie sie im Negresco den Schlüssel bedeutungsvoll neben sein Champagnerglas gelegt hatte.
»Mein Anthony hat immer von einem eigenen Weinberg geträumt«, hatte die Tante gesagt, und ihre Augen waren dabei feucht geworden. »Jetzt kannst du diesen Traum für deinen Onkel weiterleben.«
Immer wenn Tante Odette theatralisch wurde, läuteten bei Leon die Alarmglocken. Sie hatte den Weinberg einen »einmaligen Ort« genannt, war aber selber schon zwanzig Jahre nicht mehr dort gewesen. So wie Leon es sah, war der Weinberg nur eine weitere verrückte Investition seines Onkels gewesen. Irgendwann mit Enthusiasmus in Angriff genommen und nach kürzester Zeit wieder vergessen. Aber immerhin schien es den Weinberg tatsächlich zu geben.
»Du wirst diesen Ort lieben«, hatte ihm die Tante mit entrücktem Blick erklärt, »und das kleine Haus, das dazugehört – ein Ort wie im Himmel.« Dabei hatte Odette die Augen verdreht und verzückt zur Decke der Royal Lounge gesehen.
Leon kannte Tante Odette, und darum klang das alles für ihn stark nach einem verwilderten Stückchen Land mit einer windschiefen Hütte darauf. Tante Odette wollte ihm dieses »Kleinod«, wie sie es nannte, überschreiben, einfach so. Sie hatte angeblich alles schon mit einem Notar in Pierrefeu besprochen. Was Leon jetzt nur noch tun musste, war unterschreiben. Was sich für ihn irgendwie nach weiteren Problemen anhörte.
Ein Weinberg war in Leons Augen etwas für Menschen mit Gärtnerambitionen. Und die hatte er gar nicht. Auf der anderen Seite fühlte es sich irgendwie gut an, wenn man sagen konnte, dass man einen Weinberg besaß.
»Da könntest du deinen eigenen Wein produzieren«, sagte Isabelle.
»Ich habe keine Ahnung, wie man Wein produziert«, entgegnete Leon, »aber es klingt nach einer Menge Arbeit.«
»Wir würden dir natürlich helfen. Stellt euch vor, die eigenen Reben ernten. Wäre das nicht fantastisch? Irgendwie so archaisch …«, schwärmte Isabelle.
»Ihr braucht mich gar nicht so anzusehen.« Lilou blickte finster zu ihrer Mutter. »Glaub bloß nicht, dass ich durch irgendeinen Weinberg krieche und Trauben aufsammle.«
»Soweit ich weiß, schneidet man die Reben mit einer Schere ab und sammelt sie in einer Trage«, meinte Isabelle.
»Fail!«, sagte Lilou und hob demonstrativ beide Hände in Abwehrhaltung.
»Was meint sie?«, fragte Leon.
»Fail and over«, wiederholte Lilou.
»Ist Computersprache«, erklärte Isabelle geduldig. »Das passiert, wenn Kinder nur noch mit ihrem Handy sprechen. Allerdings braucht man sie auch nicht mehr zu füttern. Du kannst sie direkt an die Ladestation hängen.«
»Sehr lustig«, sagte Lilou. »Die Trauben könnt ihr selber einsammeln. Ich mach euch auf keinen Fall den Ernte-Sklaven. Da mähe ich ja noch lieber unseren Rasen.«
»Du bist mein Zeuge, Leon«, sagte Isabelle, und dann zu ihrer Tochter: »Das mit dem Rasen, ist das ein Deal?«
»Warum fahren wir morgen Nachmittag nicht einfach mal rüber und sehen es uns an? Sind doch nur zwölf Kilometer«, bot Leon an.
»Tolle Idee«, meinte Isabelle begeistert. Lilou verdrehte nur genervt die Augen.
7. KAPITEL
Anna fröstelte. Es war kühl geworden auf der Terrasse des Restaurants Galiote in der Rue Patron Ravello. Bei zwei Gläsern Wein hatte sie ohne Appetit einen Teller Nudeln gegessen. Sie war frustriert und erschöpft. Alle ihre Bemühungen, eine Spur von ihrer Schwester Susan zu finden, waren ins Leere gelaufen. Inzwischen war Anna in das Fremdenzimmer eingezogen, das ihre Schwester bei dem Ehepaar Pelletier gemietet hatte. Hier stand immer noch Susans roter Samsonite, der einen Teil ihrer Klamotten enthielt. Darunter auch das neue Sommerkleid mit dem Blumenmuster, das sie so liebte. Warum hatte sie das nicht mitgenommen, wenn sie mit einem Kerl unterwegs war? Nur ihr kleiner Wanderrucksack fehlte.
»Susan, wo sind Sie denn gewesen?«, hatte Madame Pelletier Anna begrüßt, als sie vor drei Tagen den Delikatessenladen in der Rue Charles de Gaulle betrat.
Es passierte Anna oft, dass man sie mit ihrer Schwester verwechselte. Ein Schicksal, das sie mit den meisten eineiigen Zwillingen teilte. Wenn man ein Kind ist, macht es Spaß, Freunde und Lehrer in die Irre zu führen. Aber als Anna erwachsen wurde, fühlte es sich an, als hätte sie gar keine eigene Identität. Als würde sie von ihrer Umwelt nur noch wahrgenommen, wenn sie mit ihrer Schwester Susan zusammen auftrat. Vielleicht lag es auch gar nicht so sehr am Aussehen, dachte Anna. Vielleicht lag es ja daran, dass sie und ihre Schwester absolut unterschiedliche Charaktere waren. Susan war der Sonnenschein. Ihr strahlendes Lächeln war mitreißend, und sie schien sich völlig unbeschwert durchs Leben zu bewegen. Susan war kühn und leichtsinnig, doch die Gefahren hatten immer einen Bogen um das schöne Mädchen gemacht, das jeder mochte. Und die Männer verzehrten sich nach Susan mit den strahlend blauen Augen, den vollen Lippen und den hohen Wangenknochen, die ihrem Gesicht einen leicht orientalischen Touch gaben.
Anna fehlte die Unbeschwertheit ihrer Schwester. Sie war von Anfang an die Nachdenklichere der beiden gewesen. Und sie war es auch, die sich ständig Sorgen um ihre Schwester machte. »Du bist die Erstgeborene«, hatte ihre Mutter immer zu ihr gesagt, »darum musst du auf Susan aufpassen.« Das war natürlich nur ein Scherz, denn Anna war genau sieben Minuten vor ihrer Schwester auf die Welt gekommen. Und trotzdem fühlte sie sich bis heute für ihre »jüngere« Schwester verantwortlich.
Wahrscheinlich hatte die nette Polizistin recht, dachte Anna, und sie machte sich mal wieder unnötig Sorgen. Mit einem Jungen spontan für ein paar Tage in der Camargue zu verschwinden, war das nicht typisch Susan? Ihre Schwester hatte sich verliebt, war mit dem Auto nach Arles gefahren, und morgen oder übermorgen würde sie wieder auftauchen. Braun gebrannt mit ihrem entwaffnenden Lächeln und ohne jedes schlechte Gewissen.
Aber aus irgendeinem Grund wusste Anna, dass das nicht geschehen würde. Sie konnte nicht sagen, warum, es war so ein Gefühl. Ein Gefühl, wie sie es noch nie in ihrem Leben gespürt hatte. Als wäre die unsichtbare Verbindung zu Susan mit brutaler Gewalt zerrissen worden. Anna fühlte sich plötzlich verlassen, wie der letzte Mensch auf dem Planeten. Sie saß alleine auf der Terrasse des Restaurants, und Tränen liefen ihr über die Wangen. Der Kellner mit dem Wechselgeld sah sie besorgt an und sagte etwas auf Französisch, das Anna nicht verstand.
»Alles okay«, antwortete Anna, »pas de problème.« Sie setzte ihre Sonnenbrille auf, um die Tränen zu verbergen. Dann stand sie auf, ließ ein paar Euro auf dem Tisch liegen und ging.
Jetzt, Ende September, waren die Straßen und Gassen von Le Lavandou um zehn Uhr abends bereits wie leer gefegt. Als hätte es den Touristenrummel im Juli und August nie gegeben. Der Ferienort am Meer lag in tiefer Ruhe. Kein Gedränge in den Straßen, keine plärrende Musik aus den Eissalons und den Bistros. Das Riesenrad am Strand hatte längst die Beleuchtung abgeschaltet und seinen Dienst eingestellt. Sogar das kleine Karussell, vor dem sonst Eltern warteten, während sich ihre Kinder um die besten Plätze in Feuerwehrautos und fliegenden Untertassen stritten, war unter regendichten Planen verpackt. Der ganze Ort schien seinen Pulsschlag verlangsamt zu haben und sich von der Hektik des Sommers zu erholen.
Plötzlich traf es Anna wie ein eisiger Windstoß. Irgendetwas stimmte nicht. Sie blieb stehen, als wäre sie in einen Sumpf geraten, in dem jeder falsche Schritt das Ende bedeuten könnte. Anna sah sich vorsichtig um. Sie war allein in der Gasse, die nur vom Schein einer einzelnen Straßenlaterne beleuchtet wurde. In diesem Moment entdeckte sie den Mann. Das hieß, sie sah nur seinen Schatten, der sich so langsam in einen düsteren Durchgang zurückzog, als würde er schweben. Nur der Glanz eines Augenpaares, in dem sich das Licht spiegelte, war für die Dauer eines Wimpernschlags in der Dunkelheit zu erkennen. Dann hatte die Nacht den Unbekannten verschluckt.
Anna merkte, dass sie für ein paar Sekunden den Atem angehalten hatte. Sie war wie gelähmt. Sie dachte, sie hätte den Tod gesehen. Anna drehte sich um und rannte los, rannte zum Place Ernest Rayer zur Brasserie du Centre, dahin, wo Menschen saßen, Wein tranken und lachten, zurück ins Licht und ins Leben.
8. KAPITEL
Leon Ritter, Rechtsmediziner am Krankenhaus Saint-Sulpice, parkte sein Cabriolet auf seinem persönlichen Stellplatz. Die Klinik befand sich am Rand der Kleinstadt Hyères, keine zwanzig Kilometer von Le Lavandou entfernt. Hier, im Keller des neuen Anbaus, war erst kürzlich eine moderne pathologische Abteilung eingerichtet worden. Ein Prestigeprojekt von Klinikleiter Dr. Hugo Bayet, der damit seinen Ruf festigen und seine Chance auf eine Professur an der Universitätsklinik in Marseille erhöhen wollte.
Leon hatte Dr. Bayet auf einer Tagung in Toulouse kennengelernt, wo er als leitender Mitarbeiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt einen Gastvortrag über »Blutspurenmuster-Verteilungsanalyse« halten sollte. Bayet war beeindruckt und bot ihm den Job in seiner Klinik an. Für Leon war das Angebot die Chance, seiner Vergangenheit zu entfliehen. Mit dem Verlust seiner Frau war Leons Leben aus dem Tritt geraten. Bei dem Flugzeugabsturz war alles in einem gewaltigen Feuer verbrannt. Von seiner Frau Sarah hatte sich überhaupt keine Spur mehr gefunden. Das hatte dazu geführt, dass Leon sich eingeredet hatte, dass seine Frau vielleicht von dem Unglück verschont worden war. Fünfmal war er in den folgenden Jahren nach Thailand geflogen, um eigene Ermittlungen anzustellen, was zu einer Kette von Problemen geführt hatte. Leon zog sich schließlich völlig zurück, vernachlässigte seine Freunde und stürzte sich geradezu manisch in seine Arbeit. In das Haus im Taunus, in dem er zusammen mit Sarah gewohnt hatte, kam er nur noch gelegentlich, um zu übernachten. Meist blieb er in Frankfurt, wo er sich in der Nähe des Universitätskrankenhauses ein kleines Zwei-Zimmer-Apartment gemietet hatte. Er arbeitete jede Nacht und schließ nur noch wenige Stunden.
Da schien das Angebot, an der Klinik in der Provence zu arbeiten, wie ein Wink des Schicksals. Es war für Leon so etwas wie ein neuer Anfang gewesen. Da er bei seiner französischen Mutter und seinem deutschen Vater zweisprachig aufgewachsen war und außerdem vier Semester in Paris studiert hatte, gab es für ihn keine Verständigungsprobleme. Trotzdem war sein deutscher Akzent für Franzosen unüberhörbar. Darum war er für viele Kollegen und Bekannte der Docteur Allemand, und er würde es wohl auch immer bleiben.
Vor Leon glitt die automatische Glastür zur Seite, und er betrat die Empfangshalle des fünfstöckigen Klinikanbaus. Er trug eine Papiertüte der Bäckerei Lou wie eine Monstranz vor sich her, als er auf Schwester Monique zuging, die in der Patientenaufnahme saß und ihn anstrahlte. Die Bäckerei Lou in der Avenue Charles backte nicht nur das mit Abstand beste Brot von ganz Le Lavandou, sondern hatte auch eine köstliche Auswahl an hausgemachtem Gebäck zu bieten.
»Ich dachte, ich könnte Sie vielleicht für ein Pain au chocolat von Lou gewinnen«, sagte Leon. Das war natürlich eine rein rhetorische Frage, denn Schwester Monique, knapp 1,60 Meter groß und ziemlich mollig, war geradezu süchtig nach Pain au chocolat.
»Danke, Docteur«, sagte sie und ließ die Tüte blitzschnell in einer Schublade verschwinden. »Aber eigentlich bin ich im Moment auf Diät.«
Leon lächelte, er wusste, dass das Gebäck nicht mal die nächste Stunde überleben würde.
»Gab’s was?«, fragte er. Normalerweise war es um diese Zeit ruhig. Da die meisten Touristen längst wieder abgereist waren, blieb für Leon wenig zu tun. Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ging im September signifikant zurück. Aber auch Schlaganfälle und Herzinfarkte wurden deutlich weniger, wenn sich übergewichtige Touristen nicht mehr in der glühenden Mittagssonne mit den Weinen der Region überforderten.
»Wir haben einen tödlichen Unfall«, erklärte Monique ungerührt. »Ein Weinbauer, wurde vom eigenen Traktor überrollt, bei Pierrefeu-du-Var.«
»Die sollen ihn uns rüberschicken, ich seh ihn mir morgen an.«
»Er ist aber schon unten und wartet auf Sie«, sagte Schwester Monique und meinte es nicht ironisch.
Für Leon waren die Toten wie »Patienten«. Und er erwartete von allen Mitarbeitern, dass sie das genauso sahen. Als Leon vor fast zwanzig Jahren in Frankfurt von der Notfallchirurgie zur Rechtsmedizin gewechselt war, hatten ihn die Kollegen gewarnt, mit zu viel Empathie an diese neue Aufgabe heranzugehen. Das würde ihn kaputtmachen. Er müsste die Opfer so betrachten, wie sie auch Staatsanwaltschaft und Richter sahen, als Beweismittel.
Doch Leon betrachtete die Toten als menschliche Wesen, die einmal Freunde, eine Familie, ein Leben gehabt hatten. Darum hatten sie ein Recht darauf, mit dem gleichen Respekt behandelt zu werden wie all die lebenden Patienten auf den Stationen im Rest der Klinik. Die Toten in der Pathologie waren Leons Verbündete bei der Aufklärung von Verbrechen. Weil sie ihm sowohl die Geschichte ihres Lebens als auch ihres Todes erzählen konnten, wenn er nur genau genug hinsah. Die Kollegen in Frankfurt hatten anfangs ihre Witze über Leon gemacht. Sie hielten ihn für einen schrulligen Eigenbrötler, der nicht lange durchhalten würde. Aber was die Aufklärung von Kapitalverbrechen betraf, waren Dr. Leon Ritters Erfolge inzwischen legendär.
»Die Polizei braucht die Blutalkoholwerte und die genaue Todesursache. Am besten noch heute, haben sie gesagt.«
»Die bekommen ihre Werte schon noch früh genug«, sagte Leon.
Als er in den Sektionsraum kam, hatte sein Assistent Olivier Rybaud bereits den Toten vorbereitet. Auf dem Tisch aus rostfreiem Stahl lag ein Mann von Mitte sechzig. Auch unter dem grünen Tuch konnte Leon erkennen, dass der Brustkorb eingedrückt war.
»Bonjour, Docteur«, sagte Rybaud. Er hatte einen Bericht in der Hand, der in einer abwaschbaren Klarsichtfolie steckte. »Opfer männlich, 64 Jahre alt. Größe 176 Zentimeter, Gewicht 79 Kilo. Der Mann wurde von seiner eigenen Erntemaschine überrollt.«
Leon schlug das grüne Tuch zurück und betrachtete den Brustkorb. Grobstollige Reifen hatten das feine Gewebe der Epidermis zerrissen und eine tödliche Spur hinterlassen. Leon betrachtete den Mann. Er war übergewichtig für jemanden, der hart arbeiten musste. Die Hände waren kräftig und die Haut von Sonne und Wind braun und trocken gebrannt. Rechts trug er einen schmalen goldenen Ehering, den er schon viele Jahre nicht mehr abgenommen und der sich tief in die Haut eingeschnitten hatte. Im Gesicht hatte der Mann tiefe Falten, und sein Haar war grau. Die Zähne im halbgeöffneten Mund waren vom Rauchen braun verfärbt. Leon konnte regelrecht spüren, wie dieser Mensch sein Leben lang und bei jedem Wetter in den Weinbergen geschuftet hatte. Und dann, eine kleine Unaufmerksamkeit, und das war’s.
Leon fielen die Füße auf, die geschwollen waren, genau wie die Vorderseite der Unterschenkel. Das konnte ein Hinweis auf eine rechtsseitige Herzinsuffizienz sein. Das Ergebnis von Wassereinlagerungen, weil ein geschwächter Herzmuskel nicht mehr richtig arbeitete und dann der Blutstau in den Venen zu Wassereinlagerungen in den Gefäßen führte.
»Die Polizei will die Alkoholprobe schnell wegen der Kfz-Versicherung.«
»Was wollen die denn?«, fragte Leon.
»Die Erntemaschine ist ungebremst gegen die Halle gerauscht. Die Maschine ist im Eimer. Hundertfünfzigtausend Euro futsch.«
»Woher wissen Sie das denn schon wieder?«, wunderte sich Leon.
Rybaud zuckte mit den Schultern. Er stammte aus der Gegend um Pierrefeu und schien einfach jeden zu kennen.
»Das da ist Georges Matin«, sagte Rybaud und deutete auf den Toten. »Hatte ein kleines Weingut bei Pierrefeu, um das muss sich jetzt wohl seine Witwe alleine kümmern. Keine Ahnung, wie die das schaffen will, ohne die Maschine.«
»Und die Versicherung …«, sagte Leon und ließ es wie eine Frage klingen.
»Hofft natürlich auf eine Mitschuld des Unfallopfers, damit sie nicht den ganzen Schaden übernehmen muss. Blutsauger«, sagte Rybaud, ohne eine Emotion zu zeigen.
Rybaud war nie anzusehen, was er dachte. Seine Miene war absolut ausdruckslos. Und er schien sich völlig geräuschlos durch die Räume der Pathologie zu bewegen. Für Leon hatte sein Assistent etwas von einem Geist. Aber er war nie krank, erschien immer pünktlich und arbeitete zuverlässig.
»Machen Sie einen Bluttest und noch eine Urinprobe zum Abgleich.«
»Oui,Docteur, hab schon alles vorbereitet«, sagte Rybaud und machte sich an die Arbeit.
Das Erntefahrzeug hatte den Mann von rechts erwischt, wobei er auf den Rücken gefallen sein musste. Das Gewicht der schweren Maschine hatte die Rippen eingedrückt. Leon öffnete den Brustkorb, und sein Verdacht bestätigte sich. Zwei Rippen waren unter dem Druck des Reifens gesplittert, und eine davon hatte sich in den Herzbeutel gebohrt. Der Knochen hatte schließlich die Wand der rechten Herzkammer durchstoßen und die Trikuspidalklappe zerrissen, die den Rückfluss des Blutes in den Vorhof verhindern sollte. Innerhalb weniger Sekunden war der Kreislauf des Mannes kollabiert. Das Gehirn wurde nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, und der Winzer starb.
Für einen Augenblick sah Leon den Mann zwischen seinen Weinstöcken auf dem Rücken liegen, die Spätsommersonne im Gesicht, und sein letzter Gedanke war vermutlich, dass er sterben würde. Leon gab sich einen Ruck und setzte die Untersuchung fort. Die Lunge war die eines starken Rauchers, wie es bei der Verfärbung der Zähne zu erwarten gewesen war. Aber dann entdeckte er noch etwas anderes. Eine kleine Verengung auf der Vorderseite des Herzmuskels an der linken Kranzarterie, wo ein kleines Blutgerinnsel einen Verschluss gebildet hatte. Keine Frage, der Mann hatte einen Herzinfarkt erlitten.
»Haben Sie schon den BAK-Wert?« Leon sah zu seinem Assistenten, der die Taste eines Messgeräts drückte, das daraufhin einen Papierstreifen ausdruckte.
»Jetzt liegt er bei 0,4 Promille.« Rybaud betrachtete den Ausdruck. »Zum Unfallzeitpunkt müsste der Blutalkoholwert demnach knapp überm Limit gelegen haben, bei gut 0,6 Promille.« Rybaud reichte Leon den Papierstreifen.
»Haben Sie die Zeit auch richtig berechnet?« Leon sah seinen Assistenten fragend an.
»Natürlich, Docteur, im Bericht der Polizei steht Unfallzeit 8.45 Uhr. Das war vor genau vier Stunden.« Rybaud tippte demonstrativ auf seine Armbanduhr.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.