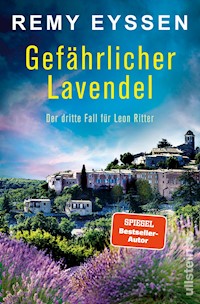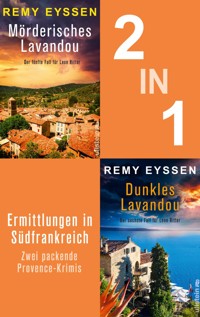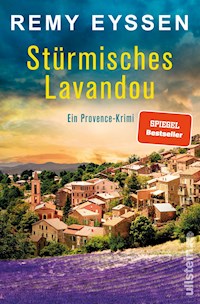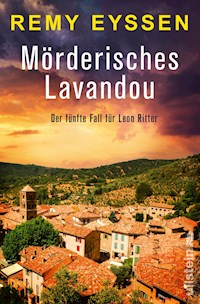9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dunkles Lavandou
Der Autor
REMY EYSSEN, geboren 1955, arbeitet als freier Redakteur unter anderem für die Münchner Abendzeitung. Seine Recherchen führten ihn in der Vergangenheit häufig zu den Schauplätzen großer Kriminalfälle. Seit den Neunzigern schreibt er Drehbücher für zahlreiche deutsche Filme und Fernsehkrimis. Mit der Leon-Ritter-Reihe begeistert er seine Leserinnen und Leser und landet regelmäßig auf der Bestsellerliste.Von Remy Eyssen sind in unserem Hause bereits erschienen:Tödlicher Lavendel · Schwarzer Lavendel
Das Buch
Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen …
Remy Eyssen
Dunkles Lavandou
Leon Ritters sechster Fall
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juni 2020© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München (Himmel); Sharpshooter / Redux / laif (Dorf)Autorenfoto: privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-2242-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
Leseprobe: Dreimal schwarzer Kater
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meiner Frau und meiner Tochterfür ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Der Sand war so warm, und die Wellen schlugen mit sanftem Rauschen an den Strand. Für einen Moment glaubte die junge Frau sogar, die wärmenden Strahlen der Sonne auf ihren geschlossenen Augenlidern zu spüren.
Wach endlich auf, mach die Augen auf!, mahnte sie eine innere Stimme.
Bitte, lass mir nur noch diese Minute, dachte die Frau und spürte, wie die Angst an ihrem Körper hochkroch. Das da draußen, das war nicht die Sonne, und es gab auch kein Meer und keine Wellen. Da draußen gab es nur noch das Böse. Da draußen, da war die Hölle.
Die Frau öffnete die Augen und blinzelte in das Licht einer Kerze, die in einem roten Glas stand. Der Raum, den sie nur spärlich erhellte, war kein wirkliches Zimmer, eher eine Zelle. Es gab kein Fenster und keine geraden Wände. Dieses Verlies schien aus grob behauenem Stein gebaut. Die Wände bestanden aus Fels, der sich wer weiß wie tief in die Dunkelheit erstreckte. Sie würde es nie erfahren. Sinnlos, darüber nachzudenken.
Die Frau senkte ihren Blick, und doch musste sie immer wieder zur gegenüberliegenden Wand sehen. Dorthin, wo die Knochen lagen und die Schädel. Sortiert und gestapelt in steinernen Nischen, bedeckt vom Staub der Jahrhunderte. Sie schloss erneut die Augen, so fest sie konnte. Nicht hinsehen, sagte sie sich, erinnere dich an die schönen Dinge. Sie dachte an ihre pinkfarbenen Flip-Flops mit dem Sternenmuster, die sie sich in einer Boutique am Hafen gekauft hatte. Wann war das gewesen? Gestern, vor einem Monat, vor einem Jahr?
Sie sah sich den Strand entlanglaufen und zurückklettern in das blau-weiße Fischerboot, das in der Bucht dümpelte. Da waren die anderen, die lachten und ihre Hände in das kühle Wasser hielten. Und da war der junge Mann, der sie ansah mit seinen großen, warmen Augen und dem wunderbaren Lächeln. Sie konnte das Lachen hören und den Duft des frischen Baguettes riechen und den gekühlten Rosé auf der Zunge schmecken.
Aber dann waren da plötzlich grobe Hände, die sie packten und zu Boden rissen. Heftige Schläge trafen sie. Harte Schläge, schmerzhafte Schläge mit Gerten und Peitschen. Sie versuchte, sich zu schützen. Hörte sich schreien. Nicht die Tonne, nur nicht das Wasser. Nicht noch einmal die Angst, ersticken zu müssen. Bitte, bitte, hört auf damit! Sie fühlte die Verzweiflung über sich zusammenschlagen wie eine Welle schmutzigen Wassers.
Die junge Frau öffnete erneut die Augen. Ihr war schwindlig. Hatte sie geschlafen? Wieso stand da ein Teller mit Brot? War er wieder hier gewesen? Ihr Atem kam jetzt stoßweise. Sie starrte in die Dunkelheit. Was war das für ein Geräusch, dieses leise Knirschen? Kam da nicht jemand den Gang entlang? Doch das waren keine Schritte, die über den harten Boden schlurften. Das war ein anderes Geräusch. Es klang wie ein entferntes Schluchzen. War da jemand? Gab es etwa in dieser Hölle jemanden, der ihr Schicksal teilte?
»Hallo?«, versuchte sie zu rufen. Aber ihre Stimme war so brüchig, dass ihr Ruf von der Dunkelheit verschluckt wurde wie ein Falter in der Nacht.
Die Frau versuchte, sich aufzusetzen, als sie mit einem hellen Schrei wieder zurückfiel. Ihr Körper war ein einziger Schmerz. Schultern und Knie stachen, als steckten kleine, spitze Nadeln in den Gelenken. Aber es waren nicht nur die Gelenke. Es war auch ihre Haut. Dort, wo sie die Flüssigkeit auf sie gegossen hatten, konnte sie die dunkelroten, aufgeplatzten Blasen sehen, und ihre Haut brannte wie Feuer.
Sie hätte schreien mögen, aber die Genugtuung wollte sie ihrem Peiniger nicht geben. Sie wimmerte leise vor sich hin. Wofür kämpfst du noch?, fragte sie sich. Du wirst sowieso in diesem Drecksloch sterben, und du kannst nichts dagegen tun.
»Verdammtes Schwein«, wollte sie schreien, aber sie hörte die eigene Stimme nur als heiseres Krächzen. Vielleicht war sie längst tot. Vielleicht stimmte ja die Geschichte vom Tag des Jüngsten Gerichts. Vielleicht war sie ja wirklich in der Hölle gelandet. Wieder spürte sie, wie eine Welle von Traurigkeit über sie hereinbrach und wie sie hemmungslos zu schluchzen begann. Es dauerte Minuten, oder waren es Stunden, bis sie sich beruhigt hatte. Sie fror, und die Schmerzen waren immer noch da. Nein, sie war nicht tot. Sie war definitiv nicht tot.
Mit einer letzten Anstrengung stemmte sie sich ein Stück an der Wand hoch, bis sie sitzen konnte. Vorsichtig hob sie den Kopf und betrachtete ihr Lager. Sie saß auf einer zerschlissenen Isomatte, die einmal hellblau gewesen war. Vielleicht hatte diese Matte an einem Strand gelegen, und Kinder hatten darauf gespielt. Jetzt war sie voller Risse und verkrusteter brauner Flecken. Sie versuchte nicht darüber nachzudenken, woher diese Flecken stammten. Neben der Matte stand der Blechteller und eine Plastikflasche mit trübem Wasser. Sie wollte aufstehen, aber das Klirren der eisernen Kette erinnerte sie daran, dass sie eine Gefangene in diesem Verlies war. Festgekettet mit dem Handgelenk an einem Ring in der Wand. Wieder ein Geräusch. Kam er jetzt? Kehrte er zurück, um ihr noch mehr Schmerzen zuzufügen? Sie sah nach rechts. Dort im Halbschatten stand die schmutzige Wanne, gefüllt mit brackigem Wasser. Bitte, nicht noch einmal das Wasser!
Die Frau atmete die feuchte, warme Luft. Sie hatte plötzlich wieder den metallischen Geschmack von Angst auf der Zunge, spürte, wie ihre Finger zu kribbeln begannen, wie eine fremde Macht die Kontrolle über ihren Körper zu übernehmen schien. Ihr blieb die Luft weg, und sie hörte ein Brausen in den Ohren.
Sie begann schneller zu atmen, in hektischen, flachen Stößen. Ihr wurde schwindlig. Sie zog die Knie eng an den Körper, ließ sich zur Seite kippen. Bitte, es soll aufhören, dachte sie. Einfach nur aufhören. Die Angst rollte über sie hinweg wie eine Welle.
Sie lag auf der Seite, die Knie angezogen wie ein Kind, das sich vor dem Einschlafen fürchtet. Jetzt konnte sie wieder ruhiger atmen, aber die Schmerzen kamen zurück. Wie viel Schmerz kann der Körper aushalten? Anfangs hatte sie gedacht, dass sie vielleicht den Geist von ihrem Körper trennen könnte. Dass der Schmerz sie nicht erreichen würde. Wie bei den Märtyrern, von denen sie gelesen hatte. Aber das hatte sie nicht geschafft. Sie hatte ihrem Peiniger die Genugtuung verschafft, sie leiden zu sehen, die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren und alle Hoffnung aufzugeben.
Es war wieder ganz still um sie herum. Würde man nach ihr suchen? War überhaupt jemandem aufgefallen, dass sie nicht mehr da war, da draußen in der anderen Welt, in der jetzt vielleicht die Sonne schien und die Bougainvilleen in ihrem Garten ihre blassrosa Blüten öffneten. Die Frau merkte, wie ihr bei dieser Vorstellung die Tränen kamen. Der Gedanke an das Licht, die Wärme und das Meer machte sie unendlich traurig. In diesem Augenblick hörte sie schlurfende Schritte, die lauter und lauter wurden. Sie hörte Gemurmel und vergaß zu atmen. Er kam zurück, und er wollte zu ihr.
1. Kapitel
Morgens um acht waren die meisten Händler noch mit dem Aufbau ihrer Stände beschäftigt. Manche reisten von weit an und folgten dem Wochenmarkt von Tag zu Tag in einen anderen Ort. Jetzt schien die frühe Junisonne flach über das Meer, und es ging noch gemütlich zu auf dem großen Parkplatz an der Avenue Vincent Auriol. Es war die Zeit, bevor sich die Touristen durch die schmalen Marktgassen drängten. Zwischen Ständen mit Olivenöl aus dem Massif des Maures, Wildschweinwurst aus dem Domaine de la Forêt, Doraden aus dem Meer und billigen Hawaiihemden aus China. Aber das würde sich schnell ändern. Wenn die Sonne höher stieg und den Markt aufheizte, würde es hier schon bald nur noch nach Schweiß und Sonnenöl riechen. Dann würden sich die Touristen gegenseitig zur Seite drängen und Einkaufen zum nervenaufreibenden Abenteuer machen. Aber noch war alles entspannt. Die Verkehrspolizei stellte die Umleitungsschilder auf, während die Gendarmerie nationale dafür sorgte, dass die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Ständen und Auslagen eingehalten wurden.
Leon war an einem schlichten Stand stehen geblieben, der etwas ramponiert wirkte. Auf zwei Klapptischen wurden Oliven in Plastikschalen und Kräuter in kleinen Tontöpfchen präsentiert, an denen selbst gemalte Etiketten klebten. Darauf stand »Rosmarin«, »Herbes de Provence«, »Thymian« oder »Wacholder«. Ein einzelner Schirm sollte die Kunden vor der Hitze schützen. Aber auch der hatte Löcher, durch die schon jetzt die Mittelmeersonne brannte. Ein handgemaltes Schild über der Auslage pries »Délices Provençaux«, und genau deswegen war Leon hierher, ganz ans Ende des Marktes, gekommen. Wegen der provenzalischen Köstlichkeiten, die Monsieur Clément Roman auf seinem Hof in den Hügeln herstellte und mit Unterstützung seiner Frau und seines Sohnes auf dem Markt verkaufte. Leon deutete auf eine Schale mit Tapenade, der köstlichen, schwarzbraunen Olivenpaste.
»Davon hätte ich gerne was«, sagte Leon und atmete den Duft von Rosmarin, Koriander und Majoran ein. Der Korb an seinem Arm war schwer von den Leckereien, die er bereits auf dem Markt eingesammelt hatte.
»Bien sûr, Docteur.« Monsieur Roman, der Besitzer des Standes, war Ende vierzig, groß und wirkte etwas schlaksig. Sein Gesicht war schmal, und die leicht schräg stehenden Augen gaben seinem Blick etwas Verlorenes. Dabei war Monsieur Roman immer freundlich und zuvorkommend. Im Hintergrund sah man seine Frau Amélie zusammen mit dem zwanzigjährigen Sohn Rodolphe Flaschen mit Olivenöl in Holzkisten von der Ladefläche des Transporters räumen. Die Frau musste früher eine Schönheit gewesen sein, dachte Leon. Ein Hauch von Karibik schien ihre Erscheinung zu umwehen. Monsieur Roman hatte einmal erwähnt, dass sie aus den französischen Überseegebieten nach Le Lavandou gekommen waren. Aus Guadeloupe, wenn Leon sich richtig erinnerte. Jetzt wirkte die Frau blass und müde, als würde sie sich von einer Krankheit erholen, dachte Leon. Amélie Roman schaute schnell zur Seite, als sich ihr Blick mit Leons traf.
»Amélie, gib mir mal eine von denen!« Roman zeigte auf die Flaschen mit dem selbst gepressten Olivenöl, und seine Frau reichte ihm eine, die er an Leon weitergab.
»Danke, aber davon habe ich noch«, meinte Leon.
»Ein Geschenk des Hauses«, sagte Roman mit einem Blick, der keinen Widerspruch zuließ. »Ist von der letzten Ernte.«
»Danke vielmals«, erwiderte Leon. »Dieses Jahr will ich aber dabei sein, wenn Sie das neue Öl pressen.«
»Das haben Sie letztes Jahr auch schon gesagt.«
»Die Arbeit.« Leon zuckte mit den Schultern.
In diesem Moment hörte man hinter dem Stand das Klirren von zerbrechendem Glas.
»Kannst du nicht aufpassen?«, raunzte Clément Roman seinen Sohn an.
Rodolphe erschien neben dem weißen Transporter. Er war ein ganzes Stück größer als sein Vater. Nur sein Kopf schien irgendwie zu klein geraten für den massigen Körper, der dem jungen Mann die Tapsigkeit eines Bären verlieh.
»Tut … tut mir leid«, entschuldigte sich Rodolphe mit piepsiger Stimme, die nicht zu seinem Aussehen zu passen schien. »Waren alle leer, kommt nicht wieder vor, Vater.«
»Schon gut«, meinte Roman milde. »Pass auf, dass du dich nicht schneidest, wenn du die Scherben forträumst.«
Leon lächelte verständnisvoll.
Lilou, die sich an dem Nebenstand Gürtel und Jeans angesehen hatte, kam zurück und sah in Leons Korb.
»Wer soll denn das alles essen?«, fragte sie.
»Oh, da kenne ich aber jemanden.« Leon sah die Sechzehnjährige mit einem Lächeln an. Sie trug zerfranste Jeans, die sie sich kurz über dem Knie abgeschnitten hatte, und als Oberteil ein übergroßes T-Shirt, von dem sie einen Zipfel hinter ihren Gürtel geklemmt hatte. Ihre wilden dunklen Haare waren zu einem Dutt gebändigt, den sie auf dem Hinterkopf verzwirbelt hatte und der von einem Klemmkamm in Form einer überdimensionalen Erdbeere gehalten wurde. An den Füßen trug sie Jesuslatschen. Es war ein wüstes Sammelsurium an Klamotten, aber an ihr sahen sie aus wie der extravagante Entwurf eines Modedesigners.
»Du hast gesagt, dass wir noch einen Kaffee bei René trinken«, drängelte sie.
»Da will ich Ihre Tochter natürlich nicht aufhalten.« Monsieur Roman schaute Leon nachsichtig an und reichte ihm die Plastiktüte mit dem Olivenöl und der Tapenade über den Tresen.
»Landet irgendwann sowieso alles im Meer«, sagte Lilou, und Monsieur Roman sah sie fragend an. »Die Plastiktüte. Irgendwann verschluckt sich ein Walbaby daran und stirbt.«
»Sie ist Umweltschützerin«, erklärte ihm Leon.
»Du brauchst dich nicht für mich zu entschuldigen.«
»Au revoir«, sagte Monsieur Roman, und es klang verdächtig nach: »Sie haben es aber wirklich auch nicht leicht …«
»Also, was wolltest du mir sagen?«, fragte Leon, als sie weitergingen.
»Wieso, was meinst du?«, tat Lilou überrascht.
»Wenn du so früh mit mir auf den Markt gehst«, Leon war vor dem Café Mobile stehen geblieben, »dann führst du doch irgendwas im Schilde.«
»Bonjour, Docteur.« Der Mann hinter der Theke des fahrbaren Cafés hieß Cyril. Er war Ende vierzig und übergewichtig. Ständig strich er sich mit den Fingern über seine Glatze, als gäbe es da noch irgendwelche Haare zu ordnen. Er wirkte immer etwas schmuddelig, doch heute hatte er eine weiße Schürze umgebunden, die erstaunlich sauber war. Das Café, mit dem Cyril von Markt zu Markt fuhr, war in einem uralten Citroën-Transporter Typ H untergebracht, der mindestens fünfzig Jahre auf den Achsen hatte. Die rechte Längsseite des Fahrzeugs ließ sich über die ganze Länge aufklappen und so in ein mobiles Bistro mit Vordach und Tresen verwandeln.
Auf den beiden Herdplatten hinter Cyril standen Pfannen, in denen Steak haché und Frites gebrutzelt wurden. Hier arbeitete Jaqueline. Die blonde Frau war mindestens fünfundzwanzig Jahre jünger als Cyril. Sie war die neueste Geliebte des Chefs, der seine Gefährtinnen häufiger wechselte als die Reifen seines fahrbaren Bistros. Leon staunte jedes Mal, wie es dem Wirt des Café Mobile gelang, dermaßen attraktive junge Frauen für sich und das entbehrungsreiche Leben in seinem fahrenden Imbiss zu gewinnen.
»Café crème für den Docteur?«, fragte Cyril sofort. »Und Mademoiselle?«
»Ich nehme auch einen Café crème«, sagte Lilou, der der musternde Blick des Wirts unangenehm war.
»Also?« Leon beugte sich zu Lilou und rückte etwas von dem Gast neben ihm ab, der um diese Uhrzeit bereits ein Hacksteak mit Fritten verdrückte und dazu ein Glas Rosé schlürfte.
»Es ist wegen der Ferien«, druckste Lilou herum. »Also Ingrid und ich, wir …« Sie zögerte. »Ich habe dir doch von dem fantastischen Haus auf Korsika erzählt, das ihre Eltern haben.«
Lilou brach ab und wartete auf Leons Reaktion. Der ließ sie einen Moment schmoren.
»Verstehe. Du willst also mit Ingrid nach Korsika, und ich soll Isabelle überreden zuzustimmen.«
»Du weißt doch, wie Maman ist.« Lilou sah Leon an. »Sie tut so, als wäre ich immer noch zwölf.«
»Ach, bist du nicht?« Leon grinste das Mädchen an. Lilou war die Tochter seiner Lebensgefährtin Isabelle, aber Leon hatte sie inzwischen ins Herz geschlossen, als wäre sie sein eigenes Kind. Dabei hatte Isabelle gute Gründe, vorsichtig zu sein. Die Entführung ihrer Tochter lag kaum vier Jahre zurück. Lilou hatte das Erlebnis längst überwunden, aber Isabelle holte gelegentlich noch die Erinnerung an die schrecklichen drei Tage ein, in denen Lilou verschwunden war.
»Bitte sprich du mit ihr«, sagte Lilou. »Auf mich hört sie ja nicht.«
»Weil sie Angst um dich hat. Das weißt du doch.«
»Und wie lange soll das noch gehen?« Lilou klang frustriert. »Bis ich dreißig bin oder vierzig?«
»Wie wäre es erst mal mit achtzehn?«, fragte Leon und erntete den verständnislosen Blick eines Teenagers. »Kommen Ingrids Eltern auch mit?«
»Ha, ha …« Lilou klang genervt.
»Und Bertrand?«, fragte Leon beiläufig.
Diesmal sah Lilou demonstrativ an ihm vorbei. Bertrand war Ende dreißig und arbeitete im Immobilienbüro. Leon hatte ihn einmal kurz kennengelernt. Er war höflich und charmant gewesen, ein wenig zu charmant, wie Leon fand. Und definitiv viel zu alt für ein junges Mädchen, das noch zur Schule ging und im nächsten Jahr sein Baccalaureate machen wollte. Lilou hatte natürlich abgestritten, dass Bertrand mehr als nur ein netter Bekannter war. Aber Leon war nicht die Nervosität entgangen, die Lilou befiel, wenn das Gespräch auf Bertrand kam.
»Das deute ich mal als ein Ja.«
»Ingrids Bruder Marc kommt jedenfalls mit«, sagte Lilou schnell.
»Bestimmt?« Das war immerhin ein Lichtblick. Leon kannte den Sohn der Nachbarn, der in Nizza Jura studierte und ein sehr verantwortungsbewusster junger Mann war.
»Glaubst du mir etwa nicht?« In Lilous Stimme schwang Trotz mit. »Denkst du, ich lüge?«
»Nein, ich denke, du hilfst nur der Wahrheit ein wenig auf die Sprünge.« Er sah sie abwartend an.
»Keine Ahnung, ob Bertrand auch kommt.« Lilou klang genervt. »Ich weiß nicht. Ja, vielleicht kommt er mal vorbei.«
»Aber Ingrids Bruder ist die ganze Zeit dabei?«
»Zumindest die erste Woche.« Lilou sah Leon an. »Er will eine Rucksacktour durch Korsika machen, mit seinen Freunden.«
»Also die meiste Zeit …« Leon sprach den Satz nicht zu Ende.
»… sind Ingrid und ich alleine«, ergänzte Lilou, »na und?«
»Nicht ganz alleine«, meinte Leon cool. »Ich meine, nicht wenn Bertrand vorbeikommt.«
»Du nervst.« Lilou nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. »Wenn Marc zurück ist, bleiben wir noch ein paar Tage, dann fahren wir alle gemeinsam zurück nach Lavandou. Das ist schon alles.«
»Klingt ja harmloser als ein Aufenthalt im Kloster.«
»Immer tun alle so, als wollten wir den ganzen Tag Party machen.«
»Wollt ihr etwa nicht?«, fragte Leon, und Lilou verdrehte die Augen. »Liegt vielleicht daran, dass Eltern auch mal sechzehn Jahre alt waren. Kaum zu glauben, oder?«
Lilou wollte etwas erwidern, überlegte es sich aber dann anders.
»Na gut, ich spreche mit Isabelle«, sagte Leon. Lilou gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Aber nur unter der Bedingung, dass Marc auch wirklich mitkommt und dieser Bertrand nur ein guter Bekannter ist.«
»Du bist so was von misstrauisch«, schmollte Lilou.
»Nur vorsichtig«, meinte Leon. »Ich rede mit Isabelle.«
»Echt?« Lilou nickte glücklich. »Danke!«
2. Kapitel
Die Wache der Gendarmerie nationale war vor einigen Jahren aus dem Zentrum des Ortes in ein Neubaugebiet verlegt worden. Das war nicht aus städtebaulichen oder ästhetischen Gründen geschehen, sondern der alte Steinbau war einfach zu klein geworden und den Aufgaben einer modernen Polizeistation nicht mehr gewachsen.
Die neue Wache war ein schlichter einstöckiger Bau, ockerfarben mit dem Flammensymbol der Gendarmerie nationale auf den Glastüren. In den Wintermonaten dämmerte die Wache vor sich hin. Doch wenn im Juni die Touristen kamen, erwachte die Polizeistation schlagartig aus ihrem Dornröschenschlaf und verwandelte sich in ein hektisches Provinzrevier. Denn mit den Touristen zog es jedes Jahr auch Frankreichs Ganoven in Richtung Süden. Vom Autodieb bis zum Trickbetrüger, vom Taschendieb bis zum Hochstapler, während der Sommersaison hofften sie alle, an der Côte d’Azur das schnelle Geld zu machen. Für drei Monate wurde aus dem idyllischen Ort am Mittelmeer ein summendes Wespennest und verschaffte den Flics von Lavandou mehr Arbeit, als ihnen lieb sein konnte. Aber kaum gingen mit der ersten Septemberwoche die Sommerferien zu Ende, packten auch die Ganoven ihre Koffer, fuhren zurück in die Metropolen, und in Le Lavandou kehrte wieder Ruhe ein.
Capitaine Isabelle Morell, stellvertretende Polizeichefin, drängte sich durch den Flur der Wache. An den Markttagen war immer besonders viel los. Streitereien zwischen verärgerten Bürgern und genervten Flics drangen aus den Büros. Es ging um gestohlene Handtaschen, eingeschlagene Autoscheiben, ungerechte Strafzettel oder Fahrraddiebstähle.
»Madame? Madame …!« Jemand tippte Isabelle energisch auf den Arm.
»Capitaine«, korrigierte Isabelle und sah den Mann an, der neben ihr stehen geblieben war. Er war Mitte vierzig, leicht übergewichtig und trug eine hellblaue Bermudashorts, dazu ein ehemals weißes Hemd, das ihm über den Gürtel hing. Sein Gesicht zeigte hektische rote Flecken, und sein schütteres Haar konnte die Halbglatze nur unzureichend verdecken.
Isabelle hatte sich so umgedreht, dass der Mann die drei goldenen Streifen auf ihren Schulterklappen erkennen konnte, die sie als Capitaine der Gendarmerie nationale auswiesen.
»Capitaine, excusez-moi«, sagte der Mann betont höflich, als hätte er etwas gutzumachen. »Ich möchte Anzeige erstatten, jetzt gleich.«
»Da gehen Sie am besten den Gang hinunter und melden sich bei Lieutenant Kadir.« Sie deutete den Gang hinunter. »Da vorne, die dritte Türe links.«
»Da war ich schon. Der hat mich ja zu Ihnen geschickt«, sagte der Besucher gereizt.
»Zu mir?«, fragte Isabelle. Offenbar hatte der Besucher auch schon ihren Kollegen genervt, was ein schlechtes Zeichen war. »Tut mir leid«, sagte Isabelle. »Ich habe jetzt eine Besprechung.«
»Es geht aber um einen Anschlag auf unsere Republik«, sagte der Mann sichtlich empört, und Isabelle sah ihn für einen Moment irritiert an.
»Es geht um unsere Freiheit und unsere Werte als Franzosen«, ergänzte er theatralisch. Also doch ein Spinner, dachte Isabelle und überlegte, wie sie den Mann wieder loswerden konnte.
»Was für ein Anschlag?«, fragte sie und wusste im selben Moment, dass das die falsche Frage war.
»Schrauben …« Der Mann sprach plötzlich mit gedämpfter Stimme.
»Schrauben?«
»So ein Bursche aus dem Maghreb«, sagte der Mann. »Wollte dreihundert Schrauben kaufen, sechs Millimeter. Dreihundert Stück …!?«
»Sie arbeiten im Eisenwarenladen, richtig?« Jetzt war Isabelle wieder eingefallen, woher sie den Mann kannte.
»Sie wissen doch, was diese Leute mit Schrauben machen?« Der Besucher sah Isabelle mit schräg gelegtem Kopf an.
»Nein, sagen Sie es mir.«
»Sie bauen Bomben. Die Schrauben kommen in den Sprengstoff, und dann: kawumm!« Der Mann riss seine Hände auseinander.
»Kawumm …?«, widerholte Isabelle, als hätte sie nicht genau verstanden.
»Die Schrauben werden zu Schrapnellen, reißen Menschen in Stücke.« Der Mann sah die stellvertretende Polizeichefin mit zweifelndem Blick an. »Wer kümmert sich hier sonst noch um Terrorangriffe auf unsere Republik?«
In diesem Moment sah Isabelle ihren Kollegen Lieutenant Didier Masclau den Gang entlangkommen.
»Didier, kommst du bitte mal. Ich brauche dich hier.« Der Kollege sah seine Chefin fragend an. »Es geht um die Sicherheit der Republik.«
»Worum?«, fragte Didier irritiert.
»Das ist Lieutenant Masclau. Unser Spezialist für Terrorabwehr.« Sie zwinkerte ihrem Kollegen zu. »Dieser aufmerksame Monsieur möchte helfen, einen Terroranschlag auf unsere Republik zu verhindern.«
»Was denn für einen Terroranschlag?«, fragte Didier.
»Ich möchte eine sehr wichtige Aussage machen.« Der Besucher richtete sich auf und drückte sein Kreuz durch. Dann sagte er leise zu Didier: »Was ich hier sage, bleibt doch anonym?«
»Wieso? Haben Sie etwas beobachtet?« Didier sah argwöhnisch zu seiner Chefin herüber.
»Ich sage nur: dreihundert Schrauben und: kawumm«, antwortete Isabelle. »Nimm doch bitte seine Aussage auf. Und falls die Republik untergeht, ich bin bei Zerna in der Besprechung.«
Isabelle ließ den Lieutenant und den besorgten Bürger stehen und lief zum Ende des Gangs, wo Polizeichef Zerna sein Büro hatte. Es war wirklich an der Zeit, dass sie für ein paar Tage hier herauskam. Sie freute sich schon auf das verlängerte Wochenende, das sie mit Leon auf der Insel Port Cros verbringen würde.
3. Kapitel
Leon hatte das Verdeck seines alten Peugeot Cabrio aufgeklappt, nahm den Fuß vom Gas und rollte langsam über die schmale D 42. Er liebte diese Straße, die an zahllosen Weingütern vorbeiführte und sich in endlosen Kurven an haushohen Pinien und alten Korkeichen vorbeischlängelte. Natürlich hätte er auch die vierspurige Schnellstraße durch das Hinterland nach Hyères nehmen können, vorbei an Gartencentern und Supermärkten. Aber dann hätte er sich um einen der schönsten Momente seines Tages gebracht. Wann immer es seine Zeit zuließ, fuhr Leon diesen Umweg. Im Schatten einer großen Platane hielt er an. Er stellte den Motor ab, lehnte sich auf dem verschlissenen Ledersitz seines Wagens zurück und genoss den Blick über die schier endlosen Weinfelder, die jetzt im Juni in frischem Grün standen. Leon konnte den Atem der Provence riechen, den Geruch von Thymian, Rosmarin und ein wenig von dem Staub des ockerfarbenen Bodens und der salzigen Meeresbrise, die von den nahen Buchten heraufwehte. Nach einigen Minuten absoluter Entspannung startete Leon erneut den Motor und stellte das Radio lauter. Auf dem Sender Nostalgie sang Charles Aznavour »La Bohème«.
Eine gute Viertelstunde später bog Leon auf den Parkplatz des Krankenhauses Saint Sulpice ein. Die Klinik war ein großer Bau, der aus dem alten Trakt und einem Neubau bestand. Nicht gerade ein architektonisches Highlight, dachte Leon während er seinen Wagen auf einem der begehrten Plätze im Schatten einer mächtigen Zeder abstellte. Leon klappte das Dach zu und betrat die Klinik durch den gläsernen Haupteingang. Hinter dem Empfang winkte ihm Schwester Monique zu. Leon grüßte zurück und verschwand durch die Tür zum Treppenhaus.
Die Räume der Rechtsmedizin lagen im Souterrain des Neubaus. Leon nahm stets die Treppe, wenn er in die »Unterwelt« wollte, wie die Pathologie in der Klinik spöttisch genannt wurde. Das Treppensteigen hatte nichts mit Fitness oder Kreislauftraining zu tun, sondern damit, dass Leon Aufzüge hasste. Genauer gesagt fürchtete er enge Räume, und ganz besonders schreckte er vor dem Gedanken zurück, den Lift eventuell mit jemandem teilen zu müssen, den er nicht mochte. Also ging er lieber gleich zu Fuß. Achtunddreißig Stufen hinab in die Unterwelt und achtunddreißig Stufen wieder hinauf.
Leon liebte seinen Beruf, und es kam ihm inzwischen wie ein Geschenk vor, dass er ihn hier in einer Klinik mitten in der Provence ausüben durfte. Das war nicht immer so gewesen. Als er damals seine Stelle an der renommierten Universitätsklinik in Frankfurt am Main kündigte, um den Job als Rechtsmediziner in einer unbekannten Provinzklinik irgendwo in der Provence anzunehmen, erklärten ihn seine Kollegen für verrückt. Alle waren sich einig, dass Leon nicht einmal die sechsmonatige Probezeit überstehen würde. Das war jetzt fünf Jahre her.
Natürlich hatten die Kollegen recht gehabt. Kein Rechtsmediziner, der vorwärtskommen wollte, gab freiwillig eine Universitätskarriere auf. Aber damals waren ihm all diese Dinge egal gewesen. Die Universität, die Klinik, das Haus. Er wollte nur noch weg, so weit wie möglich. Weg von allem, was ihn an den Tod seiner Frau Sarah erinnerte. Es war mehr als nur ein Ortswechsel gewesen. Es war eine Flucht vor der Vergangenheit. Heute wusste Leon, dass er richtig entschieden hatte. Mehr noch, er war überzeugt, dass es irgendwo da oben einen großen Masterplan gab, der ihn absichtlich in diese kleine Stadt am Meer geführt hatte. Damit er hier ein neues Leben beginnen konnte. Damit er hier Isabelle kennen- und lieben lernen konnte. Hier hatte ihm das Schicksal eine Familie geschenkt, und hier war er so glücklich geworden, wie er es in Frankfurt niemals mehr hätte werden können.
Leon war in dem von Neonlicht beleuchteten Gang der Abteilung für Rechtsmedizin stehen geblieben. Für einen Moment hing er seinen Gedanken nach. Bei schönem Wetter fiel es ihm gelegentlich schwer, die Arbeitsräume in der »Unterwelt« zu betreten. Nicht, weil ihn der Job bedrückt hätte. Ganz im Gegenteil, Leon war fasziniert von seiner Arbeit, und er sah einen tiefen Sinn darin, den Tod von Menschen zu untersuchen. Er wollte herausfinden, warum die Opfer gestorben waren, das schuldete er ihnen. Er wollte ihre Geheimnisse lüften, ihre Geschichten erfahren. Das war auch einer der Gründe, warum er die Toten konsequent als seine »Patienten« bezeichnete. Nein, sein Zögern hatte einen anderen Grund. Er wollte noch einen Augenblick der Wärme nachspüren, die die Junisonne draußen auf seiner Haut hinterlassen hatte.
»Docteur!« Die Stimme seines Assistenten Olivier Rybaud riss ihn aus seinen Gedanken. Wie immer war der Assistent völlig geräuschlos im Gang aufgetaucht. »Können wir, Docteur?«
»Wie? Ja, natürlich«, sagte Leon schnell.
»Ich habe die Patientin schon vorbereitet«, sagte Rybaud.
Leon ging in sein Büro, zog sich seinen grünen zweiteiligen Arbeitskittel an und nahm sich eine der Einmalschürzen aus dem Karton. Dann betrat er den Obduktionssaal, in dem bereits sein Assistent auf ihn wartete. Olivier Rybaud war der perfekte Mitarbeiter. Er hatte gute medizinische Kenntnisse, war ein präziser Beobachter und schien immer den nächsten Schritt seines Chefs vorauszuahnen. Der große, stille Mann wäre bestimmt selber ein guter Rechtsmediziner geworden, davon war Leon überzeugt. Rybaud besaß die richtige Mischung aus Neugier und Fantasie, um offene Fragen zu beantworten. Einmal, am Ende einer anstrengenden Obduktion, die bis spät in die Nacht gedauert hatte, gestand Rybaud seinem Chef, dass er vor Jahren ein Medizinstudium begonnen hatte. Er wollte nicht erzählen, warum er es abgebrochen hatte, und wann immer Leon seitdem dieses Thema ansprach, schwieg Rybaud beharrlich.
»Paulette Caumer, zweiundachtzig Jahre alt, Gewicht dreiundfünfzig Kilo, Größe hundertfünfundsechzig Zentimeter.« Rybaud hatte immer alle Daten eines »Patienten« im Kopf.
Auf dem Seziertisch unter dem weißblauen Licht des LED-Spots lag die unbekleidete Leiche einer alten Frau. Sie war blass und voller Altersflecken. Die Haut war übersät von Falten und Runzeln, wie ein Stück teurer Stoff, der nach jahrzehntelangem Gebrauch zerknittert und verschlissen war. Leon umrundete langsam den Tisch und betrachtete die Tote. Über dem Jochbein hatte sie eine tiefe Schürfwunde, die die Haut bis auf den Knochen aufgerissen hatte. Eine ähnliche Verletzung zeigte sich am rechten Ellenbogen und an der rechten Schulter. Keine der Verletzungen schien stark geblutet zu haben. Es war etwas anderes, das den Tod dieser Frau so bemerkenswert machte und ihre Leiche auf Leons Sektionstisch befördert hatte. Ein etwa siebzig Zentimeter langer, dünner Metallstab hatte sich ein paar Zentimeter unterhalb ihres hinteren linken Rippenbogens in den Brustkorb gebohrt und war knapp unter dem linken Schlüsselbein wieder ausgetreten.
»Als sie gefunden wurde, lag sie zwischen ihren Tomaten«, sagte Rybaud ungerührt.
»Gestürzt?«, fragte Leon.
»Wie es aussieht, ist sie von ihrer Terrasse gefallen, genau in das Tomatenspalier.«
»Aber?«, fragte Leon. Er wusste, dass sein Assistent immer gut informiert war, wenn die Opfer aus der Gegend stammten. Rybaud hatte gute Verbindungen zu Staatsanwaltschaft und Polizei. »Was spricht man in der Gerüchteküche?«
»Madame Caumer hatte Geld. Ihr verstorbener Mann war Bauunternehmer gewesen. Sie hatte keine Kinder, nur einen Neffen. Dem hat sie jahrelang das Studium finanziert.« Rybaud hatte das in abfälligem Ton berichtet. »Aber statt zu studieren, hat er das Geld in teure Autos und die Bars von Toulon und Marseille gesteckt.«
»Was der Tante nicht besonders gefallen hat, wie ich vermute.« Leon zog die Lupe zu sich heran, die an einem Gelenkarm von der Decke hing. Er schaltete die eingebaute Beleuchtung ein und betrachtete die Austrittswunde des Eisenstabes genauer.
»Sie soll stocksauer gewesen sein«, sagte Rybaud, »und sie hat die Zahlungen eingestellt.«
»Geben Sie mir bitte mal die kleine Sonde.« Leon hielt die Hand auf. Rybaud reichte ihm das Instrument.
»In seiner Stammkneipe hat er getönt, er würde seine Tante fertigmachen«, berichtete Rybaud. »Am nächsten Tag lag sie tot zwischen ihren Tomaten.«
»Und der Neffe?«, fragte Leon.
»Sitzt in U-Haft. Er war ihr letzter Besucher.«
»Einen Schuldigen hat die Polizei also auch schon. Sehr fleißig.« Leon klang zynisch. »Ein wenig voreilig, denke ich.«
»Haben Sie was gefunden?« Rybaud beugte sich neugierig vor.
»Nein, nichts, aber manchmal führt ja gerade das zum richtigen Ergebnis«, murmelte Leon und betrachtete die Schürfwunde im Gesicht des Opfers.
»Verstehe ich nicht?« Rybaud verfolgte jede Bewegung seines Chefs.
»Ich kann so gut wie keine Blutungen entdecken«, sagte Leon. »Wer hat das Opfer gefunden?«
»Der Neffe. Die Flics vermuten, dass er die Tante über die Brüstung gestoßen hat.«
»Die Polizei täte gut daran, die Untersuchung der Rechtsmedizin abzuwarten«, meinte Leon.
»Die Nachbarn wollen einen Streit auf der Terrasse gehört haben.«
Leon schwieg und betrachtete aufmerksam die Wunde im Gesicht des Opfers. Dann richtete er sich auf.
»Fangen wir an.« Leon griff zu dem Mikrofon und drückte den Aufnahmeknopf. »Vor mir liegt eine zweiundachtzigjährige Frau. Gewicht dreiundfünfzig Kilo, Größe hundertfünfundsechzig Zentimeter …«
Eine gute Stunde später hatten Leon und sein Assistent die Tote obduziert. Den Körper geöffnet, Organe gemessen und gewogen und Proben genommen. Zuletzt hatte Leon den Schädel mit der elektrischen Rundsäge geöffnet, obwohl er wusste, was ihn erwartete. Das Gehirn lieferte ihm nur die letzte Bestätigung der Vermutung, die er von Anfang an gehegt hatte.
»Ich denke, der Neffe von Madame Caumer kann sich freuen.« Leon betrachtete das Gehirn, das jetzt in einer glänzenden Nirosta-Schale lag. Er deutete auf eine Stelle im linken oberen Hirnlappen, wo sich das ansonsten weißlich gelbe Gewebe dunkelrot verfärbt hatte. »Machen Sie davon eine Aufnahme, und dann brauche ich einen Schnitt von der Stelle.«
»Sie glauben nicht, dass sie gestoßen wurde?« Das war mehr eine Feststellung als eine Frage von Rybaud.
»Nur minimale Blutungen an den Schürfwunden.« Leon deutete auf die Verletzungen, während er sprach. »Mehrfache Fraktur der Rippen rechts und links. Wieder nur sehr geringe Einblutungen. Und schließlich der Metallstab.«
Leon griff nach dem Metallstab, den sie aus dem Brustkorb gezogen und neben den Körper des Opfers gelegt hatten.
»Schwache Blutungen an der Eintrittswunde, genauso sieht es an der Austrittswunde aus«, sagte Leon und legte den Stab zurück.
»Ging nur knapp am Herzbeutel vorbei.«
»Ich bin sicher, das hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht«, sagte Leon.
»Sie meinen, sie war schon tot, als sie in das Tomatenspalier gestürzt ist?« Rybaud sah seinen Chef an.
»So gut wie.« Leon deutete auf die Dunkelfärbung des Gehirns. »Die alte Dame hat Sekunden zuvor einen hämorrhagischen Apoplex erlitten.«
»Ein geplatztes Gefäß …« Rybaud betrachtete das Gehirn.
»Der Schlaganfall hat zu sofortiger Bewusstlosigkeit und Organversagen geführt«, erklärte Leon. »Die Frau muss nach vorne gekippt sein und ist dann über die Brüstung nach unten gestürzt.«
»Und wenn er sie doch gestoßen hat?«
»Eher unwahrscheinlich. Erst kam der Schlaganfall, dann kam der Sturz. Sie ist innerhalb von Sekunden gestorben.«
»Sie und ihr Neffe haben gestritten. Vielleicht hat sie ja deswegen den Schlaganfall erlitten«, überlegte Rybaud.
»Möglich, aber mit seiner Tante zu streiten, ist kein Straftatbestand«, meinte Leon.
»Der Richter wird den Verdächtigen freilassen müssen.« Rybaud klang fast etwas enttäuscht.
»Habe ich doch gesagt: Für den Neffen ist das ein echter Glückstag.«
4. Kapitel
Isabelle war genervt, sie fühlte sich in letzter Zeit überhaupt schnell müde und abgespannt. Ob sie sich eine Erkältung eingefangen hatte? Wahrscheinlich war es nur der Stress der letzten Tage, tröstete sie sich. Mit den Touristen kamen jedes Jahr auch die Probleme, und mit den Problemen kam die Arbeit. Das war heute bereits das dritte Meeting in der Gendarmerie nationale. Und wie immer ging es um nervigen Kleinkram, ganze Berge von nervigem Kleinkram.
Da war zum Beispiel der kilometerlange Graben entlang der D 559. Für die superschnellen Glasfaserleitungen. Vor zwei Monaten hätten sie fertig sein sollen. Natürlich war nichts geschehen. Die Kabel waren noch immer nicht verlegt. Himmel, sie hatten Hauptsaison! Und jetzt hatte sie den Ärger mit den Umleitungen. Es fehlte an Schildern. Es hatte beim letzten Mal eine Dreiviertelstunde und den Einsatz von sieben Beamten gebraucht, bis der Verkehr wieder floss.
Am Nachmittag lieferten sich ein paar betrunkene Holländer eine Schlägerei mit einer Gruppe nicht weniger betrunkener Belgier. Das hatte zu zwei Festnahmen geführt und einem verletzten Belgier, dem jetzt ein Vorderzahn fehlte. Außerdem machte die Gendarmerie nationale Jagd auf eine Diebesbande aus Rumänien, die gezielt in Appartements einbrach, wenn die Bewohner am Strand waren.
Die Telefone standen nicht still, und ständig erschienen neue Bürger, in der Hoffnung, dass die Polizei ihre Probleme lösen konnte. Inzwischen hatte sich vor dem Büro, in dem die Polizei die Anzeigen aufnahm, eine Schlange gebildet, die bis zum gläsernen Eingang der Wache reichte. Da die Besucher unentwegt die Lichtschranke blockierten, blieb auch die elektrische Schiebetür ständig offen. Das wiederum führte dazu, dass die Klimaanlage nicht mehr arbeiten konnte und die Temperatur in der Wache inzwischen auf über dreißig Grad angestiegen war.
Im stickigen Besprechungsraum wedelten sich die Frauen und Männer der Gendarmerie frische Luft zu und hofften, endlich zurück in ihre Büros zu kommen. Aber noch stand Polizeichef Thierry Zerna vor der großen Wandkarte, die das Gemeindegebiet von Le Lavandou abbildete, und erteilte Anweisungen an sein Team. Zerna liebte diese Auftritte, bei denen er sich vor seine Leute stellen konnte, auf den Fußballen wippte und versuchte, ein wenig größer zu erscheinen, als er es mit seinen ein Meter zweiundsiebzig in Wirklichkeit war.
»Die Einsatzleitung für das Saint-Pierre-Fest übernimmt wie immer meine Stellvertreterin Capitaine Morell.« Mit einer galanten Geste wies er auf Isabelle.
»Das geht leider nicht«, sagte Isabelle, als müsste sie ihren Chef an etwas erinnern, das doch sowieso klar war. »Ich bin nicht da.«
»Was soll das heißen, Sie sind nicht da?«
»Ich habe schon vor Monaten meine freien Tage eingereicht, und das Saint-Pierre-Fest gehörte dazu. Das wurde von Ihnen persönlich abgezeichnet.«
»Moment, Sie können doch nicht …«, wollte Zerna lospoltern, obgleich er genau wusste, dass er die Sache mit den freien Tagen vermasselt hatte.
»Doch, ich kann, und ich werde auch«, entgegnete Isabelle selbstbewusst. »Es sind meine freien Tage. Die werde ich mit meiner Familie verbringen und ganz bestimmt nicht hier im Büro.«
Jedes Jahr im Sommer wurde in Le Lavandou das traditionelle Fest zu Ehren von Saint-Pierre gefeiert. Er war der Schutzheilige der Fischer, und einmal im Jahr wurden in seinem Namen Fang und Boote der Fischer gesegnet. Das war ein wichtiges Ritual, das schon, solange man denken konnte, gefeiert wurde. Früher war es nur eine kleine Feier gewesen, inzwischen war das Fest zu einer gewaltigen Touristenveranstaltung angewachsen, die den ganzen Tag dauerte.
Das Fest begann damit, dass die Figur des Heiligen durch den Ort bis an den Strand getragen wurde. Dann wurde sie auf ein Boot gehoben, mit dem der Priester in die Bucht fuhr und seinen Segen sprach. Nachdem er alle Fischerboote gesegnet hatte und Dutzende kleiner Blumenflöße aufs Wasser gesetzt worden waren, schipperte die Prozession wieder zurück in den Hafen. Danach versammelten sich Einwohner und Gäste zum großen Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Bouleplatz.
Anschließend folgte der beliebteste Teil dieses feierlichen Tages: Gäste und Einheimische stürmten Cafés und Bistros, um sich mit einem oder besser gleich mehreren Gläsern eisgekühltem Rosé nach den frommen Anstrengungen zu entspannen. Was allerdings gelegentlich zu wenig christlichen Exzessen führte, bei denen nicht selten die Polizei einschreiten musste. Die Überwachung der Veranstaltung war daher wenig beliebt bei der Gendarmerie.
»Dann übernimmt in diesem Jahr Lieutenant Masclau die Leitung.«
»Das geht leider nicht, Patron. Da habe ich schon einen dringenden Termin.« Der Lieutenant zögerte. »Ich will meine Mutter in Toulon besuchen.«
»Das können Sie auch an jedem anderen Tag machen, Masclau.« Zerna klang nicht so, als wollte er diskutieren.
»Aber, Patron …«, versuchte es Masclau noch einmal.
»Sagen Sie Ihrer Mutter, Sie müssten einen Heiligen bewachen. Das wird sie bestimmt verstehen.«
Gelächter unter den Anwesenden, die Ersten drängten zur Tür.
»Sonst noch etwas?«, fragte Zerna in die Runde.
»Es gibt da eine Vermisstenanzeige, der wir nachgehen sollten«, sagte Isabelle. »Es geht um eine junge Frau, Mitte zwanzig.«
»Eine Touristin? Die verschwinden doch ständig!«, rief einer der Beamten.
»Strandurlaub ist Gift für jede Beziehung«, rief ein anderer. Die Männer stießen sich an und feixten.
»Natürlich, weil den Frauen da erst klar wird, was für Langweiler sie zu Hause haben«, warf eine der Polizistinnen dazwischen. Einige Frauen lachten.
»Die taucht bestimmt wieder auf«, rief eine der Kolleginnen.
Genau in diesem Punkt war sich Isabelle nicht so sicher. Natürlich verschwanden ständig Menschen, und die Sommerferien waren laut Statistik eine besonders kritische Zeit. Aber – und auch das sagte die Statistik – über neunzig Prozent der Vermissten standen innerhalb der ersten Woche wieder vor der Tür. Meist waren es reumütige Ehefrauen, die zurückkamen, verwirrte Teenager oder Männer, die am Strand die Liebe ihres Lebens kennengelernt zu haben glaubten. Aber kaum ging der Urlaub zu Ende, schmolz die Leidenschaft schneller dahin als das Eis am Strand.
»Sie stammt hier aus Le Lavandou«, sagte Isabelle. »Aline Moreau.«
»Das ist doch die mit dem Küchenladen?«, rief jemand, und Isabelle nickte.
»Ihr Bruder hat uns informiert«, sagte Isabelle.
»Ich dachte, die wären verkracht«, meldete sich Masclau, der immer noch sauer war, dass er seine Chefin am Saint-Pierre-Tag vertreten musste.
»Wie lange ist die Frau schon verschwunden?«, wollte Zerna wissen.
»Vier Tage«, antwortete Isabelle. »Sie sei mit dem Firmenwagen unterwegs, meinte der Bruder.«
»Irgendwelche Anzeichen eines Verbrechens?«
»Nein«, musste Isabelle einräumen.
Isabelle kannte die Bestimmung, die das Polizeiaufgabengesetz für solche Fälle vorsah. Demnach wurde nach Erwachsenen nicht automatisch gesucht, außer es lag ein Verbrechen vor, das zu ihrem Verschwinden geführt hatte, oder sie wurden seit mindestens einer Woche vermisst.
»Dann würde ich sagen: Wir warten noch das kommende Wochenende ab.« Zerna sah zu seiner Stellvertreterin hinüber. »Aber halten Sie mich auf dem Laufenden, falls Sie in der Sache etwas hören.«
Damit war die Besprechung beendet.
5. Kapitel
Das Chez Miou war immer gut besucht, was kaum an der Ausstattung des Bistros liegen konnte. Das Lokal hätte schon längst renoviert werden müssen. Die Korbstühle waren durchgesessen, die Sonnenschirme ausgebleicht, die Beleuchtung stammte noch aus den Siebzigerjahren und die Toilettentür ließ sich seit mindestens einem Jahr nicht mehr richtig schließen. Aber das Bistro hatte dafür etwas, was den meisten anderen Cafés fehlte. Es hatte Charme, und es lag direkt am Bouleplatz.
Für Leon gab es kein besseres Bistro im Ort, und darum war das Chez Miou aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Auch heute, nachdem er den Obduktionsbericht geschrieben und noch ein paar administrative Dinge in der Klinik erledigt hatte, war er hierhergefahren. Jetzt saß er auf seinem Stammplatz, direkt neben den weit geöffneten Glastüren, die sich bei warmem Wetter wie eine Ziehharmonika zusammenschieben ließen. Auf diese Weise wurde eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen: Innen saßen die Stammgäste, und die äußeren Plätze unter den Sonnenschirmen waren für die Touristen. Die Gäste schätzten vor allem die gigantischen Eiskreationen des Lokals, für die sein Besitzer berühmt war. Sie trugen so vielversprechende Namen wie »Sommerliebe« oder »Sex on the Beach«.
»Voilà, Docteur. Hier kommt der Café crème für meinen Lieblingsgast.« Mit einer schwungvollen Bewegung stellte Yolande die Tasse auf den Tisch und beugte sich weit nach vorne, was ihre Oberweite besonders gut zur Geltung brachte.
»Der Lieblingsgast hat sich schon den ganzen Nachmittag auf Ihren Café crème gefreut«, sagte Leon mit breitem Lächeln.
»Ach, Sie Schmeichler.« Yolande gab ihrer Stimme noch ein wenig mehr Timbre, wie sie es bei den Femmes fatales in den alten Filmen so bewunderte.
»Haben Sie von dem Anschlag gehört?« Yolande sah sich um und rückte noch ein wenig näher an Leon heran, der sie fragend ansah. »Es heißt, Terroristen haben den Saint-Pierre-Tag im Visier.«
»Unseren Schutzheiligen, ganz sicher?« Leon konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Das Chez Miou war die heimliche Nachrichtenzentrale der Stadt, und Yolande war die ungekrönte Herrscherin über jede Art von Gerücht. Sie schien jedes Gespräch, das ihre Gäste führten, zu belauschen. Sie wusste immer als Erste Bescheid. Egal, ob es um Trennungen, Krankheiten oder Schwangerschaften ging. Allerdings musste man ihre Informationen mit Vorsicht genießen, denn gelegentlich ging die Fantasie mit ihr durch. Außerdem liebte sie Verschwörungstheorien, aber damit war sie im Chez Miou nicht die Einzige.
»Sie glauben mir nicht?« Yolande klang etwas empört.
»Ich denke, der gute Saint Pierre wird auch dieses Jahr die Fischerboote segnen. Genau wie in den hundert Jahren davor«, meinte Leon.
»Ich weiß es von einem der Flics.«
»Sie kennen doch die Flics. Das ist nur Gerede. Glauben Sie mir.«
»Von wegen!«, kam es von der Bar. Dort stand Michel, in der Hand ein randvolles Glas Pastis, das er schon nicht mehr ganz ruhig halten konnte. »Liegt alles an den Flüchtlingen. Die wollen uns fertigmachen. Jeden von uns … Ihr werdet es sehen.«
»Komm mal wieder runter, Michel!« Die alte Véronique, die ebenfalls mit einem Pastis in der Hand an der Theke stand, sah Michel nur kurz an. »Trink deinen Pastis und nerv uns nicht.«
»Halt die Klappe!«, fuhr Michel die Frau an. »Du weißt doch gar nicht, worüber wir hier reden.«
Wenn er betrunken war, wurde Michel schnell ausfallend. Er besaß den Tabakladen an der Promenade und bemühte sich seit Jahren vergeblich um ein Mandat bei der Front National. Bei der letzten Wahl hatte er es immerhin auf die Kandidatenliste geschafft, aber dann war er auf ganzer Linie eingebrochen. Eine bittere Erfahrung, von der er sich noch immer nicht erholt hatte.
»Na, wird unser Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl wieder antreten?«, fragte Véronique ihn provozierend.
Véronique war dreiundachtzig Jahre alt, Kettenraucherin und noch vor fünf Jahren mit dem eigenen Boot zum Doradenfischen gefahren. Inzwischen hatte sie ihren Kahn verkauft und genoss das Leben einer Rentnerin. Sie war selbstbewusst, schlau und die beste Boulespielerin der Stadt. Jedenfalls war das die Meinung von Leon. Und die Siege, die er mit Véronique auf den Bouleplätzen von Le Lavandou und Umgebung erkämpft hatte, schienen ihm recht zu geben.
»Ihr wisst ja hoffentlich, dass diese Kerle jetzt doch ihre Moschee La Londe kriegen«, sagte Michel lauernd. Die »Kerle« waren für Männer wie ihn die Muslime im Allgemeinen, die er auch gerne als »Kanaken« bezeichnete.
»Jetzt kommt diese Geschichte wieder«, stöhnte Véronique. Michel sah sie mit glasigem Blick an.
»Lass ihnen doch ihre Moschee«, brummte Jérémy, um den Frieden in seinem Lokal besorgt. »Die stört doch niemanden.«
»Stört niemanden …?« Michels Gesicht lief rot an. »Wartet nur ab, bis sie von ihren Türmen runterjaulen.« Er schwenkte sein Glas und verschüttete dabei den Rest seines Pastis auf dem Boden. »Mach mir noch einen«, blaffte er Jérémy an und knallte sein Glas auf die Theke.
»Du hattest genug, Michel. Geh nach Hause.« Jérémy nahm das Glas und stellte es in die Spüle.
»Ihr habt doch alle keine Ahnung.« Inzwischen hatte sein Bluthochdruck Michels Gesicht tiefrot gefärbt, und Leon fragte sich, wie lange das Herz des übergewichtigen Ladenbesitzers noch durchhalten würde.
»Zehnmal am Tag wird vom Turm gejault. Aber sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.«
»Fünfmal.« Der Mann mit dem Panamahut, der am Ende des Tresens stand, hielt die rechte Hand hoch und zeigte die fünf Finger.
Der Mann hatte bisher nur stumm zugehört. Er war Anfang vierzig und trug einen Dreitagebart. In seinen Jeans, den abgewetzten Sneakers und seinem weiten Leinenhemd sah er aus wie ein Abenteurer. Leon war nicht entgangen, dass Yolande schon ein paarmal interessiert zu dem Gast hinübergesehen hatte. Über dem Hemd trug der Mann eine Anglerweste, in deren Taschen statt Angelhaken und Ködern ein Notizblock, verschiedene farbige Stifte, ein Kompass und eine Sonnenbrille steckten.
»Was soll das denn wieder heißen? Fünf?« Michel drehte sich um, starrte den Gast an, und Leon konnte sehen, dass er auf Krawall aus war. Aber sein Gegner war mindestens zehn Jahre jünger, nüchtern, sportlich und leicht einen halben Kopf größer als sein Herausforderer.
»Sie beten fünfmal am Tag.« Der Mann sprach mit dem aufgebrachten Michel wie mit einem bockigen Kind. »Der Muezzin ruft vom Minarett zur ›Salat‹, das ist das Gebet der Muslime. Fünfmal am Tag. Muslime dürfen übrigens überall beten, außer am Freitag, da schreibt der Koran vor, dass sie in die Moschee gehen sollen.«
»Ach ja, ist das so?«, fragte Michel sarkastisch.
»Ein Mann vom Fach«, sagte Leon anerkennend und hob seine Kaffeetasse zum Gruß. »Bei Ihnen kann man noch was lernen.«
Der Gast erwiderte den Gruß mit seiner Tasse und einem Lächeln.
»Die jaulen trotzdem von ihren scheiß Türmen runter«, maulte Michel und schickte ein provozierendes »bêcheur« hinterher, was in dieser Gegend so viel wie »Klugscheißer« bedeutete.
»Jetzt hör schon auf, Michel!« Véronique sah durch die weit offen stehenden Türen hinauf zum Abendhimmel, an dem feine Wolken wie zerrissene Seide aufgezogen waren. »Wir bekommen Mistral«, erklärte sie in Richtung des Gastes. »Das macht manche Leute ganz wuschig im Kopf.«
»Was ist das überhaupt für eine beschissene Religion, wo sie sogar die eigenen Leute foltern und umbringen«, brummelte Michel. »Zum Glück sind wir Christen anständige Menschen. Wir haben nämlich Kultur.«
»Das hat man ja bei den Hexenverfolgungen gesehen«, bemerkte der Gast mit dem Panamahut trocken.
»Touché!« Leon lachte und wies auf den freien Stuhl an seinem Tisch. »Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir.«
»Aber gerne.« Der Mann nahm seine Tasse und ging zu Leon.
»Daniel Simon«, stellte er sich vor. »Danke für die Rettung.«
Leon war aufgestanden.
»Lassen Sie mich raten: Sie arbeiten an der Universität.« Simon lächelte und nickte. Leon deutete auf ihn. »Kirchengeschichte?«
»Nahe dran. Kunstgeschichte.«
»Leon Ritter.« Er reichte Simon die Hand.
»Und Sie sind Arzt?«
»So etwas Ähnliches …« Leon sah ihn an. »Rechtsmediziner.«
»Wirklich? Das stelle ich mir spannend vor.«
Normalerweise versuchte Leon tunlichst zu vermeiden, seinen Beruf zu erwähnen. Rechtsmedizin schien für die meisten Menschen ein Synonym für Gruselgeschichten zu sein. Dass der Job nicht nur gute Kenntnisse in Medizin, sondern auch in Chemie, Physik und ein großes Maß an psychologischem Vorstellungsvermögen verlangte, interessierte offenbar niemanden. Die Leute wollten Horrorgeschichten hören.
»Ich wette, Ihr Job ist genauso aufregend«, sagte Leon ausweichend. »Woran arbeiten Sie? Oder machen Sie hier Urlaub?«
»Nein, ich untersuche Kapellen in der Provence. Schwerpunkt ist das späte Mittelalter.«
»Aha, daher die Hexenverfolgung.«
»Nein, es geht um Baustile: Nur ganz wenige Kapellen hatten eine Krypta, und genau nach denen suche ich.«
»Klingt spannend.«
»Aber was die Hexenverfolgungen angeht, die gab es tatsächlich hier in der Provence. Sogar noch bis ins achtzehnte Jahrhundert.«
»Da bin ich froh, dass wir in so aufgeschlossenen Zeiten leben.«
»Das haben die Menschen im ausgehenden Mittelalter auch gedacht. Die haben die Renaissance als Geburtsstunde der Individualität gefeiert. Dabei ging da die Hexenverfolgung erst richtig los. Prozesse ohne Anklage, Folter, Scheiterhaufen.«
»So viel zu den guten alten Zeiten«, meinte Leon amüsiert.
»Kann ich Sie zu einem Rosé überreden?«, fragte Simon.
Leon hob die Einkaufstasche, in der Zucchini und Lauch zu sehen waren.
»Aber nur einen für den Weg. Ich muss nämlich noch kochen.«
Als Leon eine Viertelstunde später das Miou verließ, schlug er den Kragen seiner Jacke hoch. Es war kühler geworden. Vor dem Café wirbelte eine erste Windböe eine Staubfahne hoch. Wir werden einen Sturm bekommen, dachte Leon.
Stunden später, nach einem fulminanten Ratatouille und einem köstlichen roten L’Angueiroun Réserve, lag Leon im Bett und hörte neben sich die regelmäßigen Atemzüge von Isabelle. Der Sturm hatte an Kraft zugelegt, schleuderte jetzt dicke Regentropfen gegen die Scheiben und zerrte an den Dachpfannen, dass sie klapperten. Isabelle drehte sich zu ihm um.
»Denkst du, das Dach bleibt dicht?«, fragte sie flüsternd.
»Keine Sorge«, beruhigte Leon sie leise. »Ich habe mir das Dach erst letzte Woche angesehen.«
»Lieb von dir«, murmelte sie mit sanfter Stimme. »Danke für das leckere Essen!« Sie kuschelte sich an ihn.
Leon legte seinen Arm um ihren warmen Körper und zog sie noch näher an sich heran. Draußen flammte ein Blitz auf. Leon mochte den Mistral.
6. Kapitel
Der Mann war sauer. Ja, er hatte etwas getrunken. Natürlich, wie sollte er sonst diesen Scheißjob aushalten? Man musste trinken, wenn man mal ein paar Stunden zwischendurch schlafen wollte. Schlafen?! Um fünf Uhr waren die Flics aufgekreuzt. Vor Sonnenaufgang, das musste man sich mal reinziehen. Er solle weiterfahren. Er würde den Verkehr behindern, weil er die Auffahrt zur Tankstelle versperrt habe. So ein Schwachsinn! Sollten die doch selber mal nach einem Parkplatz für einen Vierzigtonner suchen. Nachts, irgendwo auf der Autoroute. Mit hundertzwanzig scheiß Schweinen im Aufleger. Lebendigen Schweinen. Grunzenden, quiekenden, stinkenden Viechern. Und er musste ihnen auch noch zu saufen geben und zweimal am Tag Futter in die Tröge schmeißen. War er Trucker oder ein scheiß Schweinehirt?
Ob der Transport legal war? Nein, war er nicht. Aber was sollte er denn machen? Die Mistviecher mussten nach Genua. Quer durch Frankreich. Von Brest bis nach Genua, weiter ging es wirklich nicht. Und das im Sommer. Gestern hatten sie fast dreißig Grad auf der Autobahn gehabt. Da konnten einem die Viecher fast leidtun. Na klar gab es Vorschriften. Jede Menge Vorschriften. Es gab Transport-Vorschriften und Vorschriften vom Veterinäramt. Und es gab die Vorschriften der einzelnen Départements. Wenn er sich an all die beschissenen Vorschriften halten würde, dann müsste er den Viechern auch noch ’ne Gutenachtgeschichte vorlesen. Schweine durften nämlich keinen Stress haben, sonst schadete das später dem Fleischgeschmack. So ein Schwachsinn. Wer interessierte sich eigentlich für den Stress, den er hatte?
Gestern Abend im Aufleger lag eins von den kleinen Viechern tot in der Scheiße. Die anderen waren drauf rumgetrampelt. Da hatte er es auf dem Parkplatz hinter die Büsche geworfen. Was hätte er denn machen sollen? Er war dafür verantwortlich, dass die Schweine lebend in Milano ankamen. Der Kunde interessierte sich einen Dreck für seine Probleme. Und was taten die Flics? Die lauerten doch nur darauf, Männern wie ihm das Leben schwer zu machen. Deswegen fuhr er mit gefälschten Papieren. In denen stand, dass sein Transport nicht in Brest sondern in Orange losgegangen war. Da hatte er den Flics mal eben tausend Kilometer unterschlagen, na und? Wenn die Flics gewusst hätten, dass er die Schweine quer durch Frankreich transportierte, in einem Rutsch und auch noch alleine ohne Beifahrer … Die hätten ihn noch auf dem Parkplatz verhaftet.
Jetzt donnerte er mit seinem Vierzigtonner durch die Nacht, hielt sich am Lenkrad fest, hatte Kopfschmerzen, und ihm war schlecht. Dabei hatte er sich geschworen, keine Flasche mehr anzurühren. Doch er war schwach geworden. War ja auch kein Wunder, bei der ganzen Scheiße, die er an der Backe hatte.
Er griff zwischen die Sitze und zog eine leere Flasche Armagnac hervor. Dann ließ er die Beifahrerscheibe herunter und schleuderte die Flasche nach draußen. Mit dumpfem Knall zerbarst sie an einem Straßenschild. Der Mistral schob den Laster vor sich her und wehte den beißenden Gestank von Schweinemist in die Kabine. Fluchend schloss der Mann wieder das Fenster. Vor sich, auf der vollkommen leeren Autobahn, konnte er einen ersten fahlen Lichtstreifen am Horizont sehen.
Die Fahrt wurde ordentlich bezahlt. Aber das löste noch lange nicht seine finanziellen Probleme. Die Bank saß ihm im Nacken. Zwei Raten für das Haus waren überfällig. Er hatte sich verschuldet, um das Haus zu kaufen. Natürlich war es zu groß. Aber seine Frau hatte so lange Druck gemacht, bis er Ja gesagt hatte. Dieses verdammte Haus. Er war schon zwei Wochen nicht mehr dort gewesen. War ja auch kein Wunder. Die Straße war besser, als zu Hause das Stänkern seiner Frau zu ertragen.
Der Mann saß hinter seinem Lenkrad und schüttelte den Kopf. Irgendwie hatte er sein ganzes Leben verkackt. Er starrte geradeaus. Er konnte die Höhen des Massif des Maures sehen, dessen Konturen sich im Licht der Morgendämmerung am Horizont abzeichneten, während über dem Laster noch die letzten Sterne funkelten. Der Mann fluchte gerne, aber in Wirklichkeit mochte er diese einsamen Momente auf der Straße. Alle Probleme schienen weit weg zu sein. Er ließ seine Scheibe ein Stück hinuntergleiten, und der kühle Wind machte ihn wach. Und er fühlte sich auf einmal frei und glücklich. Der Mann betrachtete die Brücke, unter der der Laster jetzt hinwegglitt. In diesem Moment tat es einen lauten Schlag. Für den Bruchteil einer Sekunde schien ein fremdes Gesicht ihn durch die Windschutzscheibe anzustarren, dann rutschte es nach unten. Ein Körper wirbelte durch das Licht der Scheinwerfer und verschwand unter der Fahrerkabine. Fast im gleichen Moment spürte er, wie die schweren Doppelreifen etwas überrollten.
Der Mann hatte den Truck vor Schreck instinktiv nach rechts gerissen. Im nächsten Moment versuchte er seinen Fehler zu korrigieren und zog das schwere Fahrzeug zurück auf die Spur – zu spät. Die Lenkung bewegte zwar die Zugmaschine nach links, aber der schwere Aufleger schoss unverändert geradeaus weiter. Fahrzeug und Anhänger klappten zusammen wie ein Taschenmesser. Vierzig Tonnen ungebremste Energie drängten nach vorne und zermalmten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Der Mann spürte, wie sich das Führerhaus auf der Straße drehte. Die Reifen kreischten über den Asphalt. Die ganze Fuhre driftete unkontrolliert auf den Mittelstreifen zu. Der Mann hielt sich am Lenkrad fest, dann kam der Graben. Die Verbindung zum Anhänger brach. Der Aufleger stürzte auf die Seite und wurde von der Straße geschleudert. Schweine schrien in Todesangst. Der Aufleger wurde von der Leitplanke zerfetzt. Plastik, Metall und tote Tiere wirbelten durcheinander.
Dann trat Ruhe ein. Während sich eine gewaltige Staubwolke über das Unfallchaos senkte, wurde es für einen Moment so still, dass der Mann den Wind in den Büschen hören konnte. Er war wie durch ein Wunder dem Chaos entkommen. Nur an der rechten Hand war ein blutender Schnitt.
Er sah sich um. Rauch stieg aus dem Motor auf, die Warnblinkanlage leuchtete auf, zuckende Schweine lagen mit gebrochenen Beinen in ihrem Blut. Der Mann schloss für einen Moment die Augen und wünschte sich, dass er diese gottverdammte Fuhre nie angenommen hätte.
7. Kapitel
Als Leon eine halbe Stunde später am Unfallort eintraf, erinnerte ihn die Szene an Dantes »Inferno«. Blaulichter blitzten in der Morgendämmerung. Scheinwerfer beleuchteten diesen Ort der Verwüstung, wo Polizisten laut rufend hin und her liefen und die verletzten Schweine erschossen. Da einige der Tiere die Mittelleitplanken überwunden hatten, musste auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden, um neue Unfälle durch herumlaufende Schweine zu verhindern.
Isabelle war um zehn Minuten nach fünf Uhr morgens angerufen worden, und die Einsatzleitung hatte Leon gleich mit angefordert. Wenn sie ihre Kollegen richtig verstanden hatte, war auf der Autobahn ein Fußgänger überfahren worden, was einen gewaltigen Unfall ausgelöst hatte. Isabelle sah sich um. Die Einsatzleitung hatte nicht übertrieben.
»Guten Morgen«, begrüßte Lieutenant Kadir den Médecin Légiste und seine Chefin, »ziemliche Schweinerei würde ich sagen.«
»Was ist mit dem Fahrer?« Isabelle ging nicht auf Momos Scherz ein.
»Er kann sich nur noch erinnern, dass jemand gegen seine Scheibe geknallt ist«, meinte Kadir. »Dabei hat er den Lenker verrissen.«
»Gegen die Frontscheibe?«, fasste Leon nach. »Die ist doch mindestens zwei Meter über der Straße.«
»So hat er es aber gesagt.« Kadir klang, als wollte er sich für den Fahrer entschuldigen.