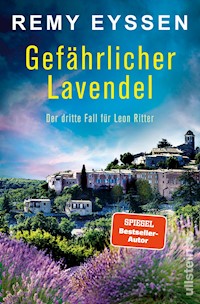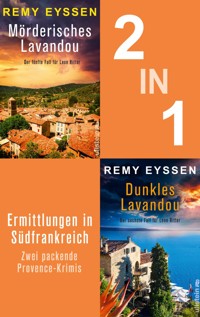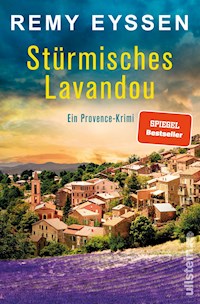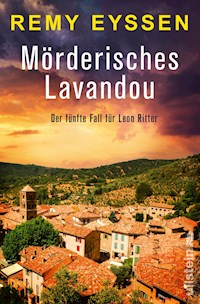9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vor dem azurblauen Mittelmeer muss sich Leon Ritter dem Schlimmsten stellen Gerichtsmediziner Leon Ritter und seine Partnerin Isabelle Morell freuen sich auf die letzten Wochen des Sommers in Le Lavandou. Doch die Sonnentage werden überschattet, als eine Frau in heller Aufregung bei der Polizei auftaucht, um ihre beiden Kinder vermisst zu melden. Zunächst wird die Gegend durchkämmt in der Hoffnung, die beiden könnten weggelaufen sein. Doch schnell wird klar: Lucas und Louisa wurden entführt. Die Eltern, die mit ihrer Firma in finanziellen Schwierigkeiten stecken, müssen das Lösegeld auftreiben – und die Ermittler wissen, dass sie nur eine Chance haben, das Leben der Kinder zu retten ... *** Der beliebteste Gerichtsmediziner der Welt: Leon Ritter ermittelt mit Hirn und Methode - und einem Glas Rosé in der Hand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Trügerisches Lavandou
Der Autor
REMY EYSSEN, geboren 1955 in Frankfurt am Main, arbeitete zunächst als Redakteur bei der »Münchner Abendzeitung«, später als freier Autor für Tageszeitungen und Magazine. In den Neunzigerjahren entstanden die ersten Drehbücher. Es folgten zahlreiche Arbeiten für TV-Serien und Filme bei allen deutschen Fernsehsendern.
In unserem Hause sind vom Autor bereits erschienen: Tödlicher Lavendel · Schwarzer Lavendel · Gefährlicher Lavendel · Das Grab unter Zedern · Mörderisches Lavandou · Dunkles Lavandou · Verhängnisvolles Lavandou · Stürmisches Lavandou
Remy Eyssen
Trügerisches Lavandou
Ein Provence-Krimi
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München, © Gary Yeowell / Getty ImagesE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2960-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meiner Frau und meiner Tochter
für ihre Geduld und ihren Rat
Prolog
Seine Erinnerung lag hinter einer Wand aus Nebel, die jeden Moment auf ihn herabzustürzen drohte. Genauso wie damals beim Spielen, als der Sand auf ihn gerutscht war. Als er nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Als er um ein Haar erstickt wäre. Genauso fühlte es sich jetzt an. Er kannte diesen Traum, und er wusste auch, wie er sich daraus befreien konnte. Genauso wie es der Kinderarzt mit ihm geübt hatte. Ruhig atmen und langsam zählen sollte er immer, wenn in ihm die Angst aufstieg. Wenn ihm heiß und kalt wurde und er sich nicht mehr dagegen wehren konnte. Wenn nicht einmal mehr weinen, nicht einmal schreien half. Weil er gefangen war in seinem eigenen Kopf. Wie ein Vogel in einem Käfig. Dann musste er ankämpfen gegen das schlimme Gefühl vom Sturz in die Finsternis.
Warum half ihm jetzt keiner? Er war doch erst sieben Jahre alt.
»Viel zu jung für solche Spinnereien«, hatte der Doktor gesagt. Drei Wochen musste er in dem alten Haus bleiben, und zu jedem Essen musste er Tabletten schlucken, genau wie die anderen Kinder. Vitamine, hatte die Krankenschwester gesagt. Aber der Junge war sich sicher, dass das gelogen war. Wenn er die kleine blaue Pille geschluckt hatte, war alles vergessen. Keine Angst mehr da, keine Käfer, die an der Zimmerdecke entlangkrabbelten und sich auf sein Bett fallen ließen. Kein schwarzer Tunnel mit hellem Licht am Ende. Gar nichts mehr. Nur absolute Stille. Stimmen und Geräusche gänzlich verschluckt.
»Ist ganz einfach«, hatte der Doktor gesagt. »Wenn die Käfer wieder kommen, mach die Augen zu und zieh die Decke über dich. Dann können sie dich nicht sehen und krabbeln an dir vorbei.«
Natürlich wusste der Junge, dass auch das gelogen war. So große Käfer gab es gar nicht. Der Doktor erzählte ihm das nur, um ihn zu beruhigen. Aber der Trick funktionierte, und das war schließlich die Hauptsache. Wenn er die Hand ausstreckte, wäre da seine Kuscheldecke, und alles wäre wieder gut.
Der Junge streckte die Hand nach oben – und griff ins Leere. Da war keine Decke, da war kein Stuhl, da war gar nichts. War jetzt alles vorbei?
Was hatte der Doktor gesagt, der sich immer die Haare mit einem kleinen Gummiband am Hinterkopf zusammengebunden hatte? Der ihn immer »Kumpel« genannt hatte und ständig »Gimme five« mit ihm machen wollte. Wo war der Doktor jetzt?
Der Junge blinzelte, es war so heiß. Er konnte kaum noch atmen. Plötzlich war da ein Summen in der Luft, und dann kam das Brausen. Laut wie ein heranrasender Zug war das Geräusch. Der Boden zitterte, es war dunkel, und es roch nach Erde. Plötzlich fühlte der Junge, wie sein Körper ganz leicht wurde, und dann stürzte er ab. Er fiel tiefer und tiefer, und dann verlosch alles Licht.
1. Kapitel
Docteur Leon Ritter hatte die alte Küstenstraße gewählt, die Route de Vin, die Le Lavandou im Südwesten verließ und dann an einem Weingut nach dem anderen entlangführte, die wie Perlen an einer Schnur aufgereiht waren. Leon hatte das Dach seines fünfundzwanzig Jahre alten Peugeot-Cabriolets aufgeklappt und Radio Nostalgie, seinen Lieblingssender, eingestellt, der seine Hörer rund um die Uhr mit alten Chansons erfreute. Leon liebte Chansons, und an warmen Sommertagen wie diesem drehte er das Autoradio so laut, dass die Lautsprecher schepperten. Eine Viertelstunde später bog der Rechtsmediziner auf einen Feldweg ab und stellte den Motor aus. Die Musik verklang, und einen Moment klang die Stille laut in seinen Ohren. Er lehnte sich auf seinem abgewetzten Ledersitz zurück, atmete die Luft ein, die nach Weinreben und dem nahen Meer roch, und lauschte dem plötzlich wieder einsetzenden Geräusch der Zikaden, diesem gewaltigen, ewigen Orchester der Provence. Leon sah zum Himmel hinauf, wo ein kräftiger Mistral die Fetzen von Zirruswolken vor sich herschob. Genau das waren die Momente, in denen er wusste, dass er alles richtig gemacht hatte. Dass er sich richtig entschieden hatte, als er die Stelle in der Provence angenommen hatte, allen Unkenrufen seiner Kollegen zum Trotz.
Er konnte sich noch gut erinnern, wie er seinen Job als Oberarzt im Rechtsmedizinischen Institut der Universität Frankfurt gekündigt hatte. An die mitleidigen Blicke der Kollegen, die Prophezeiungen, dass er verkümmern, untergehen, in Vergessenheit geraten würde. Ein Job in einer unbekannten Provinzklinik irgendwo im Süden von Frankreich, das musste man sich mal vorstellen. Da zerfiel die Karriere eines Mannes in Trümmer, von dem es noch vor wenigen Wochen hieß, er könne schon bald der neue Leiter der renommierten Rechtsmedizin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt werden. Ein aufsteigender Stern am Medizinerhimmel. Das alles gab er auf für … ja, wofür eigentlich? Für den Job eines Rechtsmediziners in der Provence?
Die Kollegen hatte ja recht: Er stand neben sich. Natürlich war es der Tod seiner Frau gewesen, der ihn ganz tief im Inneren seiner Seele erschüttert hatte. Eines Morgens, nach einer weiteren schlaflosen Nacht, hatte er plötzlich gewusst, dass er nicht in Frankfurt bleiben wollte. Nicht an der Uni und nicht in der Stadt, nicht einmal in Deutschland. Er würde etwas Grundsätzliches in seinem Leben ändern müssen, wenn er den Unfall seiner Frau verarbeiten wollte. Und er musste es gleich tun, bevor es zu spät war und das alte Leben ihn wieder einholte. An diesem Tag fiel ihm die kleine Anzeige am Schwarzen Brett auf. Die Stellenanzeige einer Klinik in der Provence, die sein Leben verändern sollte. Das war jetzt acht Jahre her, und er hatte es keinen Moment bedauert, diesen Schritt ins Ungewisse gegangen zu sein.
Leon nahm einen weiteren tiefen Atemzug und sah auf das glitzernde Meer, bis seine Augen tränten. Dann wendete er den Wagen und fuhr zurück auf die Straße in Richtung Hyères. Etwas außerhalb der Stadt lag die Klinik Saint-Sulpice keine halbe Stunde von Le Lavandou entfernt. Ein farbloser Bau aus den Siebzigern. Vor einigen Jahren war die Klinik durch einen modernen Anbau erweitert worden. Seitdem besaß das Krankenhaus nicht nur eine hochmoderne Radiologische Abteilung, sondern sogar einen Hubschrauberlandeplatz. Dem Heliport war die neue Intensivstation für die Erstversorgung von Unfallopfern angeschlossen. Der Arbeitsplatz von Médecin Légiste Docteur Leon Ritter befand sich eine Etage tiefer, im Souterrain des neuen Anbaus: die Abteilung für Rechtsmedizin.
2. Kapitel
Leon hatte sein Peugeot-Cabriolet auf dem Mitarbeiterparkplatz im Schatten einer Pinie geparkt. Er ging um das Gebäude herum und betrat die Klinik durch den gläsernen Haupteingang, als könnte er auf diese Weise noch etwas Sonnenlicht und Wärme mit in seine voll klimatisierten Katakomben nehmen, wie er seinen Arbeitsplatz gelegentlich nannte.
Als Leon zum Empfang kam, wurde er von einer fröhlich lächelnden, etwas molligen Frau aufgehalten, deren Namensschildchen an der gestreiften Bluse sie als Schwester Monique auswies.
Die Schwester galt unter ihren Kollegen als pingelig und streng, nur bei Leon, »ihrem« Docteur, machte sie eine Ausnahme, was nicht nur daran lag, dass Leon ihr gelegentlich ein Pain au Chocolat aus der Bäckerei Loup in Lavandou mitbrachte. Schwester Monique bewunderte Leon. Seine entspannte Art, die dazu führte, dass ihn nichts aus der Ruhe brachte und dass er sich von niemandem etwas vorschreiben ließ. Nicht einmal von Dr. Hugo Bayet, dem Klinikleiter. Ginge es nach Schwester Monique, dann säße Leon nicht im Keller, sondern im Chefarztbüro im ersten Stock mit Blick auf den dunkelblauen Golf de Giens.
»Bonjour, Docteur«, rief sie von ihrer Empfangstheke aus und hielt einen Zettel in der Hand hoch, um Leon zu bedeuten, dass er herüberkommen solle.
»Schwester Monique«, begrüßte Leon sie freundlich. »Wie immer die Erste. Ohne Sie könnten wir die Klinik dichtmachen.«
»Ach, Docteur …« Die Schwester kicherte wie ein kleines Mädchen. Dann sah sie ihren Lieblingsdoktor an. »Die Staatsanwaltschaft hat angerufen.« Immer noch lächelnd reichte sie Leon den Zettel.
»Worum geht es denn?«, fragte Leon.
»Es geht um den Fall Lagarde. Sie brauchen das Gutachten noch heute«, sie zögerte kurz, als würde es ihr nicht zustehen, Kommentare abzugeben. »Sie wissen doch, wie die bei der Staatsanwaltschaft in Toulon sind.«
»Ich weiß. Wenn es nach denen ginge, müssten wir hier auch noch übernachten«, sagte Leon. »Na dann …«
Leon ging zur Treppe, die ins Souterrain führte und somit direkt in die Rechtsmedizinische Abteilung. Die Rechtsmedizin befand sich zwar in der Klinik Saint-Sulpice, aber die Abteilung arbeitete unabhängig. Ihre Auftraggeberin war vor allem die Staatsanwaltschaft, die auf rechtsmedizinische Gutachten in Strafprozessen angewiesen war. Dabei ging es neben Mord auch um andere Gewalttaten wie zum Beispiel Körperverletzung oder sexuellen Missbrauch. Gelegentlich wurde die Rechtsmedizinische Abteilung auch von Versicherungen um ihre Einschätzung gebeten, zum Beispiel um den Schweregrad von Verletzungen oder Erkrankungen eines Versicherungsnehmers wissenschaftlich zu beurteilen.
Die Klimaanlage im Autopsiesaal summte leise, und Leon spürte den kühlen Lufthauch, der durch den lindgrün gekachelten Raum zog. Leon hatte Jeans, Hemd und Leinensakko gegen ein hellblaues kurzärmeliges OP-Hemd und Hose getauscht. Flüchtig sah er zum Lüftungsschacht an der Decke hinauf. Als er hier angefangen hatte, hatte er sich immer wieder wegen der viel zu niedrig eingestellten Klimaanlage erkältet. Es hatte ihn zähe Auseinandersetzungen mit dem Hausmeister gekostet, aber schließlich hatten sie sich auf eine erträgliche Temperatur von einundzwanzig Grad Celsius geeinigt. Ein Kompromiss, der sogar von Leons Assistenten Olivier Rybaud akzeptiert wurde.
Rybaud hatte die erste Obduktion dieses Tages bereits vorbereitet. Die Tote auf dem Sektionstisch war mit einem Tuch abgedeckt. Auf einem Rollwagen lagen die wichtigsten Instrumente bereit, und auf dem flachen Touchscreen des Computers konnten alle relevanten Daten abgelesen werden. Leon tippte auf den Bildschirm. Jetzt tauchte eine Nummer auf und ein Name: Josette Hourriez.
Leon betrachtete die tote Frau, deren Körper mit einem hellgrünen Tuch bedeckt war, einen Moment lang. Am oberen Ende des Obduktionstisches war eine Strähne dünner grauer Haare zu sehen, die unter dem Tuch hervorgequollen war. Die Frau musste deutlich über siebzig sein, schätzte Leon und gab seinem Assistenten mit einem kurzen Nicken zu verstehen, dass er anfangen konnte. Wie ein Zauberer zog Rybaud mit einer schnellen Bewegung das Tuch zur Seite, und da lag sie. Die Haut wächsern, die Augen geschlossen. Der Körper ausgezehrt.
»Sie wiegt keine fünfzig Kilo mehr«, sagte Rybaud, der Leons Gedanken erriet.
»Bekannte Krankheiten?«
»Nach dem Tod ihres Mannes ist sie ins Altenheim gezogen«, antwortete der Assistent, als müsste jeder wissen, was das bedeutete.
Leon wunderte sich schon lange nicht mehr, dass sein Assistent Dinge wusste, die nicht in den Polizeiprotokollen standen.
»Sie kannten die Frau?«
»Sie nicht, aber ihren Mann«, sagte Rybaud. »Jean Hourriez. Der war ewig Versicherungsvertreter bei Assurance Provençal.«
»Hat sich denn sonst niemand um die alte Dame gekümmert?«, wunderte sich Leon. »Jemand aus der Familie?«
»Eine hat sich gekümmert …«, sagte Rybaud vieldeutig und mit einer Geste zu dem aufgeklappten Laptop auf dem Rolltisch. »Steht alles im Polizeibericht.«
Mit gespielter Strenge musterte Leon den anderen Mann. »Wie lautet die erste Regel bei einer Autopsie?«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Rybaud. »Man soll nichts drauf geben, was die Flics sagen. Aber die sind ja nicht alle blöd.«
»Ganz im Gegenteil«, erwiderte Leon. »Auch zu viel Fantasie kann zu falschen Theorien führen.«
Leon hatte am Tag zuvor den kurzen Bericht über den Mord im Altenheim im Var-Matin gelesen. Demnach hatte die achtundzwanzigjährige Enkelin nach und nach das Konto ihrer bettlägerigen Großmutter geplündert. Irgendwann hatte die betagte Dame den Betrug durch einen Zufall bemerkt und ihre Enkelin zur Rede gestellt. Wenige Tage später hatte die junge Frau ihre Großmutter im Heim mit einem Kissen erstickt. Jedenfalls stand es so im Polizeibericht.
Wenn Leon eine Autopsie begann, war es ihm am liebsten, so wenig wie möglich über das Opfer zu wissen. Er wollte sich von den Eindrücken überraschen lassen und weitgehend unvoreingenommen an die Untersuchung gehen. Das war für ihn die sicherste Methode, nichts zu übersehen. Auch der kurze Artikel im Var-Matin hatte in seiner Fantasie bereits ein bestimmtes Bild erzeugt: eine schwächelnde alte Großmutter und ihre gierige Enkelin, die die alte Frau bestohlen hatte. Was lag da näher als ein Mord …?
»Schließlich war die Enkelin die einzige Besucherin im Raum!« Sein Assistent klang fast etwas gekränkt, doch er führte weiter aus. »Als der Pfleger ins Zimmer kam, hielt sie sogar noch das Kissen in der Hand, mit dem sie gerade ihre Großmutter erstickt hatte.«
»Das ist jetzt aber Spekulation«, unterbrach Leon seinen Mitarbeiter freundlich, aber bestimmt.
»Sie hat selbst gesagt, dass sie es getan hat.«
»Vielleicht war sie ja nur verwirrt«, sagte Leon. »Da geben Menschen leicht etwas zu, das sie nicht getan haben.«
»Die Flics haben sie jedenfalls in U-Haft genommen.« Für Rybaud war der Fall eindeutig.
»Die Polizei nimmt gerne jemand fest, wenn sie auf diese Weise schnell einen Fall abhaken kann«, meinte Leon. »Das haben wir doch schon zigmal erlebt.«
»Wenn die Situation aber so eindeutig ist?«, versuchte es Rybaud noch einmal.
»Fangen wir an«, überging Leon den Einwurf, als spräche er mit einem trotzigen Schüler.
Er schaltete das Aufzeichnungsgerät für den Untersuchungsbericht ein, das mit einem Gelenkarm an der Decke befestigt war und sich in alle Richtungen verstellen ließ. Rybaud zog den Rollwagen näher heran. Und Leon begann seinen Bericht. »Wir haben ein Opfer, weiblich. Alter …« Leon unterbrach sich und sah Rybaud an.
»81 Jahre«, ergänzte der Assistent sofort. »Gewicht 46 Kilo, Größe 167 Zentimeter.«
»Alter 81 Jahre«, übernahm Leon die Daten für das Protokoll, »Größe 167 Zentimeter und Gewicht 46 Kilogramm.«
Das war eine der großen Qualitäten seines Assistenten: Rybaud hatte ein phänomenales Gedächtnis und konnte sich auch noch nach Monaten an einzelne Patientendaten erinnern. Leon griff nach dem Handgelenk des Opfers, hob den Arm leicht an und ließ ihn wieder neben der Toten sinken.
»Die Totenstarre hat sich bereits wieder abgebaut.« Leon beugte sich über die Tote und hob sie an der Schulter ein paar Zentimeter an, sodass er das Schulterblatt betrachten konnte. »Leichenflecken haben sich deutlich abgesetzt, was auf einen Todeszeitpunkt vor mindestens drei, eher fünf Tagen hindeutet.«
Leon umrundete das Opfer auf dem Sektionstisch. Einmal blieb er kurz stehen und nickte, als hätte die tote Frau ihm etwas gesagt. Leon hatte eine ungewöhnliche Vorgehensweise bei seinen Obduktionen: Er »sprach« mit den Toten, wie er es nannte. Seiner Theorie nach konnte niemand die Todesumstände genauer beschreiben als das Opfer selbst. Davon war Leon überzeugt. Man musste nur in der Lage sein, die Spuren richtig lesen zu können, um zu verstehen, was wirklich geschehen war. Anfangs hatten ihm seine Theorien bei den Kollegen spöttische Bemerkungen eingebracht. Aber seine Ermittlungserfolge gaben ihm recht. Leons Aufklärungsquote war legendär, und er wurde immer wieder zu Gastvorträgen an den medizinischen Universitäten von Aix oder Marseille eingeladen.
»Da sind Hämatome.« Rybaud deutete auf einige Flecken über dem Schienbein, die sich unterschiedlich verfärbt hatten.
»Vom Benutzen eines Rollators, würde ich vermuten.« Leon betrachtete die Unterarme der Toten. »Keine Abwehrspuren.«
»Abwehrspuren gegen ein Kissen?«, wiederholte Rybaud spöttisch und sah zu Leon.
»Was würden Sie tun, wenn jemand versucht, Sie mit einem Kissen zu ersticken?« Leon griff zu dem Rollwagen und zog ein sterilisiertes Skalpell aus der Schutzfolie.
»Machen wir weiter«, sagte er und schaltete das Aufzeichnungsgerät wieder ein.
3. Kapitel
In den Räumen der Gendarmerie nationale in der Avenue André del Monte in Le Lavandou herrschte Hochbetrieb. Dabei war es noch nicht einmal neun Uhr. Im Vorraum mit den hohen gläsernen Eingangstüren war es schon jetzt heiß und stickig. Das würde sich im Lauf des Tages noch steigern: Wenn die Sonne gegen Mittag auf die Fenster brannte, stieg die Temperatur in der Wache wie in einem Toaster. Eigentlich sollte die brandneue Klimaanlage für erträgliche Temperaturen sorgen, aber die Anlage streikte – mal wieder. »Une petite journée« hatte der Monteur versprochen. Gerade einmal einen Tag würde die Reparatur dauern, dann würde die Anlage garantiert wieder reibungslos laufen. Aus dem »kleinen Tag« waren inzwischen zwei Wochen geworden.
Ein dürrer Mann in kurzen Hosen und mit einem winzigen Hund auf dem Arm drängte sich nach vorn, um lauthals den Diebstahl seiner Brieftasche zu melden. Zwei Mädchen stritten mit einer Frau darüber, wer wessen Auto auf dem Parkplatz angefahren hatte, und ein Mann, der für diese frühe Stunde eindeutig zu viel Rosé intus hatte, beschwerte sich, dass er im Hafen von einem Hütchenspieler abgezockt worden war.
»Madame«, der Mann mit dem Hund tippte Isabelle auf den Arm, »wir waren zuerst hier.«
Aber Isabelle, die noch ihre Zivilkleidung trug, sah den Mann nicht einmal an, sondern schlängelte sich zur Tür ihres Büros durch, gleich auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges. Sie öffnete die Tür, an der ein Messingschild mit ihrem Namen angebracht war.
Aufatmend betrat Isabelle ihr Büro und zog die Tür schnell hinter sich zu. Verglichen mit dem Gedränge draußen auf dem Flur war dies eine Oase der Ruhe. Doch dann stutzte sie und korrigierte sich mental: Ihr Büro wäre eine Oase der Ruhe gewesen, wenn da nicht ihr Kollege Lieutenant Kadir und diese Frau auf sie gewartet hätten. Isabelle schätzte die Besucherin auf Anfang vierzig, wobei diese sich jünger kleidete. Teure Kleidung aus der Boutique, dachte Isabelle. Sie sah sofort, dass die Besucherin geweint hatte.
»Entschuldige, dass wir hier so einfach reingegangen sind«, sagte der Lieutenant mit der dunklen Haut und den scharf geschnittenen Zügen eines Mannes aus dem Maghreb, die ihm bei seiner Arbeit schon so manches Vorurteil eingebracht hatten. Dabei war Lieutenant Kadir in Nizza geboren und galt unter Kollegen als französischer als die meisten Franzosen. »Da draußen, da konnte ich sie ja schlecht lassen«, fügte Kadir mit einer Kopfbewegung in Richtung Tür hinzu.
»Schon gut, was gibt es denn?«, fragte Isabelle, und man merkte ihr an, dass sie bereits ahnte, dass dies einer der Tage war, die nur mit schlechten Nachrichten daherkamen.
»Das ist Madame Julie Marsenne«, sagte Mohamad Kadir, den Isabelle, wenn sie unter sich waren, Moma rief. Er wies mit einer Geste auf die Besucherin. »Sie sucht ihre Kinder.«
»Sie sind weg, einfach so«, schniefte die Frau in ihr zusammengeknülltes Papiertaschentuch. »Das kann doch nicht sein, oder?«
»Wo?«, fragte Isabelle, während sie Madame Marsenne musterte. Ihr fiel auf, dass die Besucherin eine sündhaft teure Markenuhr trug. »Wo sind Ihre Kinder verschwunden, Madame?«
»Ich hatte den Wagen vor dem Supermarkt abgestellt. Wirklich nur ganz kurz. So wie immer.«
»Sie meinen, Sie haben die Kinder allein im Auto gelassen …?«, fragte Isabelle vorsichtig.
»Das haben wir oft so gemacht. Die Kinder wissen, dass sie dann für ein paar Minuten das Auto nicht verlassen dürfen. Ich habe nur ein paar Müsliriegel geholt. Und als ich zurückkam, da …«, für einen Moment versagte der Frau die Stimme. Dann hatte sie sich wieder gefangen. »Sie waren weg. Verschwunden, einfach so.«
Isabelle warf Lieutenant Kadir einen fragenden Blick zu.
»Wir waren ja nur zu zweit im Streifenwagen, als Madame Marsenne uns angehalten hat«, sagte Kadir. »Lieutenant Masclau und ich haben sofort alles abgesucht, aber da waren keine Kinder, nichts.«
»Auch nicht im Supermarkt?«, fragte Isabelle.
Moma schüttelte den Kopf. »Wir hätten sie nicht übersehen können. Um die Zeit waren noch kaum Kunden im Supermarkt.«
»Bitte«, die Frau sah Isabelle flehentlich an, »Sie müssen etwas unternehmen. Sie müssen sie suchen. Sie sind doch …«, die Frau unterbrach sich, »noch so klein.«
»Wie alt sind Ihre Kinder, Madame?«, fragte Isabelle.
»Lucas ist sieben und Louisa …«, die Frau schluchzte leise auf. »Louisa ist erst vier.«
»Ihre Tochter ist erst vier Jahre alt?« Isabelle klang ein wenig erschrocken. Am liebsten hätte sie die Frau gefragt, wie eine Mutter ihre beiden Kleinkinder am helllichten Tag aus den Augen verlieren konnte.
»Bitte, helfen Sie mir«, sagte die Frau flehentlich.
»Keine Sorge«, sagte Isabelle und legte ihrer Besucherin die Hand auf den Arm. »Wir werden Ihre Kinder finden, ganz bestimmt.«
»Sie würden nie weglaufen«, sagte Madame Marsenne. »Glauben Sie mir, Madame la Commissaire.«
»Capitaine. Capitaine Morell«, korrigierte Isabelle und schob das Namensschild auf ihrem Schreibtisch ein wenig in Richtung Madame Marsenne. Auf dem Schild stand neben dem Namen auch ihr Rang: Stellvertretende Polizeichefin. Und darauf war Isabelle stolz. Schließlich war sie die erste Frau, die es in Le Lavandou jemals an die Polizeispitze geschafft hatte.
»Fahndung?«, fragte sie Lieutenant Mohamad Kadir. »Wir haben den Markt und die angrenzenden Läden abgesucht«, fügte er hinzu. »Nichts.«
»Kennen sich die Kinder im Ort aus?«, fragte Isabelle.
»Bitte?«, sagte Madame Marsenne irritiert.
»Sie haben gesagt, dass Sie öfter mit Ihren Kindern bei dem Supermarkt geparkt haben?«
»Ja, es gab aber nie ein Problem, nie.«
»Würden Ihre Kinder den Weg nach Hause allein finden?«
»Nein, auf keinen Fall. Wir haben ein Haus auf dem Cap Nègre. Aber da wohnen wir eigentlich nur während der Sommerferien.« Sie sah sich unruhig um. »Bitte, können Sie denn nichts unternehmen? Die Polizei muss doch etwas tun können. Irgendetwas.«
»Das werden wir, Madame, keine Sorge«, sagte Isabelle freundlich und wandte sich an Kadir. »Einsatzleitung?«, fragte sie ihren Lieutenant.
»Weiß bereits Bescheid«, antwortete er. »Didier stellt gerade eine erste Suchmannschaft zusammen. Drei Blocks rund um den Supermarkt.«
»Wir brauchen einen größeren Suchradius«, Isabelle wies zu der Karte an der Wand ihres Büros, die Lavandou und Umgebung im Maßstab 1:25 000 zeigte. »Hier, von Saint-Claire im Osten die ganze Bucht entlang bis Port Bormes.«
Isabelle sah auf die Karte und dachte für einen Moment an ihre eigene Tochter. Wie sich Lilou vor einigen Jahren in der Hand dieses Psychopathen befunden hatte. Wie der Mörder ihrer Tochter das Messer an die Kehle gehalten und wie sie mit ihrer Waffe auf seinen Kopf gezielt hatte. Isabelle hatte noch nie zuvor so eine verzweifelte Angst gespürt. Ja, sie wusste nur zu gut, was die Mutter in diesem Augenblick empfand.
Isabelle betrachtete noch einmal die Karte. Es war zwar auch so kein besonders großes Suchgebiet, aber für zwei kleine Kinder bot es endlos viele Verstecke. Falls sie sich denn versteckten. Vielleicht marschierten sie ja in diesem Moment auch an irgendeinem Strand entlang. Oder jemand hatte sie auf einem der Campingplätze entdeckt und ihnen eine Orangenlimonade gemacht. Doch tief in ihrem Inneren wusste Isabelle, dass sie sich etwas vormachte. Sollten die beiden einfach nur weggelaufen sein, stellte sich eine völlig andere Frage: Warum hatte noch niemand die Kinder entdeckt?
»Gut, ich erweitere das Suchgebiet im Norden bis Collobrières«, sagte Kadir.
»In Ordnung, Moma. Ich will außerdem Straßensperren vor Favière und auf der D 559 gleich hinter dem Cap Nègre. Macht nur Stichproben. Jemand könnte die Kinder in Richtung Saint-Tropez mitgenommen haben.«
»Geht klar«, sagte Moma und griff nach dem Handfunkgerät, das er am Gürtel trug, und drückte die Sprechtaste.
»Kadir hier. Wir brauchen Leute für eine Fahndung nach zwei Kindern. Ja, sieben und vier Jahre alt. Besprechung in …«, er sah zu Isabelle herüber. Die hielt die fünf Finger ihrer linken Hand hoch. »In fünf Minuten«, sagte Moma, und Isabelle nickte. Er klemmte sein Funkgerät zurück an den Gürtel.
»Keine Sorge, Madame, wir finden Ihre Kinder. Bestimmt«, Isabelle legte ihre Hand freundlich auf die Schulter der mittlerweile wieder leise weinenden Mutter.
Das war gelogen. In Wirklichkeit hatte Isabelle nicht die geringste Ahnung, wo sie zuerst suchen sollte.
»Wie lange sucht ihr schon nach den Kindern?«, fragte Isabelle ihren Lieutenant.
Kadir sah auf seine Uhr. »Seit knapp fünfzig Minuten.«
»Ich hatte gerade erst entdeckt, dass die beiden nicht da waren. Ich bin über den Parkplatz gerannt und habe ihre Namen gerufen«, Madame Marsenne sah zu Isabelle. »Dann ist schon der Streifenwagen aufgetaucht.«
Moma bestätigte die Aussage mit einem stummen Nicken.
»Ich dachte, dass sie vielleicht irgendwo spielen würden«, murmelte Julie Marsenne.
»Sie werden sehen«, sagte Kadir, »spätestens nach ein paar Stunden kommen sie von ganz allein zurück.«
Isabelle hatte kurz aus dem Fenster in den leeren Hof des Polizeireviers gesehen. Sie bemühte sich, entspannt und besonnen zu wirken, als sie sich wieder zu der Mutter umdrehte. Es gab bei der Polizei eine Faustregel, und die besagte, dass fünfundachtzig Prozent aller Menschen, nach denen die Polizei fahndete, von allein wieder auftauchten. Aber das galt natürlich nur für Erwachsene, nicht für kleine Kinder. Die gleiche Regel besagte auch, dass die Chance, einen verschwundenen Menschen, der nicht von selbst wieder auftauchte, gesund wiederzufinden, nach den ersten vierundzwanzig Stunden dramatisch abnahm. Aber daran wollte Isabelle im Moment nicht denken. Warum sollte sie die Hoffnungen dieser Mutter zerstören? Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit würden die beiden Kinder innerhalb der nächsten zwei bis drei Stunden irgendwo im Ort gefunden werden. Wahrscheinlich hatten sie sich nur verlaufen. So etwas geschah ständig in der Ferienzeit, wo Kinder im allgemeinen Gedränge schnell verloren gingen.
»Gibt es in dieser Gegend irgendjemanden, den die Kinder kennen?« fragte Isabelle. »Vielleicht einen Bekannten oder den Kinderarzt?«
Madame Marsenne hatte ihr Gesicht in die Hände gestützt und schüttelte langsam den Kopf. »Nein, ich glaube nicht.«
»Vielleicht sind sie in eines der Geschäfte für Strandspielzeug«, fiel Moma ein. »Davon gibt es jede Menge an der Promenade. Oder in einen der Eissalons.«
»Die Kirmes …« Die Mutter sah Isabelle an. »Ich war mit den beiden gestern auf der Kirmes. Sie wollten gar nicht mehr nach Hause gehen, so gut hat ihnen das Karussell gefallen.«
»Haben Sie ein Foto von Ihren Kindern?«
»Ja, natürlich, hier auf dem Handy.« Julie Marsenne hatte das Handy aus der Tasche gezogen, mit dem Finger über die Fotoliste gescrollt und auf eines der Bilder getippt. »Können Sie das brauchen?«
Ein typisches Urlaubsfoto öffnete sich auf dem Screen: zwei Kinder, die auf der Kirmes nebeneinander in einer Gondel des Karussells saßen.
»Ja, das Bild ist gut«, sagte Isabelle. »Schicken Sie es mir rüber. Es wird von uns ausschließlich für die Fahndung verwendet.«
4. Kapitel
»Das Blutbild bekommen Sie in einer Stunde«, sagte Rybaud, »die Schnitte habe ich bis heute Abend präpariert.«
Die Obduktion der Leiche von Madame Lagarde hatte eine gute Stunde gedauert und war ohne besondere Überraschungen verlaufen. Keine unentdeckten Krankheiten, keine auffälligen Verletzungen. Aber trotzdem, oder gerade deswegen, hatte Leon etwas entdeckt, das, wenn es sich bestätigte, ein völlig neues Licht auf diesen Fall werfen würde. Die alte Dame hatte Leon ihr Geheimnis verraten, ihn wissen lassen, was geschehen war in jenem letzten Augenblick ihres langen Lebens. Ihren Tod hatte niemand kommen sehen. Aber er hatte dennoch Spuren hinterlassen.
»Es ist nicht so, wie wir dachten.« Leon hatte die Ergebnisse auf dem Bildschirm studiert. Dann drehte er sich um und betrachtetet nachdenklich den toten Körper.
»Sie meinen: Es ist doch nicht so abgelaufen, wie es im Polizeibericht steht«, in Rybauds Stimme klang die leise Kritik eines Mediziners, der sicher war, die bessere Diagnose erstellt zu haben.
»Wir haben uns beide geirrt.« Leon hatte den Kopf etwas schräg gelegt, als könnte er auf diese Weise besser in sich hineinhorchen. »Die alte Dame war zum Zeitpunkt ihres Todes eine leidlich gesunde Frau gewesen. Ihre körperlichen Schwächen waren vergleichsweise harmlos und ihrem Alter entsprechend. An den Organen gab es aus medizinischer Sicht keine Auffälligkeiten. Von einer Zyste in der rechten Niere und einigen Divertikeln im Darm einmal abgesehen, die stellten aber keine lebensbedrohenden Erkrankungen dar«, resümierte Leon.
»Auffällig sind dagegen die Spuren, die das Kissen hinterlassen hat«, sagte Leon und beugte sich über die Tote. »Als der Täter versuchte, es seinem Opfer mit Gewalt aufs Gesicht zu drücken und in den Mund zu stoßen. Dabei hat der Stoff Fäden in der Gebissprothese hinterlassen.«
Leon zupfte diese Fäden vorsichtig aus dem Mund und ließ sie in eine Phiole gleiten. Die Fäden stammten eindeutig von dem Kissen, und sie ließen nur einen Schluss zu: Leon spürte, wie ihm ein kleiner Schauer über den Rücken lief. Ein untrügliches Zeichen, dass er auf eine heiße Spur gestoßen war. Ein Gefühl des Erfolges.
Er zog die beleuchtete Lupe näher zu sich heran und hob mit einem kleinen Holzspatel vorsichtig das rechte Augenlid des Opfers um ein paar Millimeter an – nichts. Die Bindehaut war blass und sauber. Genauso verhielt es sich auch mit dem linken Auge. Dann drückte Leon die Ohrmuschel ein wenig nach vorn. Jetzt hätte er eigentlich die für einen Tod durch Ersticken so typischen blutigen Einschlüsse sehen müssen, die sich in dem Bindehautgewebe des Auges und hinter den Ohren bildeten, wenn dem Körper die Zufuhr von Sauerstoff verwehrt wurde. Wenn es zu einer Hypoxie kam und gleichzeitig das giftige Kohlenstoffdioxid nicht mehr abgeatmet werden konnte. All die dafür typischen Indikatoren gab es jedoch bei dieser Toten nicht: keine geplatzten Kapillaren in Augen oder Schleimhäuten, keine verräterischen Blutungen hinter den Ohren, keine akut geblähte Lunge.
Leon richtete sich auf und schwang die beleuchtete Lupe zur Seite. Er sah sekundenlang schweigend auf die Leiche der alten Frau. Dann sah er seinen Assistenten an.
»Was bedeutet …?«, fragte Rybaud ungeduldig.
»Die Enkelin hat sie nicht getötet«, stellte Leon schließlich sachlich fest und sah seinen Mitarbeiter an.
»Wer denn sonst? Madame Lagarde war allein im Zimmer.«
Leon gab ein leises Brummen von sich. »Sie war bereits tot«, sagte er knapp.
»Sie meinen …?« Rybaud unterbrach sich und sah irritiert zum Opfer.
»Die Frau war kurz zuvor an einem Herzinfarkt gestorben«, sagte Leon. »Einem klassischen Myokardinfarkt, wahrscheinlich ausgelöst durch eine verstopfte Herzkranzarterie. Genaueres werden wir erfahren, wenn wir den Brustraum und den Schädel eröffnet haben. Aber an der Schuldfrage wird das nichts mehr ändern.«
»Das würde ja bedeuten …?«, setzte Rybaud an, stockte dann aber.
»Dass die Enkelin eine Tote umgebracht hat. Wollten Sie das sagen?«, fragte Leon, und Rybaud sah seinen Chef an, als hätte der gerade einen geschmacklosen Scherz gemacht.
»Sie denken wirklich …?«, versuchte es der Assistent noch einmal und betrachtete die Tote.
»Madame Lagarde ist in aller Stille von uns gegangen, wie man so schön sagt«, meinte Leon. »Die Enkelin kam am frühen Nachmittag zu ihrer Großmutter ins Heim. Zu einer Zeit, wenn alte Leute gerne noch ihr Mittagsschläfchen machen. Sie betrat den Raum, und da lag ihre Großmutter mit geschlossenen Augen, als würde sie schlafen. Sie hat das Kissen genommen und zugedrückt. Bis der Pfleger ins Zimmer kam.«
»Aber wir kennen den genauen Zeitpunkt der Tat«, erinnerte Rybaud.
»Nein, wir kennen den Zeitpunkt, den die Polizei rekonstruiert hat«, sagte Leon. »Aber das ist nicht der Todeszeitpunkt. Den Abdrücken in der Haut und den Verfärbungen der Leichenflecken nach zu urteilen, ist der Tod von Madame Lagarde eine gute Stunde vor dem Besuch ihrer Enkelin eingetreten.«
»Aber dann«, Rybaud dachte laut nach, »dann ist das ja gar kein Mord, höchstens …« Rybaud fischte in seinem Gehirn nach dem passenden Wort.
»Spannende Frage, was?« Leon zog die dünnen Latexhandschuhe aus und warf sie in einen Mülleimer, der sich per Annäherungssensor automatisch öffnete. »Das Schlimmste, was der Enkelin jetzt noch droht, ist Störung der Totenruhe.«
»Wir müssen sofort das Gericht informieren.«
»Ich kümmere mich gleich darum«, sagte Leon und deutete auf die Tote. »Wenn Sie hiermit bitte weitermachen würden.«
5. Kapitel
Über dem Kirmeseingang schwebte eine bunte handgemalte Tafel, auf der in Neonschrift PIRATES DES CARAÏBES stand. Daneben waren messerschwingende Seeräuber zu sehen und brennende Segelschiffe. Auf der Kirmes selbst ging es dagegen schon deutlich bescheidener zu. Der Veranstalter hatte seine wenigen Fahrgeschäfte auf dem Parkplatz gleich neben dem Sportplatz aufgebaut. Ein altes Kettenkarussell, eine Schiffschaukel und ein Miniriesenrad und natürlich die obligatorische Autoscooterbahn. Über allem lag die quäkende Stimme des Veranstalters, der vergeblich versuchte, die Rückkopplung der Lautsprecheranlage in den Griff zu bekommen, dabei aber nicht minder begeistert die Vergnügungen anpries.
Zwischen den Attraktionen gab es einige Buden, die abends Pommes mit Mayonnaise oder halbe Brathähnchen verkauften. Daneben gab es außerdem Stände für Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Zwei übernächtigte Kirmeshelfer waren dabei, die Abdeckplanen von den Sitzen der Fahrgeschäfte zu ziehen, und gaben sich alle Mühe, kleine Reparaturen an der Mechanik zu erledigen, bevor die Veranstaltung gegen Mittag wieder öffnen würde.
Die Kirmeshelfer sahen aus, als würden sie sich nach einer kühlenden Brise und der gnädigen Dunkelheit sehen, damit die Besucher nicht gleich erkannten, wie sehr die Piraten der Karibik in die Jahre gekommen waren. Überall blätterte an den Fahrgeschäften die Farbe ab, viele der Lichterketten brannten längst nicht mehr, und bei den Schaukelpferden auf dem Kinderkarussell quoll die verrottete Rosshaarfüllung aus den Rissen der Sättel. Es war noch nicht mal Mittag, es würde also noch eine Weile dauern, bis die Kirmes ihre Pforten öffnen würde.
Isabelle hatte vier junge Kollegen an die beiden Ausgänge der Kirmes postiert. Zusammen mit Lieutenant Masclau war sie auf dem Weg zum Veranstalter, einem gewissen Pierre Seguin, der sein Wohnmobil gleich hinter dem Karussell geparkt hatte.
Seguin saß auf den Stufen seines Wohnwagens. Er hatte sich dem Motto seiner Veranstaltung gemäß ein Piratentuch um den Kopf geknotet. Womit er für Isabelle eher wie eine übernächtigte Reinigungskraft als wie ein Freibeuter aussah. Den Mann schätzte sie auf Anfang fünfzig. Er war sonnenverbrannt und trug khakifarbene Bermudas. Seine Füße steckten in ausgelatschten grünen Crocs. Unter dem halb geöffneten Hemd mit den aufgekrempelten Ärmeln konnte Isabelle erkennen, dass der Mann offenbar komplett tätowiert war. Er hielt ein kleines Bündel Scheine in der Hand, die er in einen Papierumschlag abzählte, als Isabelle mit Lieutenant Masclau auf ihn zutrat.
»Monsieur Seguin?«, fragte Masclau, während der Mann auf den Stufen vergeblich versuchte, noch schnell das Geld in seine Hosentasche zu stopfen.
»Erwarten Sie jemand vom Finanzamt?« fragte Isabelle provozierend.
»He, bei mir ist alles legal!« Argwöhnisch betrachtete der Mann Isabelle und ihre Begleiter, die alle Uniform trugen.
»Ihre Geschäfte sind uns egal«, brummte Masclau, der wie meist schlechter Laune war. Er war genau in der richtigen Stimmung, um sich mit einem vorlauten Kirmesbesitzer anzulegen. Isabelle sah ihn nur kurz mahnend an, und Didier Masclau schluckte runter, was er gerade sagen wollte.
»Was soll das werden? Etwa schon wieder ’ne Kontrolle?«, fragte Seguin. »Ihr wart doch erst gestern hier.«
»Sie sind doch Pierre Seguin?«, fragte Isabelle.
»Was interessiert die Flics, wer ich bin?«
»Vorsicht, Klugscheißer«, raunzte ihn Didier Masclau an. »Wir können das auch alles auf der Wache klären.«
»Pierre Seguin«, leierte der Mann mit genervtem Unterton. »Ja, meine Mitarbeiter arbeiten alle auf 450-Euro-Basis, und ja, sie sind alle angemeldet und versichert. Die Anlagen hier sind von der Police municipale inspiziert und abgenommen. Wir öffnen täglich um siebzehn Uhr und schließen um Punkt dreiundzwanzig Uhr. Sonst noch Fragen?«
»Wir suchen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.« Isabelle hatte nach ihrem Handy gegriffen und zeigte dem Kirmeschef auf dem Display eines der Fotos, die Julie Marsenne ihr geschickt hatte. Der Junge hatte darauf seiner kleinen Schwester den Arm um die Schulter gelegt. Das Mädchen trug einen pinkfarbenen Rucksack, von dem aber nicht viel mehr als die Trageriemen zu sehen waren. Die Kinder lachten, und im Hintergrund sah man die bunte Beleuchtung des Karussells. Lucas hatte eine Portion Zuckerwatte in seiner freien Hand, die die Geschwister sich offensichtlich teilten. Den fröhlichen Gesichtern nach zu urteilen, schien es ihnen zu schmecken.
Pierre Seguin warf einen kurzen Blick auf das Display und zuckte dann mit den Achseln. »Ich kann mir keine Gesichter merken.« Er klang mürrisch. »Erst recht nicht von Kindern, echt nicht. Die sehen alle gleich aus für mich.«
»Das ist er! Der Typ mit der Zuckerwatte«, war da plötzlich eine Stimme zu hören. Im selben Augenblick drängte sich eine aufgeregte Madame Marsenne zwischen den Wohnwagen hindurch. Sie deutete auf Pierre Seguin. Ihr auf den Fersen folgte Lieutenant Kadir, der versuchte, mit der empörten Frau Schritt zu halten.
»Warten Sie doch, bitte, Sie können nicht einfach hier reinlaufen!«, sprach Kadir auf sie ein.
»Ich bin die Mutter! Ich suche meine Kinder«, sagte Madame Marsenne in einem verzweifelten Ton, als müsste jeder wissen, dass ihre Kinder verschwunden waren.
»Tut mir leid, Capitaine, aber …«, Kadir blieb etwas atemlos vor Isabelle stehen und drehte hilflos die Handflächen nach außen. »Ich konnte nichts machen.«
»Schon in Ordnung«, sagte Isabelle und legte der Mutter freundlich ihre Hand auf den Arm. »Also, was war mit dem Mann und der Zuckerwatte?«
»Er hat den Kindern das Zeug geschenkt«, sie deutete auf Pierre. »Ich habe deutlich Nein gesagt, aber er hat darauf gemeint, ein bisschen Zuckerwatte würde die Kinder schon nicht umbringen.«
»Hat er wirklich ›umbringen‹ gesagt?«, fragte Lieutenant Masclau.
»Das war doch nur so dahingesagt«, murmelte Pierre Seguin. Es schien, als spürte er plötzlich, dass es mit diesen Kindern offenbar ein ernstes Problem gab und er mitten darin steckte.
»Erklären Sie das ihr.« Isabelle machte eine Handbewegung in Richtung Madame Marsenne. »Sie ist die Mutter. Ihre Kinder sind verschwunden.«
»Glauben Sie, dass die beiden …?« Sie sah Isabelle erschrocken an.
»Nein, natürlich nicht«, sagte Seguin. »Tut mir echt leid, aber hier marschieren jeden Abend ein paar Hundert Leute durch.« Seguin sah den Blick von Madame Marsenne. »Kann ich das Foto noch mal sehen?«
»Sie sind vier und sieben Jahre alt«, ergänzte Isabelle und hielt ihm ihr Handy noch mal hin.
»Kann sein, dass ich mich erinnere«, murmelte der Mann in den Bermudas. »Ich hab der Kleinen da Zuckerwatte gegeben«, er tippte auf das Handyfoto. »Ich dachte, die Jüngeren kommen doch immer zu kurz. Da hat der Junge aber sofort auch was gewollt.«
»Das ist Lucas.« Julie Marsenne klang müde. »Er ist ihr Bruder.«
»Haben Sie die Kinder heute Morgen gesehen?« Isabelle sah den Veranstalter an. »So gegen acht Uhr?«
»Himmel, nein. Wir öffnen doch erst am Nachmittag«, verneinte Seguin.
»Die Kinder waren also heute Morgen nicht auf dem Platz?«
»Nein, wie denn? Hier ist doch noch alles geschlossen.«
»Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn wir uns mal umsehen.«
»Brauchen Sie dafür nicht so einen Durchsuchungsdings?«
»Aha, ein ganz Schlauer.« Lieutenant Masclau war mittlerweile richtig übel gelaunt.
»Was denken Sie, brauchen wir denn einen Beschluss?«, fragte Isabelle mit süßer Stimme.
»Das habe ich nicht gesagt.« Jetzt war Seguin verunsichert.
»Ich kann auch den Staatsanwalt anrufen, und dann stellen wir hier den ganzen Laden auf den Kopf.« Isabelle hielt ihr Handy demonstrativ in der Hand, den Zeigefinger bereit, das Display zu berühren.
»Schon gut. Schauen Sie sich nur um, wenn Sie das glücklich macht.« Seguin stand auf und hob die Hände, als würde er sich angesichts der uniformierten Beamten freiwillig ergeben. »Sehen Sie sich um, wo immer Sie wollen.«
Obgleich der Kirmesplatz klein war, gab es eine Menge Verstecke. Ganz besonders für zwei kleine Kinder, die von zu Hause abgehauen waren, dachte Isabelle. Aber warum sollten die beiden Geschwister so etwas tun? Aus welchem Grund würden sie das sichere Auto verlassen? Hatte es vielleicht zuvor Streit zwischen der Mutter und den Kindern gegeben?
Isabelle teilte die sechs Polizisten ein, die sie aus dem Präsidium abkommandiert hatte. Mit ihnen durchkämmte sie systematisch das Gelände. Die Kirmes war auf dem äußersten Teil des großen Marktparkplatzes aufgebaut worden. Vor einigen Jahren hatte die Gemeinde Palmen auf dem Platz pflanzen lassen, um dem wöchentlichen Bauernmarkt einen Hauch von Karibik zu verpassen. Die Idee hatte funktioniert. Seitdem war der Donnerstagsmarkt ebenso ein Highlight für die Bauern der Gegend wie für die Touristen.
Isabelle sah sich um. Was hoffte sie hier zu finden? Wenn die Kinder wirklich das Auto verlassen hatten, um zur Kirmes zu laufen, wären sie inzwischen längst zum Parkplatz am Supermarkt zurückgekehrt. Dabei wären sie zwangsläufig irgendjemandem aufgefallen. Jemand, der sie gefragt hätte, wo ihre Eltern waren. Oder was sie außerhalb der Öffnungszeiten auf der Kirmes zu suchen hatten. Solche Erwachsenenfragen machten Kindern Angst, und sie wären längst zum Auto ihrer Mutter zurückgelaufen. Doch niemand schien die Kinder gesehen zu haben.
Isabelle war am äußersten Ende des Platzes stehen geblieben. Dort wo der Wind den Geruch von Salzwasser und Seegras aus der nahen Bucht herüberwehte. Sie konnte das Meer zwischen Strandrestaurants und Sonnenschirmen glitzern sehen. Und wenn die Kinder doch zum Wasser gelaufen waren? Lucas hatte im letzten Sommer schwimmen gelernt, hatte die Mutter Isabelle erzählt. Aber Louisa war im Wasser völlig hilflos, wenn man ihr nicht die Schwimmflügel anlegte. Und wenn sie ehrlich mit sich war, konnte sie sich auch bei Lucas nicht vorstellen, dass er über einen längeren Zeitraum im Wasser echte Überlebenschancen hatte.
Isabelle gab sich einen Ruck. Sie würden hier nichts finden, das spürte sie. Aber hatten sie nicht der Mutter erklärt, dass die Kinder schon nach wenigen Stunden von ganz allein wieder auftauchen würden? Plötzlich kam sich Isabelle vor wie eine Lügnerin.
Seufzend trat sie wieder zu den Beamten der Gendarmerie, die sich hinter dem Karussell versammelt hatten. Zu Kadirs Füßen lag ein grauer Plastiksack, wie er für Gartenabfälle verwendet wurde.
»Und?«, fragte Isabelle.
»Nichts«, antwortete einer der Männer. »Ein paar Klamotten, Flip-Flops, Sonnenbrillen. Was die Leute so verlieren … und eine Tasche.«
»Was für eine Tasche?«, wollte Madame Marsenne sofort wissen.
»So eine mit ’ner Katze drauf.« Der Mann zuckte mit den Schultern. »Was kleine Mädchen so mit sich rumschleppen.«
»Ist die Tasche da drin?« Isabelle tippte mit der Fußspitze auffordernd gegen den Sack.
Der Beamte ging in die Knie und zog mit behandschuhten Fingern einen pinkfarbenen Kinderrucksack, auf dem eine Katze abgebildet war, aus dem Sack. Er gab den Rucksack an Isabelle weiter.
»Der gehört Louisa, das ist Louisas Rucksack.« Einen Moment brach Julie Marsenne die Stimme. Isabelle konnte hören, wie die Mutter der Kinder schwer atmete und ihre Tränen unterdrückte.
»Sind Sie sicher?«, fragte Isabelle. Madame Marsenne nickte und versuchte, nach dem Rucksack zu greifen, aber Isabelle entzog ihn ihr.
»Natürlich bin ich sicher. Louisa hat den Rucksack doch ständig dabei. Sogar auf dem Foto, das ich Ihnen gegeben habe.«
Isabelle warf einen Blick auf das Bild auf ihrem Handy. Von dem Rucksack waren allerdings nicht mehr als ein paar Zentimeter der pinkfarbenen Träger zu erkennen, die sich über die schmalen Schultern der Vierjährigen spannten.
»Sie haben gute Augen, Madame«, sagte Isabelle anerkennend.
»Am Anfang hat sie ihn nicht mal zum Mittagsschlaf abgelegt.« Die Mutter wollte noch einmal nach dem Rucksack greifen, aber Isabelle zog ihn erneut zurück.
»Bitte nicht, Madame Marsenne«, erklärte Isabelle. »Das könnte ein Beweisstück sein.« Oder DNA-Spuren enthalten, fügte sie in Gedanken hinzu.
»Ein Beweis? Wofür?« Die Mutter klang alarmiert.
»War irgendetwas Spezielles darin?«, fragte Isabelle. »Damit wir wissen, ob das wirklich der Rucksack Ihrer Tochter ist.«
Madame Marsenne dachte einen Augenblick nach, dann sagte sie plötzlich: »Ihre Doda.«
»Das hier?«, fragte Isabelle und zog aus dem Rucksack ein hellblaues Tuch, das an eine Plastikente geknotet war. Isabelle betrachtete den Fund.
Julie Marsenne schluchzte auf. »Ihr Schmusetuch. Sie hat es zu ihrem ersten Geburtstag bekommen. Glauben Sie, dass Louisa hier irgendwo …«, die Mutter sah sich hektisch um, als könnten ihre Kinder jeden Moment zwischen den Fahrgeschäften auftauchen.
»Wo genau habt ihr den Rucksack gefunden?«, fragte Isabelle Lieutenant Kadir.
»Gleich bei dem Kettenkarussell.« Kadir deutete auf das rote Karussell. »Der Rucksack lag neben dem Eingang unter den Abdeckbrettern.«
»Wir brauchen mehr Beamte«, sagte Isabelle nüchtern. »Und wir brauchen Werkzeug.«
»Um siebzehn Uhr wird aber hier aufgemacht«, tat sich Seguin wichtig.
Isabelle griff zum Handy und gab die Kurzwahl für die Einsatzzentrale ein. »Hier wird geöffnet, wenn ich es sage. Klar?«
6. Kapitel
Der Junge hatte Angst und zitterte am ganzen Körper. Konnte es wirklich so kalt sein? Aber sie hatten doch Sommer, so viel wusste er ganz sicher. Oder gab es vielleicht das hier alles gar nicht wirklich? Er wollte, dass dieser Albtraum aufhörte, wollte zurück in die Wirklichkeit. Zu seinen Spielsachen und zum Meer. Ganz besonders zum Meer. Dann würde er die Fische mit seiner neuen Taucherbrille betrachten. Er wollte den Wellen zuhören, wie sie an den Strand klatschten und die Muscheln zerschlugen, bis sie fein wie Staub waren und man Sandburgen daraus bauen konnte. Das hatte ihm Pepo erzählt.
Wenn er sich nicht bewegte, dachte der Junge, wenn er kaum noch atmete, dann tat auch nichts mehr weh. Aber nur eine kleine Bewegung, und eine Flamme von Schmerz raste durch seine Schulter, sodass ihm die Luft wegblieb. Dann wollte er schreien, aber er konnte nur krächzen, und er spürte, wie seine ausgetrocknete Zunge ihm am Gaumen klebte. Da kann man nicht schreien, nicht mal so leise wie eine Maus, dachte er.
In einem Film über Dinosaurier hatte er gesehen, wie ein Komet auf die Erde geknallt war und dann alle tot waren. Die Dinosaurier waren tot, die Vögel waren tot und die Insekten auch. Und dann war eine riesige Monsterwelle um die Erde gesaust, die hatte alles verschluckt, sogar den Eiffelturm. Wenn es ihn damals schon gegeben hätte, das hatte der Mann im Fernsehen gesagt. Das musste man sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn er mit seiner neuen Taucherbrille ins Wasser sehen würde, und da stände dann der Eiffelturm, und die Doraden und die Langusten würden um ihn herumschwimmen.
Vielleicht hatte der Komet inzwischen ja wirklich eingeschlagen. Hatte die Erde getroffen, die jetzt natürlich eine Riesendelle hatte, und alles war weg. Die Schule, seine Eltern, seine Schwester und sogar Pepo, der Gärtner.
Der Junge hatte aufgehört zu zittern. Jetzt war ihm plötzlich heiß. Über ihm war Licht. Woher kam das Licht? Es tat in den Augen weh. Als er wieder hinsah, war es verschwunden. Er konnte nur den Deckel sehen mit den dicken hölzernen Balken. Hatte jemand den Deckel aufgemacht? Jemand hatte ihn zufallen lassen. Oder hatte er sich das nur eingebildet?
Der Junge versuchte erneut, sich zu bewegen. Warum half ihm keiner? Er merkte, wie ihm schlecht wurde. Da kam das Rauschen zurück, und gleich danach würde die große schwarze Welle ihn überspülen. So wie damals, als er die schlimmen Bauchschmerzen gehabt hatte. Bevor sie ihm den Blinddarm herausgeschnitten hatten, hat er eine Spritze bekommen. Dann war auch die Welle gekommen, und als er wieder aufgewacht war, hat er speien müssen. Jetzt war es ganz ruhig in dem düsteren Raum. Jetzt hatte er kein Bauchweh mehr, aber er war allein. Keine netten Krankenschwestern, die einem die Medizin brachten und die Gummibärchen. War da draußen niemand? Hatten ihn die Leute vergessen? Er wollte nicht mehr hier sein. Er wollte dahin, wo es warm war und hell.
Der Schrecken erwischte ihn ganz plötzlich. Und dann fühlte er sich, als ob sein ganzer Körper in Flammen stünde. So wie Paulinchen in dem Buch, das ihnen Josephine, ihr Kindermädchen, so oft vorgelesen hatte, obwohl sie das eigentlich nicht durfte. Der Junge spürte, wie Tränen in ihm aufstiegen. Er fühlte sich in diesem Moment so allein wie ein Staubkorn im Weltall. Dann kam das Rauschen und dann endlich auch die schwarze Welle, die ihn in die erlösende Ohnmacht riss.
7. Kapitel
Die Beamten der Gendarmerie nationale hatten ganze Arbeit geleistet. Genauer gesagt hatten die Männer der lokalen Peugeot-Niederlassung mit ihren Mechanikern ausgeholfen, denn es war verdammt schwierig, der Spur eines Kinderrucksacks unter ein Karussell zu folgen, wenn zwischen Bodenplanken und Erdboden kein halber Meter Platz war. Schließlich hatte man sich unter lautstarkem Protest von Pierre Seguin entschieden, die Platten Stück für Stück zu entfernen und nachzuschauen, ob sich in den Hohlräumen unter dem Karussell nicht eines der Kinder verborgen hatte. Keiner wagte es, den Gedanken zu Ende zu denken.
Nachdem man auch nach zwei Stunden noch immer nicht mehr als ein Basecap, einen Hammer und eine volle Windel gefunden hatte, entschloss sich Isabelle, auch die anderen Fahrgeschäfte unter die Lupe zu nehmen. Gegen den lautstarken Protest des Betreibers, der abwechselnd seine Unschuld beteuerte und den Flics mit juristischen Konsequenzen drohte. Doch Polizeichef Zerna hatte längst entschieden: An diesem Abend würde die Kirmes geschlossen bleiben. Schließlich musste die Polizei Pierre Seguin in jedem Fall gründlich vernehmen, auch dann, wenn keine neuen Spuren der Kinder auftauchten. Der Rucksack allein war schon Grund genug für eine umfangreiche Befragung aller Zeugen, die auf der Kirmes arbeiteten. Schließlich hatte Pierre Seguin noch immer nicht erklären können, wie der Rucksack des vermissten Mädchens ausgerechnet unter seinem Karussell landen konnte.
Noch während Isabelle den Verdächtigen das erste Mal verhörte, tauchten die ersten Gerüchte über das Verschwinden der Kinder auf. Ein Fall wie dieser war vor der Öffentlichkeit natürlich nicht zu verheimlichen. Schließlich war die Polizei in solchen Fällen dringend auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Im Normalfall würde die Gendarmerie eine entsprechende Fahndung herausgeben und abwarten. In Südfrankreich verschwanden in den Sommerferien ständig Personen, ganz besonders in den Sommerferien. Ferien strapazierten die Nerven und waren Gift für viele Familien und Beziehungen. Da gab es Familienväter, die mit ihrem Ferienflirt durchbrannten. Frauen, die ihren Mann nicht mehr ertrugen, oder Jugendliche, die ihre Eltern satthatten. Darum ließen sich die Beamten von der Gendarmerie Zeit, wenn jemand bei ihnen aufkreuzte, um das Verschwinden eines Partners zu melden. Solange es keine Hinweise auf eine Straftat gab, wartete die Polizei erst einmal ab, sofern es sich um Erwachsene handelte, die verschwunden waren. Es war allgemein bekannt, dass die allermeisten Vermissten innerhalb der ersten achtundzwanzig Stunden von allein wieder auftauchten. Wozu also sich aufregen? Schließlich war man an der Côte d’Azur. Einem Ort voller Chancen und Versuchungen.
Waren dagegen vermisste Kinder im Spiel, sah die Sache völlig anders aus. Dann gingen die Behörden automatisch davon aus, dass die Kinder Opfer eines Verbrechens geworden sein könnten. Im Fall der Marsennes gab es jedoch noch einen anderen Grund, warum die Wellen der Empathie besonders hoch ausschlugen. Lucas und die kleinen Louisa waren ein Geschwisterpaar wie aus dem Bilderbuch, das auch eine Castingagentur nicht besser hätte zusammenstellen können. Den Rest erledigten die Journalisten.
Am Nachmittag hatte es die Story bereits von den lokalen in die Hauptnachrichten von Canal 6 geschafft, und keine Stunde später erschien zum ersten Mal das herzergreifende Foto des vierjährigen Mädchens mit den dunklen Kulleraugen und ihrem hübschen, braun gebrannten Bruder, der seinen schützenden Arm um die kleine Schwester hielt.
Die TV-Zuschauer konnten sich gar nicht sattsehen an der Tragödie. Die Medien waren wie hungrige Raubtiere. Alle wollten mehr. Mehr Schmerz, mehr Verzweiflung, mehr Tränen, mehr Angst. Und wehe, den Zuschauern wurde irgendein Detail vorenthalten. Das Publikum merkte sich alles, und es konnte gnadenlos sein.
8. Kapitel
Die ersten Journalisten waren bereits vor dem Polizeirevier in der Avenue André del Monte in Stellung gegangen, dabei wussten die meisten Beamten in der Gendarmerie nationale noch nicht einmal, dass Polizeichef Zerna eine dringliche Besprechung einberufen hatte.
Roger Marsenne, der Vater der verschwundenen Geschwister, war ein Studienfreund von Fabienne Laront, dem neuen Präfekten des Département Var. Dies machte Laront zu einer Art König in seinem Regierungsbezirk: Jedes der sechsundzwanzig Départements in Frankreich wurde von einem Präfekten geführt, die alle vom französischen Präsidenten persönlich ausgewählt und eingesetzt wurden. Eine besondere Konstruktion, die Frankreich Napoleon verdankte. Das verschaffte der Position der Präfekten eine ganz besondere Bedeutung. Inzwischen war das Amt zwar dezentralisiert worden, aber nicht wenige der Präfekten fühlten sich auch heute noch wie kleine Könige. Fabienne Laront gehörte zu dieser Sorte. Das war auch der Grund, warum Polizeichef Zerna an diesem Vormittag einen Anruf bekommen hatte, auf den er gerne verzichtet hätte. Fabienne Laront hatte Zerna mitgeteilt, dass er den Fall der verschwundenen Kinder zur Chefsache gemacht hatte. Zu seiner Chefsache, und dazu gehörte, dass diese Kinder gefunden werden mussten, und zwar umgehend.
Commandant Zerna war sauer. Die Polizeidirektion in Toulon hatte sich fünf Minuten nach Laront bei ihm gemeldet. Sie würden Oberstaatsanwalt Bertrand Simon nach Le Lavandou schicken, um die Dinge, die getan werden mussten, zu koordinieren. Was nichts anderes bedeutete, als dass man an höherer Stelle kein Vertrauen in die Fähigkeiten des Polizeichefs hatte. Zerna wusste genau, was dahintersteckte. Der Präfekt hatte sich nicht etwa eingemischt, um zwei Kinder zu retten. In Wirklichkeit wollte er Oberstaatsanwalt Bertrand Simon zum nächsten Justizminister aufbauen. Und die Rettung von zwei verlorenen Kindern war der Stoff, aus dem Politikerträume waren.
Die Polizeistation platzte am frühen Nachmittag aus allen Nähten. Außer den Beamten der Gendarmerie waren auch noch die Einsatzleiter der Küstenwache, der Feuerwehr und der beiden Hubschrauber der mobilen Einsatzgruppe dabei. Zerna hatte beschlossen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und jetzt zu Anfang der Großfahndung erst einmal Optimismus zu verbreiten.
Das Meeting war auf vierzehn Uhr anberaumt worden. Aber bereits um dreizehn Uhr fünfzig war der Raum zum Bersten voll. Daraufhin hatte Zerna kurzerhand die Cafeteria zur Einsatzzentrale umfunktioniert. Jetzt ließ Zerna den Blick durch den Raum wandern. An der Wand hing mittlerweile eine große Karte, die das gesamte Quartier von Lavandou zeigte. Die Polizisten und Helfer unterhielten sich über die jüngsten Gerüchte in diesem Fall, und die immer lauter werdenden Stimmen verdichteten sich zu einem Brummen, das Isabelle an ein Wespennest erinnerte. In diesem Moment klopfte Commandant Zerna mit seinem Schlüssel hart auf die Tischplatte. Sofort unterbrachen alle Anwesenden die Gespräche.
»Gut. Fangen wir also an.«
»Sollten wir nicht auf den Vertreter der Staatsanwaltschaft warten?«, mischte sich Kommissarin Lapierre ein, die als Beobachterin der Kriminalpolizei von Toulon mit am Tisch saß. Lavandou hatte kein eigenes Kommissariat für Gewaltverbrechen. Daher wurde Kommissarin Lapierre immer dann in den Ferienort am Meer geschickt, wenn Toulon befürchtete, dass die Gendarmerie mit einem Fall überfordert wurde. Sehr zum Bedauern von Polizeichef Zerna. Dass aber diesmal sogar die Staatsanwaltschaft einen Beobachter zur Gendarmerie nach Lavandou schickte, erschien auch der Kommissarin mehr als übertrieben. Als würde sie nicht allein mit einem solchen Fall fertigwerden. Sie brauchten wirklich nicht auch noch einen Staatsanwalt vor Ort.
»Staatsanwalt Simon weiß, dass wir pünktlich loslegen müssen. Wir haben ein enges Programm«, erwiderte Zerna entsprechend trocken.
»Staatsanwalt Simon?«, fragte Isabelle, und es fiel ihr schwer, ihre Überraschung zu verbergen.
»Ja, Oberstaatsanwalt Bertrand Simon.« Zerna sah von seinen Notizen zu Isabelle und runzelte die Stirn. »Ich dachte, Sie beide kennen sich.«
»Ich, also wir«, stotterte Isabelle irritiert. Sie setzte neu an. »Das liegt schon einige Jahre zurück … Ich wusste nicht, dass er heute mit dabei ist.«
»Ist das ein Problem?«, fragte Zerna und sah seine Stellvertreterin kritisch an.
»Nein, natürlich nicht«, versuchte Isabelle ihre Verunsicherung zu überspielen.
»Heute und auch in den nächsten Tagen.« Zernas Antwort klang fast wie ein Stöhnen. »Die Präfektur hat ihn uns für die Dauer der Suche zur Seite gestellt.«
In diesem Augenblick bemerkte Isabelle einen Mann, der sich an den Beamten vorbei nach vorn gedrängt hatte. Bertrand Simon, achtundvierzig Jahre alt, hatte ein waches, markantes Gesicht. Seine Haare waren dunkel mit ein paar grauen Strähnen, die ihn noch attraktiver machten. Er war schlank, gut trainiert und schien einige der Anwesenden zu kennen, die er im Vorbeigehen grüßte. Isabelle war hin- und hergerissen zwischen Neugier und dem Bedürfnis, professionell zu wirken, als er jetzt auf sie zukam.
»Capitaine Morell«, sprach er Isabelle mit ihrem korrekten Rang an, nachdem er einen schnellen Blick auf ihre Schulterklappen mit den drei silbernen Streifen geworfen hatte.
»Monsieur le Procureur«, erwiderte Isabelle ebenso korrekt.
»Lange nicht gesehen«, sagte Bertrand Simon mit einem provozierend charmanten Lächeln.
»Haben Sie nicht mal an einem Fall in Arles zusammengearbeitet?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, die Zerna da stellte.
Damals hatte ein Mann sich seine Opfer unter den Fernfahrern gesucht, die er nachts auf abgelegenen Rastplätzen fand. Er erschlug seine Opfer mit einem Hammer und raubte sie aus.
»Ja, ich erinnere mich ganz dunkel.« Jetzt klang Isabelle ein wenig unaufrichtig.
»Schön, Sie im Team zu haben«, sagte Staatsanwalt Simon und reichte Isabelle höflich die Hand.
In diesem Moment öffnete sich die Tür zur Cafeteria noch einmal. Leon kam herein. Sein Blick fiel sofort auf Bertrand Simon, der die Hand von Isabelle ein wenig länger hielt, als es unter Kollegen üblich und angemessen gewesen wäre.
»Bonjour, Docteur. Wie schön, dass Sie es einrichten konnten«, Zernas Spott hinter der scheinbar so freundlichen Begrüßung war nicht zu überhören. »Ich nehme an, Sie kennen sich.«