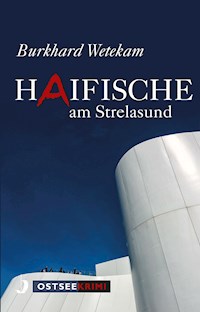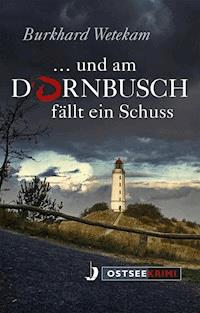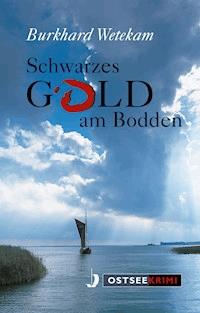
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Hört auf, nach Öl zu bohren. Wollt ihr noch mehr tote Kinder?" Ein grausiger Fund an einem kühlen Ostermontagmorgen lässt den Ex-Zeitungsredakteur Tom Brauer not- gedrungen zum Privatdetektiv werden: Auf ein Zeesboot gebettet treibt Leo, der zehn- jährige Sohn des Bauunternehmers Günter Rakowsky, tot auf dem Barther Bodden. Die Entdeckung der Leiche fällt ausgerechnet in die Zeit des offiziellen Ölförderbeginns vor den Toren der kleinen Boddenstadt Barth. Ein Zufall? Tom gerät zunehmend in den Sog widerstreitender Interessen, zweifelhafter Komplizenschaften und der kriminellen Vergangenheit von Leos Vater. Und was hat das mysteriöse Amulett zu bedeuten, das neben Leo im Boot gefunden wurde?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Wetekam
Schwarzes
GOLD
am Bodden
Inhalt
Ostermontag: Das Boot
Dienstag: Öl
Mittwoch: Zeugen
Donnerstag: Geschäfte
Freitag: Spuren
Samstag: Jagd
Mittwoch: Möglichkeiten
Ostermontag: Das Boot
-1-
Im milchigen Licht des frühen Morgens erschien die Hafenbefestigung wie eine Grenze, hinter der ein mystisches Land liegen musste. Der Geruch nach brackigem Wasser, versetzt mit einem diffusen Fischaroma, hing in der nebelfeuchten Luft. Ein leises Gluckern und der Schrei einer Möwe durchkreuzten die Stille.
Die beschauliche Morgenstimmung entschädigte Tom für die Zumutung des frühen Aufstehens. Er betrat vorsichtig den Schwimmsteg im Barther Stadthafen, der vom Tau noch feucht und deshalb glitschig war. Am Ende des Stegs lag die MATHILDA, eine ausgemusterte kleine Hafenbarkasse, die Tom vor einigen Jahren vor dem Abwracken gerettet hatte. Der Kauf, vor allem aber die Reparaturen, hatten damals seine gesamten Ersparnisse verschlungen; aber er hatte es nie bereut, das Boot mit dem rundlichen Rumpf erworben zu haben. Als er die beschlagenen Fenster der Deckskajüte sah, wurde ihm klar, dass er um diese Uhrzeit noch nie am Barther Hafen gewesen war. Und das, obwohl er seit fünfzehn Jahren in einem winzigen Stadthaus in der Gartenstraße wohnte, kaum mehr als einen Steinwurf vom Hafen entfernt. Er sah hinüber zum Hotel Speicher und bemerkte ganz oben im sechsten Stock einen Mann, der gerade von seiner Suite aus die Dachterrasse betrat. Die Terrasse krönte einen spitz zulaufenden Vorbau, der an einen Schiffsbug erinnerte. Ein findiger Architekt hatte ihn vor den ehemaligen Getreidespeicher gesetzt, sodass dieser nun wie ein gewaltiger Frachter aus Backstein wirkte, der im Aufbruch begriffen war.
Als Tom nach Barth gezogen war, hatten sie den Umbau des Getreidespeichers zu einem Vier-Sterne-Hotel gerade erst abgeschlossen. Damals, wenige Jahre nach der Wende, schien noch vieles möglich in der Stadt am Bodden. Später war der Bauboom ins Stocken geraten, abgesehen von dem einen oder anderen Einkaufszentrum, mit dem sie die Außenbezirke endgültig verschandelten. Immerhin war der Mann auf der Terrasse der lebende Beweis dafür, dass die 250 Euro teure Suite des Hotels Speicher tatsächlich gebucht wurde. Aus purer Neugier nahm Tom das Fernglas von der Ablage am Steuerstand und richtete es auf den Frühaufsteher auf der Dachterrasse des Hotels. Er trug sein nahezu weißes Haar zu einer Mähne zurückgekämmt und war in einen cremefarbenen Bademantel gehüllt. In der Hand hielt er einen Becher. Tom hätte gerne mal von dort oben zugesehen, wie die Sonne über der Grabow aufgeht, dem östlichen Teil der Boddenkette. Es musste eine herrliche Aussicht sein. Der Mann im Bademantel schien ihr aber nicht allzu viel abgewinnen zu können. Verächtlich kippte er den Inhalt seines Bechers über die Brüstung in die Tiefe und ging wieder ins Innere der Suite.
Tom schüttelte den Kopf und sah auf die Uhr. Er hatte Clara versprochen ihr drüben in Zingst beim Aufbau des Verkaufsstandes zu helfen. Sie wollte pünktlich um neun alles fertig haben. Der Gedanke an Clara brachte eine neue Farbe in den Tag, eine Ahnung von Morgenröte. Seit zwei Jahren kannten sie sich, und nach wie vor spürte er eine warme Welle, die durch seinen Bauch rollte, wenn er daran dachte, wie sie ihn empfangen würde: mit einem neugierigen, vielsagenden Lächeln, vielleicht mit einer spöttischen Bemerkung über seine Studienratstasche aus hellem Leder, seine schwarz geränderte Existenzialistenbrille oder den Dieselgeruch, der nach jeder Überfahrt in seinem abgetragenen Parka hing.
Es war ihm unangenehm mit dem Anlassen des Motors die Morgenstimmung zu zerstören. Die MATHILDA röhrte und rülpste, stieß schwarzen Qualm aus und bettelte auf ihre ganz eigene Art um einen baldigen Werftbesuch. Ein Wellenkranz breitete sich kreisförmig aus, wanderte gemächlich durch das ganze Hafenbecken und leckte an den Rümpfen der wenigen schlanken Jachten, die um diese Jahreszeit im Hafen lagen. Den Barther Bodden zu befahren, war nun wahrlich alles andere als eine halsbrecherische maritime Expedition. Seitdem das Funkgerät der MATHILDA defekt war, hatte es sich Tom dennoch angewöhnt, das Handy einzuschalten, bevor er aus dem Hafenbecken fuhr. An diesem Morgen musste er darauf verzichten: Auf dem Display blinkte kurz die Akkuanzeige, dann wurde es wieder schwarz. Er wusste, dass das Ladegerät auf dem Couchtisch in seinem winzigen Wohnzimmer lag und steckte das Handy missmutig, aber keineswegs beunruhigt in seine Tasche zurück.
Als die MATHILDA langsam durch die Hafenausfahrt bollerte und die grünbraune Boddensuppe durchpflügte, war es wieder da, dieses Gefühl von Glück, das ihn fast immer überkam, wenn er von Barth nach Zingst rüberfuhr. Er kam aus der mittelalterlichen, einstmals stolzen Handelsstadt und fuhr in das kleinere, aber wirtschaftlich blühende Zingst; in den Ort, in dem die meisten Touristen ihr Geld ließen, während die alte Perle Barth ein wenig verstaubte. Zingst hatte den kilometerlangen Sonnenstrand, hatte die Wellen der Ostsee, hatte immer gute Laune und kaum eine verkommene Ecke. Barth hatte eine Geschichte, verwinkelte Gassen und architektonischen Charme. Zingst hatte Dutzende gestaltloser Apartmenthäuser, Barth ständig Besuch vom Denkmalschutz. Zingst hatte laute Musik am Strand, Barth die mäßig beliebten Konzerte des Orgelsommers. Die Prioritäten der meisten Besucher ließen Barth genau so aussehen, wie es nun mal war – ganz schön alt. Und irgendwie passte dieser Wettstreit ganz gut zu Toms eigenem Leben: Wenn er von Barth nach Zingst fuhr, hatte er das Gefühl, eine leicht verkratzte Existenz hinter sich zu lassen und zu einer neuen, hoffnungsvolleren und fröhlicheren Hälfte seines Daseins aufzubrechen. Er wusste, dass er diese Seite seines Lebens vor allem Clara verdankte. Er freute sich auf jede Überfahrt wie ein achtjähriger Junge – und trotzdem wäre er nie auf die Idee gekommen, sein winziges Reihenhaus in der Gartenstraße aufzugeben und zu Clara zu ziehen. Er wollte auf die alte Hälfte seines Daseins nicht verzichten. Man hätte es auch so sagen können: Er war mit den dunklen Seiten dieses alten Daseins noch lange nicht fertig.
Selbst auf dem weitläufigen Barther Bodden, den nicht selten ein scharfer Westwind zum Schäumen brachte, bildete das Wasser an diesem Morgen eine beinahe glatte Fläche. Nur hin und wieder strich eine leichte Windböe darüber. Dann kräuselte sich die Wasseroberfläche und es sah so aus, als ob den Bodden ein morgendliches Frösteln überkäme. In großzügigem Abstand passierte Tom die Markierungen der Stellnetze. Die kleinen, schmalen Stangen mit den schwarzen Fähnchen ragten beinahe bewegungslos aus dem Wasser. Sie wirkten wie die Winkelemente Ertrunkener, die mit einem leblosen Gruß die Nachwelt erschaudern lassen wollen. Das Kielwasser der MATHILDA versetzte sie für einen Augenblick in nervöse Aktivität.
Nach einigen Minuten ereignisloser Fahrt rutschte Tom in einen Zustand träger Zufriedenheit, begünstigt durch das monotone Motorengeräusch und das sanfte Schwingen des Bootrumpfes. Er befand sich etwa auf gleicher Höhe mit der Spitze der Halbinsel Fahrenkamp, die den Barther Bodden von der Grabow trennt, als er den braunen Rumpf eines kleinen Segelschiffes entdeckte, das scheinbar führerlos auf dem Wasser trieb. Er dachte im ersten Moment, es sei ein recht groß geratenes Ruderboot. Erst als er das Fernglas zur Hand nahm, erkannte er, dass es sich um einen Zeesenkahn handelte, eines der traditionellen Fischerboote der Region. In früheren Zeiten hängten die Fischer auf eine Seite ein Schleppnetz, das sich wie eine riesige Einkaufstasche zwischen Bug und Heck spannte. Dann stellten sie die Segel so ein, dass Boot und Netz seitwärts durch das Wasser drifteten. Dieses Exemplar lag allerdings vollkommen bewegungslos im Wasser. Es schien unbesetzt zu sein, nirgendwo hinzuwollen und nirgendwo herzukommen. Die MATHILDA seufzte dankbar auf, als Tom den Gashebel auf neutral stellte. Die Barkasse verlor schnell an Fahrt und drehte sich ratlos nach Steuerbord, während Tom das Zeesboot mit dem Fernglas genauer betrachtete. Es war etwas kleiner als die meisten seiner Art und außerdem in einem sehr schlechten Zustand. Über dem verwitterten und fleckigen Rumpf hingen die Fetzen eines Vorsegels, das große Rahsegel und der hintere Mast fehlten.
Die Mehrzahl der Zeesboote, die noch auf den Boddengewässern zwischen Ribnitz und Barhöft unterwegs sind, gehören Liebhabern, die ihre alten Schätzchen sorgsam pflegen. Etliche andere werden für Ausfahrten mit Touristen eingesetzt. Tom kannte niemanden, der solch ein Boot einfach verfallen oder unbeaufsichtigt auf dem Wasser treiben lassen würde. Er setzte das Fernglas ab und spuckte über die Reling. Es sprach alles dagegen, einen Abstecher zu dem herrenlosen Wasserfahrzeug zu unternehmen. Der Tank der MATHILDA war noch knapp zu einem Viertel gefüllt, wenn man der zitternden Nadel auf der Instrumententafel glauben wollte. Leider gehörte zu den Launen der MATHILDA auch ein gemeines Spiel mit der Tankanzeige. Tom konnte sich kaum ein größeres Missgeschick vorstellen, als an einem Feiertag morgens ohne Sprit auf dem Bodden zu treiben, noch dazu ohne ein funktionierendes Funkgerät und Handy.
Seine Neugier siegte über die Vernunft. Er wusste später nicht mehr, was den Ausschlag gegeben hatte: das merkwürdig verkommene Äußere des Zeesbootes, die eigenartig verhaltene Stimmung an diesem Morgen, die ihn auf eine Abwechslung hoffen ließ, oder sein lange Jahre ausgeübter Beruf als Journalist, dem er ein Gespür für Situationen verdankte, denen nachzugehen sich lohnte. Von Barth hörte er Glockenschläge – es musste gerade acht Uhr sein. Die MATHILDA glitt mit minimalem Vorschub über die glatte Wasseroberfläche. Tom umkreiste die Markierungen einer Aalreuse, steuerte von der Seite auf das Zeesboot zu und brachte seine Barkasse mit einer behutsamen Drehung an dessen Seite zum Stehen. Er verließ den Steuerstand, nahm den Bootshaken auf und ging zur Reling. Aber noch bevor er den Rand des Bootes zu fassen bekam, erstarrten seine Bewegungen.
In diesem Augenblick fand ein matter Sonnenstrahl eine Lücke im Nebelfeld über der Grabow. Der Tag teilte sich in zwei Hälften – die Stunden vor dem ersten Sonnenstrahl und die Stunden danach, die Zeit vor dem Anblick des toten Jungen und die Zeit, in der sich dieser Anblick für immer in Toms Gedächtnis eingebrannt hatte.
Dass der Junge nicht mehr lebte, war ihm sofort klar. Ihm war überhaupt furchtbar viel sofort klar. Das, was er tat, tat er mechanisch, und er kam sich so vor, als würde er sich selbst dabei zusehen, wie er eine absonderliche Arbeit verrichtete: wie er das Boot heranzog und an der Reling der MATHILDA vertäute. Wie er mit einem bedächtigen Schritt das Zeesboot betrat, sich langsam neben dem Körper des Jungen hinhockte, immer bemüht, nicht zu viel Bewegung in die stille Szenerie zu bringen. Er hatte als Lokalredakteur einige Male über Unfälle mit Todesopfern berichtet und die Leichen in ihren verbeulten Fahrzeugen gesehen. Aber das hier war etwas anderes. Hier war er allein mit einem toten Jungen, mitten auf dem Wasser. Er spürte eine Furcht, die er noch nicht kannte. Alles in ihm sträubte sich dagegen, sich dem toten Jungen zu nähern.
Der Junge war etwa zehn Jahre alt, hatte dunkelblondes lockiges Haar. Er sah auf den ersten Blick aus, als würde er schlafen. Bei genauerem Hinsehen musste man den Eindruck gewinnen, dass dieser Schlaf ein besonderer, unendlicher Schlaf war. Sein Gesicht war entspannt und von einer wächsernen Farbe; es war zu entspannt, zu leer, als dass in diesem Körper noch Leben sein konnte. Trotzdem legte Tom seinen rechten Zeigefinger an den Hals des Jungen. Beinahe hätte er vor Schreck aufgeschrien. Er hatte nie einen menschlichen Körper berührt, der so kalt war wie dieser. Es erübrigte sich, nach dem Puls zu fühlen.
Tom sog die Luft durch die Nase ein und nahm einen Geruch nach Schlick und Moos wahr, vermischt mit einem Aroma von vermodertem Holz. Er fragte sich, ob so der Tod roch. Seine Gedanken kamen ihm absurd vor, aber sie kamen ganz von selbst, sie gehorchten Mustern, die er aus Kriminalromanen und Fernsehkrimis kannte. ›Keine äußeren Verletzungen‹, dachte er im ersten Augenblick. Als er sich über den Körper des Jungen beugte, entdeckte er allerdings etwas Blut, das dessen Haare über und hinter dem linken Ohr verklebte. Der Kopf des Jungen ruhte auf einer zusammengefalteten Jacke, vermutlich seiner eigenen. Ein Arm lag auf dem Bauch, der andere neben dem Körper, unter seinen Fingern sah Tom ein bronzefarbenes Objekt, etwa so groß wie eine Untertasse – ein Schmuckstück oder etwas Ähnliches.
Das Innere des Bootes war leer und von einer feuchten Schmutzschicht bedeckt. Es schien längere Zeit draußen gelegen zu haben. Zwei abgerissene Seilenden hingen vom Vormast herunter, das zerfetzte Focksegel schlabberte nahezu lautlos gegen das Holz. Es gab keine Tatwaffe, keine Ruder, nicht einmal eine Leine zum Festmachen. Tom geriet in einen Sog verwirrender Empfindungen. Für einen eigenartigen Augenblick gelang es ihm, das Erschrecken über seine Entdeckung von sich zu schieben. In diesem einen Moment empfand er die Szenerie als meditativ, beinahe weihevoll. Der Schrei einer Möwe riss ihn aus seiner Erstarrung. Er bemerkte, dass der Verbund aus seiner alten MATHILDA und dem Totenkahn langsam auf eine Flachwasserzone zutrieb, die zu einem ernsten Problem werden konnte. Er sprang zurück auf seine Barkasse und manövrierte sie zusammen mit ihrem Beiboot zurück ins Fahrwasser.
Mit halber Kraft setzte er seine Fahrt fort – es war nicht mehr die Fahrt, die er begonnen hatte. Es war eine düstere Reise mit Herzklopfen, mit weichen Knien und ängstlichen Blicken nach Steuerbord. Durch die offene Schiebetür konnte er die Bordwand des hölzernen Bootes sehen, aber nichts von dem toten Jungen. Schon nach wenigen Metern war er drauf und dran, das Boot loszuschneiden und zurückzulassen, einfach so zu tun, als hätte er es nie bemerkt. Er wusste, dass er vor Ort hätte bleiben und die Polizei benachrichtigen müssen. Aber womit? Es war weit und breit kein Fischerboot, kein Ausflugsschiff zu sehen, sogar die sonst so zahlreichen Wasservögel schienen sich angesichts dieses Fundes aus dem Staub gemacht zu haben. Die Stille, die ihm eben noch wie ein Geschenk der Natur vorgekommen war, lastete jetzt schwer auf ihm.
Bevor er in den Zingster Strom einfuhr, stoppte er den Motor zum zweiten Mal. Hastig kramte er eine Abdeckplane aus einem Stauraum im Heck der Barkasse und warf sie von oben über den Körper des Jungen. Warum hatte er das nicht gleich getan? Mit dem offenen Anblick einer Leiche konnte er unmöglich in den Zingster Hafen einfahren. Spätestens dort würde er die ersten Menschen treffen, die ersten Neugierigen. Er würde warten müssen, bis die Polizei eintraf, er würde … Es war ein unvergleichlich grausamer, düsterer und aufreibender Tag geworden. Nichts war übrig von der Vorstellung, in die neue, fröhliche Hälfte seines Lebens aufgebrochen zu sein.
-2-
Nie war ihm der Weg durch den Zingster Strom so quälend lang vorgekommen wie an diesem Ostermontagmorgen. Als die Mole des Zingster Hafens in Sicht kam, zitterte alles an ihm, von den Knien über die Finger bis zur Stimme. Er steuerte auf den Steg vor dem Hauptgebäude zu, neben die BODDENMÖWE, einem Ausflugsschiff, das gerade für die erste Ausfahrt bereit gemacht wurde.
»Ey, da kannst du nicht anlegen, Idiot!« Die Stimme gehörte einer Reinigungskraft im kakifarbenen Overall. Der Mann kratzte gerade festgetretene Kaugummis vom Deck des Fahrgastschiffes.
Tom legte ein Tau um eine Klampe an der Bordwand der BODDENMÖWE. »Schnell, ich brauche ein Telefon!«
»Du brauchst eins hinter die Ohren. Erst fährst du deinen Kutter …«
Tom sprang auf das Fahrgastschiff und schnappte sich das Handy, das in einer Fensterbank neben dem Niedergang zum Fahrgastraum lag. Als der Schiffsreiniger auf ihn zumarschierte, stieß Tom ihn so derb von sich weg, dass er gegen die Reling knallte. Er wählte den Notruf. »Ich habe in einem Boot die Leiche eines Jungen gefunden. Schicken Sie bitte die Polizei in den Hafen von Zingst.«
Der Kakifarbene starrte ihn an. »Stimmt das?«
Tom kümmerte sich nicht um den Mann. Er gab dem Mitarbeiter der Leitstelle die wesentlichen Informationen durch: Name, Ort, Zeit des Auffindens. Es kam ihm vor, als fasse er eine Geschichte zusammen, die er irgendwo gelesen hatte. Der Reinigungsmann war auf einmal ganz hilfsbereit. Gemeinsam zogen sie das Zeesboot an die Pier und machten es dort fest. Tom löste die MATHILDA von der BODDENMÖWE, steuerte sie auf einen regulären Liegeplatz und kehrte zum Hafen zurück.
Inzwischen war eine ganze Reihe von Einsatzkräften eingetroffen, als erste diejenigen, die nun gar nichts mehr ausrichten konnten – die Ambulanz aus Prerow. Es folgten ein Streifenwagen irgendeiner benachbarten Polizeidienststelle, die Freiwillige Feuerwehr und schließlich der Notarzt aus Ribnitz-Damgarten. Tom hielt sich abseits und sah zu, wie immer mehr Uniformierte und andere wichtige Leute auftauchten, um den schrecklichen Fund zu würdigen. Kurz nach dem Notarzt stapfte Holger Schiefer über die Mole, wie immer mit einer etwas zu großen Jeans und einem weiten Cordblazer bekleidet und behängt mit zwei großen Digitalkameras. Tom kannte ihn aus seiner Zeit als Lokalreporter.
Holger hob eine Hand und nickte Tom zu. »Du siehst echt scheiße aus.«
Mit routinierten Blicken prüfte der gewichtige Fotograf sein Arbeitsgerät. Ächzend stieg er auf den Rand des verwitterten Zeesbootes, das für einen Augenblick in eine bemerkenswerte Schieflage geriet. Holger überspielte seinen Schreck mit einem angestrengten Grinsen, hob die Plane hoch und legte sie vorsichtig zurück. Dann machte er ein paar Fotos vom Inneren des Zeesbootes und von dem abgedeckten Leichnam. Man hätte denken können, vor ihm läge ein prächtiger Fisch und kein totes Kind. Als er wieder auf der Pier stand, hatte seine Gesichtsfarbe aber doch einen Stich ins Grünliche bekommen.
»Mann oh Mann, so was ist in meinem Alter und um diese Uhrzeit nicht gut zu ertragen. Du hast ihn gefunden?«
Tom nickte. Es schien Holger recht zu sein, wenn er beim lauten Denken nicht unterbrochen wurde.
»Ja, das sieht nach einem veritablen Gewaltverbrechen aus, oder? Wer macht denn so was? So ’n charmanter Kerl. Da könnte ich mich aufregen. Manche wollen ja die Todesstrafe für Mord an Kindern wieder einführen. Weißt du, was ich heute eigentlich vorhabe? Ich werde im Stadtarchiv ein paar Exponate fotografieren, für so einen Katalog, alte Dokumente, Folianten, Tintenfässer und Schreibfedern. Und wenn ich da hinkomme, sehe ich auf dem Display meiner Kamera diesen toten Jungen. Ich fühle mich so richtig schmutzig, wenn ich so was fotografiert habe. Na jut, ich hoffe, die Archivarin bekommt keinen Schwächeanfall, wenn ich ihr aus Versehen das falsche Bild zeige. Also, ich muss weiter. Es ist blöd das zu sagen: Aber auch nach diesem Tag wird sich die Erde weiterdrehen. Man sieht sich.«
Tom sah ihm kopfschüttelnd nach. Holger bahnte sich seinen Weg durch die Einsatzkräfte, die auf der Mole hin und her eilten oder leise diskutierten, was nun zu tun sei. Immer mehr Neugierige tauchten auf. Die beiden Polizisten versuchten, einen Teil des Hafens abzusperren, gaben aber bald wieder auf, weil die Leute sofort einen Weg fanden, das Flatterband zu umgehen. Irgendjemand musste den Jungen erkannt haben. Es war plötzlich ein Name zu hören: Leo. Leo Rakowsky, der Sohn eines Bauunternehmers. Tom wünschte sich, dass dieses allgemeine Geraune und Gemurmel endlich aufhören möge. Er hatte keine Lust, sich irgendwo einzumischen. Er fühlte sich wie betäubt; es kam ihm vor, als sei er in einen rastlosen Bienenschwarm geraten.
Dann traf Sylke Bartel ein. Sie benötigte nicht einmal eine Minute, um sich ein Bild von der Lage zu machen. »Vergrößert die Absperrung bis zur Deichkrone! – Alle Unbeteiligten müssen hinter die Absperrung. – Die beiden Jachten am Quersteg und der Steg selbst werden geräumt! – Der Schiffsbetrieb ist mit sofortiger Wirkung eingestellt! – Das Schutzzelt für die Spurensicherung bitte direkt neben dem Boot mit dem Opfer aufbauen! – Lagebesprechung in einer Minute am Streifenwagen!«
Sylke trug einen knielangen Jeansrock und einen dunkelgrünen Kaschmirpullover, über den ihr blondes Haar wallte. Sie stand mit breitem Kreuz im Zentrum des Geschehens. Halb bewundernd, halb spöttisch beobachtete Tom, wie sie mit klaren Gesten und Anweisungen den Ameisenhaufen in einen planvollen Einsatz verwandelte.
Gleich nach ihrem Eintreffen hatte Sylke Tom bemerkt. Aber erst als alle Einsatzkräfte ihren Aufgaben nachgingen, wandte sie sich ihm wieder zu und winkte ihn mit dem linken Zeigefinger zu sich heran.
»Tom, ausgerechnet du! Haben dich denn alle guten Geister verlassen?«
»Guten Morgen, Sylke.«
»Mit welcher Berechtigung hast du das Boot in den Hafen geschleppt?« Die schmalen Lippen in Sylkes Gesicht bebten. Sie hatte sich tatsächlich die Zeit genommen, sich vor ihrem glanzvollen Auftritt im Zingster Hafen zu schminken. Dass sie so eitel war, hatte er nicht erwartet. Eigentlich wollte er nichts verschweigen. Aber schon sein erster Satz entsprach nicht ganz der Wahrheit.
»Ich hatte den Eindruck, dass das Zeesboot im Schilfgürtel verschwinden würde.«
»Du hast sicher einen Ersatzanker auf deinem Seelenverkäufer, oder? Mit dem hättest du das Boot am Fundort fixieren können, um dann die Polizei zu benachrichtigen.«
»Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich … ich wollte diesen Jungen da draußen einfach nicht so zurücklassen …«
»Ich nehme an, du hast die Leiche nicht berührt?«
»Ich musste doch …«
»… den Tod feststellen. Okay. Geschenkt. Wer sagt mir, dass nicht du derjenige bist, der genau diesen Tod verursacht hat?«
Tom starrte sie an. »Du glaubst doch nicht wirklich …«
»Ich bin nicht für Glaubensfragen zuständig, ich bin bei der Polizei.«
»Aber du kennst mich doch!«
»Ein schöner Satz! Fürs Poesiealbum. Nicht alle Leute, die ich kenne, sind Heilige.«
Tom schüttelte den Kopf. »Der Körper des Jungen war eiskalt, als ich ihn fand.«
»Warte hier.« Sylke ließ ihn stehen und folgte einem Beamten, der einen Metallkoffer in das weiße Schutzzelt schleppte.
Zwei Halbstarke hatten sich unter der Polizeiabsperrung durchgeschoben. Sie lehnten lässig auf ihren Rollern, zwei zierliche, chromblitzende Fahrzeuge, die anstatt einer Lenkstange nur einen Knauf besaßen. Einer der beiden Jugendlichen zeigte auf Tom: »Ist das der Mörder?« Der andere hatte schon ein Handy auf ihn gerichtet und filmte.
Tom ging auf die beiden zu. »Ey, ihr dürft hier keine Bilder machen. Und wenn ich auch nur ein Foto von mir im Netz finde, dann …«
Von hinten packte eine Hand seinen Oberarm. Ein Uniformierter mit Schnauzbart blickte ihn an wie ein Roboter, dem der zentrale Chip fehlt. »Sie sollen hier stehen bleiben, Mann! Haben Sie nicht gehört, was die Kollegin gesagt hat?«
Wieder richtete der Halbstarke sein Handy auf ihn – Gruppenbild mit Polizist. Tom sah sich nach Sylke um, die im weißen Zelt verschwunden war. »Dieser Junge da macht Fotos oder filmt. Ich weiß genau, was er mit den Bildern vorhat. Das ist eine Verletzung der Privatsphäre!«
Der Beamte schien intellektuell nicht in der Lage zu sein, das Vergehen zu begreifen. Immerhin tauchte eine junge Kollegin auf und zitierte die beiden Jungen zu sich. Dann war auch Sylke wieder da. »Tom, ich muss dich jetzt fragen, was du gestern Abend zwischen 20 und 24 Uhr gemacht hast.«
»Ist das dein Ernst?«
»Ich warte auf eine Antwort.«
»Ich war zu Hause. Das TV-Programm war beschissen.«
»Du kommst bitte mit zur Polizeistation nach Barth.«
Tom hatte das Gefühl, dass die Hafenmole anfing zu schwanken. Aus den Augenwinkeln sah er, wie die Polizistin mit den beiden Halbstarken schäkerte. Einer zwinkerte Tom dummdreist zu. Waren die denn alle bekloppt? Er sah aber auch, dass die beiden Roller unbeaufsichtigt herumstanden. Er verspürte einen unwiderstehlichen Wunsch, die groteske Situation zu beenden. Er wollte nicht darauf warten, dass sich irgendeine höhere Einsicht durchsetzte; bei Leuten, die offensichtlich keine besondere Begabung für höhere Einsichten hatten. Die Gelegenheit war günstig: zu den beiden Rollern sprinten, einen mit einem kräftigen Tritt ins Hafenbecken befördern, mit dem anderen ein paar Schritte laufen, aufspringen und den kleinen, drei Fuß breiten Weg an der Pier entlangsausen, im Slalom die Fahrradständer umrunden, die scharfe Biegung mit Bravour nehmen, die Lücke zwischen den Schaulustigen finden, durch das Fluttor und die Hafenstraße im Gewirr der Zingster Gassen verschwinden.
Er konnte es tun.
Es war eine Sache von wenigen Sekunden.
Er tat es.
-3-
Der Roller war gut geölt. Wie ein Surfbrett auf den Wellen vor Hawaii schoss er die Hafenstraße entlang. Als er am Ende angekommen war, sah Tom sich um. Ein Streifenwagen wendete, das Blaulicht war schon eingeschaltet. Sie mussten das tun. Er begriff, dass er eine Dummheit begangen hatte. Aber die eigene Dummheit zu durchschauen, heißt ja noch lange nicht, sie auch zu korrigieren. Er konnte nicht anders, er wollte weg vom Hafen, weg von diesem Boot mit dem eiskalten Körper eines Kindes, weg von Sylke Bartel, dem rocktragenden Sheriff von Barth.
Ohne nach links oder rechts zu schauen, raste Tom über den Asphalt. Dass es nicht empfehlenswert war, die Jordanstraße in diesem Höllentempo zu überqueren, schien ihm vollkommen klar. Weniger klar war ihm, ob und wo das Surfbrett auf Rollen, mit dem er unterwegs war, eine Bremse besaß. In seinem rechten Augenwinkel blitzte ein Stück Chrom auf, als er ungebremst quer über die Hauptverkehrsachse des Ortes schoss. Der markige Ton einer Hupe ließ sein rechtes Ohr zerspringen und erfüllte alle Voraussetzungen, um als Fanfare das Jüngste Gericht anzukündigen. Wollte er der zweite Tote an diesem Sonntagmorgen werden?
Mit einem Teil seines Bewusstseins blieb er auf dem Asphalt liegen. Ein kläglicher Krieger, von einem Kleinlaster gefällt. Der andere Teil von ihm schaffte es, aber es war knapp. Die Schimpftirade aus dem Transporter hatte einen südeuropäisch klingenden Akzent und wurde schnell wieder leiser. Er kam außer Atem. Auf selbst angetriebenen Fahrzeugen durch die Stadt zu rasen, war nicht seine Stärke. Die Polizisten hinter ihm schalteten ihr Martinshorn ein. Es ging vorbei am Postplatz und an einem Restaurant, von dem Clara behauptete, es gebe dort die besten Bratkartoffeln in ganz Vorpommern. Es war sicher nicht der richtige Zeitpunkt, um an Bratkartoffeln zu denken, aber der Gedanke saß fest in seinem Kopf wie eine Zecke. Immerhin: Der Anblick eines mittelalten Mannes in Jeans und Parka, der wie irre einen winzigen Roller vorantrieb und von einem Einsatzwagen der Polizei verfolgt wurde, das war eine Attraktion, die die Passanten an einem Ostermontag in Zingst sonst nicht geboten bekamen. Mit offenem Mund standen die Menschen am Straßenrand. Applaus gab es allerdings keinen.
In gefährlicher Schräglage bog Tom auf den Parkplatz eines Edeka-Marktes ein und steuerte auf eine alte Dame zu, die mit ihrem Rollator die Zufahrt überquerte. Er wich aus, das Hinterrad rutschte weg, aber er konnte sich gerade noch fangen. Dann kam auch schon die Durchfahrt zur Strandstraße, mit diesem dämlichen Schild, über das er sich schon unzählige Male geärgert hatte:
Vernünftige Leute fahren hier nicht mit dem Rad – allen anderen ist es verboten.
Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Tom die Chance, an dieser Stelle unvernünftig zu sein. Immerhin war auf dem Schild ja von Fahrrädern die Rede und nicht von gestohlenen Rollern. Rasant manövrierte er um das Drängelgitter herum. Der Polizeiwagen raste auf ihn zu und bremste mit quietschenden Reifen. Er widerstand der Versuchung, der herausspringenden Besatzung einen aufgestellten Mittelfinger zu zeigen. Die Polizisten sahen ein, dass sie zu Fuß keine Chance gegen ihn hatten und gaben die Verfolgung auf.
Er fuhr einen Umweg über die Bahnhofstraße und die Neue Reihe, hier war es ruhiger. Einfamilienhäuser wechselten sich mit neuen Apartmentanlagen ab. Liebevoll gestaltete Vorgärten waren eingerahmt von akkurat geschnittenen Hecken und Entwässerungsgräben, die sich in einem weitläufigen Netz durch ganz Zingst zogen. Ein paar Rollerschwünge weiter bog er in eine Einfahrt zu einem größeren Grundstück ein, auf dem zwei in Meergrün gehaltene Mehrfamilienhäuser standen. Im Vergleich zu den benachbarten Gebäuden im Landhausstil fehlte diesen Häusern jeglicher Charme. Nicht einmal Balkone gab es. Über die Rasenfläche waren Wäscheleinen gespannt und im vorderen Bereich des Grundstücks reihte sich ein gutes Dutzend Garagen aneinander, mit klapprigen Holztoren und kaum groß genug, um darin einen modernen Mittelklassewagen unterzubringen.
Tom blickte sich um. Niemand war zu sehen. Eilig schob er den heiß gelaufenen Roller noch ein paar Schritte weiter und lehnte ihn an eine Hauswand. Claras Garage fand er offen, der Kombi war nicht da. Tom ging ins Innere und nahm einen braunen Pappkarton mit Lumpen aus dem Regal. Tief unter den alten Lappen ertastete er Claras Wohnungsschlüssel.
Die Wohnung lag im ersten Stock; es war sehr still und wie immer aufgeräumt. Helle Holzmöbel, cremefarbene Tapeten. Auf dem Esstisch eine Vase mit leuchtend gelben Narzissen – wahrscheinlich hatte Clara die von ihrer Vermieterin bekommen. Oder sie hatte sie von ihren Eltern aus Wismar, bei denen sie die letzten Tage verbracht hatte. Eigentlich war diese Wohnung der richtige Ort, um klare Gedanken zu fassen. Aber Tom war weit davon entfernt: Eben noch erleichtert, der Polizei entkommen zu sein, fühlte er sich leer und verlassen. Er wanderte ruhelos im Wohnzimmer auf und ab. In der Küche fand er einen Zettel:
Du bist nicht gekommen. Wenn es etwas gibt, das heute für dich wichtiger ist als unsere Verabredung, dann wirst du morgen sicher nach China fahren, um da einen Sack Reis aufzustellen. Gute Reise. Clara
Tom faltete das Papierstück zusammen. Er hatte nicht das Gefühl, Claras Botschaft verstanden zu haben, aber es klang verärgert, sarkastisch, fast wie Abschied. Jetzt hatte er schon zwei Probleme und er wusste nicht, welches von beiden das größere war. Sein Blick fiel auf eine Reihe von Buntstiftgemälden, die Clara an ihre Küchenschränke geklebt hatte. Kinder aus ihrer Kindergartengruppe hatten sie ihr zum 35. Geburtstag gemalt. Er dachte an die Party im vergangenen Sommer. Unten im Garten hatten sie bei sonnigem Wetter gegrillt, vom Nachmittag bis tief in die Nacht gefeiert. Es war ein schönes Fest gewesen, aber Tom erinnerte sich auch an etwas anderes, an ein unterschwelliges Gefühl der Erwartung und Ungeduld, das er in den Blicken mancher Gäste gesehen zu haben glaubte. Spätabends hatte es Leonie, eine Schulfreundin Claras, dann in Worte gefasst: »Na, Tom? Wann ist denn die Hochzeit? Werdet ihr noch eine richtige Familie?«
Ein hässliches Bild zerrte ihn in die Gegenwart zurück. In aller Schärfe stand es ihm wieder vor Augen, das Bild vom frühen Morgen: der Junge im Zeesboot, bleich und starr und kalt. Er erschien ihm mehr und mehr wie ein Bote aus einer anderen, düsteren Welt, der auf unerklärliche Weise in die jetzige eingedrungen war. Der tote Junge ließ alle anderen Probleme zu Nebensächlichkeiten schrumpfen. Und es war geradezu ungeheuerlich, dieses Bild neben die Erinnerung an Claras Geburtstagsparty zu stellen – und diese Frage: Werdet ihr noch eine richtige Familie?
Tom öffnete das Fenster des Wohnzimmers. Die Luft draußen war nach wie vor eigenartig drückend, gar nicht so frisch, wie man es von einem Tag im April erwarten konnte. Er blickte über aufgeräumte Gärten und noch unbelaubte Hecken und Sträucher. Gern wäre er zum Museumsmarkt gegangen, um Clara wenigstens beim Verkauf zu helfen, aber vielleicht hatte sich längst das Gerücht verbreitet, er, Tom, sei vor der Polizei geflohen, weil er mit dem Tod dieses Jungen irgendetwas zu tun hätte. Der Gedanke ließ ihn schaudern. Er malte sich aus, wie eine Gruppe aufgebrachter Marktbesucher sich auf ihn stürzte und mit Regenschirmen und Handtaschen auf ihn einprügelte. Nicht einmal anrufen konnte er Clara. Sie besaß seit einiger Zeit keinen Festnetzanschluss mehr, sondern telefonierte nur noch mit dem Handy, das sie selbstverständlich mit zum Museumsmarkt genommen hatte. Tom überlegte, ob er in Claras Schränken nach einem passenden Ladegerät für sein eigenes Mobiltelefon suchen sollte, aber er wusste plötzlich nicht mehr, ob er Clara überhaupt anrufen wollte. Er schloss das Fenster und warf einen Blick in die Vorratskammer. Schlagartig wurde ihm bewusst, dass er großen Hunger hatte. Und dass jetzt der richtige Zeitpunkt war, um etwas vollkommen Unpassendes zu tun.
Schwer beladen eilte er in die Küche und krempelte die Ärmel hoch. Es tat ihm gut, sich auf elementare Dinge zu konzentrieren: Paprika waschen und zerteilen, Kartoffeln und Zwiebeln schälen, Möhren in Scheiben schneiden. Er klammerte sich an diese einfachen Herausforderungen und bewegte seine Finger mit dem Kartoffelschäler immer schneller, weil er an nichts anderes mehr denken konnte als eine wohlschmeckende, kräftig gewürzte Ratatouille mit Kräutern von der Fensterbank.
-4-
Ein einziges Objekt hatte Clara bis kurz vor elf Uhr verkauft: ein Stück Schiffsplanke, das sie mit Öldampf geschwärzt und auf einen lehmfarbenen Hintergrund geklebt hatte. Wasser und Sand hatten das vor langer Zeit gesplitterte Holz abgeschliffen. Mit etwas Fantasie oder nach dem Genuss von ein paar Gläschen Sanddorngeist nahm die Planke unweigerlich die Form einer flachen Hand mit einer geheimnisvollen Linienzeichnung an. Wer an diesen Punkt gelangt war, sah nicht mehr ein Stück verwittertes Holz, sondern erblickte den gespenstischen Gruß eines vor Jahrhunderten ertrunkenen Fischers.
Der Zingster Museumsmarkt, der sonst immer an Donnerstagen stattfand, war in diesem Jahr ausnahmsweise auf den Ostermontag gelegt worden – eigentlich eine gute Idee, wie der große Andrang an den Verkaufsbuden zeigte. Trotzdem liefen Claras Geschäfte nicht gut. Und der Grund dafür stand für sie längst fest. Wegen Toms unsäglichem Ausbleiben war sie eine Viertelstunde zu spät gekommen. Es war nicht seine Art, und sie hatte ihn nicht erreichen können. Sorgen machte sie sich trotzdem nicht. In aller Eile hatte sie den Wagen beladen, war hergefahren und hatte ihren Stand arrangiert. Zum Glück unterstützt von Manuel Schütz, der zusammen mit seiner Frau Sara zwei Stände weiter selbstgefertigte Waren aus ihrer Töpferei in Ahrenshoop verkaufte. Aber wenn ein Tag so unruhig begann, dann nahm er meist keinen guten Verlauf. Es fiel Clara schwer, die Fragen der Marktbesucher so zu beantworten, dass diese am Ende Lust bekamen, etwas zu kaufen. Sie selbst hätte an diesem Tag nichts von ihren Sand- und Muschelbildern mitnehmen wollen, um sie sich dann an eine Zimmerwand zu hängen oder in ein Regal zu stellen. Sie glaubte nicht mehr daran, dass sich die Fundstücke in etwas Neues verwandelt hatten. Vielleicht, dachte sie, war alles noch immer Strandgut und sie selbst ein Scharlatan, der einen verwitterten Ast mit ein paar Farbklecksen darauf für fünfzehn Euro anbot.
Immerhin war der Museumshof gut besucht, besser, als an den üblichen Markttagen einmal im Monat. Touristen und auch viele Einheimische schlenderten zwischen einem guten Dutzend Ständen umher, schnupperten an selbstgebrannten Likören, ließen Seifen und Stoffe durch ihre Finger gleiten oder probierten kleine Brotstückchen mit Sanddornmarmelade oder Honig vom Darß. Aber eine merkwürdige Lähmung lag über dem Hof. Vielleicht hatte es mit der feuchten, untypisch windarmen Luft zu tun, die drückend über dem ganzen Ort hing. Keine Spur von frischer Meerbrise. Für einen Tag im April war es ungewöhnlich mild.
Um kurz vor elf drängte sich Sara an ihren Stand und trug ihr die schreckliche Nachricht zu, die an diesem Morgen in Zingst die Runde machte. Saras Stimme zitterte, und Clara spürte in diesem Zittern etwas Authentisches und Bedrohliches, etwas, das ihr sagte: Diese Geschichte kann niemand erfunden haben.
»War es ein Unfall?«
»Was für eine Art von Unfall soll das gewesen sein, bei diesem Wetter? Der Junge lag angeblich in einem Holzboot, ohne äußere Verletzungen.«
Zerstreut reichte Clara einem Kunden ein Stück Sackleinen, das sie vor einigen Monaten am Strand gefunden hatte. Es war mit Muscheln und einem getrockneten Seestern verziert. In früheren Tagen hätte sie diese Art von Kunstwerk als maritimen Kitsch eingeordnet. Aber inzwischen machte es ihr Spaß, so etwas zu arrangieren. Und die Leute waren meist ganz scharf darauf.
»Es war der Sohn von einem Bauunternehmer«, erzählte Sara. »Grabowski oder so ähnlich …«
»Rakowsky? Wirklich? Das ist ja schrecklich!«
»Kennst du ihn?«
Der Kunde gab Clara das Sackleinen-Arrangement zurück und lächelte fragend. Normalerweise hätte sie ihm das Ding noch schmackhaft gemacht. Aber jetzt legte sie es wortlos zurück in die Auslage. Der Mann schlenderte weiter.
»Rakowsky kenne ich nicht«, sagte sie zu Sara, »aber seine Frau. Ich bin mit ihr zur Schule gegangen. Mannomann, das ist nicht fair!«
»Kanntest du auch das Kind?«
»Ich wusste gar nicht, dass Ursula überhaupt einen Sohn hatte. Als sie vierzehn war, ist sie mit ihrer Familie nach Stralsund gezogen. Ich habe gehört, dass sie letztes Jahr mit ihrem Mann wieder hierhergekommen ist, aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Es war immer irgendwie schwierig mit ihr.«
Sara sah sie fragend an. »Wieso schwierig?«
»Ursula war etwas Besonderes. Unnahbar. Viele hielten sie für arrogant. Wir haben sie ›Die Königin‹ genannt. Es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich mich mit ihr ganz gut verstanden. Ich weiß noch, dass wir uns zusammen Modekataloge angeguckt haben. Schöne Kleider, das war wohl das Thema, das uns verband.«
Sara wies Clara diskret auf eine Frau hin, die eine kleine, aus Plastikmüll zusammengesetzte Figur aus der Auslage genommen hatte und mit einem Fingernagel daran herumkratzte.
»Sie können diese Figur gerne kaufen. Bis dahin wäre es nett, wenn Sie sie nicht verändern würden.«
Die Frau, eine stark geschminkte Mittvierzigerin mit roten Locken, sah Clara empört an. »Aber das ist doch nur Müll!?«
»Wenn Sie den Unterschied zwischen Müll und künstlerisch gestalteten Materialien nicht verstehen, sollten Sie sich vielleicht woanders umsehen.« Clara erschrak über den harschen Ton, den sie da anschlug. An normalen Tagen hätte sie ganz anders reagiert. Aber dieser Tag war schon lange nicht mehr normal. Sie nahm der Frau die Figur aus der Hand und wurde mit einem verächtlichen Blick bedacht.
»Müll ist Müll. Das können Sie nicht ändern. Und wenn Sie mich fragen: Hier ist alles mehr oder weniger Müll.« Die Rothaarige warf sich, während sie sich demonstrativ abwandte, ihren Mantel über und verschwand zwischen anderen Marktbesuchern.
»Was für ein Besen!«, sagte Sara. An ihrem Stand drängelte sich gerade eine Menschenmenge; Manuel schien mit dem Verkaufen nicht mehr hinterherzukommen. »Ich muss wieder rüber«, sagte Sara und blickte besorgt in Claras Gesicht. »Kommst du klar? Soll Manuel dir nachher beim Abbau helfen?«
Clara nickte. »Danke, das wäre toll. Heute ist ein Tag … ich weiß nicht, wie ich das sagen soll … ein kaputter Tag. Dass Tom mich heute Morgen einfach im Stich gelassen hat, ist ein starkes Stück. Wenn er wenigstens angerufen hätte!«
Zwischen elf und vierzehn Uhr verkaufte Clara nur noch zwei kleine Muschelbilder, aber sie war nicht einmal enttäuscht. Nur irgendwie verwirrt, sie fühlte sich wie in graue Watte gepackt. Manuel half ihr, die Kartons in dem alten Kombi zu verstauen. Sie verabschiedete sich von Sara und stieg ein.
Langsam glitt ihr Wagen die Jordanstraße entlang. Sie wollte nicht nach Hause fahren und kurvte eine Weile ziellos durch den Ort. Irgendwann war sie auf der Landstraße angekommen, die aus Zingst hinausführt und im Nichts endet. Die Straße nach Osten, ein holpriger Weg zwischen kargen Birkenwäldern und sumpfigen Wiesen. Einzelne Gehöfte und Häuser hinter Bäumen bilden den Ortsteil Müggenburg, dann führt eine letzte Abzweigung nach rechts zu einem winzigen Hafen. Clara ließ den Kombi langsam ausrollen, bis er vor einem Metallzaun zum Stehen kam. Im Hintergrund ragte eine stattliche Villa auf, mit Reet gedeckt und eingefasst von einer weitläufigen Gartenanlage. Ein Weg führte bis vor die Haustür und dann in einem Bogen zurück zur Straße.
An einem Tag im Frühling vor einem knappen Jahr hatte Clara schon einmal das Anwesen der Rakowskys betrachtet, oben vom Deich aus. Damals war sie mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, auf einer Tour bis zur östlichen Spitze der Halbinsel. Sie hatte gehört, dass Ursula mit ihrem Mann wieder nach Zingst gezogen war und wollte sich aus Neugier ihr neues Domizil ansehen. Das Gebäude schien die gleiche Atmosphäre steriler Pracht zu verbreiten, die sie schon von Ursulas Elternhaus her kannte. Allerdings hatten die Rakowskys mit ihrem zweiflügeligen, reetgedeckten Landhaus dessen Ausmaße noch einmal verdoppelt oder verdreifacht. So viel Reichtum schreckte Clara ab. Hatte sie anfangs noch überlegt, wieder Kontakt zu Ursula aufzunehmen, so hatte sie diesen Vorsatz spätestens an diesem Tag aufgegeben und darauf geachtet, dass sie dem Anwesen nicht mehr zu nahe kam.
Jetzt war sie wieder da, näher als je zuvor, von einem Gefühl getrieben, das sie nicht beschreiben konnte. Hatte sie nicht damals, als sie beide noch zur Schule gingen, schon geglaubt, dass sie Ursula vor irgendetwas bewahren müsse; dass sie ihr zeigen müsse, wie das wirkliche Leben war, und so etwas wie Herzenswärme vermitteln? Ursulas Vater war ein leitender Funktionär des VEB Landmaschinenbau Güstrow, ein wortgewandter und ehrgeiziger Karrierist. Hätte man das Wort in der DDR damals verwendet, hätte man ihn als Managertyp bezeichnet. Ursulas Mutter wirkte wie eine ältere, etwas verbrauchte Ausgabe ihrer Tochter: schlank und braun gebrannt, immer adrett gekleidet, eine athletische und gleichzeitig unglückliche Frau, die aller Welt mit einer tiefgründigen Abneigung begegnete. Clara hatte sich gefragt, wie ein Mädchen mit solchen Eltern jemals glücklich werden konnte.
Sie blickte hinüber zur Villa. Auf dem Zufahrtsweg parkten zwei nicht sehr große und nicht sehr teure Autos. Clara bezweifelte, dass eines davon den Rakowskys gehörte. Vielleicht waren die beiden abgeholt worden, um ihren toten Sohn in der Gerichtsmedizin zu identifizieren. Dieser Gedanke ließ Clara erschaudern. Sie begriff, dass sie an diesem Ort nichts zu suchen hatte. Hinter dem unbestimmten Drang, hierher zu kommen, verbarg sich nicht nur Mitgefühl, sondern auch eine ungute Neugier, vielleicht sogar Schaulust. Sie schämte sich dafür und startete den Motor. Der Weg führte noch einige Meter weiter, querte den Deich und endete auf einem kleinen Parkplatz. Ein Stück vom Bodden war zu sehen, ein Steg mit Anlegestelle, der Zingster Strom, dahinter die kleine Insel Kirr, die abgesehen von zwei Ferienhäusern und einigen Dutzend Rindern unbewohnt war.
Es war das Beste, auf kürzestem Weg nach Hause zurückzukehren. Clara wendete den Kombi auf dem lehmigen Parkplatz und fuhr wieder über den Deich. Als sie das Grundstück der Rakowskys passierte, lief vor ihrem Auto eine Frau auf die schmale Straße. Sie trug Turnschuhe und eine billige graue Joggingjacke aus dem Discounter. Clara kannte sie nicht. Die Frau überquerte die Straße und winkte. Clara wäre gern weitergefahren, aber die Frau gestikulierte immer heftiger, sodass sie schließlich doch bremste und die Scheibe herunterkurbelte.
Die Frau kam an die Fahrerseite und fragte: »Frau Lehnhoff? Würden Sie kurz mit mir kommen?«
Clara sah sie fragend an.
»Meine Chefin, Frau Rakowsky, sagt, sie kennt Sie.«
Clara zögerte. Es war doch eine Dummheit gewesen, so nah an das Haus heranzufahren. Die Frau in der Joggingjacke hatte einen unangenehm flehenden Blick. »Bitte!«
Ein Jahr lang hatte Clara sich gescheut, Kontakt zu Ursula aufzunehmen. Und ausgerechnet an diesem Tag sollte sie das nachholen? Sie lenkte den Kombi auf den Seitenstreifen und stieg aus. Ihr Herz klopfte, als sie der Hausangestellten durch das Tor folgte, das lautlos aufschwang und sich dann wieder schloss. Sie gingen um die Villa herum, über eine weitläufige Terrasse, dann durch eine gläserne Schiebetür ins Innere. Clara blieb einen Moment stehen, um den Raum auf sich wirken zu lassen, ein etwa vierzig Quadratmeter großer Salon, der sich in zwei Bereiche teilte. Um einen wunderschönen Esstisch aus rötlichem Holz standen Designerstühle mit hohen, schmalen Lehnen. Am anderen Ende befanden sich ein Kamin und eine Sitzgruppe, in hellbraunem Leder gehalten. Alles in diesem Raum wirkte freundlich, geradlinig, schnörkellos.
Ursula saß regungslos auf dem Ledersofa und blickte aus dem Fenster. Sie trug eine elegant geschnittene, schwarze Hose, dazu eine Seidenbluse in dunklem Violett, die geheimnisvoll schimmerte. Ihre fein glänzenden, kaffeebraunen Haare waren hochgesteckt und ihr Gesicht strahlte die gleiche kühle Würde aus, die Clara noch in so deutlicher Erinnerung hatte. Ein Ausdruck tiefer Traurigkeit lag auf ihren Gesichtszügen. Die Falten um den Mund, um die Augen und die schlanke Nase herum hatten sich sicher nicht erst an diesem Tag in ihr Gesicht gegraben, aber dieser Tag würde für immer darin abzulesen sein. Trotzdem fand Clara, dass Ursulas Gesicht mit den Jahren noch schöner geworden war. Dieser Gedanke kam ihr unpassend und beinahe geschmacklos vor, aber sie konnte sich nicht dagegen wehren. Sie selbst fühlte sich im Vergleich zu Ursula haltlos und verkommen.
Clara setzte sich auf einen freien Sessel und sagte erst einmal nichts. Die Hausangestellte verschwand im Hintergrund des weitläufigen Salons. Nach einer Weile richtete Ursula ihren Blick langsam auf Clara, so, als versuche sie aus einem langen Traum zurückzukehren. »Ich habe dich gesehen, Clara. Entschuldige, dass Marianne dich einfach so angesprochen hat.«
»Das macht doch nichts.«
»Es kommt mir so unwirklich vor. Wie lange haben wir uns nicht gesehen?«
»Ich weiß nicht. Wir waren vierzehn, oder?«
Ursula nickte und versank wieder tief in ihren Gedanken. Marianne, die Hausangestellte, setzte ein Tablett auf dem Couchtisch ab. Sie sprach so leise, als wären sie in einem Krankenhaus. »Ich habe Tee gekocht.«
Dann war es wieder still. Durch die bodentiefe Fensterfront fiel der Blick über die Terrasse auf eine parkähnlich eingefasste Rasenfläche, die durch verschiedenartige Gehölze und einen steinernen Springbrunnen aufgelockert wurde. Die ersten, zartgrünen Triebe waren schon zu sehen, auch einige früh blühende Blumen zierten die geschmackvoll geschnittenen Beete. Ganz hinten, unter den Ästen ausladender Buchen, sah Clara eine Schaukel und einen kleinen Sandkasten.
»Du musst nichts sagen, Clara. Ich … ich würde gerne mit dir über früher reden, aber nicht heute. Es wäre schön, wenn du einfach ein wenig hier bleiben würdest.« Ursulas Stimme hatte einen flehenden Ton angenommen.
Clara überlegte angestrengt, was sie tun sollte, wenn Ursula die Fassung verlieren oder einfach gar nichts mehr sagen würde. Aber es schien ihr tatsächlich gut zu tun, dass jemand da war, der ihr abverlangte, die Haltung zu bewahren.
»Wenn ich etwas merkwürdig bin, wirst du mir das sicher verzeihen, oder? Ich habe heute Mittag ein starkes Beruhigungsmittel bekommen. Es ist … na ja, ich denke, die Wirkung wird bald nachlassen, und ich weiß nicht, was dann mit mir passiert.« Ursula blickte auf ihre Füße, die in zierlichen Sandaletten aus schwarzem Lackleder steckten. Sie schien mit den Tränen zu ringen. »Mein Mann ist heute sehr früh zu beruflichen Besprechungen nach Frankfurt am Main gefahren. Es wird ihn umwerfen. Es wirft uns beide um. Eigentlich wollte er bis morgen bleiben. Aber seine Geschäftspartner stellen ihm ihren Firmenjet zur Verfügung. So kann er heute Abend schon zurückkehren.« Sie machte eine kleine Pause. »Es ist … so unbegreiflich … so erdrückend. Ich bin so weit weg davon, es zu verstehen, dass Leo nicht mehr zurückkommt. Nie wieder.« Den letzten Satz hatte sie nur geflüstert. Ihre Stimme versagte. Sie nahm einen Schluck Tee und musste sich ganz auf die Bewegung konzentrieren, um nichts zu verschütten. »Wir waren … wir waren eine richtige Familie. Günter – mein Mann – konnte im letzten Jahr beruflich etwas kürzer treten. Er hat mit Leo mehr Zeit verbracht, da draußen im Garten zum Beispiel. Darüber bin ich wirklich dankbar. Mein Gott, wie ich rede … hörst du das? Es klingt so, als hätte ich das alles schon verstanden. Was mich selbst betrifft, ich … ich …«
Sie verlor den Faden, ihre Stimme stockte, sie begann zu schluchzen. Clara setzte sich zu ihr auf das riesige Sofa und legte vorsichtig den Arm um ihre Schultern.
Ursula beruhigte sich, blickte Clara an und richtete sich auf. »Ich bin wirklich dankbar, dass du hier bist. Kannst du noch etwas bleiben? Du musst nichts machen. Einfach nur da sein.«
Clara nickte. Sie brachte kein Wort heraus.
Ursulas Stimme bekam eine dunkle Farbe. »Die Polizei wird die Sache natürlich untersuchen. Aber was hilft uns das? Es bringt uns Leo nicht zurück. Er war unser einziges Kind. Hast du auch Kinder?«
Clara schüttelte den Kopf. »Nein, ich …«
»Ja, trotzdem wirst du dir vorstellen können, was das bedeutet. Ich habe eigenartigerweise schon oft darüber nachgedacht. Das ist so meine Art. Ich habe mir ausgemalt, wie es wäre, wenn Günter oder Leo krank würden oder einen Unfall hätten. Was wäre, wenn einer von ihnen sterben müsste? Ich habe das gedacht und überlegt, ob ich mich gegen diesen Fall innerlich absichern kann. Irgendwie … vorbereiten. Verstehst du?«
»Ich weiß nicht.«
»Nein, das ist eine Marotte von mir. Du wirst denken, dass ich verrückt bin. Sicherheit war immer wichtig für mich. Angst erzeugt den Wunsch nach Sicherheit. So ist es doch, oder? Aber wir haben nun mal auch Angst. Hast du auch manchmal Angst, Clara?«
»Nicht diese Art von Angst, aber vielleicht andere Ängste. Ich habe zum Beispiel Angst, dass mich meine Arbeit irgendwann nicht mehr ausfüllt oder ich sie verliere. Oder dass ich im Alter einsam sein könnte.«
»Bist du verheiratet?«
Clara musste lächeln. »Das war bislang kein Thema. Ich habe einen Freund, der mich allerdings ausgerechnet heute im Stich gelassen hat.«
Ursula sah sie mit gläsernem Blick an. »Das ist gut … Nein, ich meine, es ist gut, dass du einen Freund hast. Weißt du, ich bin auch sehr eigenständig – verheiratet oder nicht. Wenn Günter sich daneben benimmt, dann bekommt er von mir schon einiges zu hören. Ich mische mich grundsätzlich nicht in seine Geschäfte ein, aber hier im Haus habe ich das Kommando. Das hier ist mein Revier.«
Clara hatte plötzlich das Gefühl, dass sie eine Diskussion weiterführten, die sie vor beinahe zwei Jahrzehnten nicht zu Ende gebracht hatten. »Weißt du noch, als wir damals über das Heiraten gesprochen haben? Wir waren dreizehn oder vierzehn. Und wir hatten unterschiedliche Ansichten. Es ist verrückt, aber wir haben beide genau das getan, was wir uns vorgenommen haben: Du hast einen Mann geheiratet, der dir Sicherheit gibt und ich habe es nicht geschafft, mich festzulegen.«
Ursula versuchte so etwas wie ein Lächeln. Sie sah Clara an, und für einen Moment schien etwas von einer Herzenswärme aufzuleuchten, die Clara bei Ursula damals oft vermisst hatte. Erst in den letzten Monaten, bevor Ursula nach Stralsund gezogen war, hatte sie das Gefühl gehabt, in ihr eine Freundin gefunden zu haben.
»Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du schon mal eine Ausstellung gemacht hast. Du bist eine richtige Künstlerin.«
»Ach, das mache ich nur nebenbei. Strandkunst – den Leuten gefällt das. Hauptsächlich bin ich Erzieherin, hier in Zingst.« Sie legte ihre Hand auf Ursulas Arm und strich langsam darüber. Ursulas Finger fühlten sich trocken und fein an, als gehörten sie zur Hand eines vorzeitig gealterten Kindes.
Das Telefon klingelte. Ursula bewegte sich schwerfällig wie eine alte Frau und sprach mit schwacher Stimme ein paar Worte in den Hörer. Dann kehrte sie zurück.
»Günter ist bald schon da. Sie können direkt auf dem Kleinflughafen in Barth landen. Er kommt dann mit einem Taxi.«