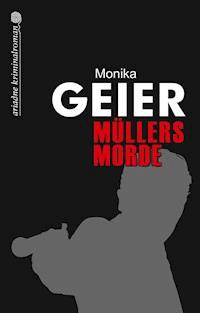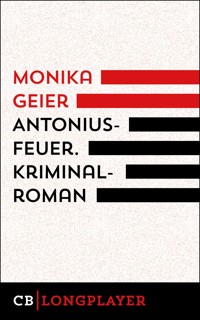7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Katastrophe für den Pfälzer Fremdenverkehr: Zwei Touristinnen entdecken verdächtige Knochen in einem Wildschweingehege. Eine der beiden verschwindet spurlos in den Bad Dürkheimer Wäldern. Verirrt? Oder hat es mit dem geplanten Neonazi-Trainingscamp zu tun? Und was geschah mit dem mazedonischen Koch, der so unheimlich gut schlachten konnte? Kriminalkommissarin Bettina Boll forscht nach ... »Psychologisches Gespür und hintergründiger Humor: Bei Geier ist Spannung garantiert!« Hörzu »Monika Geier verfügt über die Bösartigkeit aller guten Krimi-autorinnen, über Witz und die Raffinesse für wirklich subtile Plots. Ihre Bücher sind mehr als eine Entdeckung, sie sind eine Befreiung von schlecht gewordener Konvention.« Tobias Gohlis, Die Zeit »Schöne, schaurige und pathologische Details, handwerkliches Können und intelligenter Humor!« Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Katastrophe für den Pfälzer Fremdenverkehr: Zwei Touristinnen entdecken verdächtige Knochen in einem Wildschweingehege. Eine der beiden verschwindet spurlos in den Bad Dürkheimer Wäldern. Verirrt? Oder hat es mit dem geplanten Neonazi-Trainingscamp zu tun? Und was geschah mit dem mazedonischen Koch, der so unheimlich gut schlachten konnte? Kriminalkommissarin Bettina Boll forscht nach ...
»Psychologisches Gespür und hintergründiger Humor: Bei Geier ist Spannung garantiert!« Hörzu
»Monika Geier verfügt über die Bösartigkeit aller guten Krimi-autorinnen, über Witz und die Raffinesse für wirklich subtile Plots. Ihre Bücher sind mehr als eine Entdeckung, sie sind eine Befreiung von schlecht gewordener Konvention.« Tobias Gohlis, Die Zeit
»Schöne, schaurige und pathologische Details, handwerkliches Können und intelligenter Humor!« Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt
Über die Autorin
Monika Geier
Schwarzwild
Bettina Bolls vierter Fall
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2017
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Printausgabe: © Argument Verlag 2008
Lektorat: Ulrike Wand
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: April 2017
ISBN 978-3-95988-080-0
Ich habe aus Versehen Mike Tysons Gebiss verschluckt.
Marie
Marie saß auf dem Beifahrersitz ihres Wagens und dachte Dinge, die sie sonst nicht denken würde. Rosa Dinge. Mit Blümchenmuster. Nichts, was leicht in Worte zu fassen war. Eigentlich schaute sie nur zufrieden und völlig regungslos auf einen verregneten Wanderparkplatz mitten im grauen Winterwald.
Dann ging es ans Aussteigen, und sofort fühlte sie sich schwer und kurzatmig. Kalt war ihr auch. Tommy beugte sich nach hinten und kramte unter den Rücksitzen nach seinen Stiefeln. Marie sah die feinen gelockten Haare in seinem Nacken und fragte sich, ob die erblich waren. Das würde ihr gefallen, ein Kind mit Löckchen. »Ich glaube«, sagte sie träumerisch, »ich komm nicht mit.«
Sofort blickten sie zwei wache braune Augen prüfend an. »Aber die Hardenburg war deine Idee.«
»Ich weiß.«
»Norbert und Claudi sind extra aus Frankfurt gekommen.«
»Ja.«
Tommy ließ sich in den Sitz zurücksinken. »Geht’s dir gut, Schatz?«
»Oh ja. Nur bisschen müde.«
»Wirklich?«
»Sehr müde«, sagte Marie mit schlechtem Gewissen, denn natürlich war sie augenblicklich nicht mehr müde. Eine Dreiviertelstunde rüber zur Hardenburg, das war ein Spaziergang, das konnte man nicht mal Wanderung nennen, es war schon reichlich affektiert, dafür auch nur festere Schuhe anzuziehen. Und Norbert und Claudi warteten. »Nein, ich bin natürlich dabei.«
In dem Moment klopfte es ans Fenster, und gleichzeitig wurde Maries Tür aufgerissen. »Hi«, rief Norbert in die Runde, und sein Lächeln überstrahlte noch seinen neongelben Anorak. »Wanderwetter!«
Marie lächelte zurück. Auf Norberts grauen Haaren saßen kleine Tröpfchen, die in der Hitze der Wanderfreude sicher gleich verdampfen würden.
»Marie! Gut siehst du aus! Steht dir, der Bauch! Hey, Tom.« Der neongelbe Freund blickte sich um, hob die Arme, als wollte er die wunderschöne Welt kurz mal herzlich drücken. »Ja, da haben die Mädels sich wieder einen super Tag ausgesucht, um uns rumzujagen, was?« Er zwinkerte Marie zu. »Auf geht’s, Marie, das letzte Mal ohne plärrendes Balg. Das müsst ihr genießen.«
Norberts Energie war ansteckend genug, um Marie über den Parkplatz zu dem kleinen fahlen Haus zu bringen, das leicht erhöht über den glänzenden Autos wachte. Doch kaum hatten sie den Gasthof passiert, fielen die beiden Männer in ihren gewohnten Laufschritt und ließen Marie und Claudi hinter sich zurück. Claudi aber war nicht Maries Lieblingsfreundin. Sie war dünn und stolz drauf und redete oft übers Abnehmen. Außerdem kannte sie jede Menge Geschichten über schlimme Krankheiten, die böse ausgegangen waren. Immerhin besaß Claudi aber eine angenehm dunkle Stimme, und daher ließ Marie sich gewöhnlich einfach von ihren heiseren Worten umgeben, nickte ab und zu freundlich und dachte sonst an etwas völlig anderes. Jede Ärztin muss ausblenden können, zumindest in ihrer Freizeit. Sonst wird sie mit den Malaisen dieser Welt geradezu totgeschlagen.
Heute jedoch fühlte Marie gleich zu Beginn des Ausflugs, dass ihr Panzer mächtige Risse hatte und wahrscheinlich nicht einmal die nächste Stunde überstehen würde, denn Claudi erzählte eben, was sie vom Hörensagen übers Kinderkriegen wusste. Das konnte Marie nicht ignorieren, auch wenn sie ahnte, dass es klüger wäre. Bei Claudi würde es Komplikationen geben. Vielleicht sogar tote Babys. Im Moment war sie gottlob noch bei den Atemtechniken.
»... Lamaze. Oder so heißt das, und diese Freundin meiner Mutter hat das wirklich jeden Tag gemacht, ich meine, mit Disziplin, weißt du, jeden Tag.«
»Oh«, schnaufte Marie. Der Weg war steiler, als sie ihn in Erinnerung hatte.
»Ja, und sie hatte bei der Geburt keine Schmerzen, stell dir vor. Überhaupt keine. Aber sie hatte ja auch schon seit dem dritten Monat geübt.« Claudi sprang leichtfüßig über eine riesige glitschige Wurzel, die Marie wie ein unüberwindliches Hindernis erschien, dann blieb sie stehen und musterte ihre Wandergefährtin zweifelnd. »Du bist im achten, nicht?«
»Ja.«
Zu spät für disziplinlastige Wunderkuren. Claudi nickte befriedigt, schmerzfrei würde Maries Niederkunft jedenfalls nicht werden. »Na, es kommt auch auf die Hebamme an, hab ich gehört.«
»Genau.« Marie blieb stehen und hielt sich am Zaun des angrenzenden Wildschweingeheges fest. Es war ein weitläufiges, schmutziges Gehege, die Äste, die den Zaun bildeten, waren schwarz und schmierig vor Nässe. Dafür fühlten sie sich überraschend stabil an.
Claudis Gesicht war plötzlich misstrauisch. »Geht’s? Ist ein bisschen steil hier.«
»Sicher«, keuchte Marie. »Kein Problem.«
Nun hatten die Wildschweine sie bemerkt und kamen auf sie zugaloppiert. Eine ganze Rotte, die wild grunzte. Claudi musterte nervös Maries Bauch. Hilfesuchend blickte sie dann den Männern hinterher, doch die waren längst um die nächste Kehre verschwunden. »Brauchst du was? Willst du dich mal hinsetzen?«
»Nein.« Marie hievte ihren gespannten Körper über die gewaltige Wurzel, machte dann noch ein paar Schritte und betrachtete die Schweine, deren schwarze Borsten voll feuchten Lehms waren. Eisiger Wind kam auf und fand die Lücken in Maries Kleidung. Trotz ihres Körperumfangs fröstelte sie.
»Vielleicht solltest du was trinken.« Claudi hob lahm die Arme. »Aber die Rucksäcke haben jetzt die Jungs.«
»Ach, muss nur mal zu Luft kommen, es drückt gegen die Lunge, bin ein bisschen kurzatmig.« Marie atmete heftig. Das Reden sollte sie eigentlich lassen. »Ganz normal«, brachte sie trotzdem heraus. Und blickte auf die kahlen, lehmgetränkten Aststücke, die hinter dem Zaun bei den Schweinen lagen. Sie sahen aus wie ein Haufen uralter Knochen.
»Okay«, sagte sie dann nach einer Weile, in der Claudi sie nur ängstlich beobachtet hatte. »Es geht weiter.« Und schaffte noch genau zwanzig Meter. Dann war eine kleine Felsstufe zu erklimmen, nichts Schwieriges, aber sie war mit feuchtem Laub bedeckt. Claudi kam mit drei großen Hüpfern drüber, Marie hingegen geriet ins Rutschen und erschrak, leicht nur, aber sofort spürte sie dieses warnende Ziehen im Bauch. Von der Seite grunzten sie die Schweine an.
»Was ich eigentlich erzählen wollte«, sagte Claudi, die wieder in ihren rauen Redefluss verfiel, »mit dem Termin musst du aufpassen. Die Schwägerin meiner Tante, na ja ...«
Das Ziehen war hartnäckig. Marie hielt an und holte tiefer Luft. Aus, ein, aus, ein.
Claudi blieb ebenfalls stehen, blickte vielsagend und senkte vertraulich die Stimme. »Ich würd’s dir nicht sagen, wenn du nicht Doktorin wärst und sowieso wüsstest, was alles passieren kann.«
Jetzt kamen die Komplikationen. Marie hielt sich wieder am Zaun fest. Die Wildsäue waren ihnen gefolgt, und da sie kein Futter erhalten hatten, war ihr Quieken inzwischen ärgerlich. Einer der Äste im Gehege war wirklich ein Knochen, fiel Marie auf. Ein breites, etwas schaufelförmiges Hüftbein. Lag einfach so da, am Zaun, wo jedermann vorbeispazierte. »Schau mal«, sagte sie, hauptsächlich um die Wandergefährtin von ihren Schreckensgeschichten abzulenken. »Ein Knochen. Ist der nicht unheimlich?«
Claudi hing sofort am Zaun. »Ach Gott. Tatsächlich. Der ist ja riesig. Sieht aus wie von ’nem Menschen.«
»Quatsch«, machte Marie unwirsch.
»Doch, findest du nicht? Frau Doktor?«
Claudi arbeitete als Verkäuferin in einem Modehaus. Von Hüftknochen wusste sie höchstens, wie weit sie vorstehen mussten, um echt hipp zu sein. Doch auch Marie mit ihrem Staatsexamen in Medizin konnte nicht auf Anhieb Menschen- von Tiergebein unterscheiden. Ihr Gebiet waren die Herzen anderer Menschen. Sie war Kardiologin, und Knochen hatten sie noch nie interessiert. »Nein, finde ich nicht«, sagte sie, bedauerte allerdings ein wenig, dass sie damals in Anatomie so oft geschwänzt hatte.
Claudi überlegte einen Moment. »Schweine sind ja Kannibalen«, sagte sie dann.
Wie um zu nicken, senkte die große graue Wildsau ihren Rüssel.
»In Gefangenschaft werden sie zu Raubtieren und fressen sich gegenseitig.«
»Hm.« Marie hielt ihren Bauch. Über Schweine wusste sie wenig. Gemeinsam blickten sie den Tieren nach, die sich jetzt trollten und im eisgrauen Bodendunst über dunkle Schlammpfützen jagten. Das andere Ende der Einzäunung war nicht auszumachen.
»Da ist wohl das Gehege zu eng«, sagte Claudi ernst.
»So furchtbar klein sieht’s gar nicht aus.«
»Im Vergleich zur Freiheit ist jedes Gehege eng«, sprach Claudi weise und wandte sich ab. »Drei Tage«, setzte sie dann rätselhaft hinzu, die Nase nun hübsch längs des Weges ausgerichtet.
»Werden wir brauchen, um die Jungs einzuholen?« Marie hätte nicht drauf eingehen sollen. Sie war verdammt selbst schuld.
Claudi schüttelte den Kopf und blickte feierlich. »Nein. Die Freundin meiner Tante. Die war drei Tage über dem Geburtstermin. Obwohl der Arzt sie gewarnt hatte.«
Der Bauch zog mächtig. »Sag’s mir nicht«, bat Marie.
»Es war tot«, versetzte Claudi sanft. »Das Kind. Übertragen. – Denk dran, dass du vorsichtig bist«, fügte sie dann scheinheilig hinzu.
Marie bat Claudi, alleine weiterzugehen, wozu die aber wenig Lust hatte, denn ihr gefiel die neue Rolle als Kassandra überaus gut. Dass die Frau Doktorin ihr wirklich zuhörte, dass sie irgendwie dieses eine Thema zu fassen bekommen hatte, bei dem Marie nicht abschalten konnte, das fand Claudi – na ja, fast lustig. Und dass sie mal die Sportlichere von ihnen beiden war, auch.
Gewöhnlich zogen die drei Studienfreunde Norbert, Tommy und Marie voraus und überließen Claudi die Nachhut, nicht verächtlich, sondern schlicht taub gegenüber allem, was nichts mit der Tour zu tun hatte. Claudi trug einen umwerfenden Anorak? Wurde nicht bemerkt. Claudi verstauchte sich in ihren neuen Schuhen den Knöchel? Der Marsch fand trotzdem statt. Claudi machte eine Diät und fühlte sich geschwächt? Man drängte ihr kiloweise Traubenzucker auf. Und dann der ständige Regen. Der wurde natürlich ignoriert. Als könnte man diesen schleimig tropfenden, eisigen Wald mittels funktionaler Ausrüstung in ein Sommerparadies verwandeln. Als wäre die Natur beherrschbar. Schlechtes Wetter gibt es nicht und so weiter. Diesen Mist musste man wohl glauben, wenn man Arzt geworden war. Auch um der rechten Einstellung zum Beruf willen.
Gelassen betrachtete Claudi ihre schwer atmende, hochschwangere Wanderfreundin Marie, die einen unsäglichen, dick wattierten rosa Anorak über dem ohnehin schon ausladenden Bauch trug, dazu Latzhosen und uralte braune Lederstiefel. Eine Frau, die sich so ausstaffierte, schwanger oder nicht, konnte eigentlich nur blind sein. Die rosa Kapuze war mit einem grellen Blümchenmuster gefüttert, das in seiner Scheußlichkeit fast schon wieder gut war. »Du solltest jetzt nicht allein bleiben«, sagte Claudi ziemlich gleichgültig. Absicht war das Scheußliche bestimmt nicht. Marie hatte viel zu wenig Stil, um ironische Modeakzente überhaupt zu erkennen. Sie sah bloß unfreiwillig komisch aus.
Nun blickte sie herüber, die hellen Augen aufmerksam wie selten. »Toller Schal«, sagte sie und wies auf Claudis Hals.
Na so was! Claudi zupfte überrascht das wunderschöne warmbraune Stück zurecht. »Danke.« Winzige türkisfarbene Wollfäden leuchteten darin. »Aus London.«
Marie atmete immer noch viel zu heftig.
»Du wirst jetzt nicht gleich hier auf der Stelle entbinden, oder? Das ist wirklich alles normal?«
»Ja.« Marie reckte ihr Kinn und atmete durch. »Ich setz mich da vorn in das Haus und warte auf euch.«
»Echt? – Also ich weiß nicht, ich finde, das sieht aus, als würden sie da drin kleine Kinder fressen. – Entschuldigung.« Das Gehöft – der Wilde Mann – war bestimmt historisch interessant, sonst hätten sie es kaum zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung erwählt. Doch Claudi fand es nur unappetitlich. In den Fensterkästen ankerten verwitterte Kunstblumen, der graue Putz war voller großer Wasserflecke, und der Schornstein stieß ganz erstaunliche Mengen Rauch aus.
Marie verzog gequält das Gesicht. »Es gibt ein Dach und drinnen wird sich ein Stuhl für eine hochschwangere Frau finden.«
»Blöd, dass die Jungs jetzt schon so weit sind«, sagte Claudi. »Bis ich die erreiche, kann es ewig dauern. Willst du wirklich die ganze Zeit allein dasitzen?«
»Ja«, erwiderte Marie sofort. »Einsam werde ich nicht sein«, fügte sie hinzu. »Da unten ist alles voll besetzt. «
Marie wollte sie loswerden, was Claudi sehr verständlich fand, umgekehrt wäre es ihr genauso ergangen. Doch sie spielte besorgt. »Es ist sicher besser, ich komme mit.« Als kleine Rache für den vielen überfreundlich verabreichten Traubenzucker. Und diese widerlichen Isodrinks. Und Müsliriegel. Und überhaupt all die guten Ratschläge. Für die heimlichen Blicke, wenn sie mal keine Wanderschuhe trug. Oder neue. Für diesen ganzen vernünftigen Scheiß, den Claudi einfach hasste.
»Ach bitte«, wehrte Marie ab. »Ich möchte dich nicht von unserer Tour abhalten.«
Claudi verschränkte die Arme. »Du willst mich nicht dabeihaben«, stellte sie nüchtern fest.
Marie blickte herüber, wieder mit diesen aufmerksamen Augen. »Aber das ist doch Blödsinn«, entgegnete sie lahm. Und blinzelte, als wäre Claudi eine Zeitung, die zu eng bedruckt war. Oder nein, keine Zeitung, dachte Claudi. Ein Werbeblatt. Für Marie wäre sie höchstens ein Werbeblatt.
»Wir können uns natürlich auch zusammen absetzen. Wie wär’s, Kakao trinken und Sahnetorte essen? Ich glaube, dort unten am Lokal stand so was auf der Tafel.« Marie gab sich einen sichtlichen Ruck. Sie lächelte sogar ein bisschen verschwörerisch. »Na los, komm. Wer will schon im Januarregen wandern? Wie sind wir überhaupt auf diese völlig irre Idee gekommen?«
Das war nun so entwaffnend hellsichtig, dass Claudi einen Moment ganz still stehen und die Gefährtin anstarren musste. »Aber das ist doch fantastisches Wanderwetter«, sagte sie endlich. Und setzte lahm hinzu: »Wir sind schließlich nicht aus Zucker.«
Claudi hatte nie vorgehabt, den Nachmittag mit Marie in einem schmutzigen Gasthof über kalorienreicher Hausmannskost zu verbringen, das wussten sie beide. Im Grunde stand es auch gar nicht zur Debatte, dass sich beide Frauen um die Wanderung drückten, eine zumindest musste den Männern hinterher und Bescheid geben. Welche von beiden das allein sein konnte, war ebenfalls klar. Doch die vielen Schnörkel, die nötig waren, um Claudi loszuwerden, stressten Marie mehr, als sie je zugegeben hätte. Erst als die Wanderfreundin endlich um die nächste Kehre verschwunden war, hörten Maries Wehen auf. Sofort. Eine Weile blickte sie noch auf den Weg und lauschte in ihren Körper, der sich nur langsam entspannte. Dann drehte sie sich um und stapfte auf das graue Waldlokal zu.
Das Tal war erfüllt von aufsteigendem Frost und alter Feuchtigkeit. Kalter Dunst lag über dem Boden, Eisränder umzackten die Pfützen, schmutzige Schneereste erhellten kleine Punkte weit oben am Hang. Keine Menschenseele weit und breit, die bunten Autoreihen vor dem Haus schimmerten unwirklich wie auf einem kolorierten Foto, nichts bewegte sich außer den Schweinen und dem Rauch, der stetig aus dem schmutzigen Schornstein quoll. Der Nieselregen drückte die Schwaden herab, sodass die schmale Wirtschaft sich langsam selbst mit ihren Ausdünstungen umhüllte. Es sah gespenstisch aus. Und plötzlich dachte Marie, dass der Hüftknochen weiter oben im Gehege vielleicht doch wie Menschengebein ausgesehen hatte.
Im Inneren des kleinen Hauses war es nicht wesentlich trockener als draußen, nur dass einem hier die Feuchtigkeit wie mit einem Spüllappen ins Gesicht geschlagen wurde. Der Raum war voll und lärmig, die Gesichter der Gäste gerötet, und überall lagen und hingen nasse Jacken herum. Es roch durchdringend nach säuerlicher Weinsoße. Marie setzte sich an einen Holztisch, auf dem noch ein kleines Weihnachtsgesteck stand, schälte sich aus ihrem rosa Anorak und bestellte einen Tee.
»Alles in Ordnung?«, fragte der dunkelhäutige junge Mann, der ihr die Tasse brachte, in barschem Ton. Er blickte auf ihren Bauch und musterte dann spöttisch die kissenartige Menge rosa Stoff über ihrer Stuhllehne.
»Danke, kein Problem«, erwiderte Marie mit einem Lächeln. Der Junge ging nicht darauf ein. Er wandte sich brüsk ab und verschwand hinter der Theke. Ernüchtert starrte Marie ihm hinterher. Eigentlich wollte sie mit jemandem reden und ihren exzentrischen Verdacht loswerden. Doch so saß sie nur stumm über ihrem Tee.
Es war still. Und dunkel. Die Wolken hingen tief; das ganze Waldstück bestand aus eng gepflanzten Nadelbäumen. Zu Claudis Linker fiel die Erde steil ab und verschwamm mit den feuchten Baumstämmen zu schweigender Finsternis. Rechterhand war es kaum heller, dort bildeten größere Felsbrocken Lücken in der Bepflanzung, doch es waren schmale, unwirtliche Lücken. Schwerfällig kroch das Wasser über die schwarzen Felsen, selbst die kleinen rotsandigen Stellen unter den Überhängen, die gewöhnlich fein und weich und trocken waren, hatten sich voll Feuchte gesogen und boten wohl keinem noch so winzigen Tierchen mehr Schutz.
Claudi war zum ersten Mal allein im Wald.
Die Erfahrung war eigenartig, etwa so, wie wenn man dreißig Jahre an der Küste gelebt hat und plötzlich feststellt, dass man gar nicht schwimmen kann. Allein war alles ganz anders. Da lag ein Lauschen über den Felsen und zwischen den Bäumen, ein feuchtes Rascheln, da wurde atemlos Luft angehalten, Quäntchen nur, kleine Häuche, angehalten von Mäusen und Spinnen und vielleicht einem Fuchs, aber man spürte das viele Innehalten rundherum. Und dass da Augen sein mussten, überall, hinter jedem Ast und jedem matschigen Pflänzchen und in jedem Loch, viele verborgene Augen, die ängstlich und gebannt den Tritten der jungen Frau folgten, bis deren große störende Füße endlich außer Sichtweite waren. Es war ein schwarzer, hässlicher kalter Wald, der sich eng um Claudi schloss und gleichzeitig riesig und weit wirkte, ein Labyrinth, ein Meer von Bäumen. Es gibt fast nichts, was so aufdringlich distanzlos ist wie ein Wald. Im Wald existiert nur das Innen.
Und der eine oder andere schmierig rote Fliegenpilz.
Eine gute Stunde verbrachte Marie auf ihrem unbequemen Stuhl im Wilden Mann. Langsam kündigte sich der Nachmittag an. Hinten in der Küche räumten zwei Frauen unter großem Geklapper die schmutzigen Teller vom Mittagessen in eine Spülmaschine. Erste Kaffees wurden bestellt. Der junge Mann, der bediente, vermied es nach wie vor, Marie anzusehen, so sorgfältig, dass sie Schwierigkeiten hatte, eine zweite Tasse Tee zu bekommen. Es liegt an mir selbst, dachte sie da auf einmal, ich muss abweisend wirken. Niemand in dem sonst übervollen Raum setzte sich zu ihr an den langen freien Tisch. Tatsächlich war ihr das aber inzwischen auch recht. Sie konnte nicht aufhören zu grübeln. Das Bild von dem Knochen in ihrem Kopf mochte einfach nicht verblassen. Es hatte sich festgesetzt, wie eine dieser kleinen, harmlos aussehenden Zeitungsmeldungen über Familiendramen in der Rubrik Vermischtes.
Der dunkelhäutige Junge hinter der Theke hatte nun einen Moment Ruhe. Er war sehr kräftig, stand massig mit verschränkten Armen da und schaute über den Raum. Marie nutzte die Gelegenheit. »Hallo!«, rief sie laut, setzte wieder ein freundliches Lächeln auf und hob die Hand, um ihn herzuwinken. Vielleicht brauchte sie einfach was Handfestes im Magen. Er jedoch sah schnell fort, griff nach einem Lappen und putzte an einem Zapfhahn herum.
Verdrossen sank Marie auf ihrem Stuhl zurück. Hatte dieser Kerl etwa ein Problem mit ihrem Bauch? War er verlegen, weil sie fruchtbar war? Oder ahnte er am Ende, dass sie ernsthaft über ihn und dieses Anwesen nachdachte? Durstig sah sie in ihre leere Tasse und überlegte weiter, wie wahrscheinlich es war, dass dort an dem Gehege, das jedes Wochenende von mehreren Hundert Leuten besucht wurde, öffentlich ein Menschenknochen zur Besichtigung auslag.
Ganz und gar nicht wahrscheinlich.
Andererseits: Das Teil hatte alt ausgesehen. Vielleicht rechnete niemand jetzt noch mit seinem Auftauchen. Vielleicht ging längst keiner mehr ängstlich jeden Tag die Zäune ab, um verräterische Spuren zu entfernen. Und ganz offensichtlich tat der Besitzer nur noch das, was zum Erhalt des Anwesens unbedingt nötig war. Genau so, dachte Marie, sah es hier nämlich aus. Wo würde also – kaum vorstellbar, aber doch möglich – am ehesten etwas übersehen werden? Welchen Weg benutzten die Betreiber der Anlage selbst am seltensten?
Den öffentlichen Wanderweg am Haus vorbei.
Oder?
Marie erhob sich. Jetzt sollte der junge Mann kommen, falls er seine Zeche wollte, andernfalls würde sie einfach gehen. Es ließ ihr keine Ruhe. Sie musste dieses Ding noch mal ansehen. Am besten ganz aus der Nähe. Es war bestimmt ein Schweineknochen. Und wenn nicht, dann –
Nun, dann würde sie weitersehen.
Es war ungefähr die fünfte bis zehnte Wegkreuzung, und da war auch eine Markierung, ein weißer Punkt an einem etwas versteckten Bäumchen, doch der nutzte Claudi nichts, denn sie wusste nicht, wohin er sie bringen würde. Ein dummer Fehler, ganz blöd, eigentlich eine Winzigkeit: Claudi hatte versäumt, sich unten am Gasthaus über die Route zu informieren. Dort waren Schilder an den Bäumen gewesen, das wusste sie, und eine öffentliche hölzerne Wanderkarte, und davon abgesehen auch Marie, die wahrscheinlich jede Markierung im gesamten Pfälzerwald kannte. Sie hätte nur Marie fragen müssen, welcher dieser Striche und Punkte und Kringel zur Hardenburg führte. Sie hätte einmal auf den Wegweiser schauen müssen.
Claudi zog ihr letztes frisches Tempo hervor und schnäuzte sich. Weshalb stürmte ihr bescheuerter wanderverrückter Gatte auch jedes Mal los, als sei dort oben am Ziel ein Preis zu holen. Wieso hatte nicht wenigstens Tommy aus Rücksicht auf seine hochschwangere Frau ein bisschen warten können.
Warum hatte sie bloß ihr Handy im Auto vergessen?
Sie blinzelte über ihr Taschentuch, es war das hellste Ding weit und breit, heller noch als der schmutzig weiße Punkt an dem kleinen Baum. Ansonsten gab es nur schweigenden grauen Wald und schweigenden grauen Himmel und die Geräusche, die das Wasser beim Fallen und Rinnen und Durchdringen machte. Da war kein Rascheln mehr und kein Wolfsschatten hinter den Felsen. Sie fühlte sich nicht länger beobachtet. Was sie spürte, war nur noch Verlassenheit. Und die war echt schlimm. Wenn da nichts war, nicht einmal ein böser Wille, wozu sollte sie dann weitergehen?
Und wohin? Wie konnte dieser verdammte Wald nur so menschenleer sein? Wo doch dort unten auf dem Wanderparkplatz selbst die Pfützen und Grasnarben belegt waren? Was war denn mit den ganzen Bikern und Nordic Walkern, wo steckten die, wenn man sie einmal brauchte?
Claudi hatte jetzt richtig Angst. Die Nacht, das spürte sie deutlich, war nicht mehr weit. Die Bäume rückten näher zusammen und die Kälte zog an. Sie steckte das Taschentuch weg. Sie brauchte einen Plan.
Anfangs war sie etwas zynisch der Maßgabe gefolgt, dass der Weg, je unbequemer er aussah und je steiler er nach oben führte, desto richtiger sein musste, gewöhnlich konnte man bei ihren Touren damit nicht falsch liegen. Aber irgendwo hatte sie eben doch den falschen Abzweig erwischt. Das merkte sie, als die verschiedenen Markierungen ausblieben, der Weg breit und befahrbar wurde und sachte abwärts führte. Daraufhin hatte Claudi versucht zurückzufinden, was ihr nicht gelungen war, dann war sie ein wenig herumgeirrt und endlich einem Wirtschaftsweg gefolgt, der fast keine Steigung hatte und sich in weiten Zügen um die Ausläufer der Berge wand. So war sie eine ganze Weile gegangen, eine Stunde vielleicht oder zwei, ihre Uhr hatte Claudi natürlich auch nicht dabei. Sie wusste aber eins: dass sie wegmusste von dieser hübschen, geschotterten kleinen Straße, die einfach nicht aufhörte. Denn solche Fahrwege, das hatten die anderen ihr mehrfach erklärt, waren manchmal Sackgassen, sie wirkten einladend und bequem, dienten aber nur der Holzwirtschaft und brachten einen schlimmstenfalls mitten in die Wildnis, um dort plötzlich einfach zu enden.
Was sie brauchte, das war ein kleiner Stich, ein markiertes Pfädchen, das sie sicher runter ins Tal geleitete. Je schmaler der Weg, desto eher führte er zu einem nahen Ziel. Und wenn es dann noch abwärts ging, kam man fast automatisch zu einem Parkplatz, einer Hütte oder sonst einem Vorposten der Zivilisation.
Nun stand aber kein kleiner Pfad zur Auswahl, sondern nur Claudis breit ausgefahrener Wirtschaftsweg und dann dieser andere mit dem weißen Punkt. Der war nur wenig schmaler und besaß ebenfalls keine Steigung, die bei der Entscheidung hätte helfen können. Er führte aus einem dunklen Fichtengehölz in einen etwas lichteren Buchenwald, und genau dort war das Zeichen, an einem kleinen, aber knorrigen Baum, es war sorgfältig genug aufgemalt, um als Wandermarkierung durchzugehen, aber andererseits auch schon sehr verblichen. Claudi dachte kurz daran, eine Münze zu werfen. Dann ließ sie es bleiben. Aberglaube brachte sie auch nicht weiter.
Zögerlich, doch überzeugt, das einzig Vernünftige zu tun, verließ Claudi die Schotterstraße und folgte jener uralten Wandermarkierung, einem elenden fahlen Stern.
Um die Tür zur Gaststube hing ein roter Filzvorhang, der so alt und steif war, dass man sich unwillkürlich fragte, ob er eventuell schon vor dem Haus da gewesen war. Als dieser Vorhang nun ganz besonders energisch nach vorn gestoßen wurde, wusste Marie, die längst wieder im Warmen saß: Dies konnte nur Norbert sein. Und da schimmerte es auch schon gelb von der Wanderkluft, und ein tropfender, breitbeiniger Norbert mit entsetzlich gefurchter Stirn stand mitten in der Stube. Er warf ihr einen kurzen, schwer deutbaren Blick zu und rief nach hinten: »Da sind sie.«
Dann kam er auf Marie zu, füllte sofort den Raum mit seinem Neongelb und seiner Regennässe und seinen Schultern und der frischen Luft, die er mitbrachte, und den Funken, die er schlug. Das Lokal wirkte gleich um einiges kleiner. »Herrgott, Marie!«, polterte er los. »Wo wart ihr denn?!«
»Ihr seid auch ganz schön losgerannt«, erwiderte sie. »Ich bin schwanger, da kann man nicht so schnell.«
»Seid ihr umgekehrt?«, fragte Norbert unwirsch. »Wo?!«
Tommy schob sich hinter ihm ins Blickfeld. Er triefte ebenfalls. Und wirkte mitgenommen. »Schatz.« Er küsste sie aufatmend. »Da bist du ja. Ihr hättet Bescheid sagen müssen. Wir haben uns Sorgen gemacht.«
»Wir sind drei Mal die ganze Strecke rauf und runter«, präzisierte Norbert grimmig. »Und wir haben ungefähr hundert Mal auf Claudis Handy angerufen, und vier, fünf Mal hatten wir auch Empfang, aber da seid ihr nicht drangegangen.«
Marie schüttelte den Kopf, ihr ging das alles zu fix. »Wieso wir?«, fragte sie.
Dass es dunkel wurde, und zwar schnell, steigerte Claudis Angst beträchtlich. Es wurde immer schwieriger, sie niederzukämpfen. Claudi weinte. Es war entsetzlich kalt, und sie war überall nass, selbst die Lederjacke gab langsam nach. Am unangenehmsten aber waren ihre tropfenden Haare, die fielen ihr ständig in die Augen, sodass sie kaum die Lider heben konnte. Claudis Blickfeld beschränkte sich auf das kleine Stück Weg direkt vor ihren Füßen, und wenn es irgendwo noch mehr weiße Punkte an den Bäumen längs dieses Pfades gab, dann hatte sie die jedenfalls nicht gesehen. Tatsächlich war es ein Glück, dass da überhaupt noch ein Weg war, denn zuweilen schien der Pfad sich einfach aufzulösen. Er war breit, aber ziemlich verwachsen und offenbar selten begangen. Bergab führte er auch nicht. Und nun begann sie außerdem noch zu rutschen. In dem feuchten Laub, das ihr unter den Füßen gefror, bildeten sich kleine, gemeine Eisnester. Die Hoffnung, zufällig einem anderen Menschen zu begegnen, ob Wanderer, Biker, Walker oder Jäger, hatte sie begraben. Blieb nur, dass die anderen sie suchen kamen. Norbert. Claudi dachte an Norbert. Ihr Herz. Es war verrückt, sie konnte doch hier nicht einfach so verrecken, höchstens zwanzig Kilometer zur nächsten Ortschaft und fünf zur nächsten Straße, es musste einen Ausweg geben.
Und den sah Claudi dann auch. Zuerst meinte sie, es sei eine Halluzination. Sie erschrak. Als sie genauer hinsah, erkannte sie in fast unmittelbarer Nähe eine Mauer vor sich. Eine ziemlich hohe und lange Mauer. Sie gehörte nicht zu einer Wanderhütte oder einem Wasserwerk oder was es sonst im Wald an Unbewohntem gab. Obenauf meinte sie ein kleines Dach wahrzunehmen. Ohne auch nur einen Gedanken an eine Münze oder den Weg zu verschwenden, den sie gerade verließ, bog Claudi in das Gehölz zu ihrer Seite und stolperte bergwärts, dem Gebäude zu.
Die Steine fühlten sich rau und feucht und kühl an, da war so wenig Wärme, dass Claudi schon wieder daran zweifelte, dass sie das Richtige tat, aber Weglaufen ging natürlich erst recht nicht, diese Steine waren die Rettung. Hier war ein Außen, zu dem es ein Innen geben musste, und wenn sie drinnen war, dann wäre sie im Trockenen und in Sicherheit. Sie folgte der Mauer, stieß an eine Gebäudekante, quälte sich durch einen Busch, nur um in der finsteren Dämmerung nicht den Kontakt zu dem Bauwerk zu verlieren, und gelangte schließlich zu einem Zaun. Nein, einem Tor. Ein hohes Tor aus Brettern, mit Maschendraht bespannt, und dahinter lag ein Gehöft, ein kleines Haus mit Nebengebäuden mitten im Wald. Zwischen den einzelnen Bauten befand sich ein offener Hof, dessen Pflaster sich einladend von der nassen Trübnis des Waldes abhob. Mondbeschienen konnte man es nicht nennen, aber überschaubar. Claudi steckte ihre Finger durch die eisigen Drahtmaschen und sagte: »Hallo!« Das klang aber so kläglich und fremd, dass sie nicht weiter versuchte, jemanden anzurufen, der da ganz offensichtlich nicht war: Der Hof lag so verlassen, wie es irgend ging, da stand kein Auto, da brannte kein Licht, die meisten Läden waren zugeklappt und die wenigen sichtbaren Fenster starrten sie blind und schwarz an. Bei Tageslicht war es sicher ein freundliches Haus. Es hatte etwas Sommerliches, die Formen waren angenehm, das Dach niedrig, Türen und Fenster in Sandstein eingefasst, man konnte sich vorstellen, wie Wanderer sich hier erfrischten. Claudi stieg über das Tor. Sie war nicht sehr geschickt, dafür aber leicht, daher konnte sie das wackelige Hindernis mit einiger Mühe überwinden. Dann stand sie im Hof, betrachtete die dunklen Scheunen zur Linken, hörte ein Rascheln und grauste sich. Da unter den schwarzen Dächern standen komische dunkle Sachen, denen sie nicht zu nahe kommen wollte. Sie beschloss, sich rechterhand an das Haupthaus mit dem kleinen Altan zu halten, dort vorn waren Fenster mit geöffneten Läden, eins davon konnte sie zur Not einschlagen. Allerdings erwiesen sich die Sandsteinreliefs um die Tür, die von unten nur dunkel ausgesehen hatten, bei direkter Anschauung als lebensgroße menschliche Figuren. Es sah furchterregend aus. Claudi atmete durch. Sie wagte einen Blick auf die Tür. Da musste sie jetzt rein. Ein Kauz schrie, eher unterdrückt, um nicht zu sagen: gurgelnd, abgesoffen, etwas bewegte sich, sie fuhr herum: nichts. Wenn es hier nur keinen Hund gab! Ein heftiger, plötzlicher Fluchtreflex packte sie, weg, nur fort von diesem schaurigen Platz! Die tropfende Klinke der Tür drückte sie aber noch herab. Und die gab nach.
Dahinter war natürlich alles schwarz. Claudi stieß das Holzblatt mit dem Fuß an und entdeckte etwas, das ihr fast den Glauben an das Gute wiedergab: Dort stand auf dem Boden direkt neben der Tür eine große Maglite. Eine dicke, fette Taschenlampe.
Das Innere des Hauses war auch beklemmend, aber längst nicht so sehr wie der Wald draußen. Das erste Zimmer schien unbewohnt. Es war feucht und dreckig. Bis auf eine alte Leiter, einen Bierkasten mit leeren Flaschen, ein paar schmutzige Eimer und etwas Plunder und Laub in den Ecken war nichts darin. Nur ein dickes rotkariertes Flanellhemd, das nicht sonderlich gut roch, hing über die Leiter geworfen und erschien Claudi wie ein Geschenk des Himmels. Sie rieb sich Haare und Gesicht damit trocken und zog ihre quietschnasse Lederjacke aus. In dem Hemd waren sogar ein steinaltes zerdrücktes Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug, und Claudi zündete sich sofort und gänzlich automatisch eine Zigarette an, obwohl sie schon seit über zehn Jahren nicht mehr geraucht hatte, damals war sie noch ein Teenager gewesen. Es schmeckte verdammt gut. Und war irgendwie warm. Sie rieb sich die klammen Hände, legte das Hemd um und betrat einen kleineren Raum, in dem ein altertümlicher Kochherd stand. Das war wohl mal die Küche gewesen. Ein Ofen, jubilierte sie innerlich. Sie untersuchte das vorsintflutliche Ding. Die große Kochplatte obenauf war reichlich verbogen. Mehrere metallene Einsätze saßen schief und wackelig darin, aber sie wollte ja nicht kochen. Direkt neben dem Herd stand ein Stuhl, ein morscher, den konnte sie verfeuern, wenn es sonst nichts gab. Sie öffnete das Feuerloch und leuchtete hinein. Die Steine, die den Herd innen auskleideten, waren allesamt geborsten, doch immerhin roch der Ofen durchdringend nach feuchter Asche, allzu lang konnte der letzte Betrieb also nicht her sein. Auf dem Rost lag etwas verkohltes Zeug. Sie suchte die gesamte Apparatur ab, wobei sie die große Klappe für das Backrohr kaum aufbekam, so sehr war sie verzogen. Doch nirgendwo waren Holz oder Kohle zu finden. Claudi klapperte mit den Zähnen. Sie fror entsetzlich in ihren nassen Klamotten. Sie brauchte Feuer. Entschlossen ergriff sie den Stuhl und knallte ihn kräftig gegen die Wand. Er zerbarst laut. Einen Moment hielt sie die Luft an und erwartete – nun ja, irgendwas, dass das Haus einstürzte, dass ein Höllenhund sie schnappte, dass ein Geist durch die Wand kam. Dann beruhigte sie sich wieder und pflückte die Reste des Möbels auf, um sie weiter zu zerbrechen. Vorsichtig schichtete sie ein Häufchen Kleinholz in das Feuerloch, doch es war kalt und feucht und brannte nicht. Sie zerriss das Zigarettenpäckchen und stopfte das Papier unters Holz, das aber war zu wenig, oder sie war zu ungeschickt, jedenfalls verglühte es, ohne das Holz anzubrennen. Das Feuerzeug war auch nicht mehr gerade voll, es spuckte hauptsächlich Funken. Sie rauchte noch eine Zigarette (zumindest die brannte) und ging ins vordere Zimmer, um dort ein bisschen zu suchen, denn sie wusste, dass sie viel mehr Zunder brauchte, um die mangelnde Erfahrung im Feuermachen auszugleichen. Leider, leider hatte sie keine Handtasche mitgenommen. An Brennbarem besaß sie nur ein Taschentuch, drei Zigaretten, etwas feuchtes Papier, das auf dem Fußboden gelegen hatte, und dann noch ihren schönen Schal, der war dünn und leicht zu reißen und noch einigermaßen trocken, zumindest an der einen Stelle, die an ihrer Kehle gesessen hatte. Ihn aber wollte sie nur zur größten Not opfern. Vielleicht befand sich ja auf dem Feuerrost oder im Aschekasten noch ein Rest trockener Kohle.
Mit diesem Gedanken ging sie zurück in die Küche und räumte das Feuerloch wieder aus. Angeekelt fischte sie in der undefinierbaren schwarzen Masse auf dem Rost herum. Kohle fand sie dabei nicht, zumindest keine trockene. Nur ein langes, schwarzes, biegsames Ding, das sich kühl anfühlte. Sie legte es beiseite. Anschließend untersuchte sie den Aschekasten. Er saß fest in dem verzogenen Ofen und konnte keinen Millimeter mehr herausgezogen werden. Doch es schien etwas darin zu liegen, und daher fasste Claudi sich ein Herz, nahm den Rost heraus und krempelte ihren ohnehin schon schmutzigen Ärmel hoch, um mit der bloßen Rechten von oben in den Kasten hineinzugreifen. Sie bekam ein paar feste Stücke zu fassen, sie waren schwarz und sehr hart, das war wohl Kohle, die durch den Rost gefallen war. Ob so etwas gleich brannte? Sie musste es hoffen. Sorgfältig tastete sie in alle Ecken und fischte heraus, was da war. Schließlich hockte sie sich auf den Fußboden vor den Ofen und breitete ihre magere Beute vor sich aus. Da waren das Tempo, die Zigaretten, das Fitzelchen Zeitungspapier und sieben Stückchen Kohle. Nein, sechs. Eins der Stücke war zwar hart und schwarz, doch es hatte eine merkwürdige Form, an einer Seite zumindest, da war es gebogen wie – ja, wie ein Ring. Sie nahm das Ding, leuchtete es mit der Maglite an und rieb mit ihrem schönen Schal ein bisschen daran herum, auf ein bisschen Asche kam es nun auch nicht mehr an. Plötzlich glänzte es golden in ihrer Hand.
Ein halber Ring, tatsächlich.
Claudi spürte den kalten Boden unter ihrem Hintern und merkte, dass sie sich hingesetzt hatte. Was war das für ein seltsamer Fund? Das Material war echtes Gold, davon war sie überzeugt, andernfalls hätte es nicht so hübsch geglänzt, nicht nach einer längeren Lagerung in diesem feuchten Aschekasten. Die eine Seite war vermutlich in große Hitze geraten, denn von dem Goldreif war nur noch ein c-förmiges Stück übrig, und die offenen Stellen waren klumpig und spröde und nicht ganz blank zu reiben, die runde Seite jedoch war eindeutig ein Ring. Ein Herrenring, schätzte Claudi anhand der Größe. Ein Ehering. Mit ihren schmutzigen Fingern rieb sie daran herum, um etwa eine Gravur zu finden, und tatsächlich: Da war eine kleine undeutliche 555 und nebendran ein paar Zeichen. Die Claudi allerdings nicht lesen konnte. Sie waren griechisch. Oder kyrillisch. Oder einfach verzogen. Etwas Kaltes griff nach ihrem Herzen. Dieser Ring war vermutlich zufällig durch den Rost gefallen. Er hatte hier vernichtet werden sollen. In einem Feuer, das so heiß war, dass Gold verbrannte und der Ofen sich verbog. Claudi klapperte mit den Zähnen. Geh weg hier, sagte plötzlich eine eindringliche innere Stimme, die sie an ihre Oma erinnerte, obwohl die lange tot war. Weg hier, Claudi. Es ist schmutzig da.
Claudi blieb. Es ging nicht anders, draußen war der Wald. Entschlossen riss sie von ihrem ohnehin ruinierten Schal ein Stück ab, das trockenste, stopfte es mit dem Holz in den Ofen, zündete es an, und es brannte.
Als sie endlich erschöpft neben dem langsam wärmer werdenden Herd hockte und in Riesengeschwindigkeit die Einzelteile des Stuhls verfeuerte, da leuchtete sie irgendwann wieder den merkwürdig verformten Ring an und gruselte sich. Nach einer Weile fiel ihr dann das biegsame Teil wieder ein, das sie vom Rost geklaubt hatte, und sie betrachtete auch das. Es war ein Reißverschluss. Was Claudi noch mehr beunruhigte. Ein Reißverschluss bedeutete, dass irgendwer hier Klamotten verbrannt hatte. Doch wieso? Ein Stück Wolle, das gut glomm, okay, das verstand sie, hatte sie ja auch gemacht, aber ein Kleidungsstück mit Reißverschluss? Eine Hose?
Weiter aber kam sie nicht mit ihren Folgerungen, jedenfalls nicht sofort. Denn in dem Moment hörte sie draußen das verheißungsvolle Geräusch eines sich nähernden Autos und sah einen Lichtschein und hörte eine Tür klappen und vernahm ein langes Quietschen und Schritte und jemand rief ihren Namen. Claudi sprang auf. Ihr fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen. Endlich. Das war die Suchmannschaft.
Sie war gefunden.
* * *
Am Abend des vierzehnten Januar, einem Tag, der so dunkel und kalt gewesen war, dass ein neuer Sommer gänzlich unwahrscheinlich schien, erhielt Kriminalkommissarin Boll einen merkwürdigen Anruf.
»Ist da Boll? Barbara Boll?«, fragte eine unbekannte Frauenstimme.
»Nein, Bettina Boll am Apparat. Wer spricht denn?«
»Oh. – Dr. Glaser. Aber ich bin doch richtig, oder, es gibt bei Ihnen eine Barbara?«
Bettina blickte zum Fernseher, sie war eben im Begriff gewesen, Casablanca anzuschauen und sich mit Rotwein volllaufen zu lassen, die Flasche stand bereits geöffnet auf dem Couchtisch, auf dem Bildschirm zitterte ein ziemlich unelegantes Standbild von Ingrid Bergmann, die Augen halb geschlossen, die Nasenflügel gebläht.
»Hallo?«, sagte der Hörer.
»Tut mir leid«, antwortete Bettina und drückte auf die Off-Taste der Fernbedienung, »Barbara ist nicht da.«
»Könnten Sie –«
Bettina holte tief Luft und die Anruferin verstummte. Eigentlich mussten es doch alle wissen. Sie hatte es in der Zeitung annonciert und außerdem jedem, wirklich jedem alten Bekannten von Barba persönlich mitgeteilt, um von solchen Anrufen verschont zu bleiben. »Sie lebt nicht mehr.«
»Oh«, machte es am anderen Ende verwirrt. »Ach Gott, ich – das tut mir leid. Aufrichtig leid. – Wie ...?«
»Krebs«, sagte Bettina.
»Ach herrje.«
»Ja.«
»Verzeihen Sie. Ich habe Sie gestört. – Wann – wann –«
»Im vorletzten Sommer«, sagte Bettina, griff mit der freien linken Hand nach der Weinflasche und goss sich ihr Glas voll. Aus diesem Abend würde eh nichts mehr werden, da konnte sie genauso gut mit einer alten Freundin ihrer Schwester schmerzhafte Erinnerungen austauschen. Zur größten Not hatte sie noch Barbas Whiskey im Schrank. »Woher kannten Sie Barbara?«
»Ich – also wissen Sie, falls es Ihnen gerade jetzt nicht passt, ich –«
»Doch, es passt mir ausgezeichnet«, sagte Bettina etwas spitz. Sie schwenkte ihr Glas und prostete der unbekannten Gesprächspartnerin damit zu. Du hast angerufen, Schätzchen. Du wirst jetzt mit mir reden.
»Barbara – sie war damals Sprechstundenhilfe in der Praxis bei Dr. Mock. Der Kardiologe, wissen Sie. In Mundenheim. Ich war dort auch angestellt. Meine erste Ärztinnenstelle. Lieber Himmel! Barbara war doch so – so lebendig! Und war sie nicht schwanger?«
»Ja. Die Kinder hab jetzt ich.« Bettina zündete sich eine Zigarette an. Vielleicht war dieses Gespräch doch keine gute Idee. Eine kleine Pause entstand.
Dann sagte die Anruferin plötzlich in einem etwas anderen, geschäftsmäßigeren Ton: »Hören Sie, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, und ich habe vollstes Verständnis, wenn Sie mich aufdringlich finden und einfach auflegen – aber sind Sie vielleicht zufällig Barbaras Schwester? Die Polizistin?«
»In der Tat«, sagte Bettina überrascht und fast gerührt. Sollte Barba sie tatsächlich bei ihren Kollegen erwähnt haben? Und so ausführlich, dass die sich nach Jahren noch daran erinnerten?
»Es ist nämlich so, eigentlich wollte ich Sie sprechen. Nun finde ich es aber selbst unverschämt, Sie privat zu stören, gerade, wo doch Barbara –«
»Na, jetzt können Sie’s auch nicht mehr ändern«, sagte Bettina fast ein wenig schnippisch und hatte sofort ein mieses Gefühl.
»Tja. Ich möchte Sie wirklich nicht –«
»Sagen Sie schon. Was wollten Sie wissen?«
»Also«, das kam sehr zögerlich, »es ist, weil – Sie sind doch noch Polizistin, oder?«
»Ja.«
»Und was – bearbeiten Sie so, wenn ich fragen darf?«
»Kapitalverbrechen«, antwortete Bettina ruhig. Und hörte, wie ihre Gesprächspartnerin am anderen Ende der Leitung Luft ausstieß. Erleichtert, wie es schien. Was Bettina vage alarmierte. Sie stellte ihr Glas hin, paffte schnell an ihrer Zigarette, legte auch die fort und griff neben sich in die Schale mit dem Krimskrams. Da musste noch irgendwo ein Kuli sein. Und ein Block.
»Das passt ausgezeichnet«, sagte die Anruferin entschlossen, fast übertrieben, als müsste sie sich selbst überzeugen. Ihre Stimme war weich, registrierte Bettina, und sie klang gebildet und freundlich und sehr jung. Doch die Frau musste mindestens Mitte dreißig sein, wenn sie schon als Ärztin gearbeitet hatte, als Barba noch bei Dr. Mock gewesen war.
»Wissen Sie, es ist makaber und sogar irgendwie albern. Vor allem gerade jetzt, wo ...«
»Könnten Sie mir noch mal Ihren Namen sagen?«, bat Bettina.
Wieder entstand eine Pause. Dann sagte die Frau sachlich: »Natürlich. Dr. Marie Glaser.«
Bettina schrieb den Namen auf. »Was ist also passiert, Frau Dr. Glaser?« Auf der Dienststelle hatte Bettina gelernt, dieser Frage einen bestimmten Ton zu verleihen, freundlich, knapp, aber nicht übermäßig interessiert. Um von vornherein klarzustellen, dass man keine kompletten Lebensbeichten samt schlimmer Kindheit und verpfuschten Ehen abzunehmen gedachte. An diesem Abend in ihrem Wohnzimmer fiel es ihr allerdings nicht ganz so leicht. Weil die Anruferin sie wieder an die lustigen alten Zeiten mit ihrer Schwester erinnert hatte.
»Tja, wissen Sie«, sagte Dr. Glaser nun mit ihrer weichen Stimme, die sich so anhörte, wie Barba ausgesehen hatte, lebensfroh und mit diesem winzigen Schlag ins Alberne, der Bettina damals bei ihrer Schwester rasend gemacht hatte und sie jetzt umso schlimmer traf, »es ist so: Wir hatten schon einige Tage mit Ihren Kollegen zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie da informiert sind, aber es stand auch in der Zeitung: die vermisste Claudia Kirchheimer.«
»Oh«, machte Bettina. »Ja, hab ich mitbekommen. Bei Bad Dürkheim im Wald, nicht? Oberhalb der Hardenburg. – Die Suche musste erfolglos abgebrochen werden.«
»Claudi war meine Freundin.« Das hörte sich hart und fest an. Und endgültig. Die Vergangenheitsform ging der Frau ziemlich leicht über die Lippen. Bettina war sehr hellhörig und kritzelte wild Pfeile auf ihren Block. »Ihre Freundin, sagen Sie? Gehören Sie zu der Wandergruppe, der Frau Kirchheimer verloren ging?«
»Ja.«
»Aha.« Bettina bemühte sich um den sachlichsten Tonfall, den sie draufhatte. »Frau Dr. Glaser, gibt es denn etwas, das Sie den Kollegen vor Ort nicht erzählt haben?«
Eine Pause entstand. Bettina war inzwischen auf alles gefasst. Beichte, Zusammenbruch, wilde haltlose Selbstanklagen, unwichtige Details. Es gab kaum etwas, das die Angehörigen mehr aufwühlte als ein Vermisstenfall. Doch was jetzt kam, hatte sie nicht erwartet.
Dr. Glaser räusperte sich. »Na, so kann man das nicht sagen. Mit Claudia hat es eigentlich nichts zu tun. Das ist es ja. Ich habe etwas gefunden, das, ja, bizarr ist, und ich konnte damit nicht mitten in diese Suche platzen, verstehen Sie, da sind Menschen, die verzweifelt sind. Die hätten das mitbekommen und geschmacklos gefunden. Claudis Familie. Leute, die trauern. Denn, ich meine, wir haben Minusgrade und Claudi ist jetzt schon eine Woche fort.«
»Okay«, sagte Bettina und nahm wieder ihr Glas zur Hand. »Sie haben etwas Bizarres entdeckt, und möchten damit nicht die Familie einer Vermissten behelligen. – Oder die Kollegen, die den Fall bearbeiten«, fügte sie hinzu und machte eine kleine Pause. Dr. Glaser ging auf die unausgesprochene Frage nicht ein. »Aber es scheint doch ernst zu sein, sonst hätten Sie mich nicht ausgegraben, so mitten in der Nacht.«
»Ihre Kollegen«, sagte Dr. Glaser fein, »sind sehr bemüht um effiziente Arbeit.«
»Mit wem haben Sie denn gesprochen?«
»Schwanck hieß der eine, glaube ich.«
»Dr. Schwanck.« Ein lehrerhafter Typ, dem Bettina höchstens mal im Flur über den Weg gelaufen war. Sein Spezialgebiet waren Vermisstenfälle, denn er besaß außerordentlich gute Geographiekenntnisse.
»Wissen Sie«, Dr. Glaser holte Luft, »ich möchte nicht sagen, dass man gerade Ihnen mit kruden Vermutungen kommen könnte, im Gegensatz zu Ihren Kollegen, wirklich nicht, aber Sie sind Barbaras Schwester. Und wenn Sie nur einen Funken Ähnlichkeit besitzen –«
»Ich bin die Vernünftige in der Familie«, unterbrach Bettina. »Und genauso Polizistin wie Dr. Schwanck.«
»Schon«, sagte Dr. Glaser unbeirrt. »Aber Sie sind auch eine Frau.«
* * *
»Pünktlich, Bolle«, rief Willenbacher am nächsten Morgen mit einem Blick aufs Handgelenk. Er stand am Kaffeeautomaten im Gang der Dienststelle, direkt neben dem Kollegen Ackermann. Der klimperte mit Kleingeld. »Noch einen Kaffee vorher? Du hast ja alle Zeit der Welt.«
Bettina wand sich aus ihrem Schal. »Ich bin doch pünktlich. Genau halb neun.«
»Mach«, sagte Ackermann. »Er ist heute nicht gut drauf.« Und grinste Willenbacher zu.
»Hat seinen Frauenhassertag«, ergänzte der. Er war so was wie Bettinas inoffizieller Partner und von etwas geringerer Körpergröße als sie. Neuerdings trug er die Haare recht kurz. Die grelle lila und gelbe Farbe seines Norwegerpullis vertrug sein Teint nicht allzu gut. Aber Willenbacher stand eben auf kräftige Töne.
»Danke«, sagte Bettina. »Danke, Jungs. Baut mich doch auf.«
Sie zog auch noch die Jacke aus. Da gab der schrankhohe Automat an der Wand ein hässliches Geräusch von sich und spuckte den Kaffee an Willenbachers Tasse vorbei auf den Fußboden. Bettina grinste. Die Resopalwände des Geräts vibrierten boshaft. Es war ein echter Oldtimer, massig, brummend, mit allen möglichen vielversprechenden Tasten, sogar für Bouillon. Jeder hatte Respekt vor dem Ding. Es hatte schlechte Tage, aber sein Timing stimmte.
»Fängt das wieder an.« Ackermann wandte sich ab.
»Ich hab’s mir überlegt«, sagte Bettina, während sie den Schal in den Jackenärmel stopfte. »Ich will doch nichts trinken.«
»Warte nur«, sagte Willenbacher. »Ich kenn das Baby.« Er versetzte dem Automaten einen kräftigen Schlag auf die Seite und dann einen Tritt. Tatsächlich wackelte nun die ganze vorsintflutliche Apparatur, irgendetwas in ihrem Inneren stöhnte auf, und dann fiel Willenbachers Tasse aus dem Ausgabeschacht und zerbrach.
Es war seine grüne Tasse. Mit den roten Punkten, dickwandig und hoch, ein Geschenk seiner Freundin Annette. Niemand im Büro kannte ihn ohne diese Tasse. Fassungslos starrte Bettinas Kollege die Scherben an.
»Das Baby kennt dich aber auch ganz gut«, bemerkte Ackermann über die Schulter.
Bettina drückte dem unglücklichen Willenbacher ihre Jacke in die Arme. »Da. Ich hab’s eilig.«
»Du kochst, Will«, hörte sie Ackermann noch befehlen. »Ihr seid dran. Ich hab eigentlich längst Urlaub.«
Und dann war sie schon beim Chef.
Es dauerte nicht allzu lange bei Hauptkommissar Härting. Bettina hatte nämlich gute Nachrichten, für den Hauptkommissar zumindest: »Ich möchte beruflich etwas kürzertreten. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen.«
Härting, der sich mit einer leicht angegilbten Akte, vermutlich Bettina zu Ehren aus dem nächstbesten Ordner gezogen, weit hinter seinem Schreibtisch verschanzt hatte, blickte überrascht auf. »Endlich nehmen Sie Vernunft an«, sagte er. Erleichterung schwang in seiner Stimme mit.
Was hast du denn geglaubt, was ich will, dachte Bettina. Eine Beförderung? Verdient hätte sie die längst. Es mangelte ihr nur an generellem Wohlverhalten.
»Sie haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten«, hub Härting nun an, saß da mit seinem grauen Gesicht über seinem steifen Anzug hinter dem Schreibtisch und hielt immer noch die einsame Akte hoch, aus dem Fall Lohmeier, erkannte Bettina, der war schon fünfzehn Jahre alt. »Mit dem Tod Ihrer Schwester. So etwas muss man auch erst mal verkraften.« Härtings Polizistenaugen blickten trotz seines ungewohnt freundlichen Tons kalt und aufmerksam wie immer. Dieses ausdruckslose Lauern, das konnte man vielleicht irgendwann einfach nicht mehr ablegen. Sicher betrachteten einige altgediente Kollegen auch zu Hause ihre Familien so. Vermutlich wurden darum so viele Polizistenehen geschieden. Und eines Tages würde Bettina womöglich selbst so gucken.
»Wobei wir alle hier die größte Hochachtung vor Ihrem Schritt haben, Frau Boll. Sie haben vorbildlich die Verantwortung für zwei Waisen übernommen. In einer Zeit, die für Sie ohnehin nicht gerade leicht war.«
Bettina betrachtete ihre spitzen Knie in den abgeschabten Jeans und bekam ungeheure Lust auf eine Zigarette.
»Sie haben sich einfach zu viel zugemutet. Manchmal merkt man das selbst nicht.«
»Missverstehen Sie mich nicht«, sagte Bettina da schnell in Härtings Atempause. »Ich habe nicht gekündigt. Keineswegs. Ich möchte weiter arbeiten, und ich muss das auch, denn ich habe eine Familie zu ernähren.«
Härting starrte sie an, ließ die Lohmeier’sche Akte sinken und seufzte kaum hörbar.
»Und ich will hier bei Ihnen im K11 bleiben«, fuhr Bettina fort, um auch das zu klären. »Das ist die Arbeit, die ich am besten kann.«
»Sie haben eine gewisse Spürnase«, gab Härting widerwillig zu.
»Danke«, sagte Bettina überrascht.
Der Chef schoss einen schnellen Blick auf sie ab. »Aber wie stellen Sie sich das vor?«, fragte er unwirsch. »Wollen Sie halbtags Kapitalverbrechen aufklären? Von neun bis zwölf? Und dann heim zu den Kindern? Ist das Ihr Vorschlag?«
Tatsächlich stellte Bettina es sich ungefähr so vor. Aber das Härting gegenüber in Worte zu fassen, war wieder eine andere Sache, obwohl sie zu Hause vor dem Spiegel redlich geübt hatte.
Der Hauptkommissar war inzwischen wieder in seinem Fahrwasser: »Ich brauche Ihnen doch nicht zu erklären, Frau Boll, wie unsere Einsätze aussehen. Und was für ein Einzugsgebiet wir haben. Nehmen wir an, Sie haben fünf fixe Stunden pro Tag und wir kriegen einen Fall irgendwo an der französischen Grenze, da brauchen Sie sich erst gar nicht ins Auto zu setzen.«
»Andererseits«, sagte Bettina rasch, »sind wir ein Team. Keine Einzelgänger, die ihre Fälle ganz alleine lösen. Nicht wie im Fernsehen.« Sie blickte ihren Vorgesetzten an, ohne rot zu werden.
Der betrachtete sie stirnrunzelnd. »Frau Boll. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Wir beide, Sie und ich, wir wissen doch genau, was mit Ihnen los ist.«
Bettina starrte ihren Chef an. »Ach ja?«
»Sie sind eine talentierte junge Beamtin, aber in der Schreibstube sind Sie fehl am Platz. Ihre Aktenführung ist miserabel. Sie sind nicht halbtags einsetzbar. Gut sind Sie nur«, hier machte Härting eine unwillige kleine Pause, »draußen.«
»Danke«, sagte Bettina spontan.
Härting funkelte sie an, bilde dir ja nichts ein, hieß das. »Aber das allein ist keine Polizeiarbeit. Denn die Arbeit, liebe Kollegin, gehört auch dazu. Wie das Wort schon sagt. Was Sie tun, sind riskante Detektivspiele.« Härting ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken und seufzte leise. »Wissen Sie, Frau Boll, was Ihr Problem ist?«
Bettina verschränkte die Arme. »Welches meinen Sie?«
Härting schnaubte trocken durch die Nase, das Geräusch, das bei ihm am ehesten einem Lachen gleichkam. »Da. Sehen Sie. Das ist es. – Sie machen sehr wohl Alleingänge, Frau Boll, das wissen Sie genau. Und Sie tun es gern. Sie haben unseren Ermittlungen ein, zwei Mal die richtigen Impulse gegeben. Jetzt glauben Sie, es wird immer so weitergehen. Sie werden mit diesen Allüren auf die Nase fallen. Ich sage das nicht aus Bosheit, Frau Boll.«
Bettina kannte diese Ansprache und schwieg. Besser gesagt, sie riss sich innerlich am Riemen, um sich nicht zu äußern, denn alles, was sie darauf hätte sagen können, wäre ganz und gar nicht sachdienlich gewesen.
»Sie sind eine kleine Diva, und Sie spielen Abenteuer. Das ist in unserem Beruf gefährlich. Dabei haben Sie eine Familie. Und vor allem Kollegen. – Normalerweise lernen das schon die Kadetten in ihrem ersten halben Jahr auf der Polizeischule!« Die sonst so blassen Wangen des Hauptkommissars hatten sich eine Spur rosa gefärbt. Ohne überhaupt hinzusehen, blätterte er erregt in der Lohmeier-Akte.
Bettina lächelte, möglicherweise ein wenig boshaft. »Ich bin halt irgendwie durchs System gerutscht.«