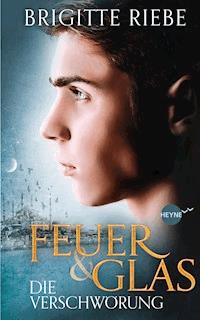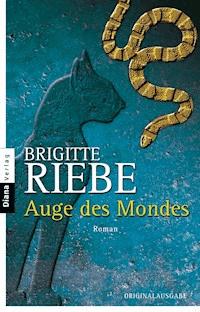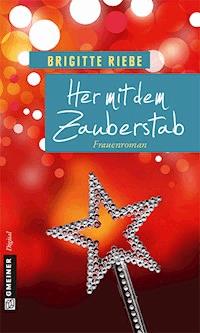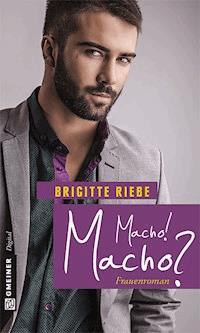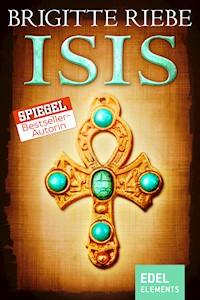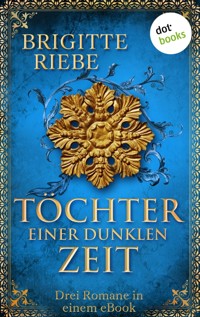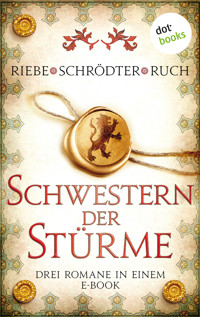
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei große historische Romane, drei starke Frauen, die gegen die Regeln und Gesetze ihrer Epoche aufbegehren - fesselnde Unterhaltung auf über 1.300 Seiten! Während das Reich Ottos des Großen von Unruhen erschüttert wird, muss die junge Roswitha inmitten von Ränkespielen für ihre Zukunft kämpfen – und einen Weg finden, ihre beste Freundin zu retten … Ava, eine junge Adlige, träumt derweil davon, als Minnesängerin die Herzen der Menschen zu erobern – doch das ist Frauen strengstens untersagt … Und Genovefa, Tochter des Herzogs von Brabant? Die kann endlich dem Hof ihres kalten Vaters entfliehen – aber wird in ihrer neuen Heimat in eine Intrige verwickelt, die sie das Leben kosten könnte … Der eBook-Sammelband »Schwestern der Stürme« vereint die historischen Romane »Liebe ist ein Kleid aus Feuer« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe, »Die Minnesängerin« von Sybille Schrödter und »Das Herz einer Gräfin« von Günter Ruch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1667
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Dürfen wir Sie auf eine abenteuerliche Zeitreise in das siebte, neunte und zwölfte Jahrhundert einladen? Während das Reich Ottos des Großen von Unruhen erschüttert wird, muss die junge Roswitha inmitten von Ränkespielen für ihre Zukunft kämpfen – und einen Weg finden, ihre beste Freundin zu retten … Ava, eine junge Adlige, träumt derweil davon, als Minnesängerin die Herzen der Menschen zu erobern – doch das ist Frauen strengstens untersagt … Und Genovefa, Tochter des Herzogs von Brabant? Die kann endlich dem Hof ihres kalten Vaters entfliehen – aber wird in ihrer neuen Heimat in eine Intrige verwickelt, die sie das Leben kosten könnte …
Drei große historische Romane, drei starke Frauen, die gegen die Regeln der Männer aufbegehren, um für ihr eigenes Glück zu kämpfen: über 1.300 Seiten fesselndes Lesevergnügen!
Über die Autorinnen und den Autor:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem über 30 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestseller-Listen vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com
Bei dotbooks veröffentlichte Brigitte Riebe die folgenden eBooks: »Schwarze Frau vom Nil«, »Pforten der Nacht«, »Der Kuss des Anubis« und »Die Töchter von Granada«.
*
Sybille Schrödter ist Juristin, Kabarettistin, Sängerin, Roman- und Drehbuchautorin – und so wenig, wie sie sich auf einen einzelnen Beruf festlegen lassen will, ist sie bereit, sich nur in einem Genre zu bewegen: Sie schreibt Kriminalromane und Thriller (»Weil mich menschliche Abgründe faszinieren«), historische Roman (»Weil es ein Vergnügen ist, in lang vergangenen Zeiten auf die Suche nach starken Frauenfiguren zu gehen«) und – unter verschiedenen Pseudonymen – Familiensagas (»Weil es in jeder Familie dunkle Geheimnisse gibt«) und Liebesgeschichten (»Nach dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt …«). Sybille Schrödter lebt in Hamburg.
Die Autorin im Internet: www.sybilleschroedter.de
Bei dotbooks veröffentlichte Sybille Schrödter die Kriminalromane »Das dunkle Netz des Todes« und »Was letzte Nacht geschah« und die historischen Romane »Die Lebküchnerin« und »Das Erbe der Lebküchnerin«.
*
Günter Ruch (1956–2010), wurde in Sinzig am Rhein geboren, studierte in Bonn mittelalterliche Geschichte und arbeitete später als Journalist, Grafiker, Fotograf und Autor.
Bei dotbooks erschienen Günter Ruchs hervorragend recherchierten und mitreißend erzählten historischen Romane »Das Geheimnis des Wundarztes« und »Gottes Fälscher«.
***
Sammelband-Originalausgabe Oktober 2020
Copyright © der Originalausgabe von Brigitte Riebes »Liebe ist ein Kleid aus Feuer« 2006 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH; Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von Sybille Schrödters »Die Minnesängerin« 2011 Piper Verlag GmbH, München; Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von Günter Ruchs »Das Herz einer Gräfin«, ursprünglich veröffentlicht unter dem Titel »Genovefa«, 2002 Rhein-Mosel-Verlag, Alf/Mosel; Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Nancy A Thiele, aleksu, setze, antonpix, wacomka
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-044-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Schwestern der Stürme« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Riebe, Sybille Schrödter, Günter Ruch
SCHWESTERN DER STÜRME
Drei Romane in einem eBook: »Liebe ist ein Kleid aus Feuer«, »Die Minnesängerin« und »Das Herz einer Gräfin«
dotbooks.
Brigitte RiebeLIEBE IST EIN KLEID AUS FEUER
Eine Burg im Harz im Jahre 946: Sie sind wie Feuer und Wasser – Eila, die junge Grafentochter, die wild und ungestüm ihrer Leidenschaft folgt, und die träumerische Roswitha, die in ihrem Schatten lebt. Welche Kraft ihre Freundschaft wirklich birgt, muss sich zeigen, als Unruhen das Reich Ottos des Großen erschüttern und die beiden Frauen auseinanderreißen. Während Roswitha inmitten von Ränkespielen nach ihrer Bestimmung suchen muss, riskiert Eila alles für ihre wahre Liebe. In einer dunklen Stunde führt das Schicksal beide Frauen wieder zusammen – können sie dem zerrissenen Reich wieder Hoffnung bringen?
Für Sabine, mit der es sich so wunderbar spinnen lässt
Wenn du den Pfeil der Wahrheit abschießt, tauche seine Spitze zuvor in Honig.Arabisches Sprichwort
Es ist nämlich besser zu schweigen,als die falschen Dinge zu sagen.Widukind von Corvey, 925-973
ERSTES BUCHDer Wolf
Kapitel 1
JANUAR 946BURG SCHARZFELS AM HARZRAND
Der Taubenschlag war Eilas Lieblingsplatz. So war es gleich beim ersten Mal gewesen, als sie ihn als kleines Mädchen an der Hand des Vaters betrat, und daran hatte sich im Lauf der Jahre nichts geändert. Das Gurren und das Flügelschlagen der Vögel, sobald sie Eilas Stimme erkannten, die Frechsten, die gleich losflogen, um sie zu begrüßen, während die Schüchternen lieber hocken blieben und sich zu putzen begannen, um die freudige Aufregung zu verbergen.
»Du musst ihre Sitzstangen ab und zu dünn mit Anisöl bestreichen, kleiner Habicht«, hatte er damals gesagt, ein Tontöpfchen aus der Mauernische geholt und ihr gleich gezeigt, wie sie es zu machen hatte. Sie liebte es, wenn der erfahrene Falkner sie so nannte, in den seltenen Augenblicken, da er ihr ganz allein gehörte. »Denn danach sind sie verrückt. So kommen sie immer wieder zurück, gleichgültig, wie weit sie sich fortgewagt haben. Das ist das Geheimnis der Schlagtreue.«
Auch jetzt vollzog sich das gewohnte Ritual; Laila und Luis, ihre Favoriten, rieben nach ein paar Augenblicken bereits die Schnäbel an ihrer Wange, wogegen die kleine Tarza mit ihrem verkrüppelten Bein ohne ihren Gefährten geduldig auf der Stange hin und her trippelte, bis Eila zu ihr trat, um sie zu streicheln. Sie hatte die Ringeltaube mit dem weißen Halsfleck verletzt im Schnee gefunden und unter dem Brusttuch hinauf zur Burg getragen, wo sie unter ihrer Obhut langsam wieder gesund wurde.
Doch der innere Friede, den sie sonst stets gespürt hatte, sobald sie bei ihren Tieren war, wollte sich heute nicht einstellen. Vielleicht lag es an den abgeworfenen Daunen, die überall herumschwebten. Die Wintermauser war in vollem Gange, und wenn die flauschigen Federn langsam zu Boden segelten, sah es fast aus, als fielen wieder dicke Flocken und die kalten Monate hätten gerade erst begonnen. Außerdem stank es bestialisch. Es hatte Eila bislang nie etwas ausgemacht, dass es im Taubenhaus streng roch, heute allerdings war es kaum auszuhalten. Bis zum Weihnachtsfest hatte der bucklige Oswin hier regelmäßig sauber gemacht und den Kot anschließend als Dünger für sein kleines Feld weggetragen. Sein Nachfolger schien es damit ebenso wenig genau zu nehmen wie mit allem anderen, was man ihm auftrug. Es lohnte sich kaum, sich seinen Namen einzuprägen, denn er würde nicht lange auf der Burg bleiben, ebenso wenig wie seine Vorgänger es getan hatten.
Eila versuchte, möglichst flach zu atmen, griff zur Schaufel und begann mit der Arbeit. Aber selbst als sie zu schwitzen anfing, konnte das die Stimme der Mutter nicht aus ihren Gedanken vertreiben.
Wenn sie sie wenigstens richtig ausgeschimpft hätte!
Dagegen hätte Eila sich auflehnen können. Doch diese unberechenbare Mischung aus Überdruss und Ablehnung machte sie einfach nur krank. Egal, was sie sagte oder tat, sie konnte der Mutter ohnehin nichts mehr recht machen. Und es würde sogar noch schlimmer werden, wie Eila aus Erfahrung wusste, je weiter Odas Schwangerschaft fortschritt.
»Du musst jetzt besonders rücksichtsvoll sein«, verlangte die alte Malin, Odas einzige Vertraute, die seit Wochen kaum noch von ihrer Seite wich, unermüdlich bestrebt, ihr einen ihrer Kräutersude einzuflößen, wogegen die Schwangere sich nicht minder beharrlich zur Wehr setzte. »Ein Fuchs hat meiner Kleinen ins Herz gebissen. Bevor du geboren wurdest. Ich denke, du bist inzwischen groß genug, um das zu verstehen.«
»Welcher Fuchs, Malin? Wovon redest du?«
Als Antwort nur eine ungeduldige Geste, dann fuhr die Alte fort: »Seitdem blutet sie. Und die Wunde kann sich nicht schließen. Oda lebt in der Schwärze. In ständiger Angst, ganz von ihr verschluckt zu werden.« Malin begann sich die Hände zu reiben, als juckten sie. Dabei hatte sie Eila doch eingeschärft, dass man daran einen Dieb erkennen konnte. »Du hast anscheinend keine Ahnung, was ich meine, Mädchen, was? Da muss es wohl doch noch einige Male Dreikönig werden, bevor eine wie du endlich begreifen lernt!«
Was sollte dieses Geschwätz von Schwärze und Blut, das Eilas Gemüt verdunkelte wie ein Schwarm gieriger Saatkrähen? Alles an der Mutter war doch so hell und zugleich unerreichbar, sogar jetzt, wo Oda vergessen zu haben schien, dass man einen Zuber mit heißem Wasser füllen lassen konnte, um darin zu baden. Selbst in diesem Zustand blieb sie voll kalter, rätselhafter Schönheit, das Haar, die Haut, erst recht die wasserklaren Augen, die sich unversehens weit öffnen und durch einen hindurchschauen konnten, als wäre man gar nicht vorhanden. Manchmal hatte sie das Gefühl, die Mutter sei ganz aus Schnee gemacht, weißem, reinem Schnee, den man nicht berühren durfte – es sei denn, man wollte erfrieren.
Eiskönigin, so nannte Eila sie im Geheimen und schämte sich im gleichen Augenblick dafür, als hätte man sie bei etwas Verbotenem ertappt. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, hätten ihr Geschwister und damit Verbündete zur Seite gestanden, aber sie war das einzige Kind geblieben, obwohl Oda nach ihr noch viermal schwanger geworden war.
Ein schriller Schrei ließ sie zusammenfahren.
Eila drehte sich um und lief hinaus, während die Tauben erschrocken aufflatterten. Sie musste nicht zum Himmel schauen, um zu wissen, was gerade geschah – und tat es unwillkürlich doch. Ein Paar sichelförmiger Schwingen dicht über ihrem Kopf, denen ein zweites in kurzem Abstand folgte. Flügelschlagen. Bellklingeln. Zwei schlanke Vogelkörper, die sich schnell höher schraubten.
Die Falken waren zurück!
Eila rannte zum Wehrturm und verscheuchte die Hundemeute, die sich kläffend an ihre Fersen heftete. Eines Tages würde sich an seiner Stelle ein stattlicher donjon aus Stein über all die anderen Gebäude erheben. Sie wusste, dass der Vater seit langem davon träumte. Bis dahin blieb es freilich ein Bergfried aus rohen Holzstämmen, auf den man eine lächerliche Zinnenkrone gemauert hatte, immerhin hoch genug, um über das Land zu schauen.
Sie kletterte die engen Leitern nach oben, so schnell sie nur konnte, und streifte dabei Federspiel, Bell und Hauben, die viel zu lang schon ungenützt an der Wand hingen. Eila stieß die Falltür zur Plattform auf.
Sie war zu spät gekommen.
Auf dem Boden vor ihr Blut und Federn. Die Falken hatten Tarzas Gefährten bereits gekröpft. Eilas Augen wurden nass. Dann dachte sie an den Vater und schluckte die Tränen hinunter.
»Lieb deine Tauben, kleiner Habicht!«, hätte er jetzt gesagt, mit jenem eigenartigen Ausdruck, der ihr das Herz jedes Mal aufs Neue zusammenzog, weil sie spürte, dass diese Worte nicht ihr galten, sondern an jemand anderen gerichtet waren. Oftmals hatte sie schon darüber nachgegrübelt, wer das sein könnte, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen.
Das Verlangen, bei ihm zu sein, machte ihr die Kehle eng. Er war das Licht in ihrem Leben, die wärmende Sonne, die sie am Erfrieren hinderte. Aber was wusste sie schon von ihm?
Dass er ein alter, grauer Wolf war, der eigentlich von weit her aus dem Westen stammte. Früher hatte er manchmal von dem großen grünen Fluss seiner alten Heimat erzählt und einem schmäleren, der sich wie ein blaues Band durch die hügelige Landschaft gegraben hatte, von Weinbergen, alten Städten, stolzen Klöstern und bunten, volkreichen Märkten voller Dinge, die sie nicht einmal dem Namen nach kannte. In letzter Zeit jedoch hatte er nichts mehr davon erwähnt.
Ein Wolf mit einer gebrochenen Nase und schiefen, abgenutzten Zähnen. Mit einem wulstig verheilten Schwerthieb, der vor Jahren im Kampf seine linke Wange gespalten hatte. Mit einer alten Pfeilnarbe auf dem Rücken, die ihm bei jedem Wetterwechsel zu schaffen machte.
Ein Wolf, der einen so fest packen konnte, dass man Angst bekam, keine Luft mehr zu kriegen.
Ein Wolf, der so überraschend zärtlich sein konnte, wenn er nur wollte.
»Lieb sie nur, deine Tauben, wenn du unbedingt willst«, hörte sie ihn sagen, »aber vergiss dabei niemals, dass sie für andere nur Nahrung sind. Wer überleben will, muss fressen. Und die Starken fressen die Schwachen, so lautet nun mal das Gesetz. Außerdem ist ein einziger Jagdfalke, den ich abgetragen habe, mehr wert als dein ganzer Schlag zusammen.«
Es war auf einmal, als stehe er neben ihr.
Der Vater sollte stolz auf sie sein, gerade jetzt, wo sie getrennt waren. Sie würde also tapfer bleiben, wie er es von ihr erwartete, und wenn es noch so schwer fiel. Ihr Atem wurde ruhiger. Mit neu erwachtem Interesse sah Eila sich um. Es kam ihr auf einmal nicht mehr so frostig vor wie in den vergangenen Tagen. Sogar der Wind hatte sich gelegt, und eine blasse Januarsonne ließ den Schnee auf den kahlen Bäumen glitzern.
Von hier oben gesehen, war die Welt weiß und still. Die Welt, die ihrem Vater gehörte. Wohin sie auch schaute, alles war sein Eigentum. Die abgeernteten Felder. Die Weiden, auf denen im Sommer buntes Vieh graste. Die Wälder, sauenreich, voller Hasen, Rebhühner und Fasanen, in denen er gern zur Beize geritten war, bevor seine Falken eines Tages wegflogen, weil sie die Hand des Herrn zu lange entbehrt hatten. Der kleine Fluss, der sich durch die moorige Talsenke schlängelte. Das Dorf, gegen Westen gelegen, mit seinen strohgedeckten Holzhäusern, halb in der Erde, als versuchten sie dort Wurzeln zu schlagen. Die Steinkirche mit dem Glockenturm – nur ein kleiner Weiler unter anderen, in denen die Fronleute hausten, die sein Land bestellten.
Von König Heinrich als Grafschaft erhalten für treue Waffendienste, wie er Eila voller Stolz erzählt hatte. Und dessen Sohn Otto, der jetzt das Reich regierte, hatte den stattlichen Besitz vor einiger Zeit sogar noch um weitere Hufen ergänzt.
Voller List und Betrug einem sächsischen Edelmann abgeluchst, wie die Mutter ihm höhnisch entgegenhielt, sobald die Sprache darauf kam. »Mit leeren Händen bist du in mein Land gekommen, alter Mann!«
»Mit Händen immerhin, die ein Schwert meisterhaft führen können und eine Lanze ebenso sicher schleudern wie die Streitaxt werfen. Hände, die Pfeil und Bogen beherrschen, wie kaum einer der Jüngeren es vermag.« Er begann dann unruhig auf und ab zu gehen, untrügliches Anzeichen, dass einer seiner Wutausbrüche drohte. »Jede einzelne Hufe hab ich mir verdient. Treue wird mit Land belohnt, Verrat mit dem Tod. Daran wird sich nichts ändern. Niemals!«
Eila hasste es, wenn die beiden sich stritten, doch leider taten sie es viel zu oft. Manchmal kam es ihr vor, als seien Zank und Zwist das Einzige, was die Eltern verband. Nun jedoch war Graf Raymond seit Wochen überfällig, und sie vermisste ihn mehr denn je. Es war nicht üblich, dass ein Ritter Burg und Familie im Winter allein lassen musste, schon gar nicht über die Weihnachtstage. Selbst Kriege und Feldzüge richteten sich in der Regel nach den hohen Kirchentagen. Es lag am König als dem obersten Befehlshaber, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, und dass es Otto nicht gelingen wollte, sprach in Eilas Augen nicht für ihn.
War das vielleicht einer der Gründe, warum sich sogar die leiblichen Brüder gegen Otto erhoben hatten, in Aufständen freilich, die von ihm bisher jedes Mal mit eiserner Faust niedergezwungen worden waren?
Eila hatte Mutter und Malin darüber tuscheln hören, die nicht ahnten, dass sie heimlich lauschte. Außerdem sprachen sie in bedrücktem Ton über neuerliche Überfälle herumziehender Steppenreiter, die alles schändeten, raubten und niederbrannten, was ihnen in die Hände fiel. Die Leute nannten sie Turci. Das Mädchen konnte sich nichts Rechtes darunter vorstellen, doch allein das fremde Wort erfüllte es mit dumpfer Furcht.
Eilas Magen begann zu knurren wie stets, wenn ihr unbehaglich zumute wurde. Aber es konnte noch Stunden dauern, bis die Mutter zur Nachtmahlzeit auftragen ließ, vorausgesetzt, sie vergaß es nicht ganz. Wenn sie schwanger war, musste man mit allem rechnen. Das Mädchen hatte schon gesehen, wie sie sich händeweise rohe Kaninchenleber in den Mund stopfte, nur um alles im nächsten Augenblick wieder würgend zu erbrechen.
Für einen Moment wurde Eila ganz flau. Sie presste ihre Stirn gegen eine Zinne und begann flach zu atmen. Da entdeckte sie unten das Pferd, den Mann, der es führte, und das Kind, das hinter den beiden hertrottete, ein ganzes Stück, als sei es darauf erpicht, Abstand zu halten.
Ein Mädchen.
Es musste ein Mädchen sein, Eila war sich sicher, als sie näher kamen. Etwas an der Gestalt, an der Haltung, ließ keinen Zweifel in ihr aufkommen, obwohl man das dunkle Haar des Kindes kurz geschoren hatte und es Beinlinge trug. Ein mageres Mädchen, etwas kleiner als Eila, dem das graue Wolltuch ständig vom Kopf auf die Schultern rutschte.
Der Mann und das bepackte Pferd gingen langsam, aber stetig durch den hohen Schnee, während das Mädchen immer wieder stehen blieb und mit dem störrischen Tuch kämpfte oder an seinem Schuhwerk nestelte, bevor es sich stockend und sichtlich widerwillig erneut in Bewegung setzte.
Eilas Hunger war mit einem Schlag verflogen. Stattdessen verspürte sie im ganzen Körper freudiges Kribbeln. So lange schon hatten sie keine Fremden mehr gesehen, keine Gäste mehr bewirtet! Den ganzen Herbst über war es so ruhig gewesen, dass Eila vor Langweile halb umgekommen war, und auf Abhilfe war bis weit ins Frühjahr hinein nicht zu hoffen gewesen. Nur wer nicht anders konnte, machte sich mitten im Winter auf den Weg.
Wer also mochten sie sein?
Eine Familie? Fahrendes Volk? Fromme Pilger auf weiter Reise?
Bald schon würde sie von ihrer Ungewissheit erlöst werden. Denn offensichtlich waren das Pferd und die beiden auf dem direkten Weg zu ihnen. Zur Einhornklippe, wie man landauf, landab den schroffen Felsen nannte, auf dem Graf Raymonds Burg lag.
*
JANUAR 946MORITZKLOSTER ZU MAGDEBURG
»Sie ist tot, Raimund, meine geliebte Königin lebt nicht mehr! Das italische Fieber hat sie mir genommen, und kein Gebet konnte helfen, nicht einmal das innigste Gelübde. An ihrer Bahre hab ich gewacht, die ganze Nacht hindurch und diesen schrecklichen, schwarzen Tag. Jetzt fühl ich mich innerlich nur noch müde und leer.«
»Ich weiß, mein König, mein Herr. Und meine Seele weint mit dir, mein Herz ist schwer vor Kummer.« Raymond verneigte sich tief und vergab Otto dabei zum abertausendsten Mal, dass er noch immer seinen Namen verschandelte.
»Edgith war doch noch gar nicht alt! Die Beste von allen. Die Schönste, die Klügste. Nie wieder werden meine Augen ein anderes Weib sehen.«
Allmählich wurden Raymond die Knie steif, und von der unteren Rückenpartie stieg wieder jener dumpfe Schmerz auf, der unversehens stechend werden konnte, wenn man sich falsch bewegte oder wieder einmal zu lang im Sattel geblieben war. Aber dennoch verharrte der Graf in seiner unbequemen Haltung.
Wir wissen beide ganz genau, dass es anders kommen wird, dachte er. Schon eine ganze Weile hat sie das Bett nicht mehr mit dir geteilt, sondern sich im Kloster heimischer gefühlt als in deinen Armen, und das nicht nur, wenn du auf Kriegszug warst. Das haben mir nicht nur ihre traurigen Augen verraten, sondern auch ein paar schwatzhafte Zofen. Sonst gäbe es sicherlich auch neben diesen beiden blassen Kindern aus den ersten Ehejahren ein paar kräftige Königssprösslinge mehr. Du bist zum Alleinsein nicht geboren, Monseigneur, und – vergebe mir der gütige Gott – ich bin es auch nicht, obwohl ich mir die Meisterin erkoren habe, die es mich zu lehren vermöchte. Auf den Kopf könnte ich dir zusagen, welche Art von Frau es sein wird. Jung muss sie sein, nicht zu groß, mit vollen Lippen und schweren Brüsten. Lebhaft, doch nicht rechthaberisch. Klug genug, um zu dir aufzusehen. Am besten auch noch mit dunklem Haar und Rabenbrauen. So wie die slawische Fürstentochter Dyma, die deine Kriegsbeute war, bevor du ihrer überdrüssig wurdest und es dir nicht schnell genug gehen konnte, sie ins Stift Möllenbeck abzuschieben. Deine fromme Königstochter aus dem fernen Wessex war nichts als ein blasser Abglanz Dymas.
»Sie ist jetzt bei Ihm«, sagte Raymond leise, »dem ewigen Vater. Dort, wo wir alle eines Tages sein werden.«
Er bekreuzigte sich. Noch etwas länger, und seine Knie würden knirschend unter ihm nachgeben und ihn in voller Länge auf den eisigen Boden stürzen lassen. Ob er dann jemals wieder ohne fremde Hilfe aufkam, stand in den Sternen.
Endlich schien der König aus seiner Agonie zu erwachen und gab ihm ein Zeichen.
Erleichtert erhob sich der Graf.
»Setz dich zu mir, Raimund! Ich möchte jetzt nicht allein sein.«
Raymond zog einen der ledernen Hocker heran und ließ sich nieder. Sein Blick glitt durch den Raum, der leer war bis auf ein paar Truhen, den Eichentisch und die eisernen Halter an den Wänden, in denen Fackeln brannten. An der Stirnseite hing ein hölzernes Kreuz; das war der einzige Schmuck. Ein Feuer im gemauerten Kamin verbreitete Wärme, vorausgesetzt, man entfernte sich nicht zu weit von ihm. Ein paar gut gefüllte Holzkohlebecken kämpften zusätzlich gegen die beißende Kälte an.
Das Kloster war geräumig gebaut, aber schlicht ausgestattet, obwohl Magdeburg unaufhaltsam zu Ottos Lieblingspfalz aufrückte. Es gab mehr als einen unter seinen Rittern, der das insgeheim beklagte, weil ständig Silber in diese neue Siedlung floss, während andere Orte das Nachsehen hatten. Auch mit der Gewährung neuer Rechte und Privilegien geizte der König nicht. Nur deshalb konnte dieser Markt an der Elbe sich immer weiter ausbreiten; nur deshalb machten jetzt reiche Fernhändler mit Pelzen, Honig und Bernstein hier Station, die früher mit ihren Waren vorbeigezogen wären.
Es gefiel Raymond, dass der Raum nichts von einem königlichen Prunkraum hatte; auf ihn wirkte er eher wie das Feldlager eines Kriegers, der ständig unterwegs sein musste. Damit kannte er sich aus. Das war das Leben, das er schon mit Ottos Vater Heinrich geteilt hatte; die gemeinsame Sprache, die ihn auch mit dessen Sohn verband.
Allerdings überraschte es Raymond, dass keiner der anderen Vertrauten beim König war, kein Gero mit dem Eisenkinn, den Otto mit der Markgrafenschaft an der mittleren Elbe und Saale üppig belehnt hatte, kein Hermann Billung, der seit einigen Jahren im gleichen Rang selbstherrlich die untere Elbe regierte. Auch Ottos jüngster Bruder Brun, für die geistliche Laufbahn bestimmt, fehlte. Seltsamerweise ließ sich nicht einmal Raymonds Waffenbruder Bernhard blicken, der günstige Gelegenheiten wie diese sonst stets zu nutzen wusste. Sein Groll auf diese Männer – allesamt von Otto weitaus höher ausgezeichnet als er, obwohl er doch eigentlich den Vorrang hätte haben müssen – war nicht verflogen, hatte sich im Lauf der Zeit jedoch gewandelt.
Wer zu nah an die Flamme der Macht kommt, verbrennt auch schnell, dachte er. Mir liegt da eher ein Platz im Schatten. Von hier aus kann ich in Ruhe meine Beobachtungen anstellen und gelassen die richtigen Schlüsse für künftiges Handeln ziehen. Wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird? Das letzte Wort wird erst beim letzten Atemzug gesprochen.
Nicht einmal die königlichen Kinder spendeten dem Witwer Trost, dabei hatte Raymond beim Betreten des schlichten Gebäudes den halbwüchsigen Prinzen Liudolf gesehen, der sich im Vorübergehen weinend an seine Schwester gepresst hatte. Würde dieser ehrgeizige Junge mit dem unsteten Blick, den er von klein auf hatte heranwachsen sehen, eines Tages ein würdiger Nachfolger Ottos werden?
Im Augenblick erschien ihm der König kraftlos, in sich zusammengesunken, als sei er über Nacht geschrumpft. Otto war kein Hüne, aber doch ein stattlicher, untersetzter Mann mit rotblondem, sich bereits lichtendem Haar und dem rötlichen Brustfell eines Löwen. Seiner Trauer hatte er zumindest den wuchernden Vollbart geopfert, den er entgegen aller Mode seit Jahren hartnäckig beibehalten hatte. Raymond fiel auf, wie bleich Otto war, wie schwer die Lider über den geröteten Augen lagen, wie schlaff das Kinn wirkte. Die Hüften waren zu breit für einen Krieger, die langen Arme überraschend mager. Raymond wusste besser als jeder andere, welche Hitze dieser Körper ausstrahlte, auch wenn es schon lange zurücklag, dass sie sich so nah gekommen waren.
»Es ist Winter«, sagte der König plötzlich. »Zeit, eure Burgen zu bestellen und all das andere, was über das Jahr liegen geblieben ist. Du solltest eigentlich gar nicht hier sein.«
»Für einen Ritter gibt es keine Jahreszeiten.«
»Doch, die gibt es«, widersprach Otto. »Und für einen König gibt es sie auch.«
»Sag das nicht mir, sondern unseren Feinden!«, erwiderte Raymond mit dem Anflug eines Lächelns. »Vielleicht haben sie ja ein Einsehen und verziehen sich freiwillig, anstatt uns aus dem Hinterhalt zu attackieren.«
»Soll das denn niemals enden?«
»Nicht bis der letzte Slawe diesseits und jenseits der Elbe deine Krone anerkannt hat, Monseigneur. Was nützen dir sonst all die Privilegien, mit denen du dein Magdeburg auszeichnest? Nicht seine Mauern schützen es vor ihnen, sondern unsere Schwerter.«
»Aber kaum sind die einen unterworfen, erheben sich schon wieder neue. Als sprudle irgendwo weit im Osten eine geheimnisvolle Quelle, unablässig bereit, stets andere, immer noch kampflustigere Stämme auszuspucken. Ich bin dieser Schlachterei manchmal so überdrüssig. Und jetzt, da meine Edgith nicht mehr ist ...« Sein Arm fiel kraftlos herunter.
Er hatte seit Tagen nichts gegessen und kaum ausreichend getrunken. Der trübe Blick und die eingefallenen Wangen verrieten Raymond genug. Er zog den Krug mit heißem, gewürztem Wein heran, den eine Dienerin hereingebracht hatte, schenkte einen Becher voll und schob ihn Otto hin.
Der nahm ihn tatsächlich und trank. Eine Spur von Farbe kehrte in sein Gesicht zurück.
»Du kennst die Antwort, mein König«, sagte Raymond. »Es war ihr Land, und mit Feuer und Blut haben wir es ihnen genommen. Sollen sie uns etwa dafür dankbar sein? Doch dein Vater hat diesen Kampf begonnen, und wir werden ihn weiterführen. Es sei denn, du willst auf all das verzichten, was wir mit Blut und Schweiß errungen haben.« Unversehens war er in seine weiche westliche Mundart verfallen, die er sonst abgelegt hatte. »Du hast keine Wahl – und das weißt du. Die Toten fordern, dass du weitermachst. Und nicht nur sie. Zögerst du, zeigst du auch nur ein Anzeichen von Schwäche, verlierst du dein Königsheil. Das wäre nicht nur der Untergang für dich, sondern auch für dein ganzes Geschlecht.«
Otto starrte ihn an, als sehe er ihn zum ersten Mal. Dabei kannte er ihn lang genug, um zu wissen, dass Raymond stets ein Hitzkopf gewesen war, der sich um Etikette wenig scherte. Beinahe sein ganzes Leben hatte er ihn begleitet, dieser kleine, drahtige Kämpfer aus dem südlichsten Zipfel von Lotharingen. Ein Krieger, wie es ihn heute kaum noch gab. Manchmal hätte man fast glauben können, der Graf sei mit der Brünne verwachsen, so stolz trug er seinen eisernen Waffenrock. Noch immer hielt er sich aufrecht, aber sein Schopf war grau geworden im Dienst seiner Könige; das Gesicht hager, der Hals faltig. Er war viel älter als die meisten anderen Ritter, und Otto trennten mehr als zwanzig Jahre von ihm, doch in Raymonds tief liegenden dunklen Augen war nichts von Überdruss oder Abschied zu lesen.
Wieso ist er nicht längst im Kampf gefallen wie so viele andere?, dachte der König. Dann gäbe es niemanden mehr, dem ich mich auf ewig verpflichtet fühlen müsste.
Unwillkürlich fuhr seine Hand zu dem goldenen Amulett auf der Brust, und die Gewissheit des heiligen Knöchelchens, das es inwendig barg, war tröstlich. Es gab ihm stets das Gefühl, näher bei Gott zu sein. Hätte er es damals schon besessen, wäre alles vielleicht anders gekommen. Aber die Zeit ließ sich nicht zurückdrehen, so sehr er sich das auch wünschte. Dafür reichte seine Macht nicht aus, die Macht des gekrönten und gesalbten Herrschers des ostfränkischen Reiches. Denn einst hatte ihn eisig der Tod gestreift. In seinen Träumen hatte er jenen Moment wieder und wieder erlebt, war schreiend aufgewacht, wild um sich schlagend, schweißgebadet.
Er wusste, dass er noch immer im Schlaf redete, und er hasste sich dafür. Jeder weitere Mitwisser wäre eine Gefahr gewesen. Denn was sich vor langen Jahren zugetragen hatte, hätte nicht geschehen dürfen, keinem König, und auch keinem wie ihm, der später einmal König werden sollte. Andererseits hätte er ohne Raymond niemals den Thron besteigen können – und es gab Tage, da hasste er ihn deshalb regelrecht.
»Haben wir uns nicht eigenhändig zu Meistern des Winterkriegs gekürt?«, sagte der alte Ritter mitten in Ottos Gedanken hinein. »Wie sonst hätten wir die Heveller vernichtend schlagen können? Ihre Burg Brennabor bezwingen? Und uns schon kurz danach die Daleminzier vornehmen? Keinen von ihnen haben wir entkommen lassen, nicht einmal die Frauen und Kinder, obwohl diese auf dem Prager Sklavenmarkt gutes Silber gebracht hätten.«
Es war, als fege ein frostiger Wind durch den Raum, als seien die schützenden Mauern plötzlich verschwunden. Die beiden Männer spürten plötzlich wieder die Kälte, den eisigen Schneesturm, der jedes Vorankommen nahezu unmöglich machte. Den Hunger, weil der Nachschub wieder einmal liegen geblieben war. Das Ungeziefer. Die Glieder, klamm, kurz vor dem Erfrieren.
Und dann war da wieder der Schmerz, während draußen die Wölfe heulten, die Angst, die lähmend zum Herzen kroch. All die Wintergeister und Schneedämonen, die aus ihren Höhlen gekrochen waren und sie nun feixend verhöhnten. Der Tod, der die Zeltstadt schon betreten hatte und nicht bereit schien, sich unverrichteter Dinge wieder fortschicken zu lassen.
Später dann das anhaltende Brennen in den Augen, nicht nur wegen der nassen, unentwegt rauchenden Feuerstellen. Ein Brennen, das erst recht nicht enden wollte, als man auf Heinrichs Befehl die feindlichen Überlebenden in den frisch gefallenen Schnee getrieben hatte, Kinder und Frauen, schutzlos und nackt, wie ihre Mütter sie einst geboren hatten ...
»Ein herrliches Weihnachtsfest war das damals in Pöhlde«, sagte Otto unvermittelt. »Als endlich alles vorüber war. So hell und so feierlich wie selten zuvor.«
»Ja, das war es.«
»Noch im gleichen Jahr hat mein Vater dich zum Grafen erhoben und dir Burg Scharzfels als Lehen gegeben. Wenig später hast du die blutjunge Oda zur Frau genommen.«
Und die nicht minder junge Dyma gebar dir Wilhelm, deinen ersten Sohn, dachte Raymond nicht ohne Bitterkeit. Ein Geschenk, für das ich alles geben würde – sogar mein Leben.
»Du vermisst sie.« Der König legte seine Hand auf Raymonds Arm, und wieder spürte der Graf sogar durch Schichten von Filz und Leder die eigentümliche Hitze, die Otto ausstrahlte. »Ich werde euch erlösen. Du sollst sie nicht länger warten lassen.«
Raymond begann zu frösteln. Oda wartete nicht auf ihn – ganz im Gegenteil. Zu viel war zwischen ihr und ihm geschehen. Vielleicht hätte er längst alles, was irgendwie nach Hoffnung schmeckte, in einem lodernden Feuer verbrennen sollen und die Asche anschließend sorgfältig vergraben. Als Buße für das Erlebte, das hinter ihm lag und ihn noch immer in seinen Träumen bedrängte, als hätte alles sich erst gestern ereignet und nicht schon vor langer Zeit. Immer häufiger verfolgten ihn in letzter Zeit solche Gedanken. Aber das ging nur ihn etwas an, niemanden sonst.
»Du schickst uns Ritter nach Hause?«, sagte er.
»Einige von euch, ja. Vergiss nicht, dass es nicht nur euch gibt, sondern auch noch eure Knechte. Die Männer wollen ihre Familien schließlich irgendwann wiedersehen.«
Das war mehr als unmissverständlich. Bernhard würde bleiben, ganz sicher, aber Raymond gehörte nicht zum engsten Kreis. Er war und blieb ein Fremder.
»Gleich nach Edgiths Begräbnis.« Ottos Augen wurden wieder feucht. »Hier in Magdeburg, dem Ort ihrer Morgengabe, soll sie die ewige Ruhe finden. Und eines Tages werde auch ich hier an ihrer Seite liegen.«
»Da siehst du, wie wichtig unsere Schwerter sind«, sagte Raymond, und es klang womöglich nur deshalb so großspurig, weil er sich so elend dabei fühlte. »Damit alles so bleibt, wie es ist.«
Otto zog die Hand wieder zurück. Die Hitze auf Raymonds Arm erlosch. Jetzt spürte er den Winter draußen und den drinnen umso deutlicher.
»Für dich, Raimund, hab ich noch einen besonderen Auftrag. Genau genommen, sind es sogar zwei. Reite für mich nach Tilleda!«
»Wozu, mein König?«
»Um dort in meinem Namen nach dem Rechten zu sehen.«
Raymonds dunkle Brauen schnellten fragend nach oben.
»Man hat mir von Unregelmäßigkeiten berichtet.« Der König sprach schneller, als wolle er ihn dadurch überzeugen. »Von einer Seuche, die dort gewütet und zu Verwahrlosung und Amtsmissbrauch geführt haben soll, bedenkliche Vorfälle also, die von einem Mann meines Vertrauens untersucht werden sollten. Wir brauchen die Pfalzen. Ohne sie wären wir verloren. Daher muss jede einzelne in guter Verfassung sein. Immer!« Er leerte seinen Becher.
»Dann wünschst du anschließend meinen persönlichen Rapport?« Raymond begann zu rechnen. Bei dem schlechten Wetter bedeutete das, dass er sein Zuhause frühestem in drei Wochen erreichen konnte.
»Es genügt, wenn du mir einen Boten schickst. Und nimm nur so viele Männer mit wie nötig! Geh als mein Kundschafter, nicht als Ritter! Ich möchte, dass du dich möglichst unauffällig umsehen kannst.«
Jeder am Hof wusste, dass Otto weder lesen noch schreiben konnte. Dafür gab es unter anderem die Männer der Hofkapelle, die deshalb über alle laufenden Vorgänge bestens informiert waren. Raymond beherrschte das Schreiben leidlich; in der Kindheit hatte seine Mutter ihn darin unterwiesen, aber das lag so lange zurück, dass er inzwischen Unsicherheiten zeigte. Für einen Bericht allerdings würde es genügen; und den Pfaffen um Otto fette Nahrung für ihre Intrigen zu liefern, war ohnehin nicht seine Sache.
»Hast du nicht erst kürzlich einen neuen Pfalzgrafen für Tilleda bestellt?« Es war Raymond herausgerutscht, noch bevor er genügend nachgedacht hatte. Kein Wunder, dass Otto ihn nach Hause schickte und andere um sich versammelte. Er würde niemals ein Höfling werden – nicht einmal in tausend Jahren!
»Mein Reich ist groß. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Dafür gibt es die familia, die Waffenbrüderschaft meiner Ritter. Weitere Fragen?«
Raymond neigte den Kopf zum Einverständnis. Den Rüffel hatte er sich selber zuzuschreiben. Bei aller Milde und Gefühlsbetontheit, die der König an den Tag legen konnte, wenn er in der entsprechenden Stimmung war, kannte Raymond ihn als kompromisslos. Das hatten nicht nur seine aufständischen Brüder zu spüren bekommen, sondern damit musste auch jeder andere rechnen, der es wagte, sich ihm zu widersetzen. Heinrich hatte man als Freund geliebt und als König geachtet; Otto gehorchte man besser, es sei denn, man war an Schwierigkeiten interessiert.
»Und der zweite Auftrag, Monseigneur?« Der Graf bemühte sich um einen freundlichen Tonfall.
»Es ist an der Zeit, dir einen neuen Knappen zu wählen. Ich habe dabei den jungen Sigmar im Auge. Er scheint mir genau der Richtige zu sein.«
»Billungs vorlauter Großneffe?« Sofort stand ihm das Bild des blonden Jungen mit dem störrischen Kinn und den schmalen Lippen vor Augen. »Was könnte ich ausgerechnet einem wie ihm beibringen?«
»Die Beize. Wie man ein Ritter wird und seinem König treu dient. Lehr ihn das, was ein erfahrener Falkner weiterzugeben hat, bevor er die eigenen Söhne unterweisen kann. Alles, was du auch Liudolf beibringen konntest.« Ein Schatten zog über Raymonds Gesicht, aber Otto schien es nicht zu bemerken. »Du musst nichts überstürzen, Raimund! Erledige meinen Auftrag in Tilleda und besorg danach in Ruhe deine häuslichen Angelegenheiten! Wir sprechen uns wieder beim Osterfest in Quedlinburg, wenn du mit deinen Leuten zurück bist. Sigmar läuft dir inzwischen nicht davon. Dafür werde ich schon sorgen.«
Verhaltenes, dann lautes Klopfen; schließlich ging die Tür auf.
»Es geht um die Totenfeier, mein König«, sagte der schlanke Mann in der Benediktinerkutte. »Ich möchte dich nicht stören« – ein knapper Blick zu Raymond, den dieser ebenso frostig erwiderte –, »aber wichtige Entscheidungen stehen noch aus. Soll ich besser später wiederkommen?« Die Stimme war freundlich, die Worte hatten trotzdem einen scharfen Klang.
»Nein, bleib! Es ist ohnehin alles gesagt.«
Raymond verneigte sich und verließ den Raum. Er hatte den Mann mit dem Fuchshaar und den gesprenkelten Augen schon nicht leiden können, als er noch Leif von Langenstein hieß. Seitdem er sich aber Pater Johannes nannte und als hoch geschätztes Mitglied der Hofkapelle Ottos angehörte, war aus Raymonds früherer Abneigung gegen Odas Verwandten stiller Hass geworden.
*
JANUAR 946BURG SCHARZFELS
Als sie schließlich zusammen im Bett lagen, war für Eila an Schlaf nicht zu denken. Zu aufregend war diese unerhoffte Begegnung gewesen, und noch jetzt hallten die Worte der kleinen Fremden in ihr nach.
»Wie heißt du?«, hatte das Mädchen sie als Erstes gefragt.
»Eila. Und du?« Die Kleine hatte mitten im Reden gehustet; nur deshalb hatte Eila sie falsch verstanden. »Rose«, wiederholte sie. »Rose. Was für ein schöner Name!«
Wenn das fremde Mädchen lächelte, verlor ihr Gesicht alles Angestrengte. »Nein, Roswitha ist mein Name. So hat mein Vater es bestimmt. Aber du kannst mich ruhig Rose nennen, wenn du willst«, bot sie gönnerhaft an.
Es kann nicht schaden, ihr eins zu versetzen, dachte Eila. Sie ist schließlich kleiner als ich und soll am besten gleich von Anfang an lernen, wer hier zu bestimmen hat.
»Was ist mit deinen Haaren passiert?«, sagte sie ohne Umschweife.
»Läuse. Und mit deinen? Du siehst aus wie eine Flamme.«
Eila war sofort verstummt. Der Schopf zu rot, die Haut zu blass, dazu noch diese hässlichen Sprenkel überall, im Gesicht, auf der Brust, sogar auf Armen und Beinen. Sie wusste selber, dass sie weder der Eiskönigin glich, noch die kräftigen Farben Raymonds geerbt hatte. Da konnte die andere gut reden, mit ihren Haaren, dunkel wie Rauch, den ebenmäßigen Zügen und Augen, die so grün waren wie das Wasser der Rhume.
Zu ihrer Überraschung hatte Rose die Hand ausgestreckt und ihre Wange berührt.
»Wie die Sterne am Himmel«, sagte sie mit ihrer hellen, ernsten Kinderstimme. »In klaren Winternächten sieht man sie am besten. Und das hier unter deinem linken Auge könnte der Große Bär sein. Du trägst die Himmelszeichen in deinem Gesicht.«
»Woher weißt du das?«
»Von meiner Mutter. Die hat alles gewusst.«
»Wieso bist du dann nicht bei ihr?«
Das Lächeln war abrupt erloschen. Dann hatte Rose kehrt gemacht und war diesem widerlichen Mann hinterhergelaufen, dessen Stimme wie gesprungen klang. Niemals zuvor hatte Eila jemanden wie ihn gesehen. So groß, so dürr, so kahl und mit einer Angst einflößenden Narbe um den Hals, die aussah, als schnüre sie ihm die Luft ab.
»Hübsches Andenken, nicht wahr, kleines Fräulein?« Sein Lachen war scheppernd. »Und ungeheuer praktisch! Der Strick, so nennt man mich seitdem. Das kann sich jedes Kind merken.«
Eila streckte im Bett vorsichtig ein Bein aus. Der schmale Rücken vor ihr hob und senkte sich, aber nicht gleichmäßig genug, um sie zu täuschen. Rose schlief ebenso wenig wie sie, das verriet ihr die flackernde Öllampe neben dem Bett.
Eila hörte sie seufzen, dann klang es plötzlich wie Weinen. Sie zögerte, schließlich legte sie ihre warme Hand zwischen die knochigen Schulterblätter. Ein Zittern ging durch den kleinen Körper, dann schien er sich zu entspannen.
»Wie alt bist du eigentlich?«, hörte Eila das Mädchen murmeln.
»Vierzehn. Und du?«
»Dreizehn. Am Dreikönigstag war mein Geburtstag.«
»Meiner auch.«
»Wenn man am gleichen Tag geboren wurde, gehört man auch zueinander. Das hab ich einmal jemanden sagen hören.«
»Kann sein«, sagte Eila, und es klang vorsichtiger als zuvor. »Es spricht jedenfalls nichts dagegen, Freunde zu werden.«
Eine Weile blieb es still.
»Meine Mutter ist tot«, sagte Rose schließlich. »Das wolltest du vorhin doch herausbekommen, oder nicht? Und die Schwester meines Vaters wollte nicht länger bei mir bleiben.«
»Weshalb? Hast du sie geärgert?«
»Nein. Jedenfalls nicht sehr oft, glaube ich.« Das Mädchen begann sich unruhig zu bewegen. »Aber das war es nicht. Tante Almut wollte endlich ins Stift. Nach Gandersheim.« Täuschte sich Eila, oder wurde die Stimme jetzt tatsächlich zittrig? »Um ein frommes Leben zu führen, so wie mein Vater es ihr seit langem versprochen hatte. Sie hatte es gründlich satt, noch länger zu warten. Vor allem konnte sie nicht länger mit ansehen, wie ich immer wieder ...« Rose nieste heftig, ein paarmal hintereinander.
»Wirst du jetzt etwa krank?«, fragte Eila.
»Kann ich gar nicht werden.«
»Weshalb?«
»Deshalb!«
Eila spürte, wie Roses Hand zur Brust glitt und etwas berührte. Das Lederband um den schmalen Nacken war ihr längst aufgefallen. Trug sie ein Kreuz? Nein, das hätte sie nicht unter dem Hemd zu verbergen brauchen. Es musste etwas anderes sein, etwas, das sie lieber für sich behielt. Eila lächelte. Dann würde es sicherlich nicht lange dauern, bis sie es herausgefunden hatte. Sie war eine Spezialistin, was Geheimnisse betraf.
»Ich werd nicht krank«, sagte Rose matt. »Bestimmt nicht! Nur im Hals kratzt es scheußlich. Und kalt ist mir auch. War ganz schön weit bis zu euch.«
»Und dein Vater? Was wird er jetzt tun? Ich meine, der Mann mit der Narbe ...«
»Der Strick?« Rose setzte sich auf und begann zu lachen. »Das ist doch nicht mein Vater, was glaubst du denn! Der hat mich doch bloß hergebracht, weil ich ohne Tante Almut nicht allein auf der Burg bleiben sollte. Mein Vater ist Bernhard, Edler von Weißenborn. Ein Ritter, der für den König kämpft.«
»Das tut mein Vater auch«, sagte Eila.
»Ja, ich weiß. Die beiden sind Waffenbrüder. Deshalb bin ich ja hier.«
»Und wirst du auch bleiben?« Eila erschrak darüber, wie sehr sie sich das jetzt schon wünschte.
»Vielleicht. Bis mein Vater zurückkehrt. Lass uns jetzt schlafen!«
Rose rutschte tiefer, und Eila legte sich dicht hinter sie.
»Sie hatte lange dunkle Haare, in die sie mich manchmal gewickelt hat, als ich noch klein war. Sie roch nach Wald. Ab und zu hat sie gesungen«, hörte sie Rose murmeln. »Wenn wir allein waren, hat sie mich Zora genannt. Das bedeutet Abendstern. Aber das verstehen nur die Sprechenden. Und niemand sonst auf der Welt hatte so weiche Hände wie sie – niemand!«
Eila tat, als ob sie fest schlafe.
»Sie hieß Marja«, flüsterte Rose später. »Doch das darfst du keinem Menschen verraten.«
Später im Traum flog Eila durch die Nacht. Es war nicht kalt, sondern mild wie am Johannistag, wenn überall auf den Hügeln die Feuer brannten und Glühwürmchenschwärme in den Hecken tanzten. Weit unter sich hörte sie die kleinen Brüder rufen, fröhlich, fast ausgelassen, und sie wollte ihnen antworten, aber sie konnte es nicht, denn ihr Mund war mit bunten Bändern verschlossen.
Als sie irgendwann müde wurde, entdeckte sie unter sich eine Baumkrone, die sich beim Näherkommen öffnete wie ein großes, warmes Nest. Sie landete sanft und wickelte sich zum Schlafen in Roses Haar, das so dunkel war wie Rauch, so lang, so weich.
*
»Was soll ich mit dem fremden Balg?«, sagte Oda. »Mein eigenes ist mir schon mehr als genug.«
Es machte ihr nichts aus, dass die junge Magd bei diesen Worten beinahe die Platte mit den abgenagten Kaninchenknochen fallen ließ. Das Fleisch war zäh gewesen, aber noch immer besser als das klumpige, angebrannte Kraut und der versalzene Linseneintopf, den ohnehin keiner angerührt hatte. Bodo, der Kämmerer, war längst gähnend zu Bett gegangen. Dem Gesinde gefiel es nicht, wie sie mit Eila umsprang, aber darum hatte sie sich noch nie geschert. Wem es nicht passte, der konnte gehen. Schon im Herbst hatte sie ihre Zofe nach Hause geschickt, weil ihr das ständige Flennen der Fünfzehnjährigen zu viel geworden war. Es gab ja Malin, die sich um sie kümmerte, und manchmal ertrug sie selbst deren Gegenwart kaum noch.
Nein, es machte Oda nichts aus, dass es immer weniger wurden, die auf der Burg dienten, als gäbe es irgendwo ein gieriges Loch, das sie alle nach und nach verschluckte. Die Leute setzten sich ab, rannten zurück zu ihren jämmerlichen Hütten, obwohl ihnen das mitten im Jahr strengstens verboten war. Gewiss, sie hätte sie zurückholen lassen können, hart abstrafen und ihnen anschließend befehlen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Doch wozu all diese Anstrengungen? Sollte die ganze Welt doch sehen, dass sie hier im Unglück leben musste, sie, der einmal der höchste Himmel offen gestanden hatte.
»Bist du dir da ganz sicher?«
»Ja, er hat es wieder einmal geschafft. Aber es wird nichts daraus, das kannst du ihm ebenfalls ausrichten.«
Sein Blick war neugierig und ungeheuer dreist zugleich. Nichts entging ihm, weder ihre strähnigen Haare noch die Ärmel, an denen Essensreste klebten. Das einstmals blaue Kleid hatte sie seit dem letzten Vollmond nicht mehr gewechselt. Malins Rosenwasser verdunstete ungenutzt in ihrer Kammer. Oda wusste, dass sie sich gehen ließ, und sie tat es mit voller Absicht. Allerdings wäre es weitaus befriedigender gewesen, hätte Raymond dabei zusehen können. Wieso ließ er überhaupt so lange auf sich warten? Egal, sie war entschlossen durchzuhalten, bis er endlich mit seinen Männern zurück war.
Jetzt sah der Strick sie offen unverschämt an.
»Sieht eher so aus, als könntest du von kleinen Bälgern gar nicht genug bekommen.« Er starrte auf ihren Bauch.
»Raus!«, sagte Oda, aber ihre Stimme klang so kraftlos, dass er einfach sitzen blieb.
Sein Grinsen vertiefte sich.
»Dann ist es also dein Gatte, der darauf versessen ist? Ich kenne ihn, deinen Raymond. Noch aus den guten alten Zeiten. Mir musst du nicht erzählen, wie hartnäckig er sein kann!«
Malin, die ein Stück weiter unten am Tisch saß und mit halb geschlossenen Augen ihre Handspindel drehte, wollte schon auffahren, aber ein knappes Nicken Odas hinderte sie daran. Sie setzte ihre Arbeit fort. Ihre Haltung allerdings verriet, dass sie sich kein Wort entgehen ließ.
»Gegessen und getrunken hast du. Das Stroh ist aufgeschüttet. Weshalb kannst du mich nicht endlich in Ruhe lassen?«
»Weil wir zu reden haben«, sagte er. »Du und ich. Du langweilst dich?«
»Wie kommst du darauf?«
»Ich kann es riechen, schöne Dame.« Er sprach weiter, bevor sie auffahren konnte. »Deshalb hab ich dir Bernhards Kleine gebracht. Ihre Tante musste sich mitten im Winter zu ihren frommen Schwestern absetzen. Hast du nicht bemerkt, wie das Mädchen aussieht? Halb verhungert und voller Ungeziefer von Kopf bis Fuß. Wer kann schon sagen, was ihr ein herrenloses Gesinde im Lauf der Wochen noch angetan hätte?«
Mit einem Knochenstück begann er ungeniert in seinen Zähnen zu stochern. Oda verfolgte angewidert sein Tun.
»Allerdings kannte ich Burg Scharzfels noch nicht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch der Waffenbruder deines Gatten bei ihrem Anblick einigermaßen überrascht sein würde.«
Oda sah, wie er wieder umherschaute, und für einen kurzen Augenblick durchfuhr sie zu ihrer Verblüffung beinahe etwas wie Scham. Dann jedoch kehrte ihre trotzige Gleichgültigkeit zurück. Sollte er nur sehen, was sie zu ertragen hatte! Der Hundekot in der Halle, die schmutzigen Wände, die aufsässigen Mägde, die Knechte, die nur noch selten gehorchten – die Gemahlin Raymonds führte eben ein alles andere als angenehmes Leben!
»Damit hab ich nichts zu schaffen«, sagte sie. »Er sagt mir nichts über seine Ritter, niemals, und ich will auch gar nichts darüber wissen.«
Sie spürte, wie sich das Kind in ihrem Leib bewegte. Es lebte. Es trat sie, kraftvoll und vorzugsweise immer dann, wenn sie gerade ihre Ruhe haben wollte. Aber das hieß noch überhaupt nichts, wie die Erfahrung sie leidvoll gelehrt hatte. Unwillkürlich glitten ihre Hände zum Bauch und verharrten dort.
Und auch diese Geste entging ihm nicht.
»Wann ist es denn so weit?«, fragte der Strick und trat nach einem Hund, der sich zu nah an seinen Stuhl gewagt hatte.
»Irgendwann. Nach Ostern, vermute ich. Sonst noch was?«
»Sie bleiben nicht am Leben«, fuhr er unbeirrt fort. »Das ist es doch, oder, was dir zu schaffen macht. Hab ich Recht? Ich hab die kleinen Kreuze draußen gesehen. Alle drei.«
Ihre hellen Augen füllten sich mit Tränen, und es war ihr gleichgültig, dass es ausgerechnet diese Kreatur war, die ihr dabei zusah.
»Es liegt an ihm«, sagte sie heftig. »Er lässt nicht von mir ab, bis es wieder so weit ist. Ich muss sie dann austragen und unter Schmerzen herauspressen, nur, um zu erleben, dass sie nicht atmen wollen. Keiner von ihnen.« Sie begann zu weinen. »Kein Einziger.«
»Alles Söhne, nicht wahr?«
Oda hatte keine Ahnung, woher er das wusste, aber es stimmte.
»Und das große rote Mädchen mit dem gesunden Appetit?«
Sie schüttelte den Kopf und schwieg beharrlich.
»Dann liegt die Zukunft deines Ritters also dort draußen vor der Kapelle begraben«, sagte der Strick. »Und deine mit dazu. Denn die Zeit rennt euch davon. Dein Gatte ist bereits ein alter Mann. Und du wirst, wenn du so weitermachst, binnen Kurzem ein verbrauchtes Weib sein. Dann kann keiner dich mehr erlösen. Auch nicht, wenn seine Knochen schon längst vermodert sind.«
»Was willst du?« Oda benutzte den Ärmel, um ihre Tränen fortzuwischen.
»Ich komme ordentlich herum, weißt du«, erwiderte der Strick, »das liegt an der Art meiner Geschäfte.« Er hatte ihr Interesse geweckt. Das erkannte er an ihrem wachen Blick. »Ich höre dies und das, sehe vieles und vergesse wenig. Weil ich nirgendwo lang bleibe, verlieren die Leute schnell die Scheu, mir Geheimnisse anzuvertrauen.«
»Komm zur Sache!«
»Ich bin längst dabei.« Er beugte sich leicht nach vorn. Etwas Kaltes ging von ihm aus. Oda wich unwillkürlich zurück. »Überall im Land treffe ich auf Frauen, die sich vergeblich einen gesunden Sohn erhoffen. Und andere wiederum, klügere, bleiben nicht nur beim Hoffen, sondern lassen sich helfen.«
»Wer könnte mir schon helfen?«, fuhr Oda auf »Es sei denn, jemand schneidet ihm eines Nachts die Kehle durch, damit er mich nicht mehr schwängern kann.«
»Dafür würden seine Eier auch schon reichen«, gab er ungerührt zurück. »Du willst also, dass dieses Kind gesund zur Welt kommt?«
»Ich gehe zugrunde dabei. Jedes Mal stirbt auch ein Stück von mir.«
Er schien zu überlegen, dann erhellte sich sein Gesicht.
»Ich könnte dir jemanden vorbeischicken«, sagte er. »Ragna.«
»Und wer soll diese Ragna sein?«
»Eine, die sich auskennt. Die schon vielen beigestanden hat. Bist du klug, dann folgst du ihren Vorschlägen. Anderenfalls können wir uns den ganzen Aufwand sparen. Du bist einverstanden?«
»Wenn Ragna zufällig eine dieser dreckigen Moorhexen ist, kannst du gleich verschwinden«, zischte Malin säuerlich. »Von denen lass ich keine an meine kleine Oda.«
»Sieh an, man hat auch mitzureden!« Sein Tonfall troff vor Hohn. »Hör ich da vielleicht eine Spur Eifersucht mitschwingen? Oder gar ein Quäntchen Verdruss? Weil ich möglicherweise Leute kenne, die fähiger sind und weitaus kundiger als eine alte Vettel?«
»Wer einmal am Galgen gebaumelt hat, kann es auch wieder tun.« Malin war aufgestanden und baute sich nun drohend vor dem Mann auf. »Und manchmal geht das sogar schneller, als einem lieb sein kann. Meine Augen mögen alt sein, aber sie sehen scharf genug, um Schurken wie dich selbst in finsterer Nacht zu erkennen.«
Sie wandte sich an Oda. »Hör ihm nicht zu! Er hat nichts als Unrat im Kopf – dieser Galgenstrick!«
»Lass ihn, Malin! Misch dich nicht ein! Ich will wissen, was er zu sagen hat. Dann erst entscheide ich.«
Der Strick lächelte breit.
»Ich wusste, dass du vernünftig bist«, sagte er. »Du erfährst es aber nur unter vier Augen. Die Alte muss raus. Sonst bleiben meine Lippen versiegelt.«
*
Es war nicht einfach, sich im Dunkeln zurechtzufinden, aber ihr Herz klopfte so hart gegen die Rippen, dass sie nicht länger liegen bleiben konnte. Außerdem fror sie jämmerlich. Der Hals war zugeschwollen, und kalter Schweiß rann ihr den Nacken hinunter. Natürlich hätte sie jetzt weinen können, nach Tante Almut rufen, nach dem Vater, aber sie wusste ja, dass beides sinnlos war, und wenn sie jetzt weinte, würde sie sich hinterher nur noch verlassener fühlen.
Sie stieß sich mit der Schulter an der rauen Wand. Der kleine silberne Mond auf ihrer Brust brannte. Die Lunula schützte sie, das wusste Rose, immer, wie die Mutter gesagt hatte, und doch hatte sie zugelassen, dass sie so krank geworden war.
Dort vorn musste die große Halle sein; sie erspähte Feuerschein, und jetzt, jetzt hörte sie auch Stimmen.
»Ich weiß nicht.« Das war Eilas schöne Mutter, die sie vorhin so kalt angesehen hatte, als sei sie nichts anderes als ein herrenloser Köter auf zwei Beinen. »Was soll das alles nützen?«
»Es gibt keine Garantie. Das weißt du ebenso gut wie ich. Aber wenn du nichts unternimmst, wird alles vermutlich so bleiben wie bisher.«
»Dann bekommt er doch noch seinen Sohn.« Sie klang bitter. »Das Einzige, woran ihm liegt. Aber was ist mit mir?«
»Du hast endlich deinen Frieden. Und wer weiß, vielleicht wächst in deinem Bauch ja auch ein gesundes kleines Mädchen heran.«
»Das ist keine Welt für Mädchen. Niemand weiß das besser als ich.«
Sie hörte, wie der Mann meckernd lachte. Sie hatte Angst vor ihm, große Angst sogar, obwohl der Strick bislang stets freundlich zu ihr gewesen war. Ihre Lider begannen zu flattern. Da war es wieder, jenes verhasste Kribbeln im Bauch, vor dem sie sich so fürchtete.
»Bestell deinem Gatten, sobald er zurück ist, dass ich fündig geworden bin. Aber es wird ihn eine Menge kosten. Und nicht nur Silber, das kannst du ihm auch bestellen. Manches ist mit Silber nicht zu bezahlen, nicht einmal mit Gold. Darauf soll er sich rechtzeitig einstellen. Sonst kommen wir beide nicht ins Geschäft.«
»Welches Geschäft? Ich verstehe kein Wort.«
»Umso besser. Bestell es ihm einfach! Er wird schon begreifen, was es heißt.«
Rose zitterte. Jetzt floss der Schweiß am ganzen Körper. Plötzlich spürte sie den erdigen Geruch der Mutter wieder in der Nase, der sie stets beruhigt hatte, und sie sah Farben, strahlend und schön. Sie machte ein paar staksige Schritte, bis sie die Halle erreicht hatte, und blieb stehen, als sie ein Rascheln hörte. Die schmutzigen Binsen unter ihren Füßen hatten sie verraten.
Der Mann und die Frau vor dem Feuer starrten sie an, als hätten sie einen Geist erblickt.
Roses Beine begannen zu zucken, dann auch die Arme. Der Kopf schlug nach hinten. Dann stieß das Mädchen mit einem dumpfen Laut die Luft aus und fiel wie ein nasses Lumpenbündel in sich zusammen.
*
FEBRUAR 946TILLEDA
Der Himmel war von dunklen Schneewolken bedeckt, als Raymond auf seiner Stute von der Goldenen Aue aus langsam bergauf ritt. Obwohl er sich große Mühe gab, sein Gewicht auf dem Sattel so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, spürte er, dass Belle viel schlechter trabte als noch am Morgen. Abermals verfluchte er den versoffenen Schmied, der sie in Magdeburg so nachlässig beschlagen hatte. Wenn sich inzwischen ein Hufabszess gebildet hatte, würde sie als Reittier für Wochen ausfallen. Dabei gab es im ganzen Frankenreich keinen Pferderücken, auf dem er sich wohler fühlte, so ruhig und trittsicher wie die Stute in guten Zeiten war. Dazu kam, dass sie eine exzellente Schwimmerin war und nicht einmal vor reißenden Flüssen Angst zeigte.
»Alles in Ordnung, meine Schöne.« Er tätschelte ihren braunen Hals. »Wir sind gleich am Ziel, und dann wird man dir helfen.«
Belle warf den Kopf zurück und schüttelte sich, als wolle sie ihn abwerfen, wie immer, wenn er mit den Wolfsfellen, aus denen sein Umhang bestand, zu nah an ihre Nüstern kam. So lange trug er das Kleidungsstück schon, und noch immer war der Angst einflößende Geruch nicht aus ihm verschwunden. Aber es gab nichts, was besser wärmte; deshalb trug er die Felle seit Jahren in jedem Winter.
Er war auf dem Pfingstberg angelangt; vor ihm erhob sich der massige Erdwall, der die Pfalz sicherte. Beim Näherkommen entdeckte Raymond, dass davor ein neuer, breiter Graben ausgehoben worden war, den er nur an einer einzigen Stelle auf einer Holzbrücke überqueren konnte. Außerdem hatte man neben dem Haupttor einen Holzturm errichtet, der eine weite Sicht über das Land erlaubte. Im schwindenden Licht sah er oben zwei Männer stehen, die Wache hielten, einer so groß und stattlich wie ein Baum, der andere ein ganzes Stück kleiner und ungleich schmäler.
»Was willst du?«, rief der Riese zu ihm herunter, nachdem Raymond abgestiegen war und auf das zweiflügelige Tor zuging, das tief in den Wall eingeschnitten war.
»Hinein«, sagte Raymond und war sich im gleichen Augenblick bewusst, welch seltsamen Anblick er in seinen unförmigen grauen Fellen bieten musste. »Macht auf! König Otto hat mich zu euch gesandt.«
Er sah, wie die beiden eine ganze Weile miteinander redeten.
»Du hast sein Siegel?«, tönte es ihm schließlich entgegen.
»Hier, in meiner Hand. Aber um das zu überprüfen, müsst ihr euch schon zu mir herunterbequemen.«
Es dauerte, bis das Tor geöffnet wurde. Durch einen Spalt schob sich eine riesige, schmutzige Pranke und nahm Raymond das Wachssiegel aus der Hand.
»Es scheint echt zu sein«, hörte er schließlich jemanden sagen.
»Es ist echt. Soll ich hier Wurzeln schlagen – oder lasst ihr mich und mein Pferd endlich hinein?«
Ein Torflügel schwang auf, und zu Raymonds Überraschung entdeckte er, dass der zweite Wächter ein halbwüchsiger Junge war, der ihn neugierig von oben bis unten musterte. Der Ritter hatte für diese Mission mit Bedacht auf die gewohnte Brünne verzichtet und trug nur Schichten von Wolle und Filz unter dem Fell; sein Lieblingsschwert aber hing an seiner Seite und beulte auf der Herzseite das Fell aus. Er sah, wie der Blick des Jungen zu der verborgenen Waffe glitt, und diese Aufmerksamkeit gefiel ihm.
»Du bist ein Ritter?«, fragte der Junge.
»Und die königliche Pfalz wird jetzt schon von Kindern bewacht?«, erwiderte Raymond in provozierendem Tonfall.
»Ich bin fünfzehn!« Der Junge mit dem dichten dunklen Schopf reagierte empört. »Und starke Muskeln hab ich auch.« Er drehte seine rußigen Hände um und streckte sie dem Ritter entgegen. Nichts entging Raymond, weder der blaue Daumennagel noch die Schwielen, die sich auf den Ballen gebildet hatten.
»Jedes scharfe Auge ist uns willkommen«, sagte der Riese. »Können wir uns vielleicht leisten, wählerisch zu sein? Seitdem die Seuche bei uns gewütet hat, müssen wir mit dem auskommen, was uns geblieben ist.« Er blieb stehen, musterte Raymond misstrauisch. »Was willst du überhaupt hier? Bist du vielleicht der neue Pfalzgraf?«
»Braucht ihr denn einen neuen?«
»Ja, denn der bisherige ist elend gestorben«, sagte der große Mann. »Zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen, letzte Woche, wie so viele andere vor ihnen. Gunna behauptet, es liege am Korn. Es hat alle vergiftet, lässt sie tanzen und rasen, bis ihre Glieder schwarz werden und nach und nach abfaulen. Als wüte ein Feuer in ihnen, das sie von innen auffrisst.«
»Und wer ist diese Gunna?«, fragte Raymond.
»Meine Mutter«, erklärte der Junge. »Außerdem brauchst du einen Schmied. Soll ich dich zu ihm führen?«
»Wie kommst du darauf?«, fragte Raymond.
»Weil deine Stute klamm geht. Wette, sie hat bereits einen Abszess, der unter dem Huf wächst. Siehst du nicht, wie sie das rechte Bein belastet, um das linke zu schonen? Da war ein Stümper an ihrem Hinterhuf zugange.«
»Er kennt sich aus«, sagte der Riese. »Du kannst ihm ruhig vertrauen, er weiß, wovon er redet. Sein Vater Algin ist Schmied – der beste weit und breit.«
»Und du lernst bei ihm?«, fragte Raymond, obwohl er die Antwort bereits kannte.
Ein knappes Nicken.
»Dann hast du bestimmt auch einen Namen.«
»Lando.« Klare graue Augen richteten sich auf Raymond. »Was ist, soll ich dich jetzt zu ihm bringen?«
»Einen Augenblick noch.« Raymond wandte sich an den hünenhaften Wächter. »Ihr habt mich hereingelassen, aber ihr redet nicht darüber. Zu keinem, verstanden? So lautet der königliche Befehl.«
Der Riese nickte. Schließlich nickte auch der Junge.
»Ich verzieh mich auf meinen Turm«, sagte der Ältere, »bis die Ablösung kommt. Wirst du mir morgen Mittag wieder Gesellschaft leisten, Lando?«
»Vielleicht.«
Der Junge war schon auf dem Weg, der Raymond und ihn zunächst an einer Reihe schlichter strohgedeckter Katen vorbeiführte, die klaftertief in der Erde steckten.
»Das sind die Grubenhäuser«, sagte Lando. »Nahe am Wall. Wo es am feuchtesten ist. Da leben die Hörigen. Von denen sind besonders viele gestorben.«
»Wann ist die Seuche denn ausgebrochen?«
»Bald nach der Jahreswende. Als es so bitterkalt war und Weizen und Emmer immer knapper wurden. Da haben viele begonnen, heimlich an die alten Roggenvorräte zu gehen. Die ersten haben schon bald über Gliederschmerzen geklagt und dass sie ihre Beine nicht mehr richtig heben können. Die schwarzen Flecken überall auf der Haut sind dann erst später dazugekommen. Meine Mutter hat alle gewarnt, aber sie wollten nicht auf sie hören.«
Die niedrigen Häuser wurden mehr und mehr von ebenerdigen Pfostenbauten abgelöst, die höher waren, aber ebenfalls aus Lehm bestanden.
»Hier leben die Freien«, sagte Lando. »Die Königsbauern. Aber selbst bei denen steht inzwischen jedes zweite Haus leer.«
»Ist es noch weit bis zur Schmiede?«, fragte Raymond. »Nein, gleich dort drüben, siehst du? Dort, wo die Steinhäuser beginnen.«