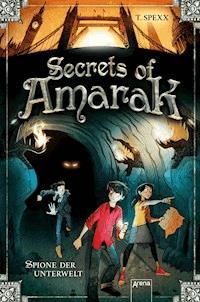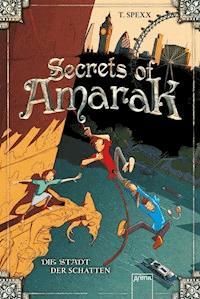
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Secrets of Amarak
- Sprache: Deutsch
Niemand kann sich erklären, was in London los ist. Immer wieder gibt es kleine Explosionen, selbst Gebäude sind schon eingestürzt. Alex, Joe und Rebecca fragen sich, ob der totgeglaubte LaPorta dafür verantwortlich ist. Doch dann wird ihnen eine geheimnisvolle Karte zugespielt. Sie verändert sich von Tag zu Tag und zeigt ein geheimnisvolles Netzwerk, das die Stadt durchzieht. Um die Zerstörungen aufzuhalten, haben die drei nur eine Chance: Sie müssen dieses Netzwerk durchbrechen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
T. SPEXX
Secrets ofAmarak
STADT DERSCHATTEN
Mit Illustrationen von Moritz von Wolzogen
T. Spexxist schon um die halbe Welt gereist und liebt das Abenteuer! Auf einer seiner Reisen wurde ihm eine kleine Flasche angeboten, die er kurzerhand kaufte. Hätte er geahnt, was er sich damit für einen Ärger einhandeln würde, hätte er die Finger davon gelassen. T. Spexx hat seine Wohnung und Identität mittlerweile aufgegeben und lebt an einem geheimen Ort.
Moritz von Wolzogen, geboren 1984, fing mit zwei Jahren an zu zeichnen und hörte nie wieder auf. Er studierte in Wiesbaden Kommunikationsdesign und gewann 2008 den Film-Nachwuchspreis edWard für seinen Kurzclip Earthcar. Seit 2012 arbeitet er als freischaffender Grafiker, Zeichner und Animationsfilmer in Frankfurt am Main.
1. Auflage 2017 © 2017 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Cover- und Innenillustrationen: Moritz von Wolzogen Einbandgestaltung: Johannes Wiebel ISBN 978-3-401-80709-6
Besuche uns unter: www.arena-verlag.dewww.twitter.com/arenaverlagwww.facebook.com/arenaverlagfans
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Prolog
Die drei Gestalten huschten den Queens Walk entlang. Um diese nächtliche Stunde gingen zwar kaum noch Leute am Themse-Ufer spazieren, aber wegen der dramatischen Ereignisse der vergangenen Wochen waren vermehrt Polizeistreifen in Londons Straßen unterwegs. Wichtige Gebäude wie die County Hall, deren imposante Fassade sich rechts von ihnen erhob, wurden besonders gut bewacht. Niemand sollte sie aufhalten, deshalb mussten sie vorsichtig sein. Vorsichtig und schnell.
Als eine Fußstreife um die Ecke bog, drückten sie sich rasch in den Sea-Life-Eingang neben sich und warteten, bis die beiden Bobbies vorübergegangen waren. Dann nahmen sie ihr eigentliches Ziel wieder ins Visier, das direkt vor ihnen in den Himmel ragte: das London Eye, Europas größtes Riesenrad.
»Los geht’s«, flüsterte Matthew seinen Freunden zu. Doch Patrick zögerte.
»Ganz schön hoch das Ding«, murmelte er und legte den Kopf in den Nacken. »Sind doch locker … hundert Meter.«
»Hundertfünfunddreißig, um genau zu sein«, sagte Christin und hob ihr Smartphone in die Höhe. »Bitte lächeln!« Das Blitzlicht erhellte für einen Moment die Dunkelheit.
»Bist du irre?!«, herrschte sie Matthew an. »Willst du, dass uns die Polizei gleich hier schnappt?«
»Wie soll ich denn bitte schön sonst mitten in der Nacht Fotos machen?«, giftete Christin zurück. »Ohne Blitz ist nichts drauf zu sehen und dann ist dein ganzer schöner Plan im Eimer.«
»Dann warte wenigstens, bis wir oben sind«, sagte Matthew. »Wenn wir vorher geschnappt werden, kannst du deine Klickzahlen im Netz gleich vergessen.«
»Klickzahlen«, murmelte Patrick mit sorgenvoller Stimme. »Ist es das wert? Für ein bisschen Aufmerksamkeit im Netz illegal auf das höchste Riesenrad der Welt zu kraxeln?«
»Europas«, muffelte Christin.
»Klar ist es das«, sagte Matthew und funkelte Patrick böse an. »Wenn du Schiss hast, zieh Leine, ja? Gemecker kann ich bei dem Trip hier nicht gebrauchen.«
Patrick hob noch einmal den Blick. Ein flaues Gefühl breitete sich in seiner Magengegend aus. Als sie den Trip geplant hatten, wirkte das London Eye gar nicht so groß, und als sie ihre Aktion mit Google Earth ausarbeiteten, sah es sogar ziemlich klein aus. Aber jetzt, hier vor Ort und mitten in der Nacht, war das Riesenrad wie ein Hochhaus – ein Hochhaus mit dreißig Stockwerken. Dreißig Stockwerke, die sie an der Außenfassade bis nach oben klettern wollten.
»Und wenn wir nur bis zur ersten Kabine hochsteigen?«, schlug Patrick vor und zeigte auf eine der zweiunddreißig ovalen Gondeln.
»Und wen soll das interessieren?«, gab Matthew genervt zurück. »Glaubst du, irgendjemand klickt uns an, wenn wir von fünf Metern Höhe runterwinken?« Er spuckte auf den Boden. »Wir klettern bis ganz nach oben. Christin filmt uns, wie wir mit erhobenen Fäusten auf der obersten Gondel stehen, und dann …« Er boxte Patrick freundschaftlich gegen die Schulter. »Dann kriegen wir Millionen Klicks, Alter. Millionen Klicks!«
Geduckt huschten sie die Rampe zum Eingang hinauf und kletterten über die Absperrung. Keine Minute später hasteten sie auf der Rückseite des Riesenrads die Stufen der Metalltreppe hoch zur ersten Gondel. Dort überwanden sie das Geländer und schon befanden sie sich mitten in der Stahlkonstruktion, die das gewaltige Rad in der Senkrechten hielt.
Wie leicht das alles ging, dachte Patrick und wunderte sich, dass das London Eye nicht besser gesichert war. Allerdings hatte vermutlich auch niemand Lust auf eine Klettertour in schwindelerregender Höhe. Niemand außer ihnen.
Zwischen den Stahlstützen war dann auch Schluss mit der Leichtigkeit. Die breiten Träger, an denen die Gondeln baumelten und über die sich die drei Jugendlichen langsam nach oben zogen, bogen sich mehr und mehr in die Höhe, was den Aufstieg immer schwieriger machte. Als die Streben schließlich steil hinaufführten, stoppte Matthew und schien darüber nachzudenken, wie er den nahezu senkrechten Stahlträger erklimmen sollte.
Knapp unter ihm klammerte sich Patrick an einer Querstrebe fest. Als er einen Blick nach unten warf, wurden seine Knie weich. Obwohl sie noch nicht einmal die Hälfte geschafft hatten, war die Höhe schwindelerregend. Patrick lief der Schweiß über die Stirn und seine feuchten Hände hatten auf dem Metall kaum Halt.
»Lass gut sein!«, rief er Matthew zu. »Wir machen die Bilder hier – reicht doch völlig aus.«
»Reicht überhaupt nicht aus«, widersprach Matthew. »Wir müssen hoch. Und ich weiß auch …«
Ein Ruck ging durch das Rad. Reflexartig klammerte sich Patrick am Träger fest. Unter sich hörte er Christin schreien. Er senkte den Kopf und sah das Mädchen an einem der Querträger hängen.
»Christin!«, schrie Patrick.
»Hilfe!«, brüllte sie.
»Ich komme!«, rief Matthew und kletterte, so schnell er konnte, runter. Während er sich mit der einen Hand am Gestänge festhielt, streckte er die andere so weit wie möglich zu Christin hinab. »Nimm meine Hand!«, rief er. »Ich zieh dich hoch.«
»Bist du irre?«, rief Christin zurück. »Ich lass doch nicht los!«
»Sie hat recht, das geht so nicht«, sagte Patrick. »Wir müssen sie packen.«
»Und wie, du Idiot?«, fragte Matthew. »Was war das überhaupt? Fühlte sich an, als würde das ganze verdammte Riesenrad aus den Angeln gehoben …«
»Ist doch jetzt egal«, sagte Patrick. »Wir müssen Christin helfen. Schnell!« Er hangelte sich nach unten.
»Was hast du vor?«, rief ihm Matthew nach, doch Patrick antwortete nicht. Er hatte einen Plan. Ob er funktionieren würde, wusste er nicht. Aber es war keine Zeit zum Nachdenken.
»Halt durch«, sagte er zu Christin, als er an ihr vorbei nach unten kletterte.
»Ich kann nicht mehr«, ächzte sie erschöpft. »Meine Hände rutschen ab.«
»Nur noch ein paar Sekunden«, bat Patrick und hangelte sich über eine der Streben auf das Dach der Gondel darunter. Christin hing rund vier Meter über ihm. Wenn sie losließ, würde er sie auf dem ovalen Dach vermutlich nicht halten können. Aber wenn er die Luke auf der Gondeloberseite irgendwie aufbekam, konnte sie sich in die Kabine fallen lassen. Ein Sprung aus einer solchen Höhe tat wahrscheinlich weh, war aber immer noch besser als der Tod.
Patrick zog sein Taschenmesser hervor und machte sich an den Schrauben zu schaffen.
»Das klappt doch nie«, rief Matthew von oben und streckte seine Hand aus. »Gib mir deine Hand, Christin!«
Aber das Mädchen war mit ihren Kräften am Ende. »Ich kann nicht mehr …«
In diesem Augenblick vibrierte das Gestänge, als würde das London Eye von einem Riesen geschüttelt. Im selben Moment hatte Patrick zwei Schrauben gelöst. »Nur noch eine«, rief er und zögerte. Das Dach der Gondel wurde warm. Warm und weich, als würde es schmelzen. Patrick spürte, wie er mit den Füßen einsank. Gleichzeitig glaubte er, eine Art tiefes Brummen oder Summen zu hören. Doch ehe er darauf reagieren konnte, schrie Christin wie am Spieß – und dann ging alles ganz schnell.
Matthew rutschte vom Gestänge und riss Christin mit sich in die Tiefe. Beide zusammen prallten mit ungehemmter Wucht zu Patrick aufs Kabinendach, das wie Kaugummi nachgab und riss. Sie stürzten in die Gondel und knallten auf den Boden. Gleichzeitig zerfetzten mit peitschenden Geräuschen die langen Stahlseile, die das London Eye am Boden sicherten. Das dreieckige Haltegerüst, an dem das Riesenrad mit seiner Nabe befestigt war, begann sich langsam zu neigen und mit einem gewaltigen Krachen klatschte das London Eye in das Wasser der Themse.
1
Mind the gap«, warnte die elektronische Stimme. Aber Rebecca hatte auch gar nicht vor, mit dem Fuß in die Lücke zwischen Bahnsteig und Metrowaggon zu rutschen. Außerdem hatte sie den Warnhinweis, der in fast allen Londoner U-Bahn-Stationen bei jeder Zugeinfahrt gegeben wurde, schon so oft gehört, dass sie ihn gar nicht mehr richtig wahrnahm. Im Moment galt ihre gesamte Aufmerksamkeit der Rolltreppe am Ende des Bahnsteigs, wo ihr Bruder Jonathan auftauchen sollte – jedenfalls hatte er das versprochen, als er noch mal schnell in den Kiosk gesprintet war, um ein paar Chewing Gums abzugreifen. Rebecca war schon mal vorausgegangen und nun stand sie hier, am Bahnsteig der Station Canada Water, und wartete.
»Mist«, fluchte sie leise. Wieso musste Joe auch ausgerechnet jetzt sein blödes Kaugummi kaufen. Hätte er doch am Flughafen machen können. Aber nein, es musste ja unbedingt hier sein. Nur Canada Water hat Frutti Di Mare, hatte er mit hochgezogenen Augenbrauen behauptet. Und was anderes kau ich nicht.
Das war natürlich Quatsch. Jeder Kiosk in London führte diese Sorte. Der Grund, wieso Joe die Kaugummis unbedingt hier kaufen wollte, hieß Carol, hatte lange blonde Haare und war die Tochter der Kioskbesitzerin. Allerdings war sie zwei Jahre älter als Joe und würde sich allein schon deshalb niemals mit einem Dreizehnjährigen einlassen. Aber das schien Joe nicht zu interessieren. Seit er sie gesehen hatte, war sein Kaugummiverbrauch sprunghaft angestiegen. Manchmal ging er sogar mehrmals täglich in den Kiosk.
»Stand clear of the closing doors«, verlangte die elektronische Stimme.
Rebecca tat das genaue Gegenteil und setzte einen Fuß in den weißblauen Wagen der East London Line. In wenigen Sekunden würden sich die orangefarbenen Türen schließen und die Tube würde abfahren, ob ihr Bruder drin war oder nicht. Wo blieb er nur so lange?
Plötzlich tauchte Joe auf. Er schlenderte die Treppe runter, als hätte er alle Zeit der Welt.
»Joe!«, rief Rebecca, so laut sie konnte. Ihr Bruder hob erschrocken den Kopf. Rebecca winkte hektisch, gleichzeitig kündigte das monotone Piepen neben ihr die Schließung der Türen an. Erst jetzt schien Joe zu begreifen, was da vor sich ging. Wie von der Tarantel gestochen sprintete er los und sprang in den Wagen – gerade noch rechtzeitig, bevor sich die Türen schlossen und der Zug abfuhr.
»Was machst du denn?«, schimpfte Rebecca, als Joe sich neben ihr auf einen Sitz fallen ließen. »Wegen dir kommen wir noch zu spät zum Flughafen. Was soll Alexander denken, wenn seine beiden besten Freunde nicht da sind, wenn er landet?«
»Hab’s doch geschafft«, nuschelte Joe entschuldigend und schob sich einen Streifen Frutti in den Mund. »Außerdem dauert es ’ne ganze Weile, bis Alex und Einstein ausgestiegen sind und ihr Gepäck geholt haben.«
»Hoffentlich«, murrte Rebecca und sah zum Fenster hinaus. Seit ihr Bruder für diese Blondine schwärmte, war er manchmal total neben der Spur.
»Wann landet der Flieger aus Äthiopien denn?«, fragte Joe. Rebecca warf einen Blick auf ihre Uhr. »In einer halben Stunde.«
Joe lehnte sich zurück. »Dann haben wir noch massig Zeit. Die Zugfahrt dauert ja nur zwanzig Minuten.«
»Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt«, sagte Rebecca und zeigte auf den Bildschirm, der vor ihnen von der Decke herabhing. Helikopteraufnahmen zeigten das in der Themse liegende London Eye, während ein Reporter das Unglück kommentierte.
»Ein ganz schönes Riesenteil«, sagte Joe. »Und was für ein Hammer, dass diese drei Typen das überlebt haben.«
Auf dem Bildschirm waren drei Jugendliche zu sehen, die nass und in Decken gehüllt von Feuerwehrleuten zu einem Rettungswagen geführt wurden.
»Was haben die da bloß gemacht?«, fragte sich Joe.
»Dad meinte, die wollten aufs Eye klettern und sich gegenseitig fotografieren«, sagte Rebecca.
Joe schüttelte den Kopf. »Wie bekloppt kann man denn sein?«
»Bringt aber ’ne Menge Klicks.«
»Was nützen dir Klicks, wenn du tot bist?« Gedankenversunken sah Joe aus dem Fenster. »Aber komisch ist das schon.«
»Was ist komisch?«, fragte Rebecca.
»Na ja, wenn nur das Riesenrad umgekippt wäre, würde ich ja noch sagen: Pech gehabt! So was kann passieren. Aber da sind ja noch die ganzen anderen Vorfälle: die South Bank University, Blackfriars Bridge, die British Library.«
Joe hatte recht: In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu spektakulären Einstürzen großer Bauten oder Teilen davon gekommen. Offiziell sprachen die Behörden von Baumängeln. Aber hinter vorgehaltener Hand war die Rede von gezielten Attacken, weshalb die Polizeipräsenz in London massiv ausgeweitet worden war.
»Du meinst, das London Eye wurde absichtlich zum Einsturz gebracht?«, fragte Rebecca.
Joe zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, wie so was gehen soll, außer mit sehr viel Sprengstoff. Und gesprengt wurde es ja offenbar nicht. In den Nachrichten haben sie von einer defekten Aufhängung gesprochen.«
»Wenn das stimmt, ist London ziemlich altersschwach«, sagte Rebecca und fügte nachdenklich hinzu: »Aber wenn tatsächlich irgendjemand dahintersteckt – was hat er dann vor?«
»Das ist die große Frage«, sagte Joe. »Falls es überhaupt einen Zusammenhang gibt.« Er stand auf und ging zur Tür.
»Wo willst du hin?«, fragte Rebecca überrascht.
»Umsteigen«, sagte Joe. »Oder willst du bis nach Stratford hoch?«
An der Station Canning Town stiegen sie in die Docklands Light Railway Richtung Woolwich Arsenal und erreichten nach drei Stationen ihr Ziel: den London City Airport, einen kleinen privaten Flughafen mitten im Hafenbecken von London Borough of Newham. Die Start- und Landebahn war nicht besonders lang, weshalb nur Flugzeuge bis zu einer bestimmten Größe zugelassen waren. Dafür lag der Flughafen so nah an der Londoner Innenstadt wie kein anderer – und damit auch nicht weit von Howard’s End entfernt, wo sowohl Joe und Rebecca als auch Alexander und Einstein wohnten.
Erst vor wenigen Wochen waren die beiden Geschwister mit ihren Eltern von Bristol nach London gezogen und hatten in Howard’s End Alexander kennengelernt, der gemeinsam mit seinem Butler Einar Stein, der von allen nur Einstein genannt wurde, in einem ziemlich großen und ziemlich alten Haus am Ende der Straße wohnte. Fast sofort waren sie in ein aufregendes Abenteuer geraten, bei dem Alexander herausfand, wieso ihn seine Eltern ein Jahr zuvor ohne irgendeine Erklärung verlassen hatten. Ein spanischer Eroberer hatte es auf eine antike Flasche abgesehen und war bereit, über Leichen zu gehen, um sie zu bekommen. Und genau diese Flasche befand sich im Besitz von Alexanders Eltern. Nachdem der Spanier bei einem Tunneleinsturz unter gewaltigen Erdmassen begraben worden war, machten sich Alexander und Einstein auf den Weg, um die Eltern des Jungen zu suchen und ihnen zu sagen, dass die Gefahr vorüber war und sie nach Amarak zurückkehren konnten, um wieder als richtige Familie zu leben.
Zweimal hatte sich Alexander von unterwegs gemeldet: einmal aus Boston und einmal aus Melbourne. Dann hatte er fast fünf Wochen nichts von sich hören lassen – bis gestern, als Joe und Rebecca folgende SMS von ihm erhalten hatten:
Komme morgen aus AA zurück. Habe interessante Neuigkeiten. Holt mich bitte um 16 Uhr LCA ab. Alex
LCA stand für London City Airport. Und als Joe und Rebecca aus der Metro stiegen und zum Terminal hinübergingen, war es kurz vor vier. Von Westen her sahen sie den A318 heranschweben und auf der Betonpiste landen. Das Flugzeug wendete und rollte langsam auf das Terminal zu. Joe und Rebecca gingen zum Ausgangsbereich und warteten. Ein paar Minuten später strömten die Fluggäste heraus.
Erst jetzt spürten sie die Aufregung und Vorfreude, den Freund wiederzusehen. Umso größer war die Enttäuschung, als er nicht kam.
»War das die falsche Maschine?«, fragte Rebecca, nachdem der letzte Passagier die Tür passiert hatte. Joe hob den Blick zur elektronischen Anzeigetafel.
»Das war die 16-Uhr-Maschine aus Addis Abadi«, las er die Angaben. »Es gibt sonst keinen Flug aus einer Stadt, die mit AA beginnt.« Nachdenklich senkte er den Kopf. »Vielleicht hat sich Alexander im Tag geirrt«, überlegte er.
»Ich ruf ihn an«, sagte Rebecca und zog ihr Smartphone aus der Tasche. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür ein weiteres Mal und ein Mann kam heraus, groß und dürr und in einem unmodischen Anzug steckend. Er schob einen Rollwagen mit Gepäck vor sich her. Sein Gesicht wirkte gehetzt.
»Einstein!«, riefen Joe und Rebecca wie aus einem Mund.
»Gott sei Dank sind Sie da«, sagte der Mann und kam hinter der Absperrung hervor.
»Wieso sollten wir nicht da sein?«, fragte Rebecca. »Sie wissen doch bestimmt, dass Alex uns informiert hat.«
Einstein nickte »Natürlich, ich dachte nur … ich wusste nicht …« Er rang nach Worten.
»Was ist passiert?«, fragte Joe besorgt. »Wo ist Alexander?«
»Er ist weg«, erwiderte der alte Mann mit ernster Miene.
»Weg?«, fragte Rebecca. »Was soll das heißen?«
»Es war alles normal«, berichtete Einstein. »Das Flugzeug landete, wir stiegen aus, und während ich das Gepäck holte, wollte der junge Herr kurz auf die Toilette. Es dauerte ein paar Minuten, bis unsere Koffer kamen. Als ich sie auf den Rollwagen gestellt hatte, drehte ich mich um und suchte nach dem jungen Herrn. Aber er war nirgends zu sehen. Also schob ich den Wagen zu den Toiletten. Doch als ich dort nach Herrn Alexander rief, bekam ich keine Antwort. Es blieb absolut still. Es war niemand drin.«
»Haben Sie nachgesehen?«, fragte Joe. »In den Kabinen?«
»Wenn Alexander in einer Kabine gewesen wäre, hätte er sich doch gemeldet, als Einstein ihn gerufen hat«, sagte Rebecca.
»Vielleicht konnte er nicht«, sagte Joe nachdenklich.
»Wieso nicht?«, fragte Einstein.
»Aus demselben Grund, aus dem er nicht wieder rausgekommen ist«, erwiderte Joe. »Ich finde, wir sollten nachsehen. Sicher ist sicher.«
Es war nicht einfach, das Personal des Flughafens davon zu überzeugen, sie in den Sicherheitsbereich zu lassen. Erst nachdem Einstein den Beamten die Situation erklärt und ihnen seinen Pass und das Flugticket gezeigt hatte, waren sie bereit, ihn und Joe zur Toilette zu bringen – in Begleitung! Rebecca sollte währenddessen mit dem Gepäck bei einem anderen Beamten warten.
Als Joe die Tür öffnete, fuhr ihm ein eisiger Wind ins Gesicht.
»Dann mal los, Junge, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit«, trieb ihn der Sicherheitsbeamte an.
Joe betrat den Toilettenraum. »Alexander?«, fragte er und lauschte. Keine Antwort. »Hey, Alex, ich bin’s, Joe«, rief er lauter. »Falls du dich versteckt hast, kannst du jetzt rauskommen.« Wieder lauschte er, wieder kam keine Reaktion.
Joe ging zur ersten Kabinentür und drückte sie mit der Hand auf.
»Leer«, sagte er und öffnete die nächste. Auch hier war niemand. Dafür war es kalt in der Toilette. Sehr kalt. Joe fröstelte. Er zog den Reißverschluss seiner Jacke nach oben. Dann öffnete er die dritte Kabinentür. Leer. Joe wollte die Tür schon wieder schließen, als er etwas auf dem Boden liegen sah.
»Was ist das denn?«, murmelte er und ging in die Knie. Da lag eine kleine glitzernde Scherbe am Boden. Sie hatte die Größe eines Fingernagels und war sehr hart.
Hart und kalt.
Plötzlich hörte er ein Geräusch, als würde jemand mit nassen Füßen über den gekachelten Boden tapsen. Es kam aus der Nachbarkabine. Joe richtete sich auf, verließ die Toilette und legte seine Hand an die glatte Oberfläche der Nachbartür.
»Was ist da?«, fragte der Sicherheitsbeamte.
»Ich weiß nicht«, sagte Joe. Sein Herz schlug schneller.
»Warum zögerst du?«, wollte der Sicherheitsbeamte wissen. »Stimmt was nicht?«
Aber Joe antwortete nicht. Seine Muskeln waren angespannt, sein Blick nach vorn gerichtet. Er hielt den Atem an und … stieß die Tür auf.
Ein graues Etwas flatterte hoch und Joe ins Gesicht. Mit den Armen schlagend wehrte er es ab.
»Herr Jonathan!«, rief Einstein und rannte gemeinsam mit dem Sicherheitsbeamten zu ihm.
»War bloß ’ne Ente«, sagte Joe und dann sah er auch, woher sie – gemeinsam mit der Kälte – gekommen war: In der hinteren Kabinenwand klaffte ein mannshohes Loch, das mit großer Kraft in die Toilettenrückseite gerissen worden sein musste. Direkt dahinter plätscherte das dunkle Wasser des Hafenbeckens.
2
Inspektor Clash kratzte sich mit dem Bleistift an der Stirn. »Das ist ja mal ’ne ziemlich merkwürdige Angelegenheit«, sagte er, nachdem ihm Einstein von Alexanders Verschwinden berichtet hatte. Das Sicherheitspersonal hatte die Polizei gleich nach Joes Entdeckung alarmiert. Und gekommen war Inspektor Clash, der auch schon die Untersuchung nach dem Zusammensturz des Tunnelsystems unter Howard’s End geleitet hatte.
»Wer entführt einen zwölfjährigen Jungen, indem er die Rückwand einer Toilettenkabine einreißt?« Er sah zu Joe und Rebecca. »Der Höllenhund war’s jedenfalls nicht.« Damit spielte er auf den Albinohund von José Madrigal LaPorta an, der ebenfalls unter den Erdmassen begraben worden war. Die Polizei hatte seine Leiche später geborgen, ganz im Gegensatz zu LaPortas sterblichen Überresten, von denen jede Spur fehlte.
»Aber etwas Ähnliches«, sagte Joe. »Sehen Sie sich das Loch doch an: Sieht aus, als sei jemand mit großer Kraft durch die Rückwand gekracht und ins Hafenbecken gesprungen.«
Der Inspektor steckte den Kopf durch die Öffnung. »Und wo ist er hin?«
»Weggeschwommen oder abgetaucht«, sagte Rebecca.
»Mit Alexander«, fügte Joe hinzu.
Clash zog den Kopf zurück. »Wisst ihr, was ich komisch finde? Dass es ausgerechnet wieder ihr seid. Erst diese Geschichte im Schmugglernetz, jetzt diese Sache hier. Und in der Zwischenzeit spielt auch noch die halbe Stadt verrückt und das London Eye fällt in die Themse.«
Joe spitzte die Ohren. »Sie meinen, es gibt einen Zusammenhang?«
»Das habe ich nicht gesagt«, erwiderte der Inspektor. »Außerdem: Was soll der Einsturz eines Riesenrads mit dem Verschwinden eines Jungen zu tun haben?«
»Was werden Sie jetzt tun?«, fragte Einstein mit besorgter Miene.
»Wir werden natürlich nach Alexander suchen«, sagte Clash. »Ich gebe gleich eine Fahndung raus. Sobald wir eine Spur haben, informieren wir Sie. Falls der Junge in der Zwischenzeit bei Ihnen auftaucht, melden Sie uns das bitte unverzüglich.«
Einstein nickte. »Selbstverständlich.«
»Was ist mit dem Grund?«, fragte Rebecca.
Clash zog die Stirn kraus. »Welcher Grund?«
»Der Grund des Hafenbeckens«, sagte Rebecca. »Wenn etwas aus der Toilette ins Hafenbecken gesprungen ist, wäre es doch möglich, dass es noch irgendwo da unten ist.«
»Kann auch sein, dass der Entführer in einem Boot abgehauen ist«, erwiderte Clash. »Oder zur anderen Seite des Beckens geschwommen und zwischen den Häusern verschwunden ist.«
Rebecca zog die Stirn kraus. »Sie wollen den Hafengrund also nicht absuchen?«
»Solange ich keinen handfesten Hinweis habe, dass sich da unten etwas befinden könnte, sehe ich dafür keine Veranlassung. Ist immerhin ein ziemlicher Aufwand, einen Taucher zu holen und da runterzuschicken.« Er schüttelte den Kopf. »Erst einmal suchen wir das Flughafengelände ab. Wenn wir da nichts finden, sehen wir weiter.«
»Solange ich keinen handfesten Hinweis habe«, äffte Rebecca Clash nach, als sie, Joe und Einstein das Terminal verließen und zur Metro gingen. »Bis dahin kann alles Mögliche passieren. Wollen wir wirklich darauf warten?«
»Du meinst, wir sollen selbst nach Alexander suchen?«, fragte Joe.
»Na, was denn sonst«, gab Rebecca energisch zurück.
»Ich denke, wir sollten das der Polizei überlassen«, sagte Einstein. »Wenn es sich wirklich um eine Entführung handelt, ist damit nicht zu spaßen.«
»Was schlagen Sie vor?«, fragte Rebecca den Butler. »Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun?«
»Wir fahren nach Amarak«, gab Einstein zurück. »Dort berichte ich Ihnen alles, was sich auf unserer Reise zugetragen hat. Vielleicht entdecken wir einen Hinweis, wer hinter der Entführung stecken könnte.«
»Sie haben recht«, sagte Joe. »Einfach blind loslegen, ohne zu wissen, wonach man eigentlich sucht, bringt nichts. Wir helfen Alex am besten, wenn wir einen kühlen Kopf behalten.«
»Also gut«, seufzte Rebecca. »Ich hoffe, die Polizei findet ihn bald. Ich kriege Bauchschmerzen wenn ich daran denke, was alles passiert sein könnte.«
Howard’s End war eine Sackgasse im Osten von London. Sie grenzte mit einer Straßenseite an einen alten Friedhof. Gegenüber reihten sich einige alte, große Häuser mit verwilderten Gärten. Hohe dunkle Eichen säumten das Kopfsteinpflaster.
Das Haus der Bookmans lag etwa in der Mitte der Straße. Ganz am Ende stand Amarak, ein zweistöckiger Klinkerbau, der von einem großzügigen Grundstück umgeben war. Zahlreiche kleine Türme und Erker schoben sich aus Dach und Backsteinfassade. Alles in allem wirkte das Gebäude, als gehöre es in eine andere Zeit.
Dieser Eindruck setzte sich auch im Inneren fort: Amarak war vollgestopft mit Artefakten, die Alexanders Eltern, ein berühmtes Archäologenpaar, während ihrer vielen Reisen gesammelt hatten. An den Wänden hingen primitive Speere und Schilde, darunter standen verzierte Kommoden. Auf mit Messing beschlagenen Truhen ruhten silberne Leuchter und afrikanische Schalen, hohe Glasvitrinen beherbergten Masken, Schmuck und Edelsteine. Neben einer Ritterrüstung lehnte ein offener Sarkophag an der Wand, aus dem noch Reste des Stoffes baumelten, mit dem einst der Leichnam eines ägyptischen Herrschers eingewickelt worden war. Tierskelette belagerten hohe Regale und unter der Decke hing der vier Meter lange Schädel eines Blauwals. Amarak war viel mehr als die großzügige Behausung eines sammelwütigen Ehepaars: Es war das über viele Jahre gewachsene Museum zweier begeisterter Weltreisender.
Einstein öffnete die schwere Eingangstür und bat Joe und Rebecca hinein.
»Verzeihen Sie den Geruch«, entschuldigte er sich. »Nach fünf Wochen ist die Luft ziemlich abgestanden. Ich werde später lüften.«
Einstein siezte alle, sogar Alexander. Das war Joe und Rebecca erst komisch vorgekommen. Aber mittlerweile hatten sie sich daran gewöhnt.
»War in der Zwischenzeit niemand hier?«, fragte Joe erstaunt, als er dem hochgewachsenen Butler durch den langen, mit dicken Teppichen ausgelegten Flur folgte.
»Während unserer Abwesenheit stand das Haus leer«, erwiderte Einstein und öffnete die Tür zur Küche. »Setzen Sie sich, ich mache uns eine Erfrischung, bevor ich Ihnen alles erzähle.«
Nachdem Einstein eine seiner berühmten Limonaden zubereitet hatte, setzte er sich zu seinem Besuch an den Küchentisch und begann den Bericht.
»Während unserer Reise haben wir die Erde einmal umrundet. Von London aus sind wir nach Madrid geflogen, dann nach Kuba, Costa Rica und Kolumbien. In Bogota fanden wir Hinweise auf das Naturhistorische Museum in Boston und von dort führte uns die Suche weiter über Kanada nach Grönland und Island. In Göteborg machten wir einen Zwischenstopp und besuchten einen meiner Cousins.« Er schluckte. »Ihnen ist ja bekannt, dass ich in Schweden geboren wurde und meine Familie …« Er führte den Satz nicht zu Ende. Joe und Rebecca wussten, dass Einsteins Familie bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen war, während er Alex’ Eltern bei einer archäologischen Ausgrabung in Aksum geholfen hatte.