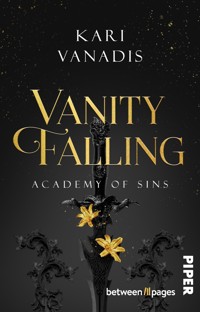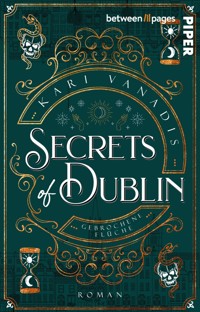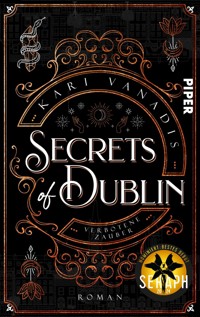
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Wundervoll
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dunkle Magie, ein geheimnisvolles Artefakt und eine Ermittlerin wider Willen ... schwarzhumorige Urban Fantasy für Fans von Ben Aaronovitch und Benedict Jacka. Nominiert für SERAPH 2024 in der Kategorie »Bestes Debüt« »Der eigene Name, an einen Dämon gebunden.« Victor schüttelte den Kopf. Ich lachte trocken auf. »Wow, okay, sag doch gleich, dass ich einen grausamen Tod sterben werde.« Die magiebegabte Leslie arbeitet im Antiquitätenladen Pot of Gold, wo sie sich mit lästigen Kunden herumschlägt und ihrer Leidenschaft für sarkastische Kommentare und magische Artefakte nachgeht. Letztere wird ihr zum Verhängnis, als sie trotz Warnung ein geheimnisvolles Ouijabrett öffnet. Dass es sich in den dämonischen Nathaniel verwandelt, der einem nervigen Teenager erschreckend ähnelt, hat sie dabei nicht geahnt. Und kurz darauf kreuzt auch noch der Privatdetektiv Victor auf, der sie erpresst, mit ihm zusammenzuarbeiten: Der Vorbesitzer des Hexenbretts ist ermordet worden, und damit Leslie sein Schicksal nicht teilt, müssen sie den Geist eines Werwolfs, einen satanistischen Kult und jede Menge Gefühlschaos überwinden. »Wunderbarer und anschaulicher Schreibstil, eine spannende Geschichte, neues Rund um Magie und Co - für mich ein rundum gelungenes Buch, welches ich absolut weiter empfehlen kann!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Also ich habe das Buch verschlungen und geliebt. Gerne würde ich mehr über die Herrschaften aus dem Buch lesen. So wirklich loslassen will ich sie nicht und frage mich, wie es mit denen weitergeht. Neue Abenteuer...« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Der Spannungsaufbau ist sehr gelungen und ich war sehr neugierig auf die Auflösung. Diese ist der Autorin hervorragend gelungen und ich bin auf weitere Geschichten aus ihrer Feder gespannt.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Secrets of Dublin: Verbotene Zauber« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Sprachredaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Covermotiv: Freepik (coolvector, rawpixel.com, morsperspective); Shutterstock (Franzi)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Triggerwarnung
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Triggerwarnung
Dieser Text enthält Themen, die triggernd wirken können, eine Aufzählung findet sich im Folgenden.
Wir wünschen ein bestmögliches Leseerlebnis.
Verlust von engen Familienangehörigen
Trauer und Trauerverarbeitung
Physische Gewalt und Mord, Blut
Bandenkriminalität, krimineller Untergrund
Medikamentenmissbrauch, Sucht
Für alle, die anders sind.
Auch wenn es klüger erscheinen mag, manche Dinge verschlossen zu halten – seid mutig und neugierig.
Und euch bewusst, wann ihr es nicht sein solltet.
Um es mit Leslies Worten zu sagen: »Fuck.«
Kapitel 1
»Unter keinen Umständen öffnen!«
Ich sah von dem Kunden zu dem Gegenstand, den er mir über den Verkaufstresen hinweg entgegenschob. Seine Hand ließ er darauf liegen, als wollte er sich überhaupt nicht davon trennen. Oder als befürchtete er, dass ich genau das tun würde, was er mir soeben verboten hatte. Tief in meiner Brust kitzelte es. Wie sollte ich dieser Herausforderung widerstehen?
Räuspernd verschränkte ich die Arme. »Sie sind sich sicher, dass Sie dieses … was sagten Sie noch gleich?« Unter seiner Hand erkannte ich nur abgenutztes Holz.
Sein Mantel raschelte, als er sich unruhig bewegte. »Ich sagte gar nichts.« Ich fixierte ihn abwartend. Er schluckte und gab zwischen zusammengebissenen Zähnen zu: »Es ist ein Ouija-Brett.«
»Ah«, machte ich und ließ mir nicht im Geringsten anmerken, was ich davon hielt. Ich hatte mit etwas Spektakulärerem gerechnet, die Hexenbretter stapelten sich hinten im Laden nur so. »Und Sie sind sich sicher, dass Sie es wirklich verpfänden wollen?« Es wäre nicht das erste Mal, dass es sich ein Kunde im letzten Moment anders überlegte, sobald er realisierte, dass Omis Erbstück doch einen höheren emotionalen Wert hatte als angenommen. Oder einen weitaus niedrigeren finanziellen als erhofft.
Schon als der rotblonde Typ mit den umnachteten Gesichtszügen und den feinen Klamotten den Pot of Gold betreten hatte, hatte er sich nervös umgesehen. Das war nichts, womit ich nicht umgehen konnte. Gelassen hatte ich darauf gewartet, dass er seinen Streifzug durch den Laden beendete und endlich zum Geschäftlichen kam. Andersweltler warteten häufig, bis alle Unwissenden gegangen waren. Und dass ich hier einen Werwolf vor mir hatte, das hatte mir seine Aura verraten, sobald er durch die Ladentür getreten war.
»Ich will das ja nur verpfänden. Das heißt doch, dass ich es jederzeit wieder abholen kann, oder nicht?«
Wow, er hat das Prinzip der Pfandleihe begriffen. Ich verbiss mir einen sarkastischen Kommentar – und das war heute bereits der fünfte. Atmen, Leslie. Später, wenn ich zu Hause wäre, würde sich meine Mitbewohnerin Ciara alle anhören müssen. »Klar, innerhalb der Frist können Sie Ihr Ouija-Brett jederzeit wieder auslösen, inklusive Zinsen, versteht sich. Das da«, und damit deutete ich mit einem schwachen Wink hinter ihn, »sind Antiquitäten, die wir ankaufen und wieder verkaufen. Werden die Pfänder nicht rechtzeitig ausgelöst, verkaufen wir sie weiter.«
Ich wollte ihn damit aus der Reserve locken, doch zu meiner Verwunderung schüttelte er nur den Kopf. »Das darf nicht passieren.«
Hatte er mir nicht zugehört? »Dann lösen Sie das Ouija-Brett rechtzeitig wieder aus.« Ich zuckte nur mit den Schultern. Das war nun wirklich nicht mein Problem. Mit dem Kinn nickte ich zum Tresen. »Kann ich mir das jetzt vielleicht erst mal ansehen?«
Kurz verkrampften sich seine Finger, die in ledernen Stulpenhandschuhen steckten. »Nicht öffnen!«, erinnerte er noch einmal und gab den Gegenstand endlich frei.
Der tut ja gerade so, als wäre das die Büchse der Pandora. Bevor er es sich anders überlegte, schnappte ich mir das gute Stück. Ich strich über das dunkle Holz, das leicht unter meinen Fingern nachfederte. Entgegen den Ouija-Brettern, die ich kannte, war dieses hier ein nach außen hin einfacher Holzkasten, der mit einem rostigen Scharnier verschlossen war. Auf den ersten Blick hätte ich ihn für einen Schreibkasten gehalten, den man in der Mitte aufklappte, um Tintenfässer und Federn zu verstauen. Solche Stücke boten auch meistens eine mit Samt ausgekleidete Schreibfläche für den betuchten Reisenden des 18. Jahrhunderts. Auf dieses Alter schätzte ich den Kasten – Hobelkratzer und andere Werkzeugspuren auf der rauen Oberfläche verrieten mir dies, ebenso wie die Bauweise. Eher frühes 18. Jahrhundert, da der Stil nicht zu den aufwendigen Mahagonischnitzereien passte, die ab 1725 kennzeichnend für irische Holzarbeiten gewesen waren. Das hier war kein Mahagoni, sondern Mooreiche: Holz, das an die sechstausend Jahre lang unter den Torfmooren geschlummert hatte, bevor es von Landwirten ausgebuddelt worden war. Die Konservierung hatte es dunkelbraun, beinahe schwarz gefärbt, trotzdem wirkte es nicht wie lackiert, sondern trug eine lebendige Maserung. Es war weder mit Schnitzereien irischer Symbole übersät noch war irgendein Name darin eingraviert.
»Ungewöhnlich«, murmelte ich.
»Bitte?«
»Ungewöhnliches Modell. Ohne es zu öffnen, könnte ich nicht einmal sagen, ob es sich wirklich um ein Ouija-Brett handelt. Das sollte zeitlich auch gar nicht passen, Ouija-Bretter gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert.«
Der eindringliche Blick seiner trüben Augen traf mich. »Nicht …«
»Öffnen! Schon verstanden!« Ich seufzte. Dabei kribbelte es mir in den Fingern, genau das zu tun. Im wahrsten Sinne des Wortes: Die Magie prickelte auf meiner Haut und lockte mich mit dunklen Versprechungen in einer Sprache, die ich noch nicht verstand. Selten fiel mir etwas in die Hände, dessen Magie ich nicht sofort identifizieren konnte. Frustrierend, hatte ich mich doch auf den Moment gefreut, das Artefakt zu berühren.
Zeit für Plan B.
»Was kann es denn?«, fragte ich möglichst beiläufig.
»Was man Ouija-Brettern eben so nachsagt. Mit Geistern kommunizieren und so etwas.« Sein Blick huschte durch den Laden. »Blödsinn, wenn Sie mich fragen.«
»Hm, das kommt ganz darauf an, wie magisch es ist.«
Der Typ erstarrte in der Bewegung. »Wie kommen Sie darauf, dass es magisch ist?«
Das Gefühl, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte, verfestigte sich. Erst seine auffällige Nervosität und jetzt diese merkwürdigen Versuche, etwas zu verheimlichen. Die Ouija-Bretter, die wir im Laden führten, waren zum Teil nichtmagisch, zum Teil mit einfachen Zaubern versehen. Ihr amerikanischer Erfinder – aktuelle Quellen waren sich uneinig, ob es sich um einen magisch begabten oder normalsterblichen Mann handelte – hatte damals ein Vermögen mit ihnen unter den Unwissenden gemacht. Dass Andersweltler die Hexenbretter als Zauberutensilien nutzten, war nur eine Frage der Zeit gewesen, auch wenn sie eher als Medium, nicht als echtes Artefakt dienten. Und mit echten schwarzmagischen Gegenständen zur Geisterbeschwörung handelten wir hier ohnehin nicht. Der Besitz solcher Artefakte war verboten, und wäre meine Mutter hier gewesen, hätte sie den Kunden höflich, aber bestimmt abgewiesen.
Mich machte die unbekannte Macht viel zu neugierig, als dass ich davor zurückschrecken würde, etwas Verbotenes zu tun, solang ich mich mit gespielter Unwissenheit herausreden konnte. Nur wollte ich ihm nicht auf die Nase binden, wie ich die Magie in dem Artefakt erkannt hatte. Offiziell war ich nur eine Eingeweihte – eine Normalsterbliche ohne magische Begabung, die das Glück besaß, eine Hexe als Mutter zu haben. »Sie sind in einen magischen Antiquitätenladen gekommen, und ich bin Expertin für magische Artefakte. Ist das nicht … recht offensichtlich?«
Er rümpfte die Nase, und sein Blick glitt zu meinem Mitarbeiterschildchen, auf dem der Name Leslie Delwood prangte. »Wird hier immer so offen mit Kunden aus der Anderswelt umgegangen? Wäre nicht mehr … Diskretion angemessen?«
Jackpot, eine Wird-hier-immer-so-Frage. Das gibt einen Euro in das Phrasenschwein. Ich legte den Holzkasten vor mir ab und stützte beide Unterarme darüber auf. Dabei lehnte ich mich ein Stück über die Theke zu ihm vor. »Wir sind hier ausgesprochen diskret. Wollen Sie mir etwas anderes unterstellen, oder sind Sie hierhergekommen, weil Sie wissen, dass Sie Ihren Kram hier in vertrauenswürdige Hände geben?« Mit einem schwarzmagischen Gegenstand wäre er im Untergrund besser beraten gewesen, allerdings schien es ihm wichtig zu sein, seinen Besitz irgendwann wiederzusehen. Händler im Untergrund boten dafür keine Garantie.
Er öffnete und schloss den Mund wie ein Fisch an Land, doch ich war noch nicht fertig. »Ich bin diskret genug, um dieses Ouija-Brett in die Pfandleihe zu nehmen, ohne es zu öffnen. Und diskret genug, um nicht zu fragen, woher Sie dieses ganz offensichtlich nichtmagische Artefakt haben.«
Sein Gesicht färbte sich rot. Damit hatte ich ihn aus dem Konzept gebracht. Viel zu einfach, allerdings wusste ich, wann ich einen Kunden auf den Boden zurückholen musste und wann ich besser den Mund hielt. Na ja, meistens jedenfalls. Wenn man meine Mutter fragte, war mein Gespür für Klappe halten verbesserungswürdig.
Nun raschelte sein Mantel wieder unruhig. »Schön, schon gut, stellen Sie mir einfach den Pfandleihschein aus.«
»Äh, wollen Sie nicht erst mal wissen, wie viel ich Ihnen für das Ouija-Brett geben würde und wie hoch die Zinsen …«
»Machen Sie nur, ich bin nicht hier, um zu verhandeln.«
Nein, das war er offensichtlich nicht. Aus unerfindlichen Gründen wollte er den Kasten so schnell wie möglich verwahrt wissen. Wer war ich, ihm diesen Wunsch zu verwehren? Wortlos riss ich einen leeren Pfandleihschein aus dem Block neben der Kasse und klatschte ihn vor mir auf den Tresen.
»Name?«
Statt zu antworten, bat er stumm um Stift und Zettel und schrieb die Daten selbst auf. Ziemlich sicher war das weder sein echter Name noch seine echte Adresse. Ich schrieb die Gegenstandsbeschreibung auf – verschlossener Holzkasten aus Mooreiche, vermutlich 18. Jahrhundert, laut Kunde ein Ouija-Brett. Dann verharrte ich über dem Darlehensbetrag.
»Einfache Ouija-Bretter – ganz ohne Magie – bekommt man bereits ab zwanzig Euro. Ich kann das höchstens als antiquarischen Holzkasten bewerten. Das Holz ist schön, aber nicht gut erhalten, und ohne das Innere zu begutachten, kann ich es zeitlich nur ungenau einordnen.« Das stimmte nicht ganz, was er nicht wissen musste. Allein die Tatsache, dass er nicht geöffnet werden durfte, minderte den Wert ohnehin. »Das Metallscharnier könnte nachträglich angebracht worden sein, wenn ich mir das so ansehe. Und ich vermute, dass der Kasten aufgrund seines Alters erst später zu einem Ouija-Brett verarbeitet worden ist.«
Wir hatten bereits gut erhaltene Kästen und Schachteln mit aufwendigen Kerbschnitzereien aus dem 18. Jahrhundert für zweitausend bis dreitausend Euro verkauft. Doch hier waren die Rahmenbedingungen anders, und ich wäre eine Idiotin, würde ich diesen ominösen Kunden nicht für seine Gleichgültigkeit bestrafen. »Der Weiterverkaufspreis, abzüglich des Risikos, das ich eingehe … fünfzig Euro.« Ohne seine Erwiderung abzuwarten, schrieb ich die Ziffern schwungvoll auf das Papier.
Es war ein Witz. Niemand, erst recht nicht jemand wie er, verpfändete einen solchen Gegenstand für so einen geringen Betrag. Trotzdem erhob er keinerlei Einsprüche, als ich den Stempel darunterknallte und eine halbherzige Unterschrift hinkritzelte. Er nickte mir nur stumm zu und nahm den Schein entgegen. War das Erleichterung in seinen angespannten Zügen?
»Schön, ich bin die Tage wieder da.« Damit verschwand er, ohne sich noch einmal umzudrehen, aus dem Laden. Ich wartete die Sekunden ab, bis die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen und er an dem halb verhangenen Schaufenster vorbeigegangen war.
Dann schielte ich auf den Holzkasten hinab, der immer noch vor mir lag. Ein Grinsen zupfte an meinen Lippen. »Natürlich bist du das.«
Kapitel 2
Ich zuckte zusammen, als etwas auf der Theke landete und dabei beinahe die fein konstruierte Messingwaage umgeworfen hätte. Zwei riesige Augen blinzelten mich vorwurfsvoll an. Zumindest bildete ich mir ein, die Missbilligung darin zu sehen.
»Scheiße, das war so klar, dass du jetzt aus deinem Versteck kommst, nicht wahr, Sekel?«
Er hatte die Form einer blaugrauen Katze angenommen, allerdings mit viel zu großen und viel zu runden Augen. Seine Lieblingsgestalt, wenn er hier frei im Laden herumlief, doch mich konnte er nicht täuschen. Sekel war ein Púca, ein Kobold, der seine Form wandeln konnte. In Wahrheit sah er wie ein dickes Äffchen mit spitzen, langen Ohren und winzigen Flügeln aus. Für mich war Sekel vor allem eins: mein Aufpasser, der mich bei jedem krummen Ding an meine Mutter verpetzte. Wir führten eine intensive Hassliebe, die allein darauf gründete, dass ich ihn loszuwerden versuchte und er mir immer wieder aufs Neue das Leben schwer machte.
Seine Schnurrhaare zitterten, als würde er in sich hineinkichern.
»Komm, miez, miez. Ich habe hinten bestimmt noch ein bisschen Katzenfutter.«
Sekel legte den Kopf schief und sein Schwanz schlug bedrohlich hin und her. Ich vergrub stöhnend das Gesicht in den Händen, wobei ich mich erneut auf den Holzkasten stützte. Die Magie brodelte unter meinen Ellbogen, machte mich viel zu ungeduldig. Púca waren stolze kleine Mistviecher und wollten angemessen behandelt werden. Mittlerweile sah ich davon ab, Sekel allzu offensichtlich zu beleidigen.
Mit einem schnellen Blick checkte ich die Zeit auf meinem Smartphone. Meine Schicht endete in einer Stunde, dann wäre meine Mutter hier, um mich abzulösen. Sekel hatte mitbekommen, wie ich den Pfandgegenstand entgegengenommen hatte, also durfte der unter gar keinen Umständen den Laden verlassen, schwarzmagisch oder nicht. Genauso wenig durfte der Kobold mitbekommen, wie ich den Kasten öffnete.
Der Laden war vollgestopft bis unter die Decke. An den Wänden reihten sich Regale, in denen nicht nur Unmengen von Büchern lagerten, sondern auch allerhand Dekokram. Die Auswahl reichte von Waterford-Kristallkaraffen und -gläsern über Sammelsurien aus dekorativen Silberrahmen, hölzernen Briefbeschwerern und Kerzenständern bis zu fein gearbeiteten Schmuckschatullen. Alles, was in gläsernen Vitrinen verschlossen war, gehörte zu den wertvolleren Gegenständen, darunter vor allem Schmuck. Die Mitte des Raums wurde von antiquarischen Schränken, Kommoden und Sesseln eingenommen, aus der georgianischen Ära, im neoklassizistischen Regency-Stil, und gepolsterte und auf Hochglanz polierte viktorianische Möbelstücke. Darauf standen wiederum Grammofone, Lampen und Teeservices. Das Licht war dämmrig, als läge ein geheimnisvoller Nebel über allem, und stammte von verschiedenen Lampenschirmen.
Ich schnaubte und packte das Ouija-Brett mit beiden Händen. Bei der schnellen Bewegung verengten sich Sekels Augen misstrauisch. Ausdruckslos sah ich auf den Púca hinab. »Das bringe ich am besten sofort ins Lager, bevor es noch in die falschen Hände gerät. Passt du hier kurz auf?«
Er verfolgte mich mit starrem Blick, als ich um den Tresen herumtrat. Dabei drehte sich sein Kopf um einiges weiter, als es für eine Katze angemessen war.
»So solltest du die Kunden lieber nicht begrüßen.«
In unkatzenhafter Manier ließ sich Sekel zu Boden plumpsen und schlüpfte mir voran durch den dunklen Vorhang, der den vorderen Teil des Ladens vom hinteren trennte.
»Hey, was …?« Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Finster stapfte ich hinter ihm her. Die dunklen Dielen knarzten laut.
Der Durchgang in den größeren und weitaus magischeren Bereich befand sich links neben der Kasse und konnte nur von Vertretern der Anderswelt durchquert werden. Für alle anderen lag der schwere Vorhang im Verborgenen, und verirrte sich doch einmal ein Unwissender hierhin, schlug die altehrwürdige Standuhr Alarm. Solang ich hinter der Theke stand, brauchte es sie allerdings nicht. Ich erkannte alles, was nicht menschlich war.
Auf den ersten Blick bot sich das gleiche Bild wie im Vorraum – mit dem essenziellen Unterschied, dass sich hier rein magische Gegenstände aneinanderreihten. Ob eine Spieluhr, deren Lied einschläfernd war, ein Spiegel, der die Reflexion hundertfach im Raum wiedergab und momentan abgedeckt war, oder ein Amulett, das einmal dem Druiden John Toland gehört hatte, nichts war hier normal. Ein eiserner Käfig hielt das levitierende Modell eines Segelschiffs an Ort und Stelle und ein dunkles Tuch eine Porzellanfigur bedeckt, die bei geringstem Lichteinfluss zersplitterte. Daneben fanden sich auch Errungenschaften der Neuzeit, wie ein verzaubertes Telefon, das Tiergeräusche imitierte, und eine Digitalkamera, die Bilder grundsätzlich ohne Personen ablichtete. Letztere war eine Erfindung eines Reiseleiters aus Paris gewesen und eines der letzten Modelle, die noch existierten. Nach einer Beschwerde der Vampirlobby waren fast alle Kameras zerstört worden.
Sekel, der auf einem Beistelltischchen auf mich gewartet hatte, sprang vor mir in die Luft. Sein Körper streckte sich in die Länge, wurde schmaler, und das struppige Fell legte sich zu stumpfen Federn an. Flügel sprossen aus dem Schlangenkörper und fingen ihn gerade noch rechtzeitig ab, bevor er wieder auf dem Boden aufschlug. Der Púca mühte sich heftig flatternd ab, es zumindest auf meine Brusthöhe zu schaffen. Wieder waren seine Augen viel zu groß, und auch sein Bäuchlein hing verdächtig nach unten.
Ich musterte ihn unbeeindruckt. »Netter Versuch. Das musst du wohl noch ein bisschen üben.«
Ja, es gab sie, die Furcht einflößenden Púca in den Gestalten schwarzer Rösser mit rot glühenden Augen. Selbst die Unwissenden kannten Geschichten über sie, denn vor allem zu Samhain erschienen sie auch ihnen und trieben allerlei Schabernack. Púca lebten eigentlich auf dem Land, wo sie einen Teil der Ernte für sich beanspruchten und die Menschen im Gegenzug schützten. Sekel war speziell. Er hatte sich diesen Laden hier zu eigen gemacht und als seine persönliche Behausung auserkoren, wodurch er innerhalb dieser Mauern über bestimmte Kräfte verfügte. Allerdings waren seine Formwandlungen nie perfekt, und sobald er verschiedene Tiere miteinander mischte, wurde es … wild.
Eine ganz und gar nicht schlangenähnliche Zunge fuhr zwischen seinen viel zu breiten Lippen hervor. Ich konnte mir ein amüsiertes Grinsen gerade noch verkneifen und grunzte nur leise, während ich eilig an ihm vorbeiging. Am anderen Ende des Raums befand sich ein weiterer Durchgang. Ich schlüpfte durch die Tür und strauchelte, als sich Sekel zwischen meinen Beinen hindurchschlängelte. Dieser verfluchte kleine … Ich bedachte ihn mit einem finsteren Blick.
Ich stand nun im Lager, einem unspektakulären Raum voller Regale mit Schubfächern und Boxen. Die magischen Pfandstücke gehörten zu den interessantesten Gegenständen im ganzen Laden. Nur leider hatte mir meine Mutter schon vor Jahren verboten, mit ihnen zu experimentieren. Ein zu hohes Risiko für Kollateralschäden an Dingen, die uns auf dem Papier nicht gehörten. Noch nicht gehörten, wie ich sie gern verbesserte. Das Verbot war geblieben, und da ich gern hier arbeitete, respektierte ich es. Meistens jedenfalls.
Ich prüfte den Namen auf dem Pfandleihschein. »Timothy Murphy.« Ich schnaubte. Natürlich hatte er ausgerechnet einen der häufigsten irischen Nachnamen angegeben. Ein wenig mehr Einfallsreichtum hatte ich ihm zugetraut.
Ich steuerte die Regalreihe mit dem Buchstaben M an und ging die Fächer bis zum Ende ab. Sie waren mit den Pfandleihnummern gekennzeichnet. Bei einem leeren hielt ich inne und zog es aus dem Regal.
»Dein verfluchter Ernst, Sekel?« Ein Schlangenkopf lugte mir entgegen. Der Púca glitt aus der Box und blieb daneben sitzen, um mich abwartend zu beobachten. »Jaja, ich lager das Ding ein! Hier, guck doch!«
Ich pfefferte den dunklen Holzkasten an seinen vorgesehenen Platz – kurz hegte ich die Hoffnung, das Scharnier würde dabei einfach von selbst aufspringen. Genervt strich ich mir das kinnlange Haar über die Seite zurück. Dann kümmerte ich mich um den Papierkram.
Solang Sekel mir derart an den Hacken klebte – und ich hatte keine Ahnung, womit ich ihn diesmal wieder verstimmt hatte, vielleicht witterte er auch, dass ich etwas plante –, konnte ich vergessen, das Ouija-Brett zu öffnen.
Um kurz nach drei klingelte mein Smartphone: Mom.
»Hey, Leslie, Schatz, tut mir leid, ich bin spät dran. Mr Sullivan hat kurzfristig jemanden gesucht, der seine Taschenuhr repariert, und du weißt ja, wie er ist: Wenn er es vermeiden kann, verlässt er das Haus nicht. Also fahre ich schnell vorbei und …«
Ich gab zustimmende Laute von mir, während ich mit einem Kugelschreiber auf die Ecke des Quittungsblocks kritzelte. Meine Mutter erzählte mir irgendetwas von einer Verzauberung, die sich von der Taschenuhr gelöst hatte. Statt Mr Sullivan die Zeit seines nächsten Missgeschicks anzuzeigen, setzte sie ihren Träger alle paar Minuten um eine Sekunde zurück – was zu weitaus mehr Missgeschicken führte, als das Ziffernblatt hergegeben hätte.
»… hältst du die Stellung noch ein wenig oder hattest du für heute schon was vor?«, beendete meine Mutter schließlich ihren Monolog, der vom Rauschen des Dubliner Verkehrs begleitet worden war.
»Oh, fuck, Mom, wie kannst du mir meinen Nachmittag so versauen, ich muss quasi all meine Pläne über den Haufen werfen«, leierte ich mit tonloser Stimme herunter, während ich meine Kritzelei beendete. Eine dicke Katze, die Sekel erstaunlich ähnlich sah, glotzte mir mit verwirrtem Blick entgegen.
Am anderen Ende der Leitung gluckste es. »Schon verstanden. Was willst du?«
Ich überlegte kurz. »Hm, kommst du an dem asiatischen Restaurant in der Charlesmont Street vorbei?«
»Das kann ich einrichten.«
»Cool, dann bring auch gleich was für Ciara mit, sonst muss ich mein Essen wieder mit ihr teilen.« Ich scrollte rasch durch die Speisekarte des Restaurants und zählte meiner Mutter auf, was sie alles mitbringen sollte. Als ich danach aufsah, fiel mein Blick auf Sekel. Er hatte es sich, immer noch als geflügelte Schlange, in einer dunklen Ecke, hoch oben auf einem Regal gemütlich gemacht. Dort sah ihn der Kunde nicht, der gerade den Schmuck in der Glasvitrine begutachtete und meinen Blick irrtümlich auffing.
»Bin sofort bei Ihnen!«, rief ich in seine Richtung. Leiser und an meine Mutter gewandt fügte ich hinzu: »Ach, und kannst du Himbeeren für Sekel mitbringen?« Das Leibgericht des kleinen Quälgeists und eine ultimative Ablenkung.
»Ähm, klar? Nur seit wann …«
»Er ist heute irgendwie schlecht drauf, nervt tierisch«, unterbrach ich sie, denn ich wusste genau, was sie sagen wollte. »Muss jetzt Schluss machen, hab ’nen Kunden.«
Ich ließ mein Smartphone auf der Theke zurück und fragte den betagten Herrn an der Schmuckvitrine, wie ich ihm weiterhelfen könne. Er blickte skeptisch an mir auf und ab, musterte mich von meinen schwarzen Ohrsteckern über die lange Silberkette an meinem Hals, die auf einem schwarzen weiten Shirt lag, bis hinab zu meinen Jogger Pants, die in olivgrünen Schnürboots steckten. Nein, ich gab sicher nicht das typische Bild einer Antiquitätenhändlerin ab. Allerdings hatte ich keine Lust, mich den Erwartungen der Kunden entsprechend zu kleiden, nur um keine blöden Blicke und schnippischen Fragen mehr zu bekommen. Wenn ich wollte, konnte ich mindestens genauso blöd zurückgucken und schnippisch antworten. Meistens reichte es jedoch, und so verhielt es sich auch diesmal, wenn ich zu fachsimpeln begann. Dann waren die Leute entweder zu verwirrt, um mich weiter infrage zu stellen, oder vergaßen ihren ersten Eindruck, während sie in meine Fachsimpelei einstiegen.
Es war nicht nur so, dass ich seit meinem Schulabschluss vor vier Jahren im Pot of Gold arbeitete, ich war hier auch aufgewachsen. Auf diesen Dielen war ich meine ersten Schritte gelaufen, wie meine Mutter immer wieder stolz erwähnte, und hatte später unzählige Nachmittage nach der Schule verbracht. Mein besonderes Gespür, mit dem ich Magie identifizieren konnte, wenn ich einen Gegenstand nur berührte, war wie ein Spiel für mich gewesen – war es heute noch. Trotzdem hätte ich nie gedacht, dass ich einmal selbst hier arbeiten würde. Ich glaubte nicht mehr an das Glück am Ende des Regenbogens, die Zeiten waren vorbei. Sie hatten an dem Tag geendet, als Mary gestorben war.
Am Ende der Beratung hatte ich den Kunden auf dreihundert Euro hochgehandelt und ihn zu Ohrringen überredet, die zu der topasbesetzten Goldkette passten. Ich verstaute das Geld in der Kasse und streckte mich seufzend. Heute war echt wenig los, und wenn meine Mutter erst bis in Dublins Bezirk Ranelagh fahren musste, dort dann von Mr Sullivan drei Tassen Tee angeboten bekam und er ihr seine neuesten antiquarischen Errungenschaften vorführte, würde ich hier noch bis Ladenschluss stehen.
Sekels Augen waren geschlossen.
Ich wagte kaum zu atmen, während ich den Púca anstarrte, der sich während meines Kundengesprächs nicht vom Fleck bewegt hatte. Seine Glubschaugen waren hinter blauen Lidern verschwunden. Ganz vorsichtig setzte ich einen Schritt nach links, dann einen weiteren, glitt über den Dielenboden und tastete mich so bis zum Durchgang.
Okay, das ist keine Übung: schräg links, schräg rechts, die Diele überspringen, neben dem Globus aufsetzen … O ja, ich kannte jeden Winkel des Ladens, jede verräterisch knarrende Diele. Zu jeder einzelnen gab es eine Geschichte, wie und wobei Sekel mich erwischt hatte. Nur so hatte ich mir diesen Spießrutenlauf überhaupt eingeprägt.
Sekunden später stand ich im M-Gang und öffnete die Box mit dem Holzkasten. »So, Timothy Murphy, wollen wir doch mal sehen, was du zu verbergen hast.«
Von dem Moment an, als er mich dazu angehalten hatte, den Kasten nicht zu öffnen, war sein Schicksal besiegelt gewesen. Für mich hatte sofort festgestanden, dass ich genau das tun würde. Kein Gewissen dieser Welt würde mich daran hindern, dieser mysteriösen Magie auf die Spur zu kommen.
Ich hockte mich vor das Regal und legte den Kasten vor mir auf dem Boden ab. Wieder strömte Magie über das Holz und unter meine Haut, und wieder verstand ich nicht, was sie mir sagen wollte. Normalerweise war es wie eine Eingebung, als würde ich auf eine komplizierte mathematische Gleichung blicken, hinter der die Lösung wie aus Zauberhand erschien. Doch diesmal starrte und starrte ich auf die Zahlen und Buchstaben und fühlte mich in meine Schulzeit zurückversetzt: Ich hatte keinen blassen Schimmer.
Ich holte tief Luft, betastete noch einmal das Mooreichenholz und hakte das Scharnier aus. Solang nicht vorherzusehen war, was die Magie bewirkte, konnte das gefährlich werden, vor allem bei verbotener schwarzer Magie. Trotzdem würde ich das jetzt durchziehen. Mit einer schnellen Bewegung, die keine anderen Gedanken zuließ, klappte ich den Deckel des Holzkastens auf.
Nichts geschah.
Es handelte sich tatsächlich um ein Ouija-Brett, auch wenn es mich unglaublich stutzig machte, keine offensichtlichen Spuren dafür zu finden, dass es nachträglich eingearbeitet worden war. Von links nach rechts reihte sich in blasser Schrift auf dem fast schwarzen Untergrund das Alphabet auf, darunter die Ziffern. Dazwischen befanden sich die Wörter Ja, Nein und Auf Wiedersehen. Und ganz oben war ein Name eingeprägt, rußgeschwärzt und kaum zu erkennen, als wäre er ins Holz gebrannt worden: Timothy Murphy.
Drei Gedanken schossen mir zeitgleich durch den Kopf und drohten, sich ineinander zu verheddern.
Das Schiebeteil fehlt, das Brett ist unvollständig.
Hat er sich mit dem Namen einen Scherz erlaubt oder heißt er tatsächlich Timothy Murphy?
Und: Die Magie ist weg!
»Was zum …« Ich fuhr mit beiden Händen über die Buchstaben, als würde ich nach dem Puls eines Sterbenden tasten. Doch da war nichts, nicht der winzigste Funke Magie. Die Gleichung war von der Tafel gelöscht worden. Hatte ich es kaputt gemacht? Verwirrt schloss ich den Kasten – und keine Sekunde später flammte die Magie wieder wie ein grelles Leuchtfeuer auf. Lockte mich höhnisch, den Deckel zu öffnen, um ihr Mysterium zu enthüllen. Doch sobald ich das tat, löste sie sich in Luft auf.
Das Spiel wiederholte sich ein paarmal, bis ich das Artefakt mit einem frustrierten Laut von mir schob. Ich fühlte mich auf einer persönlichen Ebene davon angegriffen, ganz so … als würde sich mir dieses Ouija-Brett absichtlich entziehen!
Doch so schnell gab ich nicht auf. Ich war fest entschlossen, mich nicht an der Nase herumführen zu lassen. Es musste doch irgendeinen Grund geben, warum Timothy den Kasten verschlossen halten wollte. Vielleicht benötigte ich zuerst das Schiebeteil, um die Magie zu aktivieren, oder es brauchte ein ganz bestimmtes Wort, das ich beim Öffnen sagen musste. Fieberhaft ging ich im Kopf die Geschichten verschiedener Artefakte und deren Mechanismen durch. Vielleicht erforderte es tatsächlich eine schwarzmagische Beschwörung, um das Verborgene hervorzulocken …
Sekels tiefes Fauchen riss mich aus meinen Gedanken. In seiner Katzengestalt sprang er vom Regal aus in den Gang. Eine Gänsehaut breitete sich über meine Arme aus, obwohl ich wusste, dass der Púca mir nichts antun würde. Trotzdem brannte sich der Blick seiner Koboldaugen in die meinen. Hektisch rappelte ich mich auf, als Sekel mit einem weiteren Satz auf dem Ouija-Brett landete.
»Es ist verschlossen!«, rief ich. »Ich habe nicht …« Was redete ich da? Es war nichts weiter geschehen. Ich verstand nicht einmal, warum dieser Timothy darauf bestanden hatte, dass der Kasten nicht geöffnet werden durfte. Und Sekel hatte mich schon bei viel schlimmeren Dummheiten erwischt. Warum also fühlte ich mich dann so unwohl in meiner Haut?
»Das blöde Ding ist eh kaputt! Gut, dass ich ihm nicht mehr Geld geboten habe!« Ich wusste nicht, ob ich das zu mir selbst oder dem Púca murmelte.
Ich bückte mich nach dem Ouija-Brett. Sekel fauchte erneut und sein Fell sträubte sich warnend.
Irritiert zuckte ich zurück. »Was ist denn mit dir los?« Warum benahm er sich so seltsam? Dass er mich nicht leiden konnte, war nichts Neues. Wir hatten uns zumindest auf so etwas wie einen Waffenstillstand geeinigt. »Los, runter da, ich will es wieder weglegen!«
Ich machte einen Schritt auf den Púca zu, obwohl mir alles an seiner Haltung riet, auf Abstand zu bleiben. Sofort verstummte sein Fauchen, und er sah mich nur noch an. Anklagend. Unmerklich hielt ich die Luft an.
Erst als er davonsprang und hinter dem nächsten Regal verschwand, atmete ich auf und schluckte schwer. Einen Moment blieb ich noch wie erstarrt stehen, dann fasste ich mir ein Herz und griff kopfschüttelnd nach dem Holzkasten. Beinahe wäre ich vor der Magie zurückgezuckt, obwohl sie sich nicht verändert hatte.
Die Vorahnung eines unbekannten Übels machte sich in mir breit, und obwohl ich meine Untersuchungen gern fortgeführt hätte, verstaute ich das Artefakt wieder. Vielleicht war es wirklich besser, vorerst die Finger davonzulassen.
Kapitel 3
Unser Laden reihte sich in die vielen anderen Antiquitätengeschäfte der Francis Street, deren holzverkleidete Fassaden typisch irisch waren wie kaum etwas anderes. Etwas abseits der Touristenhotspots rund um Dublins Temple Bar bummelten hier trotzdem viele Menschen entlang, entspannten in den hippen Cafés oder fotografierten Street Art. Wer sich in den Pot of Gold verirrte, erwartete als Unwissender nicht mehr als einen weiteren Antiquitätenladen. Die Eingeweihten und Andersweltler wussten um das zweite magische Gesicht. Wir waren nicht der einzige Laden für Artefakte und magischen Trödel – aber mit Abstand der beste, wenn man meine Mutter fragte. Und das sollte man besser nicht tun, denn sie konnte sehr leidenschaftlich bei diesem Thema werden.
Pot of Gold – Antiquitäten und Pfandleihe – Inh. Beth und Mary Delwood, prangte in goldenen Buchstaben auf der schwarzen Ladenfront. Daneben die Silhouette eines Leprechaun mit einem Topf voll Gold. Einen Kobold hatten wir tatsächlich, auch wenn ein Leprechaun noch mal eine andere Nummer als ein Púca war. Ich war noch nie einem begegnet, aber Mary hatte erzählt, dass sie einmal einen vor unwissenden Kindern gerettet habe. Als Belohnung hatte er ihr eine Goldmünze überreicht.
Mary. Ich hatte sie nie Mom genannt, obwohl auch Beth Delwood nicht meine leibliche Mutter war. Es hatte sich einfach so ergeben, und wir hatten nie etwas daran geändert. Ich hatte sie nicht weniger als Mom geliebt. Nun war Mary seit acht Jahren tot, und ihr Name stand immer noch auf dem Inhaberschild. Und vermutlich würde das noch eine ganze Weile so bleiben. Mom würde es nie übers Herz bringen, ihren Namen entfernen zu lassen, und im Geiste war sie eng mit dem Laden verbunden. Selbst ich glaubte manchmal, ihr Lachen hinter der Theke zu hören, oder sah ihr blondes Haar in der Sonne schimmern. Mom litt noch viel schlimmer unter dem Verlust, auch noch nach all den Jahren. Das hatte ich inzwischen begriffen. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich blind für ihren Schmerz gewesen war.
»Leslie?«
Moms roter Schopf tauchte hinter einem großen Papierlampion auf, der von der Decke hing. Sie hatte ihr Haar halb geflochten und halb hochgesteckt. Wie immer trug sie ihren dunkelbraunen Poncho, der ihr bis zu den Knöcheln reichte, und die lange Lederschnur um den Hals, an deren Ende eine gestreifte Feder baumelte. Ein Andenken an Mary.
Als sie mich entdeckte, im Schneidersitz auf dem Boden und ein Dutzend Glasmurmeln um mich herum verteilt, leuchteten ihre dunklen Augen auf. »Was machst du da, Schätzchen?«
Ich mochte es nicht, dass sie mich ständig so nannte. Wir hatten eine coole Mutter-Tochter-Beziehung, keine »Schätzchen«-Beziehung. Das passte einfach nicht zu uns. Nicht zu ihr und noch weniger zu mir. Ich bekam es ihr einfach nicht abgewöhnt, so finster meine Blicke und scharf meine Zurechtweisungen auch waren. Und da sollte sie noch einmal sagen, ich sei lernresistent.
Auch diesmal wanderten meine Augenbrauen warnend in die Höhe. Sie stockte und stützte seufzend eine Hand in die Hüfte. »Schon gut, ich gebe ja mein Bestes, ja?«
»Dein Bestes ist nicht gut genug.«
Sie gluckste. »Jetzt klingst du schon wie Ciara. Kommt sie heute eigentlich noch vorbei? Ich habe das Gefühl, sie schon ewig nicht mehr gesehen zu haben.«
Ich streckte meine Beine nach vorn aus, darauf bedacht, keine der Murmeln anzustoßen. »Bitte, Mom. Sie war erst letzte Woche hier.« Ciara war meine beste Freundin und Mitbewohnerin. Allein hätte ich mir die Wohnung, die im Dachgeschoss über dem Laden lag, nicht leisten können, obwohl unsere Vermieterin Yara mir bereits entgegengekommen war. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mein Zimmer in Moms Wohnung behalten, allerdings war sie der Meinung gewesen, dass es mir guttun würde, und Ciara war auch sofort Feuer und Flamme gewesen. Wie bei so ziemlich allem. Inzwischen war ich froh darum.
Meine Mutter tippte sich gegen die Nasenspitze. »Richtig, da hat sie Sekel mit den Himbeeren gefüttert, die ich für dich mitgebracht hatte.« Das war inzwischen fünf Tage her. Sie fragte sich vermutlich immer noch, was da in mich gefahren war. Die Himbeeren hatte ich nicht mehr gebraucht. Immerhin hatte Ciara mich gerettet, und ich war nicht in die Verlegenheit gekommen, den Púca selbst zu verköstigen. Seit dem Vorfall mit dem Ouija-Brett war er noch schlechter auf mich zu sprechen. Das ungute Gefühl hatte mich seitdem nicht losgelassen, aber bisher war weder etwas passiert noch hatte ich mich erneut an das mysteriöse Pfand herangewagt.
»Also, kommt sie heute vorbei?«
Ich brummte. »Hm, ja, später. Nach der Arbeit.«
Sie lächelte zufrieden. »Sehr schön. Und jetzt räum das auf und stell dich nach vorn in den Laden. Gleich ist mein Termin mit der Sphinx. Du weißt doch, wie empfindlich die sein können. Nachher rollt hier noch eine Murmel durch die Gegend, und sie empfindet das als persönliche Beleidigung gegen ihre Katzeninstinkte.« Mom zwinkerte mir zu und verschwand wieder durch den Vorhang.
Den Humor hat sie sich eindeutig von mir abgeguckt. Nur wäre mein Witz besser gewesen.
Seufzend begab ich mich in die Hocke. Wenn es sich vermeiden ließ, hielt Mom mich von wichtigen Terminen mit Kunden aus der Anderswelt fern, insbesondere, wenn es sich um Hexen oder Hexer handelte. Wenn ich allein im Laden stand, durfte ich die täglichen Geschäfte regeln, auch wenn sie im hinteren Teil stattfanden. Ansonsten war ich für den Vorraum verantwortlich und durfte ab und zu bei einem Artefakt mit Hand anlegen, um die Magie zu identifizieren. Selbstverständlich nicht unter den Blicken der Kunden. Ich wusste, warum es wichtig war, meine Fähigkeiten geheim zu halten, trotzdem nervte es mich.
Ich schnipste gegen die Murmel, die direkt vor meinem rechten Fuß lag. Sie leuchtete auf und rollte einen Meter nach vorn. Die Murmeln, die um mich herum verteilt lagen, setzten sich synchron in Bewegung. Jede von ihnen schnipste ich gegen den kleinen Leuchtkörper, und jedes Mal, wenn sie gegeneinanderstießen, entstand ein gläsernes Klirren und das Duplikat zerplatzte wie eine Seifenblase. Am Ende blieb nur eine Murmel übrig, die ich wieder in ihrer Blechdose verstaute.
Vorn im Laden widmete ich mich meinem Smartphone. Mom sah das zwar nicht gern, aber solang sie mit der Sphinx beschäftigt war und kein Kunde Hilfe benötigte, war mir das egal. Seit fünf verfluchten Tagen googelte ich mir die Finger wund und hatte nicht einen einzigen Hinweis auf das Ouija-Brett gefunden. Es ließ mich nicht mehr los.
Hexenbretter sind in den Sechzigerjahren populär geworden, obwohl sie bereits 1891 erfunden worden sind. Ihre Ursprünge werden viel früher vermutet. Vergleichbar sind andere Rituale aus dem Volksglauben, die es erlauben sollen, mit den Geistern der Verstorbenen zu kommunizieren, beispielsweise Jailangkung aus Indonesien.
Nur einer der Einträge, die ich im normalen Web gefunden hatte, bevor ich mich dem Otherweb widmete.
Geisterbeschwörung gehört zu der Art von Magie, die seit dem internationalen Kongress der Zirkel in den meisten Teilen der Welt verboten ist. Sie stört die Ruhe der Toten und birgt ungeahnte Folgen. Deshalb, und weil solche schwarzmagischen Rituale um ein Vielfaches aufwendiger sind, bergen Ouija-Bretter selbst nicht wirklich etwas Verbotenes. Fälle, in denen ein Geist kontaktiert werden konnte, sind auf Überreste des Toten in der Welt der Sterblichen zurückzuführen.
Mit einem Geist zu kommunizieren, stellt nicht die Schwierigkeit dar. Viel eher, ihn zu diesem Zweck hervorzurufen.
Die Magie in dem Holzkasten war mehr als das. Nur: Glaubte ich wirklich daran, dass sie von dem eingravierten Hexenbrett stammte? Vielleicht war ihre Natur ganz anderer Art.
Gerade scrollte ich durch hExbuy, dem Online-Marktplatz der Anderswelt, auf der Suche nach einem Schiebeteil. Die Dinger wurden selten einzeln verkauft, wenig verwunderlich. Ich zoomte mit zwei Fingern an ein Bild und beugte mich tiefer über das Smartphone. Das Holz sah ähnlich aus, aber spielte das wirklich eine Rolle? Vermutlich benötigte ich ohnehin das exakte Gegenstück zu dem Brett.
Die Glocke über der Ladentür bimmelte wild, als diese mit Schwung geöffnet wurde. Das konnte eigentlich nur eines bedeuten, und tatsächlich war es Ciara, die durch den Laden auf mich zustürmte. Der warme Ockerton ihres Wollpullovers hob sich gegen ihre tiefbronzene Haut ab. Ihre Tasche, die sie über eine Schulter trug, wischte nur knapp an einigen Kostbarkeiten vorbei. Marc, einer der beiden anderen Angestellten, blickte panisch hinter den Kisten hervor, die er gerade aussortieren sollte. Als er Ciara entdeckte, rollte er mit den Augen und widmete sich wieder seiner Arbeit.
Ich grinste ihr breit entgegen, obwohl sie die pflaumenfarben geschminkten Lippen unwillig zusammenkniff und es in ihren dunklen Augen loderte. Hätte ich es nicht besser gewusst, wäre ich davon ausgegangen, dass sie mir gleich an die Gurgel sprang. »Na, womit hat er dich heute wieder in den Wahnsinn getrieben?«
Mit Karacho landete ihre Tasche auf dem Sofa, das neben zwei Sesseln und einem Tisch schräg hinter der Theke stand. Hier hatten wir früher unsere Nachmittage mit Hausaufgaben verbracht. Gut, Ciara hatte Hausaufgaben gemacht, während ich sie wahlweise abgelenkt, in mein Heft gekritzelt oder mir Streiche für Sekel ausgedacht hatte.
Ciara seufzte theatralisch und warf ihr dickes schwarzes Haar nach hinten. Sie trug es heute zu Space Buns gestylt, die links und rechts als Knoten auf ihrem Kopf saßen, und die Spitzen hatte sie sich vor Kurzem wieder violett gefärbt. Von ihren Ohrläppchen baumelten kleine goldene Monde, ebenso wie von dem Choker um ihren Hals. Sie schob sich ihre Brille mit den riesigen Gläsern und dem goldenen Gestell auf der Nase zurecht.
»Frag bloß nicht! Dieser kleine, miese …« Sie stieß einen entnervten Laut aus und ließ sich auf das Sofa fallen, das gefährlich einsank. Es hatte während der vergangenen zwanzig Jahre eine Menge mitgemacht.
Ich gab Marc ein Zeichen, dass er den Laden im Auge behalten sollte, und setzte mich Ciara gegenüber in einen der Sessel. So aufgebracht war sie nicht mehr gewesen, seit Brian das Einzelbüro bekommen hatte, das eigentlich ihr zugestanden hatte. Und ich hatte richtig erraten, dass es wieder um ihren unliebsamen Kollegen und erbitterten Rivalen ging. So wie eigentlich fast immer.
»Okay, also ich habe hinten so einige Gegenstände, die mit sehr machtvollen Flüchen belegt sind, wenn du ihm davon einfach was unterjubelst …«
»Leslie, nicht hilfreich!« Sie vergrub das Gesicht in den Händen.
Ich zuckte mit den Achseln. »Du könntest ihn natürlich auch einfach selbst verzaubern.« Und wie sie das könnte. Ciara war eine unglaublich begabte Hexe. Nur leider auch eine unglaublich verantwortungsvolle.
»So läuft das nicht, Leslie. So spiele ich nicht. Ich werde ihn schlagen, da kannst du dir sicher sein. Allein indem ich hundertmal härter arbeiten und besser sein werde als alles, was er fertigbringt.« Sie hatte die Hände vom Gesicht genommen und während ihrer flammenden Ansprache die Luft mit dem Zeigefinger erstochen.
Ich hob grimmig lächelnd eine Augenbraue. Genau das hatte ich aus ihr herauskitzeln wollen.
Bevor ich etwas sagen konnte, stöhnte sie auf. »Das wird nur alles egal sein, solang Brian so ein Arschkriecher ist. Weißt du, was er heute gebracht hat? Er hat die Lieblingspralinen des Chefredakteurs gekauft und ihn ganz nebenbei davon überzeugt, mir meine Story zu entziehen. Der krasse Mordfall in der Henrietta Street? Tja, darüber wird jetzt Brian schreiben, denn – Leslie, das wirst du lieben: Mein zartes Frauengemüt solle sich doch lieber auf unverfänglichere Dinge konzentrieren und richtigen Journalisten die Arbeit überlassen.« Mir klappte die Kinnlade herunter. Ciara warf die Hände in die Luft. »Im fucking 21. Jahrhundert!«
»Scheiße, ist das sein Ernst? Was ein …« Eine Reihe von Schimpfwörtern, für die Mom mich Sekels Klo den Rest der Woche hätte reinigen lassen, verließ meinen Mund. Irgendwo hinter einem Regal hüstelte es empört. War das Marc? Auch egal.
»Das hat mein zartes Frauengemüt auch zu ihm gesagt.« Ciara schnaufte. Das hatte sie nicht verdient. Nach ihrem Journalismusstudium hatte sie frisch beim Eternity Weekly angefangen, einem Anderswelt-Magazin, das sich damit brüstete, die schärfsten Storys brühwarm zu liefern. Wenn dein netter magiebegabter Nachbar nekromantischen Praktiken verfallen war, erfuhrst du es als Erstes aus dem Eternity Weekly. Und spätestens dann, wenn die Untoten an deine Tür klopften.
»Stattdessen darf ich jetzt einen langweiligen Ratgeber über die Verwendung von Haushaltszaubern und ihren Risiken und Nebenwirkungen schreiben. Ätzend.« Risiko Nummer eins: Invasion der Besenstiele, der Zauberlehrling kehrt zurück.
Ich musste sie eindeutig auf andere Gedanken bringen. All meine Ratschläge, sich eine andere Zeitung zu suchen, würden im Nichts verlaufen, das hatte ich oft genug versucht. Dafür war Ciara viel zu ehrgeizig.
Verschwörerisch beugte ich mich nach vorn. »Hey, willst du was Cooles sehen, was wir letzte Woche reinbekommen haben?«
»Darf ich ’ne Story darüber schreiben?«, lautete prompt die Gegenfrage.
Ich breitete die Hände aus. »Echt jetzt? Du kennst die Regeln.« Keine Storys über den Pot of Gold, seine Kunden oder sein Inventar.
Ciara verdrehte die Augen und ihre Mundwinkel zuckten nach oben. »Schon klar. Na los, zeig schon.« Als wir uns erhoben, deutete sie noch mal anklagend mit dem Zeigefinger auf mich. »Auch wenn ich finde, dass da noch mehr Empörung gegen Brian hätte kommen können!«
»Ich weiß, ich bin eine schreckliche beste Freundin«, meinte ich nur trocken und winkte sie durch den Vorhang. Dann legte ich den Finger an die Lippen. Meine Mutter war immer noch im Gespräch mit der Sphinx.
Wir huschten durch den Raum zum Lager. Ich wusste nicht, ob ich Ciara das Ouija-Brett wirklich nur zeigte, um sie von ihrem Frust abzulenken, oder weil ich es selbst unbedingt öffnen wollte. Das nicht allein zu tun, hatte etwas Beruhigendes. Vielleicht hatte Ciara sogar eine Idee, immerhin war sie hier die Hexe.
»Siehst du Sekel irgendwo?« Auf dem Weg zu Timothy Murphys Kasten spähte ich durch die Regalreihen. »Kannst du kurz magisch prüfen, ob er im Raum ist? Und vielleicht einen Zauber am Durchgang anbringen, der uns warnt, falls jemand reinkommt?«
»Ich werde nie verstehen, was du gegen den kleinen Kerl hast.« Ciara behandelte den Púca wie ein putziges Haustier. Mein einziger Trost war, dass Sekel das noch mehr hasste als ich.
Trotz ihres Einspruchs vollführte sie eine kreisende Handbewegung vor sich in der Luft, wobei sie einige Worte murmelte. »Nein, er ist nicht hier.«
»Perfekt. Der Durchgang?«
»Ist das wirklich nötig?«
»Würde ich dich sonst darum bitten?« Ich verschränkte die Arme. Mittlerweile standen wir vor dem richtigen Regal. »Wenn ich könnte, würde ich es selbst machen …«
»Schon gut, schon gut, wenn du die Karte ausspielst, muss es wirklich wichtig sein.« Ciara machte auf dem Absatz kehrt und war zwei Minuten später wieder zurück. »So, fertig. Wenn jemand den Raum betritt, werde ich es dich wissen lassen.«
»Danke.« Ich atmete tief ein.
»Ähm, Leslie?«
Ich starrte das Fach an. »Ja?«
»Alles in Ordnung?«
Ich ließ die angehaltene Luft entweichen und schüttelte den Kopf. »Klar. Moment, ich hol das Ding raus.«
Wir knieten uns gegenüber auf dem Boden, der Holzkasten zwischen uns. Ich hatte beide Hände darum geschlossen und ließ die Magie auf mich wirken. Unverändert.
»Also, da war dieser Typ, der dieses Ding letzte Woche hier zur Pfandleihe gegeben hat«, erklärte ich gedämpft.
Ciaras Blick wanderte von mir zu dem Artefakt. »Diesen … Holzkasten?«
»Es ist ein Ouija-Brett«, korrigierte ich und hatte plötzlich eine Ahnung, wie blöd sich Timothy dabei vorgekommen sein musste. »Vermutlich umgearbeitet, denn das Holz ist viel älter. Pass auf, ich klapp es auf und möchte, dass du mal drüberschaust, ob dir was auffällt. Wenn ich es so geschlossen halte, spüre ich eindeutig Magie, auch wenn ich sie ungewöhnlicherweise nicht identifizieren kann.« Ciara wusste um meine Fähigkeiten, vor ihr musste ich sie nicht verheimlichen. Sie kannte meine Geschichte. »Und sobald ich es öffne, ist alles … weg.«
»Okay«, sagte Ciara lang gezogen und setzte sich aufrechter hin.
Ich öffnete das Scharnier und klappte den Deckel auf. Beim letzten Mal war nichts passiert, ich rechnete also nicht damit, dass es diesmal anders sein würde. Umso heftiger zuckte ich zurück, als mir eine schwarze Wolke entgegenschlug. Meine Fingerspitzen rutschten vom Brett ab. Ich hörte Ciara unterdrückt aufschreien, sah sie aber durch den Rauch hindurch nicht. Schwefelgestank drang mir in die Nase.
Was passiert hier?
Kaum hatte ich den Gedanken beendet, zog sich die Wolke wieder zurück, verdichtete sich zwischen Ciara und mir, bildete Umrisse, verfestigte sich – und im nächsten Moment sah ich in ein rotes Augenpaar, das mich finster anfunkelte.
Den Impuls, auszuholen und draufzuschlagen, konnte ich nicht verhindern. Unter meiner Faust schrie es unterdrückt auf.
»Scheiße, wer bist du?«, raunzte ich und verfiel aufgrund meines Schocks in meine Gangstermanieren. Schnell checkte ich, ob es Ciara gut ging. Wir waren beide aufgesprungen und warfen uns über das Ding hinweg, das sich zusammengekauert die Hände aufs Gesicht presste, einen Blick aus weit aufgerissenen Augen zu. In was für eine Scheiße hast du uns diesmal gebracht, Leslie? Ich wusste es selbst nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie das hatte schiefgehen können, nachdem ich mir sicher gewesen war, dass sich absolut nichts in dem Ouija-Brett befand.
Dann sagte Ciara plötzlich »Das Ding hat einen Schwanz!« und brachte mich damit völlig aus dem Konzept. Meine Gedanken überschlugen sich, während ich den schwarzen Schwanz mit dem Haarbüschel am Ende anstarrte, der zwischen Ciara und mir in die Höhe zuckte. Er entwuchs einem menschlichen Körper aus dem unteren Teil der Wirbelsäule.
»Fuck, was bist du?«
»Dein schlimmster Albtraum, wenn du auch nur daran denkst, den Schwanz anzufassen.« Es hatte sich wieder aufgerichtet. Nein, korrigierte ich mich in Gedanken. Er, nicht es. Zu meiner grenzenlosen Verblüffung sah ich in das Gesicht eines Jungen. Er konnte höchstens sechzehn sein, und unter einem schwarzen Schopf funkelten mich wieder diese roten Augen an. »Und ist das dein Ding? Direkt zuzuschlagen?«, grummelte er weiter und klang dabei erschreckend nach einem verzogenen, rebellischen Teenager.
Wieder rieb er sich anklagend über die Nase. »Das hat echt wehgetan!« Doch ich war viel zu sehr von seinen schwarzen, klauenbewehrten Händen abgelenkt. Ich blinzelte, zweimal, dann glitt mein Blick seinen nackten Oberkörper hinab.
Nicht nur, dass seine Knochen auf widernatürliche Weise unter der grauen Haut hervorstachen und ich links und rechts der Schultern verkrüppelte Flügelansätze zu sehen glaubte. Der Junge war über und über tätowiert. Da waren die Mondphasen und oberhalb seines Bauchnabels ein umgedrehtes keltisches Kreuz. Einmal quer über seine Brust reihte sich das Alphabet aneinander. Über seinem Schlüsselbein stand: Auf Wiedersehen
Irgendwo tief in mir verstand ich in diesem Moment, was er war. Aus meinem Mund sprudelten allerdings nur Flüche und Drohungen, unterbrochen von einem Wust aus Fragen, die mein Kopf noch nicht sortiert hatte. Während mein Gegenüber das nur mit einem irritierten Blick quittierte, huschte Ciara an ihm vorbei an meine Seite, um ihn ebenso ausgiebig zu betrachten.
Er verschränkte die Arme und verdeckte damit einen Teil der Tattoos auf seiner Brust. »Seid ihr dann auch mal damit fertig, mich anzustarren?«
»Bist du das Ouija-Brett?«, stellte Ciara endlich die alles entscheidende Frage. Immerhin behielt sie einen kühlen Kopf. Ich hielt in meinen Verwünschungen inne.
»Mein Name ist Nathaniel.« War er der Frage gerade ausgewichen? Konnten Ouija-Bretter Fragen ausweichen und einen Namen haben? Doch er war noch nicht fertig. Mit einem Räuspern breitete er die Arme wieder aus, um an sich hinab zu deuten. »Ich bin das Ouija-Brett, in dessen Besitz du«, er sah mich an, »auf welche Weise auch immer gekommen bist. Damit hast du mich gerufen.«
»Warum sollte ich dich rufen wollen?« Das klang härter als beabsichtigt, allerdings hatte ich wirklich keine Ahnung, inwiefern es mir helfen sollte, dass sich ein Ouija-Brett plötzlich in einen Teenager verwandelte. Oder war es andersherum?
Nathaniel ließ eingeschnappt die Hände sinken. »Du hast offensichtlich keine Ahnung, wozu ich fähig bin! Hmpf. Bei dem Gesicht wundert mich das nicht.« War ich gerade von einem Sechzehnjährigen beleidigt worden?
»Du bist ein Ouija-Brett«, wiederholte Ciara das Offensichtliche und klang dabei schon beinahe euphorisch. »Also kannst du … mit Geistern kommunizieren!« Gleich darauf zerfiel ihr Gesichtsausdruck und ihre Augen weiteten sich. Offenbar war ihr klar geworden, was das bedeutete.
Nun schlich sich ein dämonisches Grinsen auf Nathaniels Lippen, bei dem mich eine Gänsehaut überkam. Sechzehnjährige durften nicht so Furcht einflößend grinsen. »Ganz genau!« Dann wanderte sein Blick zwischen die Regale. »Hier ist ein Geist! Deshalb hast du mich bestimmt geöffnet … Leslie.«