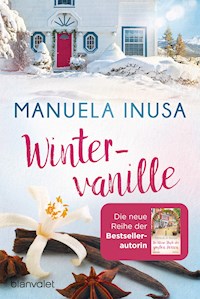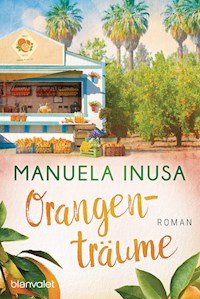9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coastlines
- Sprache: Deutsch
Auf Key West kämpft Harmony für ihre Schwester – und die Hoffnung
Harmony lebt als Journalistin in Phoenix. Die Liebe hat sie nach einigen Enttäuschungen aufgegeben. Stattdessen konzentriert sie sich ganz auf ihren Beruf und auf ihre ältere Schwester Hope, die seit drei Jahren vergeblich gegen Leukämie ankämpft. Hopes größter Wunsch ist es, ihre letzten Wochen auf Key West zu verbringen – ihrem liebsten Ort auf Erden. Harmony begleitet Hope und erfüllt ihr einen Traum: noch einmal Delfine zu beobachten. Doch schon bald überschlagen sich die Ereignisse. Ein Hurrikan zieht auf und Hopes Zustand verschlechtert sich drastisch. Nach dem Sturm ist nichts mehr, wie es einmal war, und Harmony muss lernen, loszulassen. Kann sie unter den Palmen ihren Frieden finden und vielleicht sogar noch mehr?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Harmony hat nach einigen Enttäuschungen die Liebe aufgegeben. Stattdessen konzentriert sie sich ganz auf ihren Beruf als Journalistin und auf ihre ältere Schwester Hope, die seit Jahren vergeblich gegen Leukämie ankämpft. Hopes größter Wunsch ist es, ihre letzten Wochen auf Key West zu verbringen – ihrem liebsten Ort auf Erden. Harmony erfüllt ihrer Schwester diesen Traum und begleitet Hope. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Ein Hurrikan zieht auf und Hopes Zustand verschlechtert sich drastisch. Nach dem Sturm ist nichts mehr, wie es war, und Harmony muss lernen loszulassen. Kann sie unter den Palmen ihren Frieden finden und vielleicht sogar noch mehr?
Die Autorin
Manuela Inusa wurde 1981 in Hamburg geboren und wollte schon als Kind Autorin werden. Kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag sagte sich die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin: »Jetzt oder nie!« Seither verzaubert sie ihre Leser*innen regelmäßig mit gefühlvollen Romanen. Mit ihrer erfolgreichen Valerie Lane-Reihe, den Kalifornischen Träumen und Lake Paradise eroberte sie die Bestsellerlisten im Sturm. Die Autorin liebt es zu reisen, liest vorzugsweise Thriller und trinkt am liebsten Tee. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in ihrer Heimatstadt.
Manuela Inusa
Seestern-nächte
Roman
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 09/2025
Copyright © 2025 by Manuela Inusa
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Daniela Bühl
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (Александр Плисик, Iman, LOV, vetre, MNStudio, missisya)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-32277-9V001
www.heyne.de
Für alle Superheldinnen
Prolog
Phoenix, 23 Jahre zuvor
Harmony saß mit ihrer Schwester auf der Bank vor dem Friseursalon und sang Avril-Lavigne-Songs. Hope hatte das Album vor zwei Wochen zum fünfzehnten Geburtstag von ihren Eltern geschenkt bekommen und sie konnten die Lieder schon fast alle auswendig.
»Ich will ein Eis«, sagte Hope, als sie eine Pause einlegte.
Da sprach sie Harmony aus der Seele. Es war an diesem Julitag so heiß, dass es kaum auszuhalten war.
»Hast du Geld dabei?«, fragte sie ihre große Schwester.
Die durchsuchte ihre Taschen. »Nicht genug. Wir fragen gleich Mom.«
»Ich hoffe, sie ist bald mal fertig«, stöhnte Harmony und versuchte, durch das Fenster des Salons einen Blick auf ihre Mutter zu erhaschen. Doch die Sonne spiegelte sich so sehr in der Scheibe, dass das nicht möglich war.
»Kann ja nicht mehr lange dauern«, meinte Hope.
Harmony zog eine Schmolllippe. Dann blickte sie die Straße hinunter in der Hoffnung, jemanden zu entdecken, den sie kannte. Es schien allerdings, als wären sie die einzigen Menschen, die sich bei dieser Hitze hinausgetraut hatten. Die meisten anderen Kids hatten sich wahrscheinlich in ihre klimatisierten Häuser oder Wohnungen verzogen oder sie waren verreist. So wie Harmonys beste Freundin Lauren, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder Kenny in Kalifornien war, um ihre Tante zu besuchen.
Manchmal wünschte Harmony, sie hätte auch eine Tante an irgendeinem tollen Ort, die sie besuchen könnten. Ihre Verwandten lebten aber entweder gleich in der Nähe oder weit weg in Kolumbien – von dort kam ihre Mom. Doch sie waren erst ein einziges Mal hingeflogen und das war Jahre her. Außerdem war es dann gar nicht so super gewesen. Das Land schon, klar, und der Strand sowieso, aber ihre Mom hatte die ganze Zeit mit ihrer eigenen Mutter gestritten. Die wollte sich nämlich noch immer nicht damit abfinden, dass ihre einzige Tochter einen Amerikaner geheiratet hatte statt einen netten katholischen Kolumbianer. Daniel Roberts war das genaue Gegenteil: Er war Baptist, der nicht einmal regelmäßig zum Gottesdienst ging, hatte blondes Haar und blaue Augen, konnte weder Spanisch sprechen noch Salsa tanzen und zog Baseball jedem Karneval vor. Aber Fernanda machte das nichts aus, sie liebte Dan genau so, wie er war, was nur leider oft für Unruhe in der Familie sorgte. Nach diesem letzten großen Streit, bei dem abuela ein weiteres Mal darüber schimpfte, dass sie ihren Töchtern Dan zuliebe amerikanische Namen gegeben hatte, reichte es Fernanda. Sie sagte ihrer mamá, dass sie sie erst wieder besuchen würde, wenn sie ihre große Liebe endlich akzeptierte. Das war bis zum heutigen Tag jedoch nicht geschehen.
»Glaubst du, Mom und abuela werden sich jemals vertragen?«, fragte Harmony ihre Schwester.
Hope überlegte einen Moment. »Ich glaube nicht.«
»Voll schade. Wenn sie es würden, könnten wir Urlaub am Meer machen.«
»Ja, das wäre cool.« Hope holte zwei Lollis aus ihrer fransigen Kunstwildlederhandtasche und reichte ihr einen.
»Danke.« Sie wickelte ihn aus und steckte ihn sich in den Mund. Mhmm, Orange.
»Weißt du, wenn ich erwachsen bin, werde ich am Meer wohnen«, erzählte Hope, als wäre es schon beschlossene Sache.
»Echt? Und wo genau? In Kalifornien?«
»Vielleicht. Oder in Florida, da ist es total schön. Weißt du, diese alte Serie, die Dad ständig guckt, Miami Vice, die spielt da.«
Sie dachte an die Palmen und Strände im Fernsehen und nickte. »Und was machst du dann da?«
»Na, ich lebe einfach dort«, sagte Hope. »Mit meinem Mann und meinen Kindern. Und wir gehen jeden Tag im Meer schwimmen.«
Harmony hätte alles dafür gegeben, jetzt in einen Ozean springen und sich abkühlen zu können.
»Nimmst du mich mit nach Florida?«, fragte sie.
»Klar. Wir halten doch immer zusammen.«
Sie lächelte zufrieden. Da hatte Hope recht. Trotz der vier Jahre Altersunterschied waren sie ein Herz und eine Seele, stets füreinander da und kaum zu trennen.
»Ich freu mich schon«, sagte Harmony. Dann sah sie ihre Mutter endlich aus dem Salon kommen, mit einer neuen Frisur und einem Strahlen im Gesicht.
»Na, meine Mädchen, wie sehe ich aus?«
»Toll!«, rief Harmony.
»Wirklich hübsch, Mom«, meinte Hope.
»Danke, danke.« Ihre Mutter befühlte sich das schwarze Haar, das in Locken über ihre Schultern fiel. »Also, ihr Süßen, seid ihr bereit?«
»Wozu?«, fragte Hope.
Ihre Mutter begann, die Straße entlangzutänzeln, als wären es nicht zweiundvierzig Grad im Schatten. »Na, wir gehen Eis essen. Was dachtet ihr denn?«
Die Mädchen sprangen von der Bank und folgten ihrer Mutter. Und dabei überlegte Harmony bereits, welche Sorte sie nehmen sollte. Schokolade oder Kirsche vielleicht? Stracciatella oder Pistazie? Nein, Zitrone! Wenn man sich nicht entscheiden konnte, war Zitrone immer die beste Wahl.
Sie lief hinter ihrer Mom und ihrer Schwester her und wusste, egal was auch kommen mochte, sie würde niemals allein auf dieser Welt sein.
1
Phoenix, heute
Sie trank einen Schluck Orangentee und stellte den Becher zurück auf das Fleckchen, das sie sich freigeschaufelt hatte. Es umgaben sie unendlich viele Zettel mit Notizen, deren Ordnung wohl niemand verstehen könnte außer Harmony selbst. Seit Wochen schon recherchierte sie zum Thema Obdachlosigkeit und Drogensucht in der Stadt. Denn es wurde immer tragischer, bald würde Arizona wahrscheinlich genauso tief im Elend stecken wie Kalifornien mit seinen Zelt-Straßen und -Stränden. An der Ostküste war es nicht weniger schlimm, vor allem seit New York angekündigt hatte, leer stehende Hotels in Obdachlosenunterkünfte umzuwandeln. Leider protestierten ausgerechnet die gut betuchten Bürger in ihren warmen, gemütlichen Millionen-Dollar-Apartments mit ihren vollen Kühlschränken und ihren Memory-Foam-Matratzen gegen die Umsetzung. Denn sie wollten ihre Nachbarschaft nicht mit Armut füllen, wollten nicht täglich damit konfrontiert werden, dass es ihnen besser ging und sie dennoch nichts taten. Und so endeten all die mittellosen Menschen, die mit Mühe und Hoffnung in die Stadt gekommen waren, die doch so viel versprach, auch hier auf der Straße. Nur dass im Osten die Winter kalt waren und der eine oder andere ihn bloß knapp oder gar nicht überlebte.
Wenn man schlau war, suchte man sich ein Plätzchen im Westen, bevorzugt in Kalifornien, wo sogar Venice Beach zu einer Zeltstadt geworden war und die Promenade, die sonst von den Touristen bewandert wurde, einer Szene aus einem Apokalypse-Film ähnelte. Texas und New Mexico, wo an 300 Tagen im Jahr die Sonne schien, waren ebenfalls beliebt, oder eben Arizona, der Staat, den Harmony noch immer ihre Heimat nannte. Trotz der heißen Sommer und des Ausbleibens von Schnee im Winter konnte sie sich nicht vorstellen, irgendwo anders hinzuziehen. Sie mochte Phoenix, ihr Leben hier als Journalistin und überzeugter Single. Was nicht bedeutete, dass sie mit ihren vierunddreißig Jahren den Männern bereits abgeschworen hätte. Sie war es einfach nur leid, alles in eine Beziehung zu stecken und am Ende doch wieder enttäuscht zu werden. Also gab sie sich mit gelegentlichen Dates ohne Verpflichtungen zufrieden und konzentrierte sich auf die wirklich wichtigen Dinge. Das waren zum einen ihr Job, der sie sowieso die Hälfte des Tages einnahm, und zum anderen war es ihre Familie, die sie mehr brauchte denn je.
Kurz dachte sie an ihre Schwester Hope und daran, sie jetzt schon anzurufen. Aber sie wollte erst den Artikel über die schwangere Siebzehnjährige fertig schreiben, die versuchte, von den Drogen runterzukommen. Die keinerlei Unterstützung bekam, weder von ihren Eltern noch vom Staat. Ihr Name war Lesley. Harmony hatte sie vor ein paar Tagen interviewt, was sie schwer mitgenommen hatte. Das Burger-Meal, die Schwangerenvitamine und die Babykleidung, die sie dem Mädchen dafür gegeben hatte, konnten ihr schlechtes Gewissen auch nicht beruhigen. Letzte Nacht war Lesley ihr sogar im Traum erschienen, und am Morgen auf dem Weg in die Redaktion hatte Harmony versucht, sie zu finden, um ihr ein Frühstück zu bringen. Aber die Decke unter der Brücke war leer gewesen, von Lesley keine Spur.
Nick ist der Vater, glaub ich, tippte sie in ihren Laptop. Hab aber keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Er wollte Fentanyl beschaffen und ist nicht wiedergekommen. Das war vor einer Woche oder so.
Harmony musste eine kurze Pause einlegen. Die Augen schließen. Durchatmen. Bevor sie weiterschreiben konnte.
In welchem Monat bist du?
Weiß nicht. Irgendwann wird das Ding schon rauskommen, oder?
Du nennst dein Baby ein Ding … Darf ich fragen, wie du zu der Schwangerschaft stehst? Freust du dich auf das Kleine? Hast du Angst vor der Geburt? Oder davor, was danach kommt?
Ich freu mich drauf. Irgendwie. Dann bin ich wenigstens nicht mehr ganz allein, wenn Nick weg ist. Vielleicht ist er wieder erwischt worden. Kann sein, dass er im Knast ist. Aber die werden ihn schon laufen lassen. Das haben sie letztes Mal auch, und weißt du, warum?
Warum?
Weil der Knast voll ist mit richtigen Kriminellen. Mit Mördern und so weiter. Die brauchen ihre Zellen für die und nicht für jemanden, der sich einfach nur zudröhnen wollte. Der diesem Leben nur für eine Weile entfliehen wollte. Diesem Scheißleben.
Erneut musste Harmony schlucken. Als sie ihrem Redaktionsleiter Wayne Thompson vor zwei Monaten gesagt hatte, sie würde die Berichterstattung zu dem Thema übernehmen, hatte sie nicht geahnt, was es bei ihr auslösen würde. Aber gerade weil sie emotional so involviert war, war eine richtig gute Sozialreportage entstanden, die so viel Leserfeedback erhielt, dass Wayne sie bat, eine wöchentliche Sache daraus zu machen.
Wie lange sie da allerdings noch mithalten konnte, mochte sie nicht vorhersagen. Denn es zehrte an ihren Nerven, brach ihr das Herz und ließ sie nicht mehr los, sobald sie mit den Betroffenen redete, die doch auch nur Menschen waren. Menschen, die vom Glück verlassen worden waren. Einige fast noch Kinder, einige junge Mütter, andere alte Männer, die bereits aufgegeben hatten, bloß von Tag zu Tag lebten und denen es kaum etwas auszumachen schien, wenn morgen ihr letzter wäre.
Sie speicherte ihr Geschriebenes ab und klappte den Laptop zu. Für heute war es genug. Die Uhr zeigte bereits kurz nach acht an, und sie sollte wenigstens ein bisschen Zeit für sich selbst einplanen, bevor sie schlafen ging. Zum Abschalten. Zum Runterfahren. Gegessen hatte sie auch noch nichts. Also ging sie in die Küche und beschloss, sich ein paar Spaghetti zu kochen – ihr Soul Food. Für andere Menschen waren Schokolade oder Kuchen Seelentröster, ihr hatten schon immer Spaghetti geholfen.
Während das Wasser heiß wurde, holte sie ihr Handy hervor und checkte ihre Nachrichten. Vor einer Weile hatte es ein paarmal gepiept, aber sie hatte sich nicht ablenken lassen wollen. Und wenn es etwas Wichtiges gewesen wäre, wenn ihre Mutter oder ihre Schwester sie gebraucht hätten, dann hätten sie sowieso angerufen.
Sie hatte eine Nachricht von Wayne, der fragte, ob sie rechtzeitig mit ihrem Artikel fertig werden würde – was eine unsinnige Frage war, da sie in den sechs Jahren beim Phoenix Eagle noch jede Deadline eingehalten hatte. Ihre Kollegin Bonnie hatte ein paar Informationen zum Gesundheitswesen geschickt, um die sie gebeten hatte. Und ihre beste Freundin Lauren lud sie zu einem Event ein.
Hey, Süße. Wie geht’s? Hast du Lust, nächsten Donnerstag mit zu einer Premierenlesung zu kommen?
Harmony musste lächeln. Und wie sie Lust hatte! Die Veranstaltungen, auf die Lauren sie für gewöhnlich mitnahm, waren nämlich … eher ungewöhnlich.
Als sie noch Teenagerinnen gewesen waren, hatten Harmony und Lauren eine gemeinsame Vorliebe gehabt: das Schreiben. Statt sich wie die anderen Mädchen den Cheerleaderinnen oder dem Schulchor anzuschließen, waren sie dem Debattierclub beigetreten und hatten Beiträge für die Schülerzeitung verfasst. Und während Harmony sich nach ihrem Abschluss für den Journalismus entschied, schlug ihre Freundin den Weg als Buchautorin ein. Allerdings schrieb sie keine seichte Frauenunterhaltung, sondern blutige Thriller, die nichts für schwache Nerven waren. Inzwischen war Lauren ziemlich erfolgreich, hatte es bereits viermal auf die Bestsellerliste geschafft und kannte die coolsten Persönlichkeiten. Und deshalb waren die Events, zu denen sie einlud, auch immer einen Besuch wert.
Zuletzt hatte Harmony ihre Freundin auf die Lesung eines Autors begleitet, der eine Reihe über einen Serienkiller geschrieben hatte. Bei der besagten Lesung war ein Cocktail angeboten worden, der aussah wie Blut. Was Harmony aber besonders viel Spaß bereitete, war, die Besucher einer solchen Veranstaltung zu beobachten. Denn während Lauren fiktive Charaktere zum Leben erweckte, waren es für Harmony selbst ja die echten Menschen, die sie interessierten und über die sie letztlich schrieb. Auf diesen Lesungen war dann wirklich alles vertreten: Frauen, die den Autor anhimmelten, Männer, die so aussahen, als könnten sie selbst Serienkiller sein, und sogar ältere Damen, die wirkten, als würden sie gleich ihr Strickzeug aus der Handtasche hervorholen.
Harmony liebte es, sich unters Volk zu mischen, sich mit den verschiedensten Leuten zu unterhalten, neue Eindrücke zu sammeln, etwas über die Menschen zu lernen. Sie war nie schüchtern gewesen, im Gegensatz zu Lauren, die eher introvertiert war, seit Jahren fast ausschließlich Schwarz trug und am liebsten zu Hause blieb – außer wenn coole Veranstaltungen anfielen.
Ich bin dabei! Um was für eine Premierenlesung geht es?
Die Nudeln waren noch nicht fertig gekocht, als Lauren sich schon zurückmeldete.
Mitch Boyd hat doch diesen lang erwarteten Thriller geschrieben, in dem es um die wahre Geschichte der entführten Frauen in Iowa geht.
Klingt spannend. Nenn mir Ort und Uhrzeit, ich werde da sein.
Super, ich freu mich. Wie läuft es sonst so bei dir?
Ehrlich gesagt machen mir die Reportagen über die Obdachlosen ganz schön zu schaffen.
Kann ich mir vorstellen. Aber du bist die Richtige für diesen Job, das hab ich dir schon mal gesagt. Niemand sonst könnte das so einfühlsam machen wie du.
Danke, das bedeutet mir viel. Deine Bestärkungen kommen immer zur rechten Zeit. Wie läuft es denn bei dir?
Alles bestens. Ich ermorde wohl heute noch eine Frau in der Tiefgarage.
Himmel! Wenn man nicht wüsste, dass du Thrillerautorin bist, könnte man das auch falsch verstehen. Das ist dir klar, oder? Und du weißt ja, es heißt, die Bundesbehörden beobachten uns alle, hören uns ab, lesen unsere Nachrichten. Nicht, dass da irgendwann eine Sondereinheit bei dir vor der Tür steht.
Dann nenne ich ihnen deinen Namen und du musst ihnen bestätigen, dass es sich bei meinem Vorhaben wirklich nur um eine Szene in meinem Manuskript handelt.
Ja, schick sie ruhig zu mir. Zieh mich da mit rein. Am Ende landen wir beide im Knast.
Wir zwei als Knastschwestern – ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen.
Träum ruhig weiter. Meine Spaghetti sind fertig. Viel Spaß noch beim Schreiben.
Dir auch.
Ich bin für heute fertig.
Wer’s glaubt!
Sie musste grinsen, weil Lauren sie so verdammt gut kannte. Aber für heute war wirklich Schluss. Es warteten Spaghetti, der Fernseher und ihre Katze Scarlett auf sie, mit der sie gleich schmusen wollte, wenn sie denn Lust darauf hatte. Manchmal war die Gute nämlich ein wenig zickig und nicht in Kuschellaune. Dann machte sie sich lieber auf dem Bett breit, als würde es ihr allein gehören, oder sie sprang in die Badewanne, als würde sie ein Schaumbad nehmen wollen. So war Scarlett aber schon gewesen, als Harmony sie vor vier Jahren aus dem Heim geholt hatte. Sie war trotzdem ganz vernarrt in die Kleine und hatte sie kurzerhand nach Scarlett O’Hara aus Vom Winde verweht benannt, die in ihren Augen ebenfalls ein wenig hochnäsig war. Seitdem war die schwarz-weiß gefleckte Katze ihr zu einer Weggefährtin geworden, die sie nicht mehr missen wollte.
Sie goss das Nudelwasser ab und durchsuchte den Kühlschrank nach einem angebrochenen Glas Pesto. Sie fand eins, öffnete es und schnupperte daran. Sie gab zwei Löffel davon zu den Spaghetti und rührte alles um. Ein paar Cherrytomaten und Basilikumblätter als Topping und schon hatte sie ein annehmbares Abendessen.
Mit ihrer Schüssel – sie aß Nudeln immer aus ihrer handgefertigten Lieblingsschüssel, die ihre Schwester ihr mal zu Weihnachten geschenkt hatte – setzte sie sich auf die Couch und schaltete den Fernseher ein. Jetzt wollte sie einfach entspannen, sich eine harmonische Serie ansehen und die Welt da draußen für ein paar Stunden vergessen.
2
Harmony schreckte hoch. Sie war beim Fernsehen eingenickt und irgendwie musste sie wohl im Schlaf daran gedacht haben, dass sie Hope noch nicht angerufen hatte. Sie rüttelte sich wach und trank ein paar Schlucke kalten Tee. Ihre leere Spaghettischüssel stand auf dem Couchtisch, von Scarlett fehlte jede Spur.
Stöhnend griff sie nach ihrem Handy. Es zeigte ihr an, dass es bereits zwanzig nach zehn war. Sie hoffte nur, dass ihre Schwester noch nicht im Bett war.
Als sie ihre Nummer wählte, ging Hope aber zum Glück direkt ran.
»Hallo, Mony.«
»Hey, Sis. Wie geht es dir? Wie war dein Tag?«
»Mir geht es gut, danke. Und mein Tag war auch super. Ich hatte viel Kundschaft heute.« Hope war Eigentümerin eines kleinen Schmuckgeschäfts in Scottsdale, einem Vorort von Phoenix, der gern von Touristen besucht wurde.
»Das freut mich«, sagte Harmony und ging die Balkontür schließen, damit die Mücken nicht reinkamen.
»Und wie geht es dir? Hast du wieder Leute interviewt?«
»Nein, heute nicht, ich musste in die Redaktion. Da war ich diese Woche noch gar nicht, weil ich entweder auf der Straße war oder in meiner Wohnung, um zu schreiben oder zu recherchieren.«
»Was musst du denn recherchieren?«
Sie strich sich eine Strähne ihres schwarzen Haars hinters Ohr. »Alles Mögliche. Zum einen habe ich mit einigen Ärzten über das Thema Fentanyl gesprochen. Warum es so süchtig macht und wie schwer es ist, davon loszukommen. Und ich habe sie zu dieser neuen Droge befragt, Xylazin, das eigentlich aus der Veterinärmedizin stammt und noch um einiges stärker ist. Es wird unter die Opioide gemischt, um die Wirksamkeit zu verlängern, aber es ist so gefährlich, dass schon sehr geringe Mengen zu einer Überdosis führen und tödlich enden können.«
»Das klingt wirklich schlimm.«
»Ist es. Na ja, und dann habe ich versucht herauszufinden, warum der Staat nicht mehr für die Bedürftigen tut beziehungsweise was man machen kann, damit sich das endlich ändert. Zum Beispiel dieses schwangere Mädchen, von dem ich dir erzählt habe, Lesley … Sie bekommt bald ihr Baby und ich wollte herausfinden, ob sie dafür in ein Krankenhaus kann. Auch ohne Versicherung.«
»Und?«
»Abweisen dürfen sie sie nicht, zum Glück. Es könnte aber sein, dass ihre Eltern, zu denen sie keinen Kontakt mehr hat, eine fette Rechnung bekommen.«
»Das geschieht ihnen ganz recht. Wie kann man sein Kind auf der Straße leben lassen?«
Natürlich bewegte das Hope sehr. Immer wenn es um Kinder ging, reagierte sie emotional. Sie selbst hatte jahrelang versucht, schwanger zu werden, leider war es ihr aber nicht vergönnt gewesen, Mutter zu werden. Und nicht nur in dieser Hinsicht hatte das Schicksal sie verlassen.
»Ich habe versucht, Lesley heute Morgen zu finden. Leider war sie nicht mehr an ihrem gewohnten Platz«, erzählte Harmony weiter.
»Die arme Kleine. Ich hoffe, es wird sich irgendwie alles zum Guten für sie wenden.«
»Ja, ich auch«, sagte sie, obwohl sie es besser wusste. Denn in den meisten Fällen geschah das eben nicht. So traurig es war. »Erzähl doch mal, was es sonst so gibt«, bat sie als Nächstes. »Wie geht es dir gesundheitlich?« Bei dieser Frage hielt sie wie immer die Luft an, hoffend, betend, dass sie eine positive Antwort erhalten würde.
»Ach, ganz gut eigentlich. Ich bin vielleicht ein bisschen schlapp zurzeit, aber das ist sicher nur die Hitze.«
Sofort machte sich Sorge in Harmony breit. Seit Hopes Leukämiediagnose vor drei Jahren hatten sie gemeinsam schier Unerträgliches durchgestanden – als Schwestern, die in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhielten. Nachdem Hope den Krebs besiegt hatte, dachten sie, sie wäre über den Berg. Aber Remission bedeutete nun mal nicht, dass alles unwiderruflich vorbei war. Und so war er nur ein Jahr später zurückgekehrt. Dank einer weiteren Chemotherapie sowie einer Stammzelltransplantation hatte Hope den Feind erneut geschlagen. Doch die Angst war fortwährend da, dass dieser ein drittes Mal vorbeischauen würde.
»Willst du nicht lieber einen Termin bei deiner Ärztin machen?«, fragte Harmony in dem Versuch, sich ihre Sorge nicht anhören zu lassen.
»Ich habe am Dienstag sowieso meinen nächsten Routinetermin im Krankenhaus.«
»Ja, ich weiß«, sagte sie. Denn wie könnte sie das Datum vergessen? In letzter Zeit musste sie Tag und Nacht daran denken, was die Untersuchungen ergeben und was die Ärztin ihnen diesmal sagen würde. Es war so nervenaufreibend, dass es sie auch in allem anderen beeinflusste. Vielleicht war sie deshalb so extrem emotional, was die Menschen auf der Straße betraf. »Trotzdem, Hope, du weißt, dass schon wenige Tage einen Unterschied machen können.«
»Es ist alles gut. Ich kenne meinen Körper, mach dir keine Sorgen, ja?«
»Die mache ich mir immer.«
»Und dafür liebe ich dich. Aber die paar Tage kann es nun noch warten.«
Auch wenn es sie innerlich zermürbte, wollte sie ihre Schwester gewähren lassen. Denn Hope hatte ja recht, sie hatte das Ganze zweimal durchlebt. Wenn wieder etwas wäre, würde sie es bestimmt merken.
»Na gut. Aber wenn du dich noch schwächer fühlst, gehst du früher in die Klinik, ja?«
Keine Antwort.
»Hope? Sag mir, dass du das tust. Versprich es mir.«
»Ja, Mony.«
»Okay, danke.«
»Wegen Dienstag …«, meinte ihre Schwester dann. »Du musst dir nicht extra freinehmen und mitkommen.«
»Du willst da wirklich allein hin?« Dass sie ein wenig entsetzt war, wäre untertrieben.
»Ja, kein Problem. Ich schaffe das schon.«
Harmony konnte kaum glauben, was sie hörte. »Ich will die Frage anders formulieren: Denkst du wirklich, ich lasse dich da allein hin? Selbstverständlich komme ich mit, und gar keine Widerrede!«
»Wenn du unbedingt möchtest.«
»Alles klar, dann sehen wir uns spätestens am Dienstag.«
»Wolltest du nicht am Samstag vorbeikommen? Da findet der große Flohmarkt statt.«
»Ach ja, stimmt. Das hatte ich total vergessen, entschuldige bitte.« Wo war sie nur mit ihren Gedanken? Ihr Leben konnte sich doch nicht nur um ihre Arbeit, ihre Mutter und Hopes Krankheit drehen, oder?
»Wenn du keine Zeit hast, kann ich auch allein gehen. Oder ich frag meine Nachbarin Judy«, sagte Hope.
»Nein, nein, ich komme mit. Ich muss sowieso dringend mal abschalten und wo könnte ich das besser als auf einem Flohmarkt?« Seit ihrer Kindheit liebte sie Flohmarktbesuche mit ihrer Schwester, denn sie hatten ihre ganz eigene Art, nach Dingen Ausschau zu halten.
»Sehr schön, er fängt um zehn an. Wenn du magst, können wir vorher zusammen frühstücken. Und falls nicht, dann …«
»Ich stehe um Punkt neun vor deiner Tür«, versprach sie, während sie sich nach Scarlett umsah.
»Super. Ich freue mich.«
»Ich mich ebenso.« Sie überlegte, ob sie wie geplant Hope gegenüber diese eine Sache erwähnen sollte, und entschied sich schließlich dafür. »Ich war ja heute bei Mom …«
»War alles in Ordnung?«
War jemals alles in Ordnung?
»Ja, schon. Aber Mom saß in denselben Sachen da wie vor zwei Tagen und hatte anscheinend nicht mal ihre Unterwäsche gewechselt. Da sollten wir zukünftig ein bisschen besser drauf achten.«
»Oje. Ich hab’s gestern leider nicht hingeschafft. Aber morgen habe ich es fest vor.« Sie wechselten sich täglich ab mit den Besuchen bei ihrer Mutter. Sofern es ihnen möglich war.
»Bist du sicher? Dir geht es doch nicht so gut. Ich kann das auch übernehmen.«
»Nein, nein, kein Problem. Ich wollte sowieso kolumbianisch kochen und ihr was vorbeibringen. Vielleicht mag sie ja sogar zusammen mit mir essen.«
»Okay, wie du möchtest.« Ihr fiel etwas ein, und sie musste grinsen. »Das hab ich dir ja noch gar nicht erzählt.«
»Was denn?«
»Als ich heute in der Redaktion war, bin ich Glenn über den Weg gelaufen.«
»Nein!«
»Und er hat mich für Freitagabend auf ein Date eingeladen.«
»Nein! Nein!«, rief ihre Schwester aus.
»Oh doch. Und ich habe zugesagt.«
»Ich dachte, du wolltest nicht mehr mit ihm ausgehen, nachdem er bei eurem letzten Date auf etwas Festes aus war. Du hast mir sogar gesagt, ich soll dich davon abhalten, falls du es erneut vorhättest.«
»Das haben wir geklärt. Er weiß jetzt, dass ich keine Beziehung will, und er ist damit einverstanden, dass wir es locker belassen. Zudem ist er ziemlich attraktiv und … ehrlich gesagt, ist es meistens sehr schön mit ihm.« Und damit meinte sie nicht nur den Sex an sich, sondern vor allem die Tatsache, dass Glenn sie wunderbar von all ihren Sorgen abzulenken wusste.
»Na dann, ich kann dich offensichtlich nicht aufhalten. Also bleibt mir nur, dir viel Spaß zu wünschen.«
»Danke.«
»Ich gehe jetzt schlafen, ich bin müde.«
»Gute Nacht. Und bitte melde dich, falls irgendwas ist. Ich bin sofort bei dir, wenn du mich brauchst, das weißt du.«
»Ja, ich weiß. Ich hab dich lieb.«
»Ich dich mehr.«
Sie legten auf und Harmony saß wieder allein in ihrer Wohnung. In einem Berg voller Papiere. Keine Spur von ihrer Katze, der Teebecher leer und ihre Gedanken schon bei Glenn. Den sie zwar wirklich mochte, mit dem sie sich aber niemals etwas Ernstes vorstellen könnte. Denn darüber war sie echt hinaus. Zu sehr hatte sie die Trennung von Paul mitgenommen, mit dem sie achtzehn Monate zusammen gewesen war.
Paul war Anwalt und extrem gründlich. Und pünktlich. Wenn man sich nur um zwei Minuten verspätete, war Paul gereizt. Außerdem hatte er einfach alles analysiert. Wenn es nur um die Frage ging, wo sie essen gehen sollten, hatte er erst einmal Fakten gesammelt: Rezensionen im Internet gelesen, Leute, die er kannte, nach dem Restaurant befragt … Wenn er den Laden dann für okay befunden hatte und sie sich endlich auf den Weg machten, war Harmony die Lust meist schon vergangen. Am schrecklichsten fand sie aber, dass Paul jedes Mal, wenn er sich bei einem Streit im Unrecht sah, »Einspruch!« rief. Dabei kam sie sich vor wie im Gerichtssaal und sie fühlte sich, als müsste sie sich verteidigen. Oder Gegenbeweise vorlegen. Oder einen eigenen Anwalt engagieren.
Dennoch hatte sie Paul echt gerngehabt. Er brachte ihr öfter Blumen, als es irgendein anderer Mann je getan hatte. Er bestand darauf, sie jedes Mal einzuladen, egal ob im Restaurant oder im Kino, und er hielt ihr stets die Tür auf. Bei ihm fühlte sie sich ein bisschen wie eine Prinzessin oder wie in einem Film aus den Vierzigerjahren, als die Männer noch Gentlemen waren und den Frauen die Welt zu Füßen legten.
Leider sollte Paul aber weder ihr Prinz noch ihr Cary Grant sein. Weil das wahre Leben nun mal kein Film war.
Harmony seufzte. Wahrscheinlich wäre es wirklich besser, das Date mit Glenn abzusagen. Aber dann hätte sie nur noch mehr Zeit, um sich zu sorgen, und das wollte sie unbedingt vermeiden. Also ging sie zu ihrem Kleiderschrank und überlegte, was sie anziehen könnte. Und da entdeckte sie auch Scarlett, die es sich ganz unten zwischen ihren High Heels bequem gemacht hatte.
»Du bist echt eine Diva, oder?«, fragte sie, holte das Tier hervor und knuddelte es. Glücklicherweise ließ Scarlett sie heute sogar mal. Vielleicht verstand sie ja, wie schwer es gerade für sie war. Alles. Die Reportagen, die andauernde Sorge um ihre Schwester und die Bürde, die die Verantwortung für ihre Mutter mit sich brachte. Es war nicht leicht mit ihr, doch Harmony wollte stark sein. So wie sie es immer war. Und deshalb würde sie auch Lesley und die anderen Menschen auf der Straße noch nicht aufgeben. Weil sie sie brauchten. Und wenn das Einzige, was sie tun konnte, war, ihre Geschichten aufzuschreiben und mit der ganzen Stadt zu teilen. Damit sie endlich gesehen wurden.
Harmony ließ Scarlett runter, die gleich wieder Reißaus nahm, dann ging sie in die Küche und machte sich eine weitere Tasse Tee. Fünf Minuten später griff sie sich ihren Laptop, um Lesleys Interview fertig zu schreiben.
3
Sie nahm eine Packung Tortillas aus dem Regal und legte sie in den Einkaufswagen. Dazu kamen eine Flasche passierte Tomaten, ein Glas Jalapeños, zwei Dosen Mais, Kidneybohnen, eine Tüte Reibekäse, zwei Hähnchenfilets, Chorizo, Eier, Milch, Reis und Maismehl. Schließlich ging sie in die Obst- und Gemüseabteilung und nahm alles mit, was gut und gesund aussah. Alles, was man für kolumbianische Gerichte wie Ajiaco de Bogotá, Arepa oder Tamales brauchte.
Als auch die Kochbananen im vollgefüllten Wagen waren, machte Harmony sich auf zur Kasse. Und sie hoffte, dass sie nichts vergessen hatte. Dass ihre Mutter bekam, was immer sie benötigte. Obwohl sie nur selten einen Wunsch äußerte, wusste Harmony ja, was sie mochte. Fernanda Roberts, geborene Sánchez, war zwar bereits vor über vierzig Jahren in die Staaten eingewandert, hatte sich jedoch nie an das amerikanische Essen gewöhnen können. Sie wollte weiterhin nichts als kolumbianisch kochen, selbst als sie dann einen Amerikaner heiratete. Der war allerdings so voller Liebe für seine Frau, dass er wahrscheinlich sogar Meerschweinchen oder Piranhas gegessen hätte, die in Kolumbien als traditionelle Nahrungsmittel galten. Nur waren diese natürlich in Arizona nicht erhältlich und deshalb kamen oftmals Reis und Bohnen, gefüllte Maisfladen und Eintöpfe mit Fleisch und Fisch auf den Tisch.
Harmony und Hope waren damit aufgewachsen und mochten als Kinder die meisten kolumbianischen Speisen, mit den Jahren hatten sie sich aber ihre eigenen Leibgerichte ausgesucht. Hope hatte Pizza lieben gelernt, während Harmony eine Schwäche für Spaghetti entwickelte, in jeder Variante: mit Pesto, aglio e olio oder auch nur schlicht mit Tomatensoße. Nicht selten hatte ihre Mom sich beschwert und die Mädchen gefragt, ob sie etwa eine Italienerin statt einer Kolumbianerin zur Mutter hätten. Allerdings hatte sie dabei gelacht und es nicht so ernst genommen, einfach weil sie ein lebensfroher Mensch war, dem nichts und niemand etwas anhaben konnte.
Doch das war einmal. Als Harmony eine halbe Stunde später die Tür aufschloss und das Haus betrat, war dieses wie so oft dunkel, weil ihre Mutter noch nicht mal die Vorhänge aufgezogen hatte.
»Hallo, Mom«, sagte sie und stellte die schweren Einkaufstüten ab.
»Hola, Harmony«, erwiderte die Fünfundsechzigjährige, die wie meistens in ihrem Fernsehsessel saß.
Harmony betrachtete ihre Mutter kurz. Heute trug sie ein sauberes hellblaues Kleid und ihre Haare sahen ein wenig zerzaust aus – kein Wunder, der letzte Friseurbesuch war Ewigkeiten her. Schließlich gab sie ihr einen Kuss auf die Wange. »Wie geht es dir?«
»Gut, gut. Und dir, mi corazón?« Fernanda schenkte ihr ein Lächeln, und wann immer sie das tat, glaubte man einen Moment lang fast, sie wäre die Alte und es hätte sich nicht alles, aber auch alles verändert.
»Auch gut, danke. Ich bringe dir neue Lebensmittel.«
»Das ist lieb von dir«, sagte ihre Mutter und wandte sich wieder dem Fernseher und den Figuren ihrer Serie zu. Es war eine dieser lateinamerikanischen Seifenopern, die in ihrem Haus den ganzen Tag liefen.
»Ich sortiere sie dann mal in die Schränke, ja?«
»Danke, mi corazón«, sagte ihre Mom noch, war aber bereits völlig in ihrer Fernsehwelt versunken. Und das echte Leben schien weit weg.
Harmony brachte die Tüten in die Küche und packte sie aus. Dabei entfuhr ihr ein tiefer Seufzer, wie so oft. Denn ihre Mutter verbrachte den lieben langen Tag in diesem dunklen Haus, abgeschirmt von der Realität, und wenn ihre Töchter nicht für sie einkaufen würden, würde sie wahrscheinlich gar nichts essen.
Seit dem Tag von Dans Tod war Fernanda nicht mehr dieselbe. Es war, als hätte sie ebenfalls ihr Leben verloren oder zumindest ihren Lebenswillen. Lange Zeit hatte sie sich in sich zurückgezogen und unter schlimmen Depressionen gelitten. Nach einer Weile hatte sie sich dann eine Welt erschaffen, in der das Dasein erträglich war. Eine Blase, in der sie wieder leben konnte, in die aber niemand sonst Einlass bekam – nicht einmal ihre Töchter.
Mit ihrem Liebsten war auch ein Teil von Fernanda selbst verschwunden: der fröhliche, der lebenslustige, der, der eine fürsorgliche Mutter war. Hope war damals bereits auf dem College gewesen, doch Harmony war erst sechzehn und musste fortan nicht nur mit dem Verlust ihres Dads zurechtkommen, sondern zudem mit einer Mutter, die zwar anwesend, aber dennoch abwesend war. Um die sie sich jetzt kümmern musste, obwohl es andersherum hätte sein sollen.
Ihr langjähriger Pastor, der Fernanda anfangs noch häufiger besuchen kam und dem sie sich als Einzigem anvertraute, hatte Harmony und Hope erklärt, dass Fernanda zusammen mit Dan ihren sicheren Hafen verloren habe und deshalb unter schlimmen Angstzuständen leide. Sie mochte das Haus nicht mehr verlassen, weil sie sich außerhalb ihrer eigenen vier Wände nicht mehr sicher fühlte. Mochte sich mit keiner Freundin mehr verabreden, nicht mehr in den Supermarkt gehen, ja nicht einmal zur Kirche, weil sie sich ohne ihren Liebsten völlig verloren fühlte.
Es waren schwere Zeiten und es hatte einige Jahre gebraucht zu akzeptieren, dass ihre einst so unbeschwerte Mom nie mehr dieselbe sein würde. Dass sie nie mehr die Straße entlangtänzeln würde.
Harmony stellte die Dosen in den Schrank, sah, dass keine schwarzen Bohnen mehr da waren, und machte sich eine gedankliche Notiz, dass sie beim nächsten Mal welche besorgen musste. Als sie den Kühlschrank öffnete, entdeckte sie ein paar abgelaufene Dinge, die sie sogleich entsorgte, dazu drei gefüllte Tupperdosen, die nur von Hope stammen konnten. Harmony öffnete eine der Dosen und erkannte darin Posta Negra, ein Rindfleischgericht mit einer Cola-Soße, das ihre Mutter zwar gern aß, sich aber nur selten selbst kochte. Allerdings sah es nicht danach aus, als ob sie das Essen überhaupt angerührt hätte.
Als sie in der Küche fertig war und den Müll hinausgebracht hatte, ging Harmony wieder ins Wohnzimmer. Sie stellte ihrer Mutter ein Glas Ginger Ale auf den Tisch neben den Stapel Fotoalben, öffnete die Vorhänge und setzte sich aufs Sofa. Ihre Mom bedachte sie keines Blickes.
»Hast du heute schon etwas gegessen?«, fragte sie. Es war bereits halb vier am Nachmittag, doch die Frage war berechtigt.
Fernanda nickte. »Ich hatte eine Schüssel Changua.« Das war eine Frühstückssuppe aus Milch, Eiern, geröstetem Brot, Frühlingszwiebeln und Koriander.
»Das ist ja aber sicher einige Stunden her. Soll ich dir etwas warm machen? Im Kühlschrank ist noch leckere Posta Negra von Hope.«
»Nein danke. Ich habe keinen Hunger. Ich mache mir später selbst etwas zu essen.«
»Na gut.«
Sie saßen schweigend zusammen. Nach einer Weile fragte Harmony: »Was läuft denn gerade?«
»Pálpito«, gab ihre Mom kurz und knapp preis.
»Hmm … wenn die Folge rum ist, könnten wir ja vielleicht einen kleinen Spaziergang machen oder uns wenigstens ein bisschen raus auf die schattige Veranda setzen«, schlug sie vor, obwohl sie die Antwort kannte.
»Das geht nicht! Ich kann jetzt hier nicht weg. Ich muss doch erfahren, ob Simón sich in Camila verliebt. Sie trägt das Herz seiner verstorbenen Frau Valeria in sich. Die wurde ermordet, und Simón will sich außerdem an den Organhändlern rächen.«
Oh Gott, dramatischer geht es wohl nicht, dachte Harmony. Sie atmete tief durch und versuchte, ruhig zu bleiben und zu verstehen – wie immer. Ihre Mutter war nun mal zufrieden in ihrer eigenen kleinen Telenovela-Blase, in der Menschen die Liebe fanden und bis ans Ende ihrer Tage glücklich waren – wenn sie nicht wie Valeria wegen ihrer Organe umgebracht wurden.
Sie blieb noch ein bisschen bei ihrer Mutter, dann erhob sie sich und verabschiedete sich. »Bye, Mom, ich schaue in zwei Tagen wieder vorbei.«
»Mach das, mi corazón.«
»Brauchst du irgendetwas? Soll ich was Spezielles besorgen?«
»Wenn du Yuccas auftreiben könntest? Ich würde gern mal Sancocho machen.« Sancocho war ein Eintopf, der neben verschiedenen Fleischsorten und Kochbananen auch Yuccas beinhaltete, die man hier leider nicht wie in Kolumbien an jeder Straßenecke bekam. Sie würde mal auf dem Wochenmarkt Ausschau halten, ansonsten würde sie sicher im Asiamarkt fündig werden nach der Knolle, die dort Maniok oder Cassava genannt wurde.
»Natürlich, Mom. Sieh du dir nur weiter deine Serien an.« Sie drückte ihre Mutter und ging zur Tür.
»Kannst du die Gardinen zuziehen?«, rief Fernanda ihr hinterher.
Seufzend tat sie ihr den Gefallen, wobei sie sie wenigstens einen Spalt offen ließ. Dann trat sie hinaus und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen.
Auf dem Weg nach Hause dachte sie an Hope und ihren Krankenhaustermin. Sie dachte an das Date mit Glenn heute Abend und überlegte noch immer, was sie dazu anziehen könnte. Sie grübelte wegen des Artikels, den sie heute Morgen in die Redaktion geschickt hatte, und fragte sich, ob er Lesley gerecht wurde. Ob er ihrer Leidensgeschichte die angemessene Intensität verlieh. Im nächsten Moment sann sie schon darüber nach, wessen Story sie als Nächstes aufschreiben sollte. Sie könnte die der jungen Mutter nehmen, die mit ihren beiden Kindern auf der Straße lebte und Essen aus den Mülltonnen hinter den Restaurants beschaffte. Sie konnte es kaum erwarten, damit zu beginnen. Denn sie wollte aufmerksam machen, etwas bewirken. Natürlich war ihr klar, dass ihr Boss sich vor allem gute Verkaufszahlen erhoffte. Nicht umsonst hatte er einen wöchentlichen Beitrag auf der kompletten Seite vier daraus gemacht – und das in der beliebten Sonntagsausgabe! Und nicht ohne Grund hatte er Harmony sogar ein Spesenkonto zur Verfügung gestellt, das sie nutzen konnte, um den Betroffenen etwas zu essen, neue Kleidung oder wie in Lesleys Fall Babysachen zu kaufen – im Austausch für deren Lebens- und Leidensgeschichte. Wayne hatte Harmony sogar ein Kamerateam zur Seite stellen wollen, für professionellere und noch effektivere Bilder der Obdachlosen. Zum Glück hatte Harmony ihn davon überzeugen können, dass sie vertrauenswürdiger rüberkommen würde, wenn sie allein an die Menschen herantrat und selbst ein paar Fotos mit dem Smartphone schoss. Sie wollte sie ja nicht verschrecken, bevor sie sich ihr überhaupt geöffnet hatten.
Waynes Intentionen unterschieden sich sehr von Harmonys, doch sie nahm es alles in Kauf. Denn am Ende ging es ihr allein um das Ergebnis. Ihre Mission war es, die Menschen wachzurütteln, ihnen das wahre Elend zu zeigen, das sich auf ihren Straßen abspielte und das sie leider nur zu gern ignorierten. Sie wollte den Obdachlosen ein Gesicht und einen Namen geben.
Als sie noch über all das nachdachte, nahm sie zwei Silhouetten wahr, die an eine Mauer gelehnt vor einem Spirituosenladen auf dem Boden saßen. Sie fuhr langsamer und blickte sich zu ihnen um. Ein Junge und ein Mädchen, beide schwarz und allerhöchstens zwanzig, sie trug gar keine Schuhe, er nur einen. Ohne weitere Überlegungen drehte Harmony um und parkte vor dem Geschäft.
Beim Aussteigen schlug ihr die Hitze entgegen. Zuerst betrat sie den Laden, um Vitaminwasser mit Elektrolyten zu kaufen, danach ging sie zu dem Pärchen, das aneinandergelehnt in der Nachmittagssonne schmorte. Sie reichte jedem zwei Flaschen, dankbar wurden sie angenommen.
»Mein Name ist Harmony. Darf ich mich kurz zu euch setzen?«, fragte sie, wie immer mit pochendem Herzen.
Der Junge, der von Nahem noch viel jünger aussah, trank eine der Flaschen in einem langen Zug aus und nickte dann. »Okay.«
Das Mädchen blieb still, beäugte sie nur misstrauisch.
Sie setzte sich ungefähr einen Meter entfernt auf den Bordstein und betrachtete die beiden, darauf bedacht, interessiert und nicht abwertend rüberzukommen.
»Ich bin Reporterin für den Phoenix Eagle«, begann sie. »Kennt ihr die Zeitung?«
Der Junge zuckte die Schultern, doch das Mädchen nickte. »Meine Mom liest die dauernd.«
Das war gut. Das war sogar sehr gut.
»Ich schreibe seit einer Weile wöchentliche Beiträge, in denen ich mich Menschen in dieser Stadt widme, mit denen das Leben es nicht so gut gemeint hat. Versteht es bitte nicht falsch … aber ich glaube, ihr seid zwei von ihnen.«
»Na, da hast du aber so was von recht«, meinte der Junge in lautem, aggressivem Tonfall.
»Kofi«, sagte das Mädchen und stupste ihn an.
»Was denn?« Er blickte Harmony direkt in die Augen. »Was wollen Sie von uns? Etwa über uns schreiben?«
»Wenn ihr damit einverstanden wärt? Ich möchte …«
»Warum sollten wir das sein?« Noch immer starrte der Junge sie an.
Sie versuchte, ruhig durchzuatmen. Sich selbst aus den Augen der beiden zu sehen. »Weil ich die Einwohner von Phoenix aufwecken möchte. Weil ich möchte, dass ihr gesehen werdet.« Sie sagte das aus dem Herzen heraus und konnte erkennen, dass sie das Mädchen auf eine Art berührt hatte.
Die Kleine wollte gerade etwas sagen, als aber Kofi ihr zuvorkam. »Und was kriegen wir dafür?«
Harmony überlegte nur eine Sekunde, und dabei war ihr egal, dass Wayne die Ausgaben auf hundert Dollar pro Story begrenzt hatte. »Neue Sneakers und ein Abendessen?«
Die beiden wechselten einen Blick, dann verzog sich das Gesicht des Jungen zu einem Lächeln, er hielt ihr seine Hand hin und sagte: »Deal!«
4
Zweieinhalb Stunden später stand Harmony vor dem Spiegel und betrachtete sich in ihrem kurzen dunkelbraunen Rock und dem schwarzen Seiden-Trägerhemd. Und sie überlegte, ob das Outfit zusammen mit ihren geglätteten, schulterlangen schwarzen Haaren nicht zu düster wirkte. Sie wollte keinesfalls wie ein Gothic aussehen oder als wäre sie gerade auf einer Beerdigung gewesen. Obwohl es ihr ein bisschen so vorkam. Das Gespräch mit dem obdachlosen jungen Pärchen hatte ihr ganz schön zugesetzt. Nachdem sie mit ihnen ins nächste Kaufhaus gefahren war, wo sie sich jeder ein Paar Turnschuhe ausgesucht hatten, war sie mit ihnen in einen Taco Bell gegangen. Sie hatte ihnen gesagt, dass sie alles bestellen durften, was sie mochten, und das hatten sie getan. Nur selten hatte Harmony Menschen auf diese Weise Essen in sich reinschlingen sehen. Als hätten sie seit Tagen oder gar Wochen nichts Richtiges zu sich genommen.
Dann hatte sie sich den beiden vorsichtig angenähert. Hatte sie erzählen lassen, was sie erzählen wollten. Dabei hatte sie erfahren, dass der Junge, Kofi, tatsächlich erst sechzehn war, seit zwei Jahren auf der Straße lebte und Crystal Meth zu seiner Lieblingsdroge auserkoren hatte. Das Mädchen hieß Kara, sie war achtzehn und nahm nur selten mal Drogen. Viel lieber kaufte sie sich mit dem Geld, das sie mit Gelegenheitsjobs, Betteln und manchmal auch mit Diebstahl verdiente, was zu essen oder etwas, das machte, dass sie sich besser fühlte. Zum Beispiel ein neues T-Shirt, ein Lipgloss oder eine Handcreme. Die beiden hatten vor ungefähr einem Jahr zusammengefunden und waren sehr verliebt. Sie hatten nur noch sporadisch Kontakt zu ihren Familien, Kofis Vater lebte ebenfalls auf der Straße, und Karas Schwester war im Winter niedergestochen worden. Weder Kofi noch Kara gingen zur Schule, hatten einen Abschluss oder irgendeine Zukunftsperspektive. Aber sie wollten zusammenbleiben, vielleicht nach Kalifornien gehen und irgendwann »raus aus der Scheiße« kommen und eine eigene Familie gründen.
Harmony wünschte ihnen so sehr, dass sie es schafften.
Sie bat sie um ein Foto und gab ihnen die Karte einer Sozialarbeiterin, die sie persönlich kannte, in der Hoffnung, die beiden würden sie anrufen. Dann verabschiedete sie sich schweren Herzens.
Das Schlimmste war, wie nah ihr diese Geschichten gingen. Es handelte sich hier immerhin um Menschen, die alles verloren hatten. Die am Abgrund standen und vielleicht niemals von der Straße wegkommen würden. Es war traurig, unendlich traurig, und wie gern würde Harmony ihnen ihr letztes Hemd geben, doch sie wusste auch, dass das nicht ging. Sie lebte ihr privilegiertes Leben aus einem bestimmten Grund, hatte hart dafür gearbeitet, um dort hinzugelangen, wo sie heute war. Und sie hatte eine Aufgabe. Heute hatte sie wieder etwas erreicht und das war alles, was zählte.
Ein letzter Blick in den großen Schlafzimmerspiegel und sie hatte sich entschlossen. Sie würde sich nicht noch einmal umziehen. Sie hatte ja nicht vor, in Glenn den Mann fürs Leben zu finden. Der heutige Abend war nur ein leckeres Essen und vielleicht ein paar nette gemeinsame Stunden danach. Oh ja, die könnte sie ganz dringend gebrauchen. Einfach mal abschalten und an nichts denken, weder an ihre Mutter und deren Eigenheiten noch an ihre Schwester und deren Krankheit, noch an all die armen Menschen auf den Straßen von Phoenix, denen sie niemals so sehr würde helfen können, wie sie gern würde. Sie wollte doch nur mal wieder sorglos sein und Spaß haben. Nur diesen einen Abend – war das denn zu viel verlangt?
»Hi Glenn«, sagte sie, als er vor dem Restaurant auf sie zukam, und ließ sich von ihm auf die Wange küssen.
»Du siehst umwerfend aus«, sagte er und hatte sich selbst ebenfalls herausgeputzt. Er trug eine schwarze Anzughose und ein schickes hellgraues Hemd, dessen Ärmel er hochgekrempelt hatte und dessen obere drei Knöpfe offen standen. Sein dunkles Haar war zurückgegelt, sein linkes Ohr zierte wie immer ein kleiner goldener Stecker.
Sie schenkte ihm ein Lächeln. »Danke schön. Das kann ich nur zurückgeben.«
»Wartest du schon lange?«, fragte Glenn, der dank seines Vaters japanische Züge hatte, wie er ihr bei einem früheren Date bereits erzählt hatte.
»Nicht mal zwei Minuten, keine Sorge.«
»Okay, gut. Wollen wir dann reingehen?«
Sie nickte und freute sich auf den Abend. Gemeinsam betraten sie den French Room, ein angesagtes französisches Restaurant, das eine lange Warteliste hatte, wie sie wusste. Entweder hatte Glenn Beziehungen zum Inhaber oder er hatte die Reservierung bereits gehabt, seiner eigentlichen Verabredung war etwas dazwischengekommen, und er hatte stattdessen Harmony eingeladen. Ehrlich gesagt war es ihr egal.
Sie wurden zu ihrem Tisch geleitet, bekamen die Karte und ihnen wurde Wasser eingeschenkt. Harmony entschied sich für das Ratatouille und ein Glas Rotwein, während Glenn Austern und Weißwein bestellte.
»Du hättest ruhig etwas Extravaganteres aussuchen können«, meinte er.
»Ich weiß. Ich mag es aber gern simpel. Mein Leben ist kompliziert genug«, entgegnete sie, obwohl sie sich geschworen hatte, heute Abend auszublenden, was sie belastete.
»Oh. Ist alles in Ordnung?«
»Ja, ja, alles okay.« Sie nahm einen Schluck Wasser.
»Klingt aber gar nicht so. Geht es dir gut? Und deiner Familie?«
Sie hatte bereits mitbekommen, dass Glenn der totale Familienmensch war. Sicher wollte er bald heiraten und ein paar Kinderchen in die Welt setzen.
»Glenn, das ist echt lieb, dass du dich nach meiner Familie erkundigst, aber das musst du nicht. Wir sollten nicht über so persönliche Dinge reden.«
»Das möchte ich aber. Es interessiert mich, was du privat machst und wie dein Verhältnis zu deinen Verwandten ist.«
Sie seufzte. Denn sie hatte ehrlich gedacht, er hätte das mit der »lockeren Sache« verstanden.
Und selbst wenn sie sich ihm hätte mitteilen wollen, wo hätte sie anfangen sollen?
Meine Mutter lebt in ihrer eigenen Welt und interessiert sich mehr für ihre Telenovelas als für mich?
Meine Schwester, der mir wichtigste Mensch auf Erden, ist in Remission, nachdem sie den Krebs schon zweimal besiegt hat, und ich habe fürchterliche Angst, dass er zurückkommt?
Mein Vater ist gestorben, als ich sechzehn war, was mein ganzes Leben verändert hat?
»Sei mir nicht böse, aber ich würde mich viel lieber über Belangloseres unterhalten, wie sonst auch.« Damit hatte er sie schon oft von den tagtäglichen Dramen abgelenkt. Außer dieses eine Mal, als er plötzlich von einer Beziehung anfing. Aber das war ja nun hoffentlich geklärt. Sie schlug ein Bein übers andere und streckte sich. »Was gibt es denn Neues bei dir? Du schreibst gerade an diesem Artikel über das Wetter, oder? Dass es der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung ist?«
Glenn betrachtete sie ein paar Sekunden. »Nett, dass du meine Arbeit als belanglos bezeichnest.«
»Oh Gott, Glenn, bitte entschuldige. So war das nicht gemeint, ich …«
Er lachte. »Schon okay, ich nehme es dir nicht übel.«
Der Wein kam und sie nahm zwei große Schlucke.
»Na gut, dann sprechen wir eben über meinen Artikel«, sagte Glenn und nahm seinerseits einen Schluck. »Mhm, der ist gut. Also, das Wetter. Wir dachten ja eigentlich, der letzte Sommer wäre der heißeste aller Zeiten gewesen mit hundert Grad Fahrenheit an mehr als hundert Tagen am Stück. Aber dieses Jahr wird wohl noch heftiger. Ich meine, wir haben erst Mitte Juli, und es sind bereits achtundzwanzig Menschen allein in Phoenix und Umgebung an einem Hitzschlag gestorben.«
»Schrecklich«, sagte sie und erinnerte sich an eine Meldung über eine Frau in Tempe, die mitten im Supermarkt tot umgefallen war, weil sie zu wenig getrunken hatte.
Ihr fiel ein, dass Hope ihr kürzlich gesagt hatte, sie fühle sich schlapp, und natürlich machte sie sich abermals Sorgen. Auch wenn ihre Schwester ihr bei ihrem gestrigen Telefonat versichert hatte, es sei alles wieder okay.
»Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich kurz meine Schwester anrufe, bevor das Essen kommt?«, bat sie.
»Nein, natürlich nicht. Mach ruhig«, erwiderte Glenn verständnisvoll.
»Danke.« Sie ging vor die Tür, wo bereits ein paar Raucher standen.
Sie rief Hope an, die sich wie immer direkt meldete.
»Mony?«
»Hey, Sis. Wie geht es dir?«
»Ganz gut, danke. Aber … hast du nicht gerade dein Date mit Glenn?«, fragte ihre Schwester verwirrt.
Sie strich sich mit der freien Hand die Haare hinters Ohr. »Ja, ich hab mich kurz entschuldigt, weil ich dich unbedingt noch anrufen wollte. Ich hab’s vorhin nicht mehr geschafft.«
»Das wäre doch nicht nötig gewesen. Armer Glenn.« Hope lachte, dann wurde sie ernster. »Liebes, du musst mich nicht jeden Abend anrufen, es wäre nicht schlimm, mal einen auszulassen.«
»Ich möchte aber. Außerdem wollte ich mich erkundigen, ob du auch genug trinkst.«
»Tue ich.«
»Ich meine, wirklich genug? Glenn schreibt gerade an einem Artikel über diese irren Temperaturen und er erzählte, dass bereits achtundzwanzig Menschen an einem Hitzschlag gestorben seien, nur in Phoenix und Umgebung.«
»Ich werde nicht an Hitzschlag sterben, Mony.«
»Das weiß man nie. Wenn das Immunsystem eh schon geschwächt ist und …«
»Ich verspreche es dir, ja? Ich werde jetzt sofort in die Küche gehen und ein großes Glas Wasser trinken. Nur für dich«, sagte ihre Schwester in belustigtem Tonfall.
»Bitte zieh das Ganze nicht ins Lächerliche, Hope. Ich mache mir echt Sorgen.«
»Du machst dir viel zu viele Sorgen und das ist das Problem.«
»Ist es ein Problem?«, fragte sie überrascht.
»Ja.«
»Oh. Und warum?«
»Na, weil du dir bei all den Sorgen kaum mehr Zeit für dich selbst nehmen kannst. Sitzt nicht gerade dein Date im Restaurant und wartet auf dich?«
»Schon. Aber das Essen ist bestimmt noch nicht da, wir sind in einem dieser schicken französischen Läden.« Sie kickte einen Kieselstein weg, der am Boden lag.
»Du solltest ihn trotzdem nicht länger warten lassen.«
»Okay. Nur eine Sache noch. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich heute bei Mom war und einen Großeinkauf für sie gemacht habe. Du brauchst also morgen nicht in den Supermarkt zu fahren.«
»Super, danke. Wie war sie so drauf?«
»Wie immer, würde ich sagen. Sie schaut eine neue Serie und ist Feuer und Flamme«, erzählte Harmony.
»M-hm. Und was hatte sie an?«
»Ihr hellblaues Kleid.«
»Das habe ich ihr gestern frisch gewaschen mitgebracht. Das heißt, sie hat sich heute Morgen umgezogen, sehr gut«, sagte Hope, die sich seit Jahren um die Wäsche ihrer Mutter kümmerte. »Hat sie was von der Posta Negra gegessen?«
»Es standen noch ein paar Tupperdosen im Kühlschrank.«
»Wahrscheinlich hat sie die wieder gar nicht angerührt, dabei habe ich extra ihr Lieblingsgericht zubereitet.« Hope klang enttäuscht. »Ich wollte gestern zusammen mit ihr essen, aber sie hatte keinen Hunger.«
Das war typisch. Fast jedes Mal, wenn man ihrer Mom diesen Vorschlag machte, erfand sie eine Ausrede. Harmony glaubte ja, dass sie einem stillen Beisammensitzen ausweichen wollte, da sie befürchtete, unangenehme Fragen beantworten zu müssen. Sie selbst hatte längst aufgegeben, es anzubieten, vor allem, weil sie das betretene Schweigen genauso schlimm fand. Eine Mutter, die nicht mit einem redete, weil sie vor dem Fernseher saß, konnte sie gerade noch verkraften. Eine, die sie bei einem gemeinsamen Dinner am Tisch ignorierte, war kaum zu ertragen. Doch Hope hatte es nie aufgegeben. Noch immer versuchte sie, ein wenig Normalität wiederherzustellen, obwohl der Zug schon lange abgefahren war.
»Sie wird es bestimmt noch essen«, versuchte Harmony, hoffnungsvoll zu klingen.
»Ja, mag sein. Ansonsten friere ich morgen etwas davon ein. Fahren wir nach dem Flohmarkt zusammen hin?«
»Das können wir gerne machen.«
»Okay, gut. Und du geh jetzt endlich zurück zu Glenn. Wir sehen uns zum Frühstück.«
»Ich mach ja schon. Bis morgen, ich freue mich darauf, dich zu sehen.«
»Ich freue mich auch«, erwiderte Hope und hatte bereits aufgelegt.
Harmony machte, dass sie schnellstens zurück zu Glenn kam, und tatsächlich standen bereits die Teller mit dem köstlich duftenden Essen auf dem Tisch.
»Bitte verzeih«, sagte sie.
»Familie geht immer vor«, meinte Glenn, war aber anscheinend doch froh, dass sie endlich zurück war, denn er nahm sogleich eine Muschel in die Hand und schlürfte sie aus, als wäre so eine Auster das Köstlichste überhaupt.
Harmony dagegen aß ihr Ratatouille, das nur mittelmäßig gut war, und fast wünschte sie, sie hätte sich vorhin mit Kara und Kofi ein paar Tacos gegönnt.
5
Die aphrodisierende Wirkung der Austern hielt leider nicht, was sie versprach – zwanzig Minuten, nachdem sie in Glenns Wohnung angekommen waren, war das ganze Vergnügen auch schon vorbei.
Unbefriedigt lag Harmony neben ihm in seinem Bett und hoffte, er würde wenigstens noch dafür sorgen, dass sie sich ebenfalls gut fühlte. Als sie aber zu ihm rüberblickte, war Glenn bereits eingeschlafen.
Das darf ja wohl nicht wahr sein!, fluchte sie innerlich, stand auf und zog sich wieder an. Sie verließ die Wohnung, setzte sich in ihren Wagen und wusste, es gab nur einen Ort, wo sie jetzt hinwollte. Nur eine Person, die sie nach diesem Dilemma aufmuntern konnte.
Schnurstracks fuhr sie zu Lauren und rief sie auf dem Weg kurz an, ohne sich zu sorgen, ob sie überhaupt noch wach war. Denn natürlich war sie das. Die Frau schrieb nachts am besten, wie jeder wusste.
Wenig später öffnete ihre beste Freundin ihr die Tür und bat sie herein.
Harmony drückte sie ganz fest. »Danke, dass du Zeit für mich hast.«
»Du siehst echt schlimm aus«, war alles, was Lauren erwiderte.