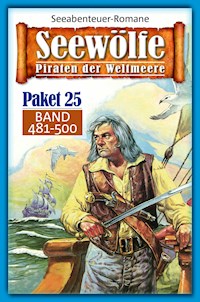
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Die Männer an Bord der Kriegsgaleone "San Sebastian" standen wie erstarrt. Im Einzelfeuer hatten sie die zehn Backbord-Culverinen eingesetzt, und zwar im genauen Zielbeschuß. Jedes Geschoß hatte ein Stück mehr aus der Felswand dort oben gehämmert. Und der dreiundzwanzigste Schuß hatte das ausgelöst, was beabsichtigt gewesen war: ein Zurückverlegen des Wasserfalls vor dem Eingang zu den Schatzhöhlen. Aber es war noch mehr passiert. Dieser letzte Schuß hatte den Eingang blockiert, denn ein mächtiger Felsbrocken hatte sich von oben gelöst und steckte jetzt in dem Zugang. Und aus den Höhlen über der Schatzbucht tönte das Gebrüll der Kerle, die sich dort verschanzt hatten. Aber die Falle hatten sie sich selbst gestellt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2320
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2019 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-95439-993-2Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 481
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 482
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 483
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Nr. 484
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 485
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 486
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Nr. 487
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 488
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 489
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 490
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Nr. 491
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 492
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 493
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 494
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 495
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 496
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 497
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 498
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 499
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 500
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
Der Geschützdonner klang ihnen noch immer in den Ohren und war wie ein rollendes Echo, das nicht enden wollte.
Die Männer an Bord der Kriegsgaleone „San Sebastian“ standen wie erstarrt. Im Einzelfeuer hatten sie die zehn Backbord-Culverinen eingesetzt, wie ihr Capitán es befohlen hatte. Jedes Geschoß hatte ein Stück mehr aus der Felswand dort oben geschlagen. Und der dreiundzwanzigste Schuß hatte das ausgelöst, was beabsichtigt gewesen war.
Doch niemand in der Schatzbucht hatte sich das Grauen vorstellen können, das nun seinen Einzug hielt.
„Heilige Madonna!“ flüsterte Mario Sangiovese, einer von der Geschützmannschaft, die eben jenen letzten Schuß abgefeuert hatte. „Der Himmel sei diesen armen Seelen gnädig!“
Enrique Carrizo, der den Genuesen noch aus der gemeinsamen Garnisonszeit in Barcelona kannte, schüttelte verständnislos den Kopf.
„Wozu das Mitleid, Amigo? Diese Kerle gehen an ihrer eigenen Gier zugrunde. Die Lumpenhunde kriegen haargenau das, was ihnen zusteht.“
Sangiovese schloß entnervt die Augen. Nichts mehr sehen müssen! Aus der Höhle unter dem Wasserfall tönten schrille Schreie und markerschütterndes Gebrüll. Die Todesangst schien die Stimmen buchstäblich höher und höher zu peitschen, bis sie nichts Menschliches mehr hatten.
Der schlanke schwarzhaarige Genuese öffnete wieder die Augen und starrte hinauf zu dem mächtigen Felsbrocken, der den Höhleneingang blockierte. Er, Mario Sangiovese, war mitverantwortlich für jenen letzten Schuß, der den Brocken aus dem Überhang geschmettert hatte und den Wasserfall nun senkrecht an der Felswand hinunterrauschen ließ. Ein Teil des Wassers strömte gurgelnd in die Schatzhöhle.
„Sollen sie ersaufen wie die Ratten“, sagte Carrizo knurrend. Er stemmte sich auf den Rohrwischer, den er noch nicht benutzt hatte, da vom Achterdeck der Befehl „Feuer einstellen“ erfolgt war.
„Versündige dich nicht“, entgegnete Sangiovese in ungewöhnlich scharfem Ton. Er, der sonst zurückhaltend und schweigsam war, schien regelrecht außer sich zu geraten.
Carrizo, sein bester Freund an Bord, wandte sich erstaunt zu ihm um. Nun gut, Mario hatte die Lunte gezündet und damit den entscheidenden Schuß ausgelöst. Aber gerichtet hatte die Culverine der Stückmeister. Die Belobigung für die erfolgreiche Visierung im Steilschuß konnte allein er einheimsen.
Carrizo, ein breitschultriger, bulliger Mann, der aus Barcelona stammte, wußte, daß sein italienischer Amigo ein rührseliger Bursche sein konnte. Wenn er in einer lauen Mondnacht auf der Back hockte, in die Saiten seiner Laute griff und diese hinreißenden italienischen Lieder von Liebesglück und Liebesschmerz sang, dann standen ihm manchmal die Tränen in den Augen. Die anderen, die ja nur des Spanischen mächtig waren, verstanden zwar bestenfalls die Hälfte, aber sie konnten sich doch dafür begeistern, wie Mario in seinen Liedern aufging. Er sang sie nicht einfach, nein, er fühlte sie mit jeder Silbe mit.
Vielleicht, so dachte Carrizo, stellte er sich jetzt vor, was die schreienden Strolche dort oben in der Höhle durchlebten. Und das machte ihn restlos fertig. Aber konnte er sich denn nicht in einen stillen Winkel verziehen, um seine besondere Art von Trübsal zu blasen?
„Verhol dich“, sagte Carrizo mitfühlend und wollte ihm den Luntenstock abnehmen. „Es ist alles erledigt. Wenn du’s nicht mit anhören kannst, dann geh unter Deck, kriech in die Koje und zieh dir die Decke über den Kopf.“
Sangioveses Reaktion ließ ihn unwillkürlich zusammenzucken.
Der Genuese ruckte herum. Sein Gesicht verzerrte sich in jäher Wut, und bevor Carrizo auch nur den Ansatz einer Bewegung erkennen konnte, zuckten Sangioveses Fäuste vor und packten ihn an den Armöffnungen seines Brustpanzers.
„Du Mistkerl!“ schrie der Genuese mit sich überschlagender Stimme. „Du bist auch so ein verdammter Mistkerl. Dich läßt es kalt wie eine Hundeschnauze, wenn andere Menschen leiden! Kannst du denn nicht nachfühlen, wie es denen da oben geht?“ Anklagend wies er mit der Linken zur Höhle und zum Wasserfall hoch. „Was immer sie getan haben – es sind Menschen!“
Carrizo wollte die rechte Hand Sangioveses von seinem Brustpanzer stoßen. Doch es gelang ihm nicht, sosehr er sich auch anstrengte. Erstaunt sah er den Genuesen an. In seiner rätselhaften, unerklärlichen Wut entwickelte er wahre Bärenkräfte.
Aus der Höhle schrillten noch immer die Stimmen. Es klang wahrhaftig so, als schrien tausend arme Seelen gegen das Höllenfeuer an, in das sie soeben geworfen worden waren. Es ging in der Tat jedem an Bord der „San Sebastian“ durch Mark und Bein.
„Mario“, knurrte Carrizo, „nimm jetzt Vernunft an. Laß mich los, bevor ich grob werde. Verdammt, was ist denn in dich gefahren!“
Auch die anderen waren aufmerksam geworden. Ungläubig sahen sie den schlanken Mann aus Italien an, der sonst so unauffällig war und eher dazu neigte, sich schwermütig in einen Winkel zu verkriechen.
Sangiovese packte erneut mit beiden Händen zu und schüttelte seinen spanischen Freund regelrecht durch. Carrizo konnte nichts dagegen tun, daß sein Kopf in der Öffnung über dem Panzer hin und her wippte. Er sah dabei aus wie eine leblose Gliederpuppe, denn der Genuese legte in der Tat unglaubliche Kräfte an den Tag.
„Nein!“ schrie er. „Es gibt keine Vernunft! Wo, in aller Welt, gibt es denn noch Vernunft? Weshalb soll dann ausgerechnet ich vernünftig sein? Ich will es nicht! Ich kann es nicht! Menschen sterben, und wir hören tatenlos zu, ergötzen uns daran! Wo bleibt da die Vernunft?“
Auch der Capitán und die Offiziere auf dem Achterdeck waren mittlerweile aufmerksam geworden.
Sangioveses Geschrei übertönte das Rauschen des Wasserfalls und das Gebrüll der in der Höhle Eingeschlossenen.
„Decksältester!“ brüllte Capitán Gaspar de Mello. „Sorgen Sie für Ruhe, verdammt noch mal!“
„Jawohl, Capitán!“ rief der Decksälteste zurück, ein gutmütig aussehender, stämmig gebauter Mann. Seinen Rang in der Schiffsmannschaft hatte er dadurch erworben, daß er schnell und wirkungsvoll zuschlagen konnte, wenn es angebracht war. Kein Hitzkopf, der schneller mit den Fäusten war als mit dem Mund. Nein, für den Rang des Decksältesten brauchte eine Schiffsführung einen besonnenen Mann, der zudem noch das Vertrauen der gesamten Crew genießen mußte.
In diesem Fall verhielt es sich so. Alle auf der Kuhl nickten zustimmend, als sie den Befehl des Kapitäns vernahmen. Sangiovese mußte durchgedreht sein. Vielleicht hatte ihm die Sonne das Hirn unter dem Helm zum Kochen gebracht, und das Ergebnis war dieses krause Zeug, das ihm aus dem Mund sprudelte.
„Zum letzten Mal, Mario“, sagte Enrique Carrizo. „Nimm die Hände weg. Oder du lernst mich von einer Seite kennen …“
„Du?“ unterbrach ihn Sangiovese schrill. „Ausgerechnet du? Du, der du behauptet hast, mein Freund zu sein – du willst mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe? Du, der du genauso niederträchtig und menschenverachtend bist wie alle anderen?“
„Mario, um Himmels willen!“ brüllte Carrizo und versuchte abermals die klammernden Hände von seinem Brustpanzer loszureißen. „Hör endlich auf mit dem Blödsinn! Warum, zum Teufel, hast du dann das Geschütz gezündet? Warum hast du nicht den Befehl verweigert, wenn dir so viel an den ach so bedauernswerten Kerlen da oben liegt? He, warum hast du das nicht getan?“
Sangioveses Blick wurde plötzlich starr. Seine ganze Haltung verkrampfte sich. Die Augen schienen ihm aus den Höhlen quellen zu wollen.
Carrizo mühte sich vergebens ab. Er hatte den Eindruck, daß Marios Klammerfäuste aus Eisen waren. Es schien fast so, als müßte man ihm die Knochen brechen, wenn man sie überhaupt lösen wollte.
„Sangiovese“, sagte der Decksälteste ruhig. Er war hinter die Männer bei der Culverine getreten. „Nimm Vernunft an. Bewahre Ruhe und belästige deinen Kameraden nicht.“
Auch der Teniente, dem die Seesoldaten unmittelbar unterstanden, hatte sich genähert. In Belange der Borddisziplin, soweit sie nicht militärische Aspekte betrafen, wollte er sich jedoch nicht unbedingt einmischen.
Der Genuese stand steif wie ein Brett.
Carrizos Zorn war in Besorgnis umgeschlagen. Es hatte den Anschein, als würde seinem Amigo gleich der Schädel platzen. Da schien irgend etwas im Inneren seines Kopfes zu sein, das sich ausdehnte und mit aller Macht gegen die Augen und die Adern drückte. Denn sie traten hervor, als würden sie die gebräunte Haut des schlanken Mannes sprengen.
„Sangiovese“, wiederholte der Decksälteste, energischer jetzt. „Ich fordere dich zum letztenmal auf, meinen Befehl zu befolgen. Bei Nichtgehorsam muß ich Gewalt anw…“
Die letzten Silben blieben ihm im Hals stecken.
Sangiovese zerrte seinen spanischen Freund herum, so urplötzlich, daß Carrizo zu überrascht war, um sich wirksam zu wehren. Überdies waren die Kräfte des Genuesen wahrhaft verblüffend. Er trieb Carrizo gegen den Decksältesten, bevor auch dieser überhaupt reagieren konnte.
Der Decksälteste taumelte unter dem Anprall zurück und ruderte mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Der Teniente, der ihm zu Hilfe eilen wollte, schlug mit ihm auf die Planken. Carrizo stürzte als dritter obendrauf, und ein Knäuel aus um sich schlagenden Armen und Beinen entstand.
Sangiovese begann unterdessen, sich wie ein Kreisel zu drehen. Die Hände hatte er dabei flach auf den Brustpanzer gelegt.
„Ihr Schweine!“ schrie er in schrillem Diskant. „Ihr seid alle Schweine! Menschenleben kümmern euch nicht! Ihr tötet und tötet und haltet euch in eurer Selbstherrlichkeit auch noch für gerecht! O mein Gott, wann wird auf dieser Welt endlich Frieden herrschen? Wann werdet ihr Schweine endlich begreifen, daß ihr es seid, die immer wieder den Tod und das Verderben unter die Menschheit bringen!“
Capitán de Mello und die Offiziere standen mittlerweile an der Querbalustrade. Einen Moment waren auch sie von dem rätselhaften Verhalten des Genuesen in Fassungslosigkeit geraten.
„Festnehmen!“ befahl de Mello jetzt schneidend, indem er eine Atempause des sich drehenden Mannes nutzte. „Alle verfügbaren Kräfte – nehmt den Mann fest!“
De Mello hatte Sangioveses Zustand sehr richtig eingeschätzt. Sechs Mann, die von zwei benachbarten Geschützen losstürmten, reichten gerade aus, um ihn zu überwältigen. Nur mit äußerster Mühe konnten sie ihn halten, wie er sich in ihrem Griff wand und versuchte, mit den Stiefeln nach ihnen zu treten.
Carrizo, der Decksälteste und der Teniente hatten sich inzwischen wieder aufgerappelt.
Carrizo umrundete eilends den kleinen Pulk von Männern. Als er vor seinem Amigo stand, erschrak er. Schaum hing in Sangioveses Mundwinkeln, seine Augen waren gerötet und blutunterlaufen.
„Mario“, hauchte er, „um Himmels willen, was ist mit dir?“
Der Blick des Genuesen begann zu flackern. Es schien, als hätten ihn die besorgten Worte seines Freundes in die Wirklichkeit zurückgeholt. Einen Moment hatte es den Anschein, als wollte Sangiovese versuchen, sich zu räuspern, um ein vernünftiges Wort an den Spanier zu richten. Doch unvermittelt verdrehte er die Augen und sank kraftlos im harten Griff der Männer zusammen.
„Der Feldscher soll sich um ihn kümmern!“ ordnete de Mello an. „Ich erwarte einen sofortigen Bericht.“
„Jawohl, Capitán“, antwortete der Decksälteste und gab den Männern einen Wink, den Ohnmächtigen zum Vorschiff zu tragen.
„Señor Carrizo, zu mir?“ rief der Kapitän.
Der Spanier eilte zum Steuerbordniedergang, nahm Haltung an und salutierte.
„Capitán?“
„Wie ich verstanden habe, sind Sie mit Sangiovese befreundet. Haben Sie eine Erklärung für sein sonderbares Verhalten?“
„Nein, Capitán. Es tut mir leid, aber ich kann es selbst nicht begreifen. So etwas hat sich Mario Sangiovese noch nie geleistet. Manchmal ist er ein bißchen still. Er redet sowieso nicht gern und ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie er sich eben gebärdet hat.“
„Er ist Italiener, nicht wahr?“
„Ja, Capitán. Sein Vater ist ein Kaufmann aus Genua, der sich in Barcelona niedergelassen hat. Deshalb kam Mario in unser Land. Wir wurden gemeinsam Soldat. Manchmal glaube ich, daß er in seinem Herzen immer noch Italiener ist, obwohl er sich alle Mühe gibt, sich anzupassen.“
„Hat er öfter Heimweh gehabt?“
„Ich glaube schon, Capitán, wenn er es auch nicht ausgesprochen hat.“
De Mello nickte.
„Gut. Lassen Sie sich von Ihrem Teniente freistellen und kümmern Sie sich um Ihren Freund. Berichten Sie mir, sobald Sie etwas Ungewöhnliches an ihm bemerken.“
Carrizo salutierte abermals.
„Darf ich mir noch eine Frage erlauben, Capitán?“ sagte er vorsichtig.
„Nur zu“, entgegnete de Mello mit dem Anflug eines Lächelns.
Carrizo preßte die Lippen aufeinander und zögerte. Dann gab er sich einen Ruck.
„Ist zu befürchten, daß er – daß er besessen ist, Capitán?“
Sekundenlang schwiegen der Kapitän und die Offiziere. Das Rauschen des Wasserfalls und das Gebrüll der Eingeschlossenen waren zur unveränderlich scheinenden Geräuschkulisse geworden. Die Offiziere wechselten Blicke. Die Bemerkung Carrizos konnte ernsthafte Folgen haben. Gerüchte, besonders wenn ihnen etwas Sensationelles anhaftete, breiteten sich auf dem begrenzten Raum eines Kriegsschiffs schnell aus. Und sie pflanzten sich fort, sobald das Schiff den nächsten Hafen anlief. Dann blieb auch nicht aus, daß kirchliche Organe von diesen Gerüchten erfuhren.
Die Kirche hatte die Macht, ein Schiff in einem solchen Fall an die Kette legen zu lassen.
Irgendein Priester, dem man besondere Fähigkeiten nachsagte, würde gerufen werden, damit er die heilige Handlung des Exorzismus durchführte – die Austreibung der Dämonen und Plagegeister, die einen Menschen befallen konnten.
Ein solcher Exorzismus konnte an einem Tag erledigt sein, konnte aber auch Wochen oder gar Monate dauern – je nach Belieben des hochwürdigen Exorzisten, in dessen alleiniger Macht es stand, die Schwere eines Falles von Besessenheit einzustufen. Diesem Urteil fügten sich nach aller Erfahrung selbst die höchsten kirchlichen Würdenträger.
De Mello winkte Carrizo einen Schritt näher heran.
„Carrizo“, sagte er halblaut. „Ihre Befürchtung ist völlig unbegründet. Bereiten Sie sich keine Sorgen. Besessenheit äußert sich ganz anders.“
„Wirklich, Señor Capitán?“
Gaspar de Mello wußte, daß seine Worte unbedingt überzeugend klingen mußten. Er hatte noch nicht die leiseste Ahnung, wie es nach den blutigen Geschehnissen in der Schatzbucht weitergehen sollte. Aber welchen Hafen er auch immer anlaufen würde – ein Zwangsaufenthalt aus irgendwelchen aberwitzigen Gründen war das letzte, was er sich wünschte.
„Wenn jemand besessen ist“, sagte de Mello daher, „dann merkt man es zuerst an seinem Atem. Er stinkt ganz abscheulich, nach Schwefel und anderem verbrannten Zeug. Ich hatte vor Jahren einen solchen Fall in Cartagena, und ich hatte seinerzeit Gelegenheit, mit dem exorzierenden Priester zu sprechen.“
Carrizos Augen wurden weit, und er kriegte den Mund nicht wieder zu. Wie alle einfachen Menschen seines Landes glaubte er fest an all jene mystischen Dinge, die einem einen Schauer über den Rücken jagten und die man sich nur hinter vorgehaltener Hand erzählte.
„Stinkender Atem, Schwefelgeruch“, sagte de Mello noch einmal und fuhr dann fort: „Weitere Merkmale sind eine deutliche Veränderung der Stimme, eine Veränderung des Gesichtsausdrucks und eine Rötung der Augen. Die Stimme ist die des jeweiligen Dämons, der gerade aus dem armen Opfer spricht. Manchmal kann es sich auch um die Stimme des Satans persönlich handeln. Achten Sie also genau auf Ihren Freund, Carrizo. Wenn er eins der genannten Merkmale zeigt, sollten Sie mich alarmieren. Wenn nicht, können Sie beruhigt sein. Er ist dann in Ordnung. Haben Sie alles behalten?“
„Jawohl, Señor Capitán“, erwiderte Carrizo hastig und begann aufzuzählen: „Stinkender Atem, Schwefelgeruch, veränderte Stimme, veränderter Gesichtsausdruck, rote Augen. Bei der Stimme handelt es sich entweder um die eines Dämons oder …“
Capitán de Mello winkte ab.
„Schon gut. Im übrigen können sich auch verschiedene Dämonen miteinander unterhalten. Das klingt dann, als ob der Besessene aus mehreren Personen besteht, jedenfalls der Stimme nach. Haben Sie alles verstanden?“
„Ja, Capitán.“
„Gut. Dann wissen Sie, was Sie zu tun haben.“
Carrizo salutierte, vollführte eine Kehrtwendung und eilte zur Krankenkammer.
Der Kapitän und die Offiziere konnten sich ein Lächeln nicht verkneifen. Rodrigez Vanetto, schlank, dunkeläugig, schnauzbärtig und Erster Offizier der „San Sebastian“, sah den Capitán etwas vorwurfsvoll an.
„Mußten Sie den armen Kerl mit solchen Schauergeschichten belasten, Señor Capitán?“
De Mello lächelte hintergründig.
„Ich hoffe, er hat einen gehörigen Schreck gekriegt. Wenn meine Rechnung aufgeht, wird er begriffen haben, daß die Besessenheit viel, viel schlimmer ist, als er sich vorgestellt hat. Folglich wird er keins der Symptome an seinem Freund feststellen und auch nichts in dieser Richtung herumerzählen. Was letzteres bedeuten würde, brauche ich Ihnen wohl nicht erst auseinanderzusetzen, Vanetto.“
Der Erste zog die Augenbrauen hoch. Er mußte zugeben, daß de Mello wieder einmal weitblickender gewesen war als alle zusammen. Auch die übrigen Offiziere nickten verstehend. Sie wußten nur zu gut, wie leicht man in eine langwierige und zermürbende Untersuchung verwickelt werden konnte.
2.
Enrique Carrizo schlüpfte in die Krankenkammer und zog das Schott hinter sich zu. Er war froh, das Tosen des Wasserfalls und die Schreie der Eingeschlossenen nur noch gedämpft zu hören.
Vielleicht würde es auch Mario helfen. Wenn er den genügenden Abstand von den Dingen hatte, kam er vielleicht wieder zur Vernunft.
Sie hatten den Ohnmächtigen auf eine Pritsche gebettet, gleich neben dem Tisch, auf dem der Holzkasten mit den chirurgischen Instrumenten stand. Carrizo erschauerte allein bei dem Gedanken an die Knochensäge und die verschiedenen Messer, mit denen der Feldscher und seine Helfer bei Gefechten zur See oft stundenlang zu arbeiten hatten.
Zum Glück hatte Mario Sangiovese keine Verwundung und auch keine Krankheit, die mit solchen fürchterlichen Geräten behandelt werden mußte.
Der Feldscher war ein hochgewachsener Mann, der so aussah, als bestünde er nur aus Knochen, Sehnen und Muskeln. Er richtete sich auf, setzte das Hörrohr ab und wandte sich unwillig zu Carrizo um. Die übrigen Männer, die den Ohnmächtigen hineingebracht hatten, standen noch auf der anderen Seite der Pritsche, bereit, sofort einzugreifen, falls Sangiovese erneut durchdrehte.
„Was hast du hier zu suchen, Mann?“ sagte der Feldscher unwillig.
„Auftrag vom Capitán“, entgegnete Carrizo stolz. „Ich bin Marios bester Freund. Der Capitán hat gesagt, ich soll mich um ihn kümmern und gut auf ihn aufpassen.“
„Extra dafür abgestellt?“ entgegnete der Feldscher mich hochgezogenen Brauen.
„Jawohl, so ist es.“
„Gut, gut.“ Der Feldscher, räumte seine Sachen beiseite und trat an ein Schapp. Er nahm eine kleine braune Flasche heraus, schloß das Schapp wieder und hielt Carrizo die Flasche hin. „Du wirst ihm dieses Mittel geben. Jede Stunde zehn Tropfen, mit Wasser verdünnt, so daß die Muck halb gefüllt ist.“
Er deutete auf einen Tisch neben dem Schapp, wo ein Krug mit Trinkwasser und mehrere Mucks standen.
„Ja, Señor“, antwortete Carrizo bereitwillig. „Und wann soll ich damit anfangen?“
„Sobald er aufwacht. Vorher wirst du ihm kaum etwas eintrichtern können.“
Carrizo nickte. Dann beugte er sich vor und zögerte – wie um eine besonders heikle Frage anzukündigen.
„Können Sie schon sagen, was ihm fehlt?“
Der Feldscher nickte gelangweilt.
„Ein klarer Kopf“, erwiderte er.
„Was heißt das?“ fragte Carrizo stirnrunzelnd.
„Daß er einen Koller hat. Nichts Besonderes. So was passiert schon mal. Dein Freund Mario ist im Grunde noch harmlos. Ich habe schon Kerle gesehen, die ein ganzes Schiffsdeck auseinandergenommen haben, bevor man sie bändigen konnte.“
Carrizo atmete erleichtert auf. Ein Koller, nun gut, das war in Ordnung. Er hatte davon gehört. Etwas völlig Normales, das jeden erwischen konnte. Es sollte entstehen, wenn einem die Sonne zu lange auf den Schädel gebrannt hatte.
Trotzdem beobachtete Enrique Carrizo seinen Amigo sehr genau, als ihn der Feldscher und die anderen mit dem Ohnmächtigen allein gelassen hatten. In dem Fläschchen befand sich ein beruhigendes Mittel. Nach den Angaben des Feldschers sollte es hervorragend gegen diese Krankheit helfen, die man Koller nannte.
Leise Bedenken wollten bei Carrizo dennoch nicht weichen.
Stirnrunzelnd und voller Besorgnis betrachtete er seinen Amigo, der noch immer regungslos dalag und anscheinend überhaupt nicht daran dachte, in die Wirklichkeit zurückzukehren. War es denn normal, daß jemand so lange ohne Bewußtsein blieb?
Carrizo zog sich einen Schemel heran, setzte sich und stellte das Fläschchen auf die Pritsche neben Sangioveses Oberkörper. Sein Atem ging offenbar regelmäßig. Carrizo sah, daß Mario die Lippen ein Stück geöffnet hatte.
Lag da nicht ein sonderbarer Geruch in der Luft? Ein furchtbarer Verdacht keimte in Enrique Carrizo auf. Stinkender Atem – Schwefelgeruch …
Innerlich zitternd beugte er sich über den Ohnmächtigen und schnupperte dessen Atemluft.
Nichts.
Kein Schnapsdunst vom letzten Saufgelage, kein Geruch von Tabak. Und auch sonst nichts Übelriechendes. Marios Atem war so klar wie ein frischer Morgen. Zu den schlimmen Trinkern gehörte er nicht, und die von den Indianern abgeschaute Mode des Tabakrauchens hatte er sich auch nicht angeeignet. Jedes Mädchen an Land hätte seine helle Freude daran, diesen gutaussehenden Burschen zu küssen.
Enrique gönnte seinem Amigo die einschlägigen Erfahrungen, denn er selbst schnitt beim schwachen Geschlecht auch nicht gerade schlecht ab.
Carrizo sank zurück auf den Schemel. Er hob den Kopf und blähte die Nasenflügel. Merkwürdig. Dieser Geruch ließ sich nicht wegdenken. Er war einfach da. Und, Hölle und Verdammnis, es war ganz eindeutig Schwefelgeruch!
Der Mann aus Barcelona erschrak bei dieser Erkenntnis. Fassungslos starrte er seinen reglosen Freund an. Möglich, daß der Schwefelgeruch gar nicht durch den Atem entstand, sondern der Haut des armen Mario entströmte. Ein Dämon hatte ja bekanntlich verschiedene Möglichkeiten, seine ekelerregenden Erscheinungsformen an die Außenwelt abzugeben.
Carrizo überlegte, ob er den Capitán benachrichtigen und um Rat fragen sollte. Die Tatsache, daß Mario den Schwefel nicht ausatmete, sondern ausdünstete, war unter Umständen besonders ernst zu nehmen.
Carrizos Blick fiel auf das Fläschchen, das der Feldscher ihm gegeben hatte. Aus einem Impuls heraus hob er das Fläschchen an die Nase.
Er schloß die Augen und atmete tief durch.
Da war er, der Geruch! Die Medizin roch nach Schwefel, und zwar durch den kleinen Korken!
Carrizo schalt sich einen Narren und schüttelte den Kopf über sich selbst. Er steckte die kleine Flasche in die Hosentasche. Gleich darauf war von dem Geruch nichts mehr zu merken.
Für Enrique Carrizo war es, als hätte sein Freund soeben zwei schwere Prüfungen bestanden. Doch die anderen, vielleicht schwereren Prüfungen standen ja noch bevor. Wie würde sich seine Stimme anhören, wenn er erwachte? Wie würde sein Gesicht aussehen und wie seine Augen?
Unvermittelt entrang sich dem Mund des Ohnmächtigen ein leises Stöhnen.
Carrizo erschauerte.
War das Mario Sangiovese, der da stöhnte? Oder war es die Stimme eines garstigen Dämons, der mit satanischer Macht an die Oberfläche des Seins drängte? Enrique Carrizo versuchte verzweifelt, sich daran zu erinnern, wann er Mario das letztemal in seiner Koje im Schlaf hatte stöhnen hören.
Jetzt bewegten sich Sangioveses Augenlider.
Carrizo sprang auf und wich zurück. Er war darauf gefaßt, die blutunterlaufenen Augen einer wilden Bestie zu sehen. Und er rechnete damit, daß sich Marios Gesicht zu einer teuflischen Fratze verzerren würde.
Unwillkürlich sah sich Carrizo nach einem Gegenstand um, nach einer Schlagwaffe, mit der er sich gegen den oder die Dämonen verteidigen konnte. Trotz allem hätte er es nicht fertiggebracht, seinen Entersäbel zu ziehen und damit auf seinen besten Freund einzustechen.
Doch plötzlich glaubte er, seinen Augen nicht zu trauen.
Marios Gesicht entspannte sich zu jenem sanften Lächeln, mit dem er Frauenherzen zum Dahinschmelzen brachte. Hatte er etwa einen besonders angenehmen Traum gehabt? Keine Schreckensbilder, von Dämonen hervorgerufen?
Nun schlug er die Augen auf, und das Weiße um seine dunklen Pupillen war so klar, daß man sich darin hätte spiegeln können.
„Wo bin ich?“ fragte Sangiovese leise. Es war seine Stimme, seine eigene, da gab es nicht den geringsten Zweifel.
Enrique Carrizo hatte das Gefühl, daß ihm ein zentnerschwerer Stein vom Herzen fiel. Nichts von den schrecklichen Erscheinungsformen der Besessenheit war eingetreten.
„Dem Himmel sei Dank“, sagte Carrizo und trat auf die Pritsche zu. „Du bist völlig in Ordnung, nicht wahr? Sie haben dich in die Krankenkammer gebracht, Amigo.“
Sangiovese stützte sich auf die Ellenbogen und sah den Spanier ungläubig an.
„Was ist passiert? Was für eine Krankheit soll ich denn haben? Himmel noch mal, wie ist denn das möglich?“
Carrizo drückte ihn behutsam auf die Pritsche zurück. Er erinnerte sich an das Fläschchen in seiner Tasche und an den eindeutigen Auftrag, den ihm der Feldscher erteilt hatte.
„Reg dich nicht auf, Amigo, bleib ganz ruhig. Du mußt dich erst mal erholen. Dafür kriegst du jetzt einen Schluck Medizin. Ich soll nämlich auf dich aufpassen. Klar?“
„Dann war ich – dann bin ich“, stammelte Sangiovese, „dann ist etwas mit mir nicht in Ordnung?“
Carrizo stand auf und ging zu dem Tisch neben dem Schapp, wo der Krug mit Trinkwasser und die Mucks standen. Er zog das Fläschchen aus der Tasche und bereitete die Medizin zu, wie es der Feldscher angeordnet hatte. Dann ging er zurück zur Pritsche und hielt seinem Freund die Muck hin.
„Das trinkst du erst einmal. Es bringt dich wieder auf die Beine, und du kriegst wieder einen klaren Kopf.“
„Was ist das?“ Sangiovese hatte sich aufgesetzt, mußte sich aber mit der Linken abstützen, da sein Oberkörper schwankte.
„Ein Beruhigungsmittel.“
„Heißt das“, Sangiovese sah erschrocken aus, „daß ich einen Tobsuchtsanfall hatte? Oder so was Ähnliches?“
Carrizo nickte.
„Trink erst deine Medizin. Ausdrückliche Order vom Feldscher. Danach reden wir weiter. Einverstanden?“
Sangiovese nickte und gehorchte.
„Schmeckt scheußlich“, sagte er widerwillig, als er die Muck absetzte. „Richtig wie Schwefel.“
Carrizo konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
„In der Tat, Mario, in der Tat. Und ich hatte schon geglaubt, daß du der Schwefelstinker bist.“
„Ich? Wie meinst du das?“
„Ich mußte befürchten, daß du besessen bist.“
Sangiovese rieb sich die Stirn. Dann sah er seinen Freund eindringlich an.
„Enrique, tu mir einen Gefallen und sag mir, was passiert ist. Ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern. Hilf mir auf die Sprünge.“
Carrizo nickte, nahm seinem Freund die Muck ab und begann seine Schilderung mit dem Verlassen des Hafens von Havanna. Dann fuhr er fort mit jenen Vormittagsstunden des gestrigen 24. Mai Anno 1595, in denen sie auf Order des sehr ehrenwerten Gouverneurs, Señor Don Alonzo de Escobedo, die Bucht westlich von Batabanó erreicht hatten. Sie – das waren die Kriegsgaleone „San Sebastian“ unter dem Kommando von Capitán Gaspar de Mello und die Handelsgaleone „Trinidad“ unter dem Kommando von Capitán Diego Machado.
Alles hatte damit begonnen, daß der Gouverneur die ersten Kisten aus der Höhle hinter dem Wasserfall auf die „Trinidad“ verladen ließ. Durch einen Zufall hatte der Bootsmann der „San Sebastian“ herausgefunden, was die Kisten enthielten. Er hatte dem Capitán der Kriegsgaleone darüber Meldung erstattet. Für alle Mann an Bord war es bereits zu diesem Zeitpunkt offensichtlich gewesen, daß de Mello Unrat witterte. Der Erklärung de Escobedos, daß es sich um einen Schatz des Königs handele, schenkte von nun an niemand mehr rechten Glauben.
Deserteure von der „Trinidad“, unter der Führung eines Galgenstricks namens Cabral, hatten das unheilvolle Geschehen erst richtig angeheizt, als sie versuchten, sich einen Teil des Schatzes aus der Höhle unter den Nagel zu reißen. Dann hatten sich die Männer unter dem Zweiten Offizier der „Trinidad“, Gutierrez, in der Höhle verschanzt. Ein blutiges Massaker hatte es gegeben, als Machados Leute in die Höhle vorzudringen versuchten.
Die entscheidende Wende war jedoch erst danach erfolgt. Gouverneur de Escobedo begab sich an Bord der „San Sebastian“, und Machado nutzte eiskalt die Gelegenheit, um mit der „Trinidad“ und den bereits an Bord befindlichen Schätzen das Weite zu suchen. Capitán de Mello hatte kurz entschlossen gehandelt und die „Trinidad“ mit einer vollen Breitseite buchstäblich abgetakelt. Jetzt lag die Handelsgaleone weiter südlich in der Bucht vor Anker. Der Fockmast hing außenbords, Rahen und Segel waren zerschossen.
Capitán Machado, das gerissene Schlitzohr, war mit sechzehn unverletzten Kerlen an Land geflüchtet und im Mangrovendickicht verschwunden. Wie sich später herausstellte, hatte er sich zu seinen eigenen Deserteuren in der Höhle durchgeschlagen. Was sich dort abgespielt hatte, war den Männern an Bord der „San Sebastian“ naturgemäß weitgehend verborgen geblieben.
Den Gouverneur hatte Capitán de Mello festnehmen und in eine Achterdeckskammer sperren lassen. Die „Trinidad“ war vom Zweiten Offizier der „San Sebastian“ mit einem zehnköpfigen Kommando Seesoldaten besetzt worden.
Um die Lage endgültig in den Griff zu bekommen, hatte der Erste Offizier der „San Sebastian“, Rodrigez Vanetto, eine besondere Idee gehabt. Nämlich die, den vorkragenden Felsen über dem Wasserfall einfach wegzuschießen. Durch systematischen Beschuß aus zehn Culverinen war diese Idee in die Tat umgesetzt worden.
Mario Sangiovese sah seinen Freund aus großen, entsetzten Augen an.
„Mein Gott, ja!“ hauchte er. „Jetzt erinnere ich mich. Es war der dreiundzwanzigste Schuß, mit dem wir den Felsbrocken heruntergeholt haben.“ Er richtete sich abrupt auf, kniff die Augenbrauen zusammen und horchte angestrengt. Dann, wie in grenzenloser Resignation, ließ er sich zurücksinken und murmelte tonlos: „Sie schreien noch immer, Enrique. Ihr Todeskampf ist noch immer nicht beendet.“
„Reg dich bloß nicht schon wieder auf“, sagte Carrizo hastig.
„Was war denn los mit mir? Du hast es mir noch immer nicht beantwortet.“
„Du bist richtig verrückt geworden. Der Feldscher sagt, es war ein Koller. Die Männer von zwei Geschützcrews waren nötig, um dich zu bändigen.“
Mario Sangiovese dachte einen Moment nach.
„Ich kann mich selbst verstehen“, sagte er dann. „Ich könnte auch jetzt noch halb wahnsinnig werden, wenn ich nur daran denke, wie sich die armen Teufel in der Höhle fühlen müssen.“
„Tu’s nicht“, sagte Carrizo beinahe flehentlich. „Denke einfach nicht daran. Wenn du willst, besorge ich dir etwas, das du dir in die Ohren stopfen kannst. Und dann warte ab, bis das Beruhigungsmittel wirkt.“
Sangiovese lächelte und winkte ab.
„Schon gut, Enrique. Keine Sorge. Ich werde nicht noch einmal verrückt spielen. Es muß wohl tatsächlich an der Hitze gelegen haben. Ich erinnere mich jetzt, daß ich das Gefühl hatte, mir würde alles zu eng werden. Diese quälenden Gedanken wurden einfach unerträglich. Und da bin ich sogar auf dich losgegangen, nicht wahr?“
„Allerdings“, erwiderte Carrizo knurrend. „Das nächstemal lasse ich mir das nicht so einfach gefallen, damit du’s weißt.“
Sangiovese klopfte ihm mit einer matten Bewegung auf die Schulter.
„Nimm’s mir nicht übel. Immerhin hast du mir jetzt diesen Sonderdienst zu verdanken. Einen Kranken zu bewachen ist doch nicht schlecht, oder?“
„Du hast es erfaßt“, entgegnete Carrizo. „Noch besser wäre natürlich, der Feldscher würde dir ein wenig frische Luft verordnen.“
„Ich bin sicher, daß du auch das erreichst“, sagte Sangiovese zuversichtlich. „Und dann fehlt uns zu unserem Glück nur noch eine Sonderration Rotwein.“
3.
Die Lage war unverändert, und die zähflüssig verrinnenden Minuten dehnten sich endlos.
Mit stetem Tosen stürzten die Fluten von der felsigen Höhe abwärts – doch nun nicht mehr in weitem Bogen, sondern senkrecht von der Endkante des Felsens hinunter ins Flußbett.
Das Geschrei der Eingeschlossenen war noch immer zu hören. Manch einer der Männer an Bord der „San Sebastian“ begann es als einen Beweis dafür zu werten, daß die Kerle doch noch nicht wie Ratten abgesoffen waren.
Deutlich war von der Kriegsgaleone aus jener mächtige Felsbrocken zu erkennen, den das dreiundzwanzigste Geschoß heruntergeholt hatte. Dieser Brocken hatte den Höhleneingang regelrecht verbarrikadiert und blockiert.
Über den Felsensims konnte man den ehemaligen Höhleneingang nun ebenfalls nicht mehr erreichen. Wer es versuchte, würde unweigerlich von den senkrecht hinabrauschenden Wassermassen in die Tiefe gerissen werden.
Mit welcher ungeheuren Wucht sich der Felsbrocken in den Höhleneingang verkeilt hatte, ließ sich mühelos folgern. Denn trotz der schäumenden und sprudelnden Fluten, die sich teilweise eben auch in das Höhleninnere ergossen, bewegte sich der Felsklotz um keinen Zoll.
Das Geschrei der eingeschlossenen Deserteure klang markerschütternd. Obwohl inzwischen alle an Bord der „San Sebastian“ begriffen hatten, was Mario Sangiovese zum Durchdrehen getrieben hatte, empfand doch keiner von ihnen Mitleid mit den Halunken dort oben.
Sie hatten sich von ihrer Gier nach Reichtum blenden lassen. Hatten sich treiben lassen und sich wie reißende Tiere verhalten. Die Männer an Bord der Kriegsgaleone hatten nicht vergessen, daß sechs ihrer Kameraden dort oben ermordet worden waren – in der vergangenen Nacht, als sie beim Wasserfall Wache hielten.
Die Mörder waren die Deserteure von der „Trinidad“. Jetzt saßen sie in den verdammten Höhlen fest und würden mitsamt dem heißersehnten Reichtum ersaufen. Wenn es denn eine gerechte Strafe oder so etwas wie ein Gottesurteil gab, dann zweifellos dieses.
Capitán Gaspar de Mello wandte sich von dem Anblick jenes Eingriffs in die Natur ab, den man auf höchst nachhaltige Weise mit dreiundzwanzig Culverinenschüssen erzielt hatte.
Er nickte dem Ersten Offizier zu.
„Geben Sie Befehl, die Geschütze zu reinigen. Die Männer müssen etwas zu tun haben.“
Vanetto zog die Brauen hoch.
„Rechnen Sie mit einem zweiten Fall Sangiovese, Capitán?“
„Ich rechne nicht damit, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Tatenlosigkeit in einer bedrückenden Situation erzeugt immer unvorhersehbare Reaktionen.“
Der Erste Offizier nickte verstehend. Er trat an die Querbalustrade und gab die Anordnungen des Kapitäns weiter. Die Männer wirkten in der Tat erleichtert, wieder zupacken zu können. Ob sie es wollten oder nicht, sie mußten einfach eingestehen, daß die Gegenwart des Todes an ihren Nerven zerrte. Capitán de Mello würde mit weiteren Befehlen in weiser Voraussicht dafür sorgen, daß es von nun an kein Nichtstun mehr an Bord gab.
Vanetto kehrte zu de Mello zurück, der jetzt an der Heckbalustrade lehnte.
„Wissen Sie, Señor Vanetto“, sagte der Capitán gedehnt, „eigentlich ist genau das eingetreten, was wir mit dem Beschuß bezweckt haben, nicht wahr?“
„Allerdings“, erwiderte der Erste Offizier grimmig, „nur mit einer völlig anderen Wirkung. Ich hätte meinen Vorschlag nicht unterbreitet, wenn ich gewußt hätte, daß der Felsbrocken den Höhleneingang buchstäblich abschotten würde.“
„Ich weiß, Vanetto. Natürlich wünscht niemand von uns den Strolchen ein solches Schicksal. Nun gut, der Höhleneingang sollte frei bleiben, und der Wassereinbruch sollte die Kerle heraustreiben. Daß es nicht so gekommen ist, konnte keiner von uns vorhersehen.“
„Wie es auch immer ausgeht“, entgegnete Vanetto dumpf, „die Männer sitzen da oben in einer Falle, aus der es wohl kein Entrinnen gibt.“
Gaspar de Mello sah den Ersten Offizier minutenlang nachdenklich an. De Mello war ein schlanker, drahtig wirkender Mann mit scharfgeschnittenen Gesichtszügen. Er war als geradlinig und korrekt bekannt. Bei allen Mannschaften, die er bisher befehligt hatte, war er ausnahmslos beliebt gewesen.
„Wenn diese Höhlen wirklich vollaufen“, sagte de Mello schließlich leise, „dann werden die Kerle elendiglich ertränkt. Machen wir uns in der Beziehung nichts vor, Señor Vanetto. Es ist ein Tod, den wohl keiner von uns irgend jemandem wünscht.“
Rodrigez Vanetto, ein schlanker Mann mit dunklen Augen und dichtem Schnauzbart, wiegte nachdenklich den Kopf.
„Wenn!“ wiederholte er.
Capitán de Mello sah ihn erstaunt an.
„Was meinen Sie damit?“
„Sie sagten es selbst“, entgegnete Vanetto mit einem kaum merklichen Lächeln. „Wenn diese Höhlen wirklich vollaufen …“
De Mello nickte stirnrunzelnd.
„Gibt es denn nach dem augenblicklichen Stand der Dinge eine andere Möglichkeit?“
„Ich würde sogar ernsthaft davon ausgehen, Señor Capitán. Sehen Sie, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das Höhlensystem dort oben absolut wasserdicht ist. Bestimmt gibt es dort Spalten und Risse im Gestein, durch die das Wasser abfließen kann.“
Der Capitán runzelte nachdenklich die Stirn und nickte schließlich zustimmend.
„Gut, diese Möglichkeit dürfte sogar wahrscheinlich sein. Bei der ganzen Sache – vorausgesetzt, sie verhält sich so – gibt es jedoch eine entscheidende Frage.“
„Ich ahne, wovon Sie sprechen, Señor Capitán.“
„Fließt das Wasser schneller ab, als es beim Eingang hineinströmt?“ sagte de Mello. „Das kann niemand von uns wissen.“
„Selbstverständlich nicht. Denkbar ist auch, daß sich Zu- und Abfluß die Waage halten.“
„Das würde bedeuten, daß das Wasser bis zu einer bestimmten Höhe ansteigt und diese dann hält.“
„Was vielleicht nicht einmal das schlimmste wäre“, entgegnete der Erste. „Die Kerle könnten sich sicherlich in höher gelegene Höhlenteile retten.“
„Und abwarten, bis sie von uns befreit werden“, sagte de Mello grimmig. „Darüber würden sie bestimmt sehr erfreut sein.“
Vanetto blies die Luft durch die Nase.
„Wenn Sie mich fragen, Señor Capitán – diese Halunken sind sich längst darüber im klaren, daß es für sie nur noch zwei Möglichkeiten gibt: entweder den nassen Tod oder die Gefangennahme durch uns.“
Der Capitán zog die Stirn kraus.
„Davon würde ich nicht unbedingt überzeugt sein. Stellen Sie sich eine weitere Möglichkeit vor, Vanetto. Zumindest theoretisch ist denkbar, daß das Wasser bis zu einer bestimmten Höhe steigt und erst dort abläuft, wo sich auf diesem Niveau Spalten und Risse befinden. Wenn es diese Spalten und Risse wirklich gibt, müßte es doch auch möglich sein, daß ein zweiter Ausgang vorhanden ist. Oder mehrere.“
„Das will ich nicht von der Hand weisen“, entgegnete Vanetto. „Solange wir aber die Schreie hören, wissen wir, daß die Kerle noch keinen zweiten Ausgang gefunden haben.“
„Was schlagen Sie also vor?“
„Erst einmal abzuwarten. Auf Anhieb können wir für die Halunken sowieso nichts tun. Es sei denn, wir würden versuchen, den Höhleneingang freizusprengen oder auseinanderzuschießen. Und wenn es einen zweiten Ausgang gibt, dann müßten wir ihn erst einmal suchen.“
„Das wäre das kleinere Übel“, sagte de Mello.
„Zweifellos, Señor Capitán“, erwiderte Vanetto. „Noch etwas scheint mir wichtig zu sein: Die Kerle haben sich als Mörder von sechs Seesoldaten schuldig gemacht. Und sie haben sich an einem Schatz des Königs vergriffen. Werden sie vor Gericht gestellt, ist zumindest den Rädelsführern die Todesstrafe sicher. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung.“
Gaspar de Mello nickte. Der Erste Offizier hatte die Tatsachen, die allesamt auf der Hand lagen, klar und nüchtern aufgezählt. Und obwohl er gewisse Skrupel nicht leugnen konnte, mußte de Mello dem Ersten doch recht geben.
Ein Schatz des Königs.
Es war ein Stichwort, das Vanetto da erwähnt hatte.
Was es mit dieser merkwürdigen Angelegenheit auf sich hatte, war für Gaspar de Mello nach wie vor unerklärlich. Warum und wieso, um alles in der Welt, war eine für Philipp II. bestimmte Schatzsendung überhaupt erst in einer so unzugänglichen Höhle gelagert worden?
Es gab eine Menge Ungereimtheiten in dieser Geschichte.
Gold und Silber, zur Aufstockung des spanischen Thronschatzes bestimmt, mußten nach den geltenden Bestimmungen unverzüglich in der Neuen Welt auf den Weg gebracht und möglichst ohne Umwege nach Spanien verschifft werden. Die Transportrouten an Land waren weitgehend festgelegt, desgleichen die Kurse der mit Gold, Silber und auch Edelsteinen beladenen Schatzschiffe. Gelegentlich wurde das sogar als eine zu starre Taktik kritisiert. Schließlich brauchten sich die Piraten nur am Rand der Geleitzug-Routen auf die Lauer zu legen, wenn sie fette Beute machen wollten.
Wie auch immer, Capitán Gaspar de Mello hatte noch niemals davon gehört, daß ein Transport ausgerechnet von einer versteckten Bucht bei Batabanó aus in See gegangen wäre.
Doch da waren weitere Punkte, die ganz und gar nicht zu den vertrauten Methoden passen wollten.
Welcher Offizier oder welcher hohe Beamte würde es sich allen Ernstes leisten, einen Schatz, der für den König bestimmt war, einfach unbewacht zu lassen? Das spottete einfach jeder Beschreibung: Ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen wurden in dieser Felsenhöhle unter dem Wasserfall Werte aufbewahrt, die geradezu unvorstellbar groß waren.
Jeder Mann, der sich in der Gegend ein bißchen genauer umschaute, hätte den Zugang unter dem Wasserfall finden können. Und dann hätte sich die Kunde von dem gehorteten Mammon wahrscheinlich in Windeseile verbreitet. Ganze Heerscharen von Abenteurern, Glücksrittern und Galgenstricken wären über diesen sogenannten Schatz des Königs hergefallen, und niemand hätte sie daran gehindert. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, war es einfach nur ein Zufall, daß dieser Schatz überhaupt noch existierte.
Ohnehin war es völlig unüblich, Gold, Silber, Edelsteine und Perlen in solchen Mengen und Massen an einem Ort zentral zu lagern. Das Risiko wurde im allgemeinen dadurch verringert, daß man kleinere Ladungen auf verschiedene Lagerplätze verteilte, um sie dann Zug um Zug zur Verschiffung abzuholen.
Gaspar de Mello gab sich einen Ruck und trat an die Querbalustrade des Achterdecks. Mit einem Wink rief er den Teniente zu sich, der die Seesoldaten an Deck befehligte.
Der Offizier nahm neben der Nagelbank des Großmasts Aufstellung und salutierte.
„Señor Capitán?“
„Holen Sie den Gefangenen, Teniente.“
„Wie Sie befehlen, Capitán. Welche Begründung soll ich nennen? Sie wissen, daß ich ihm eine solche Frage beantworten muß.“
De Mello brauchte nicht lange zu überlegen.
„Sagen Sie dem erlauchten Señor Gouverneur, daß ich geruhe, ihn zu vernehmen. Wenn er sich widersetzen sollte, wenden Sie Gewalt an. Haben Sie mich verstanden, Teniente?“
Der Offizier bestätigte den Befehl, salutierte abermals und vollführte eine Kehrtwendung. Er wählte vier Mann aus und begab sich an ihrer Spitze in den Gang zu den Achterdecksräumen.
Gleich darauf war bis hinauf zum Achterdeck ein Rumoren und Poltern zu vernehmen. Flüche ertönten, dann schneidende Befehle. Schließlich eine schrille Stimme, die vom Kielschwein bis zu den Masttoppen gleichermaßen deutlich zu vernehmen war.
„Zurück! Zurück mit euch! Teniente, Sie sind degradiert! Auf der Stelle sind Sie Ihres Amtes enthoben! Ich degradiere Sie hiermit zum einfachen Soldaten! Sie haben meine Befehle auszuführen! Meine! Ich befehle Ihnen …“
„Mund halten!“ bellte der Teniente, und es klang merkwürdig hohl und trocken aus dem Achterdeck.
„Was erdreisten Sie sich!“ schrillte wieder de Escobedos Stimme. „Ich bringe Sie vor ein Kriegsgericht, Mann! Was Sie sich leisten, ist Befehlsverweigerung! Dafür lasse ich Sie hängen! Dafür werden Sie …“
„Letzte Warnung!“ brüllte der Teniente. „Mund halten!“
„Ich denke nicht daran!“ geiferte de Escobedo im Tonfall eines zeternden Marktweibs. „Sie haben mir nicht das Wort zu verbieten, Sie elender …“
Ein klatschender Laut ließ ihn verstummen und trieb ihm offenbar die Freundlichkeit, die er noch hatte ausspucken wollen, in den Hals zurück.
Die Männer auf der Kuhl grinsten sich eins. Ihnen war klar, was sich da abgespielt hatte, und sie gönnten es dem hochwohlgeborenen Don Alonzo de Escobedo von ganzem Herzen. Niemand konnte diesen aufgeblasenen, herrischen Gockel von Gouverneur leiden. Er hatte sich einfach schon zuviel geleistet, als daß auch nur noch einer aus der Decksmannschaft oder den Reihen der Seesoldaten Sympathie für ihn empfunden hätte.
Der Teniente erschien als erster auf der Kuhl. Seine Gesichtszüge waren härter und grimmiger als zuvor, seine Schritte von energischer Entschlossenheit.
Ihm folgten die vier Seesoldaten. Zwei hatten den Gefangenen in die Mitte genommen und hielten ihn bei den Oberarmen gepackt. Die Hände waren ihm nach wie vor auf den Rücken gefesselt. Die beiden, anderen Seesoldaten bildeten gewissermaßen die Nachhut.
Im Mittelpunkt des spöttischen Interesses aller Decksleute und Seesoldaten stand jedoch das Raubvogelgesicht des sehr ehrenwerten Gouverneurs, insbesondere die linke Hälfte dieser Visage.
Sie war krebsrot angeschwollen.
Jeder an Bord der „San Sebastian“ mußte in diesem Moment anerkennend feststellen, daß der Teniente eine überaus einprägsame Handschrift hatte.
Ebenso konnte jeder auch nachempfinden, welch eine Demütigung es für den Señor Gouverneur sein mußte, vor versammelter Mannschaft als offenkundig gemaßregelter Gefangener dahinspazieren zu müssen.
Capitán de Mello sah dem Wutschäumenden unterdessen voller Gelassenheit entgegen. Für ihn stand mittlerweile fest, daß dieser durchtriebene Kerl, der unter obskuren Umständen zum Gouverneurstitel gelangt sein mußte, der Schlüssel zu allen Ungereimtheiten war.
Der Teniente baute sich drei Schritte vor dem Capitán auf, nahm Haltung an und erstattete seine Meldung.
„Gefangener wie befohlen zur Stelle, Capitán. Mußte wegen Widerstands zurechtgewiesen werden.“
De Mello bedankte sich mit einem Nicken und wechselte einen Blick mit Vanetto. Der Erste Offizier mußte seine Gesichtsmuskeln anstrengen, um nicht zu grinsen.
Der Teniente trat zur Seite und forderte die Soldaten mit einer Handbewegung auf, den Gefesselten vor den Capitán zu führen.
Es schien, als habe der Gouverneur nur auf diesen Augenblick gewartet.
„Ich protestiere!“ schrie er schrill, und seine Stimme kippte schon wieder über. „Ich protestiere in schärfster Form! Ich verlange sofortige Freilassung. Sie, de Mello, sind mit sofortiger Wirkung Ihres Postens enthoben, desgleichen alle Offiziere unter ihrem bisherigen Kommando. Ich gebe Ihnen jetzt die letzte Chance, eine mildere Bestrafung zu erwirken.“
„Sind Sie fertig?“ sagte de Mello trocken, als der Gouverneur Luft holen mußte.
De Escobedo verschluckte sich fast.
„Was nehmen Sie sich heraus, Sie – Sie …“
„Jetzt reicht es“, sagte de Mello schneidend. „Ab sofort reden Sie nur noch, wenn Sie gefragt sind. Als Festgenommener haben Sie an Bord meines Schiffes keinerlei Rechte. Für die Dauer Ihres Arrests sind Sie kein Gouverneur mehr.“
„Daß er es jemals wieder wird, möchte ich doch sehr bezweifeln“, warf der Erste Offizier ein.
De Escobedo erbleichte.
„Señores“, keuchte er, „das wird Sie samt und sonders den Kopf kosten. Was Sie betreiben, ist offene Rebellion. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu erklären, was das bedeutet.“
„Ich weise nochmals auf meinen Befehl hin“, erwiderte de Mello einen Grad schärfer. „Sie reden nur, wenn Sie gefragt, werden. Anderenfalls werde ich den Teniente bitten müssen, Sie zur Räson zu bringen.“
Don Alonzo de Escobedo zuckte zusammen. Aber er war noch längst nicht am Boden zerstört.
„Auch das wird ein böses Nachspiel haben“, zischte er und starrte mit einer ruckartigen Kopfbewegung den Teniente an. „Sie lasse ich lebenslänglich in eine Mine stecken, Teniente. Lebenslänglich, verstehen Sie? Das ist schlimmer als jede Todesstrafe, egal welcher Art. Darauf können Sie sich verlassen. In so einer Silbermine wird Ihnen der Lebensnerv langsam, aber sicher gezogen und …“
Der Teniente trat plötzlich drohend auf ihn zu und hob die Rechte. De Escobedo verschluckte sich abermals um ein Haar.
Capitán de Mello räusperte sich. Der Teniente begab sich wieder an seinen Platz.
„Damit Sie zur Vernunft kommen, de Escobedo“, sagte die Mello kühl, „sollten Sie einmal geruhen, zum Wasserfall hochzuschauen.“
De Escobedo starrte den Kapitän sekundenlang unwillig an, dann aber folgte er der Aufforderung und hob den Kopf.
Jäh nahm sein Gesicht eine käsige Färbung an, als er sah, was sich dort oben verändert hatte. Er begann, nach Atem zu ringen, und an seinem mageren Hals entstanden kleine Flecken aus purpurnem Rot.
„Fürwahr, fürwahr“, sagte de Mello in sarkastisch-theatralischem Ton, „nun bewacht sich der Schatz des Königs doch tatsächlich ganz von allein. Ist das nicht eine wundersame Fügung, verehrter Señor Gouverneur?“
De Escobedo sah aus, als könne er sich von dem Anblick nicht losreißen. Doch der Kapitän und die anderen Männer wußten nur zu genau, daß es eher Fassungslosigkeit als Faszination war, von der der Gefangene befallen war.
Endlich, nach langen Minuten, wandte er sich ab und starrte de Mello an.
„Das geht nicht mit rechten Dingen zu“, keuchte er schwer atmend. „Was da passiert ist, kann nicht mit rechten Dingen zugehen.“
„O doch, es kann“, widersprach de Mello. „Wenn Sie ein wenig nachdenken würden, würden Sie von selbst drauf kommen, de Escobedo. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, daß wir unsere Culverinen in kurzen Abständen einzeln abgefeuert haben.“
„Teuflisch“, ächzte de Escobedo, „das ist einfach teuflisch.“
„Aus Ihrer Sicht vielleicht“, sagte der Capitán. „Für uns erweist es sich als überaus praktisch. Nicht nur, daß sich der Schatz von selbst bewacht. Nein, auch die Kerle, die sich dort oben in den Höhlen befinden, haben wir jetzt unter Verschluß. So gehört es sich letzten Endes für Strolche, die Seine Majestät berauben wollen. Höchst merkwürdig erscheint mir nur, was sich kein Geringerer als der Gouverneur von Kuba in diesem Zusammenhang erlaubt hat. Wollte er doch allen Ernstes solchen Halunken samt ihrem Oberstrolch von Kapitän den Transport dieses gewaltigen Königsschatzes nach Spanien anvertrauen!“
De Escobedo verzog das Gesicht zu einer widerwilligen Grimasse.
„Ich habe Sie nicht gebeten, sich in meine Angelegenheiten einzumischen.“
„Nein, weiß Gott nicht“, sagte de Mello. „Ich habe mich auch keineswegs darum gerissen, de Escobedo! Aber wenn ich gegen meinen Willen in eine Sache hineingezogen werde, die zum Himmel stinkt, dann fechte ich das aus, bis alle Dinge an ihren rechten Platz gerückt worden sind. Darauf können Sie Gift nehmen.“
Der sehr Ehrenwerte stieß einen wütenden Knurrlaut aus.
„Ich weiß nicht, was Sie damit andeuten wollen.“
Capitán de Mello verschränkte die Arme vor der Brust und hob das Kinn.
„Das will ich Ihnen sagen, und zwar sehr klar und deutlich: Ist es vielleicht möglich, daß dieser Schatz Spanien und den König gar nicht erreichen sollte?“
„Wie kommen Sie auf einen solchen Unsinn?“
De Mello schüttelte lächelnd den Kopf.
„Absolut kein Unsinn, das dürften Sie selber am besten wissen. Immerhin ist denkbar, daß der ehrenwerte Señor Gouverneur mit dem Oberstrolch Machado unter einer Decke steckte. Jedenfalls zu Anfang. Dann aber hatte dieses Schlitzohr Machado doch tatsächlich die Unverschämtheit, ausgerechnet den sehr bedauernswerten Señor Gouverneur übers Ohr zu hauen!“
De Escobedo holte tief Luft und preßte die Lippen aufeinander.
„Wo bin ich hier? In einer Märchenstunde?“
„Schluß jetzt!“ fuhr de Mello ihn scharf an. „Allmählich ist es an der Zeit, daß ich die Wahrheit erfahre. Vor allem, was den sogenannten Schatz des Königs betrifft. Meinen Sie nicht auch? Oder muß ich Sie erst noch eines Besseren belehren?“
Der Gouverneur war zusammengezuckt. Er zerrte an seinen Fesseln, und in seinen Gesichtsmuskeln setzten heftige, unkontrollierte Bewegungen ein. Einen Moment schien es, als wolle er sich erneut aufplustern. Dann jedoch, ohne jegliche Vorwarnung, schlug er einen versöhnlichen Ton an, der alle Umstehenden zunächst überraschte, ihnen gleich darauf jedoch den Ekel hochtrieb.
„Capitán“, sagte de Escobedo geradezu sanft, „ich möchte diese Angelegenheit mit Ihnen unter vier Augen besprechen.“
Einen Atemzug lang hatte Gaspar de Mello das Gefühl, es müsse ihm die Sprache verschlagen. Da erdreistete sich dieser Kerl doch tatsächlich, ihn vor aller Ohren zu einem offenkundigen Bestechungsversuch zu bitten! Es war einfach unglaublich. Nach und nach dämmerte dem aufrechten Kapitän der „San Sebastian“ jedoch, zu welcher Sorte Mensch dieser sogenannte Gouverneur gehörte. Zu der unwürdigsten nämlich, die man sich nur vorstellen konnte.
„Haben Sie nicht verstanden?“ drängte de Escobedo, als der Capitán nicht sofort antwortete. „Ich bin bereit, die Sache aus der Welt zu schaffen. Aber nur im Gespräch unter vier Augen.“
„Nein“, erwiderte de Mello eisig. „Kommt überhaupt nicht in Frage. In dieser ganzen Angelegenheit ist schon zuviel gelogen worden.“
„Sie nennen mich einen Lügner?“ kreischte de Escobedo.
„Eben das wäre sicherlich keine Lüge“, sagte de Mello ruhig.
De Escobedo wollte abermals zu einem Tobsuchtsanfall ansetzen, wurde jedoch von dem Teniente daran gehindert, der lediglich demonstrativ einen Schritt auf ihn zutrat. Der Gouverneur schwieg, schluckte, und sein Adamsapfel bewegte sich heftig ruckend auf und ab.
„Ich brauche meinen Ersten Offizier als Zeugen“, fuhr de Mello fort. „Ohne einen Zeugen werde ich mich Ihnen gegenüber auf nichts mehr einlassen.“
De Escobedo nickte in scheinbarem plötzlichen Verständnis. Deutlich war ihm indessen anzusehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. Und dann, als er mit seiner Antwort herausrückte, war es für die Zuhörer klar, daß er seine Taktik geändert und sich zu einem neuen Schachzug entschlossen hatte.
De Escobedos Stimme klang lauernd, als er die Offiziere nacheinander ansah und seinen Blick dann auf de Mello richtete.
„Was würden die ehrenwerten Señores Offiziere davon halten“, sagte er gedehnt und mit einem listigen Blinzeln, „wenn wir uns den besagten Schatz teilen?“
Gaspar de Mello mußte sich zwingen, den Kerl nicht am Kragen zu packen und ihm auch noch die andere Gesichtshälfte in purpurnes Rot zu verwandeln.
„Dazu müßten wir den Schatz erst einmal haben“, sagte er trocken. Doch im nächsten Atemzug steigerte sich seine Stimme zu beißender Schärfe. „Aber Sie werden doch wohl nicht ernsthaft von uns erwarten, daß wir ausgerechnet Seine Majestät bestehlen?“
De Escobedo schüttelte den Kopf.
„Sie irren, Capitán. Es handelt sich gar nicht um einen Schatz des Königs.“
De Mello spielte den Verblüfften.
„Und das sagen Sie jetzt erst?“
De Escobedo wand sich wie ein Aal.
„Vorher bestand für mich kein Anlaß, Sie ins Vertrauen zu ziehen. Jetzt aber, nachdem sich die Dinge so grundlegend gewandelt haben …“ Er ließ den Rest des Satzes unausgesprochen.
„Um was, bitte sehr, handelt es sich dann“, entgegnete de Mello scheinbar begriffsstutzig, „wenn nicht um einen Schatz des Königs?“
„Liegt das nicht auf der Hand?“ erwiderte de Escobedo mit siegessicherem Grinsen. „Um einen Piratenschatz natürlich. Ich habe ihn ausgekundschaftet. Und es ist doch wohl mehr als verständlich, daß man das, was man durch einen glücklichen Zufall entdeckt hat, auch in Gewahrsam nehmen möchte.“
„Nur in Gewahrsam?“ sagte de Mello, der dem Gouverneur im übrigen ebensowenig glaubte wie Vanetto und der Teniente. „Nicht eher in Ihr persönliches Eigentum?“
„Nennen Sie es, wie Sie wollen“, erwiderte de Escobedo. „Ich muß allerdings zugeben, daß man vielleicht überlegen müßte, ob der Schatz nicht rechtlich doch dem König gehört – oder zumindest Teile davon, die ja möglicherweise aus Schatzladungen stammen, die ursprünglich für den König bestimmt waren. Aber diese Einzelheiten braucht man ja nicht so genau zu nehmen. Der König wird ohnehin mit den Schätzen aus der Neuen Welt überschüttet. Ein bißchen mehr oder ein bißchen weniger fällt da gar nicht auf, gewissermaßen.“
„Gewissermaßen“, äffte de Mello ihn nach. „Wie steht es denn mit Ihren Pflichten als Gouverneur? Haben Sie nicht sofort alles darangesetzt, die Piraten zur Strecke zu bringen, die ihre Schatzbeute da oben in der Höhle gehortet haben?“
„Natürlich habe ich sofort Ermittlungen eingeleitet“, behauptete de Escobedo. „Nur ist alles im Sande verlaufen. Erst als ich absolut sicher war, die Piraten nicht mehr aufspüren zu können, habe ich Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Schatz bergen zu lassen. Sicherlich sind die Piraten bei einem Seegefecht umgekommen. Unsere Kriegsschiffe haben mit dem Freibeuterunwesen in letzter Zeit bekanntlich ziemlich aufgeräumt.“
Capitán de Mello konnte es nicht mehr mit anhören. Wenn er dem Halunken freien Lauf ließ, würde er sich noch die aberwitzigsten Geschichten ausdenken. Es war einfach unerträglich.
Sosehr das Gefasel des ehrenwerten Gouverneurs auch erstunken und erlogen war, ging doch eines klar und deutlich aus seinem dümmlichen Bestechungsversuch hervor: Er hatte ursprünglich nichts anderes vorgehabt, als sich selbst zu bedienen. Die Kriegsgaleone „San Sebastian“ war einzig und allein zum Zweck persönlicher Bereicherung de Escobedos für diesen Einsatz abkommandiert worden. Das allein war schon ein ungeheuerlicher Vorfall. Alles in allem war die ganze Geschichte aber durch de Escobedos „Aussage“ nur noch verworrener geworden.
„Es reicht“, sagte de Mello kalt. „Ich habe genug Unsinn von Ihnen gehört, de Escobedo.“ Er wandte sich dem Offizier zu. „Teniente, führen Sie den Gefangenen wieder ab. Keine Arresterleichterungen, Bewachung wie bisher.“
„Jawohl, Señor Capitán“, antwortete der Teniente und gab den Soldaten einen Wink.
De Escobedo lief dunkelrot an, und der jähe Tobsuchtsanfall ließ ihn erzittern wie bei einem schweren Fall von Schüttelfrost. Seine Stimme schrillte so unerträglich, daß de Mello und Vanetto drauf und dran waren, sich die Ohren zuzuhalten.
„Laßt mich los, ihr Hunde! Ich warne euch! Ich lasse euch allen den Kopf abschlagen! Ich lasse euch rädern und vierteilen! De Mello, Sie werde ich dafür zur Verantwortung ziehen, daß Sie mich zu einer Falschaussage verleitet haben! Sie haben mich gezwungen, den Schatz des Königs als einen Piratenschatz zu bezeichnen! Das wird Sie teuer zu stehen kommen, darauf können Sie sich verlassen!“
De Mello stieß sich von der Heckbalustrade ab, und der Keifende verstummte vor Schreck. Doch nach zwei Schritten hielt der Capitán inne.
„Nein“, murmelte er, „Sie Dreckskerl sind es nicht wert, daß man sich die Hand beschmutzt.“
Die Soldaten rissen de Escobedo herum und führten ihn mit hartem Griff zum Niedergang an Steuerbord. Der Ehrenwerte erhielt keine Gelegenheit, seinen Tobsuchtsanfall fortzusetzen.
4.
Lange Schatten hatten sich bereits über die Westseite des Flusses gesenkt, und die Sonne, die irgendwo als glutroter Feuerball über der westlichen Kimm stand, war von der kleinen Bucht aus schon nicht mehr zu sehen.
Doch das jenseitige Flußufer lag noch in rötlichem Licht, was der Szenerie etwas Unwirkliches verlieh.
Die sechzehn Männer um Diego Machado, den Kapitän der „Trinidad“, hatten sich bislang jedoch nicht von Stimmungen beeinflussen lassen. In der kleinen Bucht, in der sie ihre vier Jollen und die Ausrüstung versteckt hatten, war es eher Ungeduld, die vorherrschte.
Immer wieder hatten die Männer versucht, ihren Anführer zu einem früheren Losschlagen zu überreden. Und sie gaben es auch jetzt noch nicht auf.
Sie hockten am Ufer, oberhalb der Jollen, hatten sich den Bauch vollgeschlagen und tranken von dem Rotwein, den sie aus Batabanó mitgebracht hatten. Machado hatte die Rationen genau zubemessen. Wenn er den Kerlen freie Hand ließ, würden sie um Mitternacht voll bis oben hin sein.
„Ich sehe das einfach nicht ein“, maulte einer von ihnen, ein schwarzbärtiger Hüne. „Warum sollen wir bis nach Mitternacht warten? Es reicht doch, wenn es dunkel ist! Oder nicht?“ Beifallheischend blickte er in die Runde, und die meisten der anderen nickten denn auch zustimmend.
Machado, der dickliche Mann, der bei seinen Leuten als verschlagen und rücksichtslos bekannt war, hörte es sich ruhig und mit unbeteiligt wirkender Miene an. Genüßlich kaute er auf einer getrockneten Feige und spülte mit Wein nach.
„Erstens sind wir in der Übermacht“, sagte einer der anderen, dessen kahler Schädel von einem grauen Haarkranz umgeben war und ihn wie einen Totenkopf aussehen ließ. „Und zweitens trifft es die Bastarde auf der ‚Trinidad‘ so oder so überraschend. Denen machen wir doch Dampf unter dem Hintern, daß ihnen Hören und Sehen vergeht!“
„Genau!“ rief ein dritter, schmächtig und mit einem blonden Ziegenbart. „So muß es laufen! Je schneller wir losschlagen, desto besser wird es klappen.“
Machado begann zu grinsen. In ihrer Gier nach Reichtum verfielen sie auf die verrücktesten Gedanken. Der klare Menschenverstand blieb auf der Strecke, sobald es um Geld und Gold ging. Sicher, auch er selbst war hinter dem Schatz her. Aber er richtete sich nach dem Stand der Dinge, was hieß, daß der Schatzanteil, der sich auf der „Trinidad“ befand, einfach ausreichen mußte. Unter den gegebenen Umständen wäre alles andere heller Wahnsinn gewesen.
Er hatte sich damit abgefunden, daß an den Schatz in der Höhle nicht heranzukommen war. Das Risiko war zu groß. Die „Trinidad“ hingegen lag im Bereich des Möglichen. Aber man mußte trotzdem mit der gebotenen Vernunft zu Werke gehen.
„So, ihr Schlauberger“, sagte er, bevor ein weiterer Kerl mit neuen und noch grandioseren Vorschlägen aufwartete. „Jetzt sag’ ich’s euch zum letztenmal. Unser Angriff beginnt eine Stunde nach Mitternacht. Nicht früher und nicht später. Die Gründe dafür liegen auf der Hand – für jeden, der seinen Kopf zum Denken benutzen kann.“
„He!“ rief der Schwarzbärtige dröhnend. „Du meinst wohl, wir sind zu dämlich, was? Ist es das, was du damit sagen willst?“
„So ungefähr“, entgegnete Machado kalt, und seine Rechte ruhte dabei wie zufällig auf dem Griffstück seiner Pistole. „Wer zwei und zwei zusammenzählen kann, sollte begreifen, daß es nur so geht, wie ich es sage. Die Stunde nach Mitternacht ist die Zeit der geringsten Aufmerksamkeit. Die Posten sind weniger wachsam als am frühen Abend. Und jene, die ihre Kojen abhorchen, schlafen tief und fest.“
„Ja, zum Teufel, aber wir sind doch in der Übermacht!“ rief der Ziegenbärtige.
„So, sind wir das?“ entgegnete Machado höhnisch. „Da habt ihr aber mal richtig nachgerechnet, wie? Habt ihr vielleicht so gerechnet, daß die elf Mann auf der ‚Trinidad‘ einfach dastehen und sich abmurksen lassen? Daß sie sich nicht wehren?“
Verständnislose Blicke hefteten sich auf ihn.
„Ihr wollt doch alle was von dem Reichtum haben, den wir uns hinterher teilen“, fuhr Machado fort. „Nur, wenn wir gleich nach Einbruch der Dunkelheit loslegen, müßt ihr eben darauf gefaßt sein, daß ein paar von euch im Höllenfeuer braten, statt in Gold und Silber zu schwelgen.“
Es wirkte. Die Vorstellung, bei dem Unternehmen möglicherweise getötet zu werden, hatte in der ungehemmt ausgebrochenen Gier bislang keiner ernsthaft in Erwägung gezogen. Jetzt aber, da Machado es ihnen auf diese Weise vor Augen führte, wurden sie nachdenklich. Gegenargumente schien es auf einmal nicht mehr zu geben.
„Na also“, sagte Machado grimmig, „jetzt reißt euch gefälligst am Riemen, sauft nicht soviel und wartet bis nach Mitternacht. Haut euch meinetwegen aufs Ohr, dann seid ihr wenigstens munter genug.“
Widerworte wurden nicht mehr laut.
Diego Machado nahm sich eine neue Feige, kaute voller Genuß und ließ die süße Frucht langsam auf der Zunge zergehen. Er hockte auf einer zusammengefalteten Plane, mit dem Rücken an eine Kiste gelehnt.





























