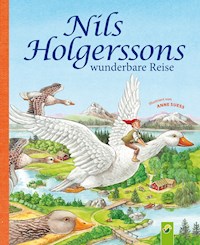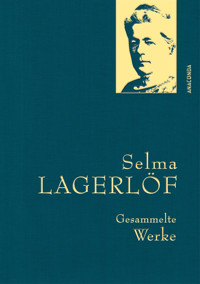
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Anaconda Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Selma Lagerlöf schrieb Geschichten vom Leben an der Nahtstelle zum Sagenhaften und Übernatürlichen. In einer starken, bildhaften Sprache erzählt die schwedische Schriftstellerin von der schicksalsmächtigen Verbindung zwischen Mensch und Natur, von Tieren, Trollen und anderen Gottesgeschöpfen, mit denen die mystische Weite ihrer skandinavischen Heimat erfüllt ist. Dieser Band versammelt Legenden, Sagen und Geschichten aus dem Norden sowie ihre unkonventionellen »Christuslegenden« und Weihnachtsgeschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Selma Lagerlöf
Gesammelte Werke
Aus dem Schwedischen von Marie Franzosund Pauline Klaiber-Gottschau
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt undenthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugteNutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzungdurch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitungoder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere inelektronischer Form, ist untersagt und kann straf- undzivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir unsdiese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Standzum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Portrait of Selma Lagerlöf (photograph),© Iberfoto / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-31155-1V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Der Luftballon
Reors Geschichte
Das Mädchen vom Moorhof
Die Prinzessin von Babylonien
Waldemar Attertag brandschatzt Visby
Unter den Kletterrosen
Ein Stück Lebensgeschichte
Die sieben Todsünden
Die Königinnen von Kungahälla
Die Legende vom Vogelnest
Das Heinzelmännchen von Töreby
Der Wechselbalg
Die Legende von der Christrose
Das Flaumvögelchen
Der Hochzeitsmarsch
Die Vogelfreien
Der Roman einer Fischersfrau
Der Fuhrmann des Todes
Eine Geschichte aus Halland
Der dienstbare Geist
Eine alte Almgeschichte
Das Wasser in der Kirchenbucht
Der Weg zwischen Himmel und Erde
Der Stein im See
Das Kindlein von Bethlehem
Die Flucht nach Ägypten
In Nazareth
Im Tempel
Das Schweißtuch der heiligen Veronika
Das Rotkehlchen
Unser Herr und der heilige Petrus
Die Lichtflammer
Ein Weihnachtsgast
Die Legende des Luciatags
Die Heilige Nacht
Die Vision des Kaisers
Der Weihnachtsmorgen
Der Sturm
Der Traumpfannkuchen
Der Brunnen der weisen Männer
Quellenverzeichnis
Der Luftballon
Vater und die Knaben sitzen an einem regnerischen Oktoberabend in einem Coupé dritter Klasse, auf der Fahrt nach Stockholm. Vater ist auf seiner Bank allein. Die Knaben sitzen ihm gegenüber, eng aneinander geschmiegt, und lesen einen Roman von Jules Verne, der den Titel führt: Sechs Wochen im Luftballon. Das Buch ist sehr abgegriffen. Die Knaben können es fast auswendig und haben endlose Diskussionen darüber geführt, aber sie lesen es immer wieder mit demselben Vergnügen, sie haben alles vergessen, um den kühnen Luftschiffern quer über Afrika zu folgen, und sie erheben nur selten den Blick vom Buche, um die schwedischen Landschaften zu betrachten, die sie durchfahren.
Die Knaben sehen einander sehr ähnlich. Sie sind von gleicher Größe, gleich gekleidet – in graue Überröcke und blaue Schulmützen –, sie haben alle beide große träumerische Augen und kleine Stumpfnasen. Sie sind immer gut Freund, gehen immer miteinander, kümmern sich nicht um andre Kinder und sprechen immer von Erfindungen und Entdeckungsfahrten. Der Begabung nach sind sie recht verschieden geartet. Lennart, der ältere, der dreizehn Jahre zählt, kommt in der Schule schwer vorwärts, und er kann kaum in irgendeinem Gegenstande mit seiner Klasse Schritt halten. Dafür ist er aber sehr geschickt und unternehmungslustig. Er will Erfinder werden und beschäftigt sich beständig damit, eine Flugmaschine zu konstruieren. Hugo ist ein Jahr jünger als Lennart, aber er begreift leichter und ist schon in derselben Klasse wie der Bruder. Auch er interessiert sich nicht besonders für das Lernen, hingegen ist er ein großer Sportsmann: Skiläufer, Radfahrer und Eisläufer. Wenn er erwachsen ist, will er auf Entdeckungsreisen gehen. Sobald Lennarts Flugmaschine fertig ist, wird Hugo damit ausfliegen, um zu entdecken, was von der Welt noch zu entdecken übrig ist.
Vater ist ein großgewachsener Mann mit eingesunkner Brust, fahlem Gesicht und schmalen, schönen Händen. Er ist nachlässig gekleidet. Seine Hemdbrust ist zerknittert, der Rockaufhänger guckt am Halse hervor, die Weste ist schief geknöpft, und die Strümpfe sind herabgerutscht. Er trägt das Haar so lang, dass es auf den Rockkragen hängt, dies jedoch nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Geschmack und Gewohnheit.
Vater stammt aus einem alten Spielmannsgeschlecht, weit her aus dem Bauernland, und er hat als sein besondres Erbteil zwei starke Anlagen mitbekommen. Die eine Anlage ist eine große musikalische Begabung, und sie trat als Erstes zutage. Er besuchte die Akademie in Stockholm, studierte dann ein paar Jahre im Ausland und machte in diesen Studienjahren so glänzende Fortschritte, dass er selbst und seine Lehrer erwarteten, es würde ein großer, weltberühmter Violinspieler aus ihm werden. Er hätte sicherlich Talent genug gehabt, dieses Ziel zu erreichen, aber es fehlte ihm an Kraft und Ausdauer. Er konnte sich draußen in der Welt keine Stellung erkämpfen, sondern kam gar bald heim und nahm einen Organistenposten in einer Provinzstadt an. Anfangs schämte er sich wohl, dass er allen den in ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprochen hatte; aber er empfand es auch angenehm, einen sichern Lebensunterhalt zu haben und nicht mehr die Barmherzigkeit fremder Leute in Anspruch nehmen zu müssen.
Kurz nachdem er die Stelle bekommen hatte, heiratete er; und einige Jahre lang war er mit seinem Lose ganz zufrieden. Er hatte ein schönes kleines Heim, eine frohe und glückliche Frau und zwei kleine Jungen, und er war der Liebling der ganzen Stadt, überall gesucht und gefeiert. Aber dann war eine Zeit gekommen, wo dies alles ihn nicht mehr zu befriedigen schien. Er sehnte sich danach, noch einmal in die Welt hinauszuziehen und sein Glück zu versuchen, doch fühlte er sich verpflichtet, daheim zu bleiben, weil er nun Weib und Kind hatte.
Vor allem war es die Frau, die ihn überredet hatte, von dieser Reise abzustehen. Sie glaubte, dass es ihm nicht besser glücken werde als das erste Mal. Sie meinte, sie seien so glücklich, dass er nichts andres zu erstreben brauche. Damit beging sie sicher einen Fehler, aber sie musste ihn auch schwer genug büßen; denn von der Zeit an kam der zweite Familienzug bei dem Manne zum Vorschein. Da er seine Sehnsucht nach Ruhm und Erfolg nicht stillen konnte, suchte er sich mit dem Trinken zu trösten.
Und es ging ihm nun so, wie es den Menschen aus seiner Familie zu gehen pflegte: Er trank ohne Besinnung und ohne Maß und kam binnen Kurzem ganz herunter. Er wurde allmählich ein ganz andrer Mensch als zuvor. Er war nicht mehr liebenswürdig und einnehmend, sondern böse und hart. Und das größte Unglück war, dass er einen furchtbaren Hass gegen seine Frau fasste und sie in jeder möglichen Weise quälte, wenn er betrunken war – und auch sonst.
Die Knaben hatten also kein gutes Heim gehabt, und ihre Kindheit wäre sehr unglücklich gewesen, hätten sie sich nicht eine kleine Welt für sich selbst geschaffen, voll von Maschinenmodellen, Entdeckungsplänen und Abenteuerbüchern. Die Einzige, die zuweilen einen Blick in diese Welt werfen durfte, war Mutter. Vater hatte nicht einmal eine Ahnung, dass sie existierte; und auch jetzt vermag er mit den Knaben über nichts zu sprechen, was sie interessiert. Er stört sie einmal ums andre, wenn er fragt; er fragt, ob es nicht schön wäre, Stockholm kennenzulernen, und ob sie sich nicht freuten, mit Vater zu reisen, und dergleichen mehr. Sie antworten sehr kurz, um sich augenblicklich wieder in das Buch zu vertiefen. Vater jedoch fragt weiter. Er glaubt, dass die Knaben von seiner Liebenswürdigkeit sehr entzückt sein müssten und nur zu schüchtern wären, es zu zeigen.
»Die haben zu lange an Mutters Schürzenband gehangen«, denkt er. »Sie sind ängstlich und zimperlich geworden. Das wird jetzt anders werden, wenn sie in meine Hand kommen.«
Aber Vater täuscht sich. Dass die Knaben ihm so kurze Antworten geben, kommt nicht von der Schüchternheit, sondern bedeutet nur, dass sie wohlerzogen sind und ihn nicht verletzen wollen. Wenn es nicht so wäre, würden sie ganz anderes antworten. »Warum sollten wir es schön finden, mit Vater zu reisen?«, würden sie dann sagen. »Vater glaubt freilich, etwas ganz Besondres zu sein, aber wir sehen ja, dass er nur ein verkommner Schwächling ist. Und warum sollten wir uns darauf freuen, Stockholm kennenzulernen? Wir wissen sehr gut, dass Vater uns nicht mitgenommen hat, um uns eine Freude zu machen, sondern nur, um Mutter zu kränken.«
Es wäre klüger, wenn Vater die Knaben lesen ließe, ohne sie zu stören. Sie sind niedergeschlagen und ängstlich, und es reizt sie, dass er so guter Laune ist. »Nur weil er weiß, dass Mutter daheim sitzt und weint, ist er heute so vergnügt«, flüstern sie einander zu.
Vaters Fragen bringen es schließlich dahin, dass die Knaben nicht mehr lesen, obgleich sie noch immer über das Buch gebeugt dasitzen. Anstatt dessen beginnen ihre Gedanken mit großer Bitterkeit um alles zu kreisen, was sie um Vaters willen haben leiden müssen.
Sie erinnern sich, wie sich Vater einmal am helllichten Tage betrunken hatte und über die Straße getorkelt kam, von einer Menge Schuljungen verfolgt, die ihn ausspotteten. Sie rufen sich zurück, wie die andern Jungen sie gehänselt und ihnen Spitznamen gegeben haben, weil sie einen Vater hatten, der trank. Sie haben sich für Vater schämen müssen, sie mussten seinetwegen in beständiger Angst leben; und sowie sie irgendeinen Spaß hatten, ist er dazwischen gekommen und hat ihnen das Vergnügen verdorben. Es ist kein kleines Sündenregister, das sie aufstellen. Die Knaben sind sehr sanftmütig und geduldig, aber sie fühlen einen Groll in sich aufsteigen, der stärker und stärker wird. Er hätte doch begreifen müssen, dass sie ihm die große Enttäuschung nicht verzeihen konnten, die er ihnen gestern bereitet hatte. Das war doch das Ärgste, was er ihnen noch angetan hatte.
Die Sache war nämlich die, dass die Mutter der Knaben sich im vorigen Frühling entschlossen hatte, sich von deren Vater zu trennen. Mehrere Jahre lang hatte der Mann sie auf jede erdenkliche Art verfolgt und gepeinigt, doch sie hatte sich nicht von ihm trennen wollen, sondern war bei ihm geblieben, damit er nicht völlig verkomme. Aber jetzt endlich wollte sie es um der Knaben willen tun. Sie hatte beobachtet, dass der Vater sie unglücklich machte; und sie meinte, sie müsse sie diesem Elend entziehen und ihnen ein gutes, friedliches Heim schaffen.
Als das Frühlingssemester zu Ende war, hatte sie die Knaben aufs Land zu ihren Eltern geschickt und war selbst ins Ausland gereist, um so aufs Einfachste die Scheidung zu erlangen. Es war ihr freilich nicht recht gewesen, dass es dadurch den Anschein gewann, als ob die Ehe durch ihr Verschulden gelöst würde; aber dem hatte sie sich unterwerfen müssen. Noch weniger zufrieden war sie damit, dass die Knaben vom Gerichte dem Vater zugesprochen wurden, weil sie eine entlaufne Ehefrau wäre. Sie tröstete sich freilich damit, dass er unmöglich die Absicht haben könnte, die Kinder zu behalten; aber sie hatte doch keine rechte Ruhe mehr.
Sobald die Scheidung durchgeführt war, war sie zurückgekommen und hatte eine Wohnung gemietet, in der sie mit den Knaben leben wollte. Erst vor zwei Tagen hatte sie alles fertig gehabt, sodass die Knaben zu ihr übersiedeln konnten. Es war der glücklichste Tag, den die Kinder noch erlebt hatten. Die ganze Wohnung bestand aus einem großen Zimmer und einer großen Küche, aber alles war neu und fein, und Mutter hatte es so außerordentlich behaglich eingerichtet.
Das Zimmer sollte Mutter und ihnen tagsüber als Arbeitsraum dienen, und nachts sollten die Knaben da schlafen. Die Küche war sehr niedlich und hell. Da würden sie essen. Und in einem kleinen Verschlag hinter der Küche hatte Mutter ihr Bett.
Mutter hatte ihnen gesagt, dass sie sehr arm sein würden. Sie hatte eine Stelle als Gesanglehrerin an der Mädchenschule bekommen; aber dies war auch alles: Davon mussten sie leben. Sie waren nicht in der Lage, sich ein Dienstmädchen zu halten, sondern mussten sich allein behelfen. Die Knaben waren über das Ganze in hellstem Entzücken; vor allem darüber, dass sie mit angreifen durften. Sie erboten sich, Holz und Wasser zu tragen. Sie wollten die Schuhe putzen und die Betten machen. Es war ein rechter Spaß, sich das alles auszudenken.
Eine Kammer war da, wo Lennart alle seine Maschinen aufheben konnte. Er selbst sollte den Schlüssel dazu haben, und kein andrer als Hugo und er sollten sie je betreten dürfen.
Aber nur einen einzigen Tag durften die Knaben bei Mutter glücklich sein. Dann hatte ihnen Vater die Freude verdorben, wie er es stets getan hatte, solange sie sich zurückerinnern konnten. Mutter hatte ihnen erzählt, sie habe gehört, dass Vater eine Erbschaft von einigen tausend Kronen gemacht hätte; er habe seine Stellung gekündigt und wolle nun nach Stockholm ziehen. Mutter und sie hatten sich sehr darüber gefreut, dass er die Stadt verließ, sodass sie ihm nicht mehr auf der Straße zu begegnen brauchten. Aber dann war einer von Vaters Freunden mit der Botschaft zu Mutter gekommen, dass Vater die Knaben nach Stockholm mitnehmen wolle.
Mutter hatte geweint und gefleht, ihre Knaben behalten zu dürfen, aber Vaters Abgesandter hatte geantwortet, dass Vater fest entschlossen sei, die Knaben in seine Obhut zu nehmen. Wenn sie nicht gutwillig kämen, würde er sie durch die Polizei holen lassen. Er sagte, Mutter solle doch das Scheidungsurteil durchlesen, da stünde es ja deutlich, dass die Knaben dem Vater gehörten. Und das wusste Mutter ja auch. Das ließ sich nicht leugnen.
Vaters Freund hatte viele schöne Dinge gesagt: Vater liebe seine Jungen und wolle sie deshalb für sich haben. Aber die Knaben wussten, dass Vater sie einzig und allein fortschleppte, um Mutter zu quälen. Er hatte sich das ausgedacht, damit Mutter an der Trennung von ihm keine Freude hätte. Das Ganze war nur Rache und Bosheit.
Aber Vater hatte seinen Willen durchgesetzt, und hier waren sie nun auf dem Wege nach Stockholm. Und ihnen gegenüber saß Vater und freute sich, dass er Mutter unglücklich gemacht hatte. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde ihnen der Gedanke, dass sie bei Vater bleiben und mit ihm leben müssten, immer widerwärtiger. Waren sie denn völlig in seiner Gewalt? Gab es keine Rettung?
Vater hat sich in seine Ecke zurückgelehnt, und nach einem Weilchen schlummert er ein. Sogleich beginnen die Knaben sehr lebhaft miteinander zu flüstern. Es wird ihnen nicht schwer, einen Entschluss zu fassen. Den ganzen Tag haben sie, jeder für sich, nur daran gedacht, durchzubrennen.
Sie verabredeten, sich auf die Plattform zu schleichen und aus dem Zuge zu springen, wenn er gerade durch einen großen Wald führe. Dann würden sie sich an einem versteckten Plätzchen im Wald eine Hütte bauen und dort allein leben, ohne sich irgendeinem Menschen zu zeigen.
Während die Knaben diese Pläne schmieden, bleibt der Zug an einer Station stehen, und eine Bäuerin, die ein kleines Kind an der Hand führt, steigt in das Coupé. Sie ist schwarz gekleidet, trägt ein Kopftuch und sieht gut und freundlich aus. Sie zieht dem Kleinen das Oberröckchen aus, das vom Regen nass geworden ist, und wickelt ihn in einen Schal. Dann zieht sie ihm die Schuhe ab, trocknet die kalten Füßchen, sucht aus einem Bündel Strümpfe und Schuhe hervor und legt sie ihm an. Schließlich steckt sie ihm ein Bonbon zu und legt ihn auf die Bank, den Kopf auf ihrem Schoße, damit er einschlafe.
Bald wirft der eine, bald der andre Knabe einen Blick auf die Bäuerin, die sich mit ihrem Kinde beschäftigt. Diese Blicke werden immer häufiger, und plötzlich haben die Knaben, beide zugleich, Tränen in den Augen. Nun sehen sie nicht mehr auf, sondern halten die Augen hartnäckig niedergeschlagen.
Es ist, als wäre zugleich mit der Bäuerin noch jemand anders, der für alle, außer für die Knaben, unsichtbar und unmerkbar ist, in den Wagen gekommen. Und dieser andre ist – Mutter. Die Knaben haben das Gefühl, dass sie gekommen sei und sich zwischen sie gesetzt und ihre Hände ergriffen habe, wie sie es noch gestern Abend tat, als es sich entschied, dass sie reisen müssten; und sie spricht ebenso zu ihnen wie damals: »Ihr müsst mir versprechen, dass ihr Vater meinetwegen nicht gram sein werdet. Vater hat es mir nie verzeihen können, dass ich ihn gehindert habe, fortzureisen. Er meint, dass es meine Schuld sei, wenn nichts aus ihm geworden ist, und wenn er trinkt. Er kann mich nie genug strafen. Aber ihr dürft ihm deshalb nicht böse sein. Da ihr jetzt mit Vater leben sollt, müsst ihr mir versprechen, gut gegen ihn zu sein. Ihr dürft ihn nicht reizen, ihr müsst auf ihn achten, so gut ihr könnt. Das müsst ihr mir versprechen; sonst weiß ich gar nicht, wie ich euch ziehen lassen soll.«
Und die Knaben hatten es versprochen.
»Ihr dürft euch nicht von Vater fortschleichen! Versprecht mir das!«, hatte Mutter gesagt.
Das hatten sie auch versprochen.
Die Knaben sind zuverlässig, und in demselben Augenblick, wo sie daran dachten, dass sie Mutter dieses Versprechen gegeben haben, lassen sie alle Fluchtgedanken fahren. Vater schläft noch immer, aber sie bleiben geduldig auf ihren Plätzen sitzen. Mit verdoppeltem Eifer fangen sie wieder zu lesen an, und ihr Freund, der gute Jules Verne, führt sie bald aus ihren Sorgen in die Wunderwelt Afrikas.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Weit draußen in der Södervorstadt hatte Vater zwei Zimmer zu ebner Erde gemietet, mit der Aussicht in einen engen Hof. Die Wohnung ist schon lange in Gebrauch, sie ist von einer Familie auf die andre übergegangen, ohne je instand gesetzt zu werden. Die Tapeten haben eine Unmenge Risse und Flecken, die Decken sind verrußt, ein paar Fensterscheiben sind zerbrochen, und der Küchenboden ist so ausgetreten, dass er ganz holperig geworden ist. Ein paar Dienstmänner haben die Möbel vom Bahnhof geholt, sie in die Zimmer getragen und sie da kunterbunt stehen lassen. Vater und Knaben sind jetzt dabei, auszupacken. Vater steht mit hocherhobener Axt da, um eine Kiste zu öffnen. Die Knaben packen aus einer andern Kiste Glas und Porzellan und stellen es in den Wandschrank. Sie sind geschickt und arbeiten eifrig, aber Vater hört nicht auf, sie zur Vorsicht zu mahnen, und verbietet ihnen, mehr als ein Glas oder einen Teller auf einmal zu tragen. Inzwischen geht es mit Vaters eigner Arbeit nicht recht vorwärts. Seine Hände sind zittrig und kraftlos, und er ist schon ganz schweißbedeckt, ohne den Deckel von der Kiste losbekommen zu können. Er legt die Axt nieder, geht um die Kiste herum und fragt sich, ob sie vielleicht verkehrt stehe. Da nimmt einer der Knaben die Axt und fängt an, sie anzustemmen, doch Vater stößt ihn fort. Lennart werde doch nicht glauben, dass er den Deckel aufbringen könne, wenn Vater selbst es nicht zustande bringe? »Nur ein geübter Arbeiter kann diese Kiste öffnen«, sagt Vater und nimmt Hut und Rock, um den Hausknecht zu holen.
Kaum ist Vater zur Türe hinaus, als ihm etwas einfällt. Er begreift plötzlich, warum er keine Kraft in den Händen hat. Es ist noch früh am Vormittag, und er hat nichts zu sich genommen, was das Blut in Umlauf bringt. Wenn er in ein Café ginge und einen Kognak tränke, dann würde er seine Kraft wiederfinden und könnte sich ohne fremde Unterstützung behelfen. Das ist viel besser, als den Hausknecht zu holen.
Vater geht also auf die Straße, um ein Café zu suchen. Als er in die kleine Hofwohnung zurückkehrt, ist es acht Uhr abends.
In Vaters Jugend, als er noch auf die Akademie ging, hatte er in der Södervorstadt gewohnt. Er war damals Mitglied eines Doppelquartetts gewesen, das hauptsächlich aus Kontoristen und kleinen Kaufleuten bestand und in einem Keller in der Nähe von Mosebacke seine Zusammenkünfte abzuhalten pflegte. Vater hatte nun Lust bekommen, nachzusehen, ob dieser kleine Keller noch existiere. Er war wirklich noch da, und Vater hatte das Glück gehabt, ein paar von den alten Freunden zu treffen, die da saßen und frühstückten. Sie hatten ihn mit größter Freude begrüßt, ihn zum Frühstück eingeladen und seine Ankunft in Stockholm auf die herzlichste Weise gefeiert. Als die Mahlzeit schließlich beendet war, hatte Vater heimgehen wollen, um seine Möbel auszupacken; doch die Freunde hatten ihn überredet, zu bleiben und mit ihnen zu Mittag zu essen. Und dies hatte sich so lange hinausgezogen, dass Vater nicht vor acht Uhr nach Hause gekommen war. Und es hatte ihn keine geringe Überwindung gekostet, sich zu so früher Stunde von der lustigen Gesellschaft loszureißen.
Als Vater heimkommt, sitzen die Knaben in der Dunkelheit, denn sie haben kein Zündholz. Vater hat ein Zündholzschächtelchen in der Tasche, und als er ein kleines Kerzenstümpfchen angezündet hat, das glücklicherweise mitgekommen ist, sieht er, dass die Knaben erhitzt und verstaubt sind, aber munter und vergnügt und augenscheinlich sehr zufrieden mit ihrem Tag. In dem Stübchen stehen die Möbel geordnet, die Kisten sind fortgeräumt, Stroh und Papierschnitzel fortgekehrt. Hugo macht gerade im ersten Zimmer die Betten für die Knaben. Das zweite Zimmer soll Vaters Schlafstube sein, und da steht sein Bett, mit so viel Sorgfalt gemacht, wie er sich’s nur wünschen kann. Jetzt geht mit Vater ein eigentümlicher Umschwung vor. Als er heimkam, war er mit sich selbst unzufrieden gewesen, weil er sich von der Arbeit davongemacht und die Knaben ohne Speise und Trank zurückgelassen hatte. Aber jetzt, wo er sieht, dass sie guter Laune sind, und dass ihnen nichts abzugehen scheint, bereut er es, dass er ihrethalben seine Freunde verlassen hat; er wird reizbar und streitsüchtig.
Er sieht wohl, dass die Knaben stolz auf alle die Arbeit sind, die sie geleistet haben, und dass sie erwarten, von ihm gelobt zu werden; aber dazu ist er gar nicht geneigt. Er fragt vielmehr, wer dagewesen sei und ihnen geholfen habe, und bittet sie, sich gefälligst zu merken, dass man in Stockholm nichts geschenkt bekomme und der Hausknecht für alles, was er täte, bezahlt werden müsse. Die Knaben antworten, dass sie keine Hilfe in Anspruch genommen, sondern alles allein gemacht hätten, aber er hört nicht auf, zu zanken. Es sei unrecht von ihnen gewesen, die große Kiste zu öffnen. Sie hätten sich dabei etwas zuleide tun können. Er hätte ihnen doch verboten, sie zu öffnen. Sie hätten jetzt ihm zu gehorchen. Er sei für sie verantwortlich.
Er nimmt die Kerze, geht in die Küche und leuchtet in die Schränke. Der kleine Vorrat an Glas und Porzellan ist in guter Ordnung auf den Brettern aufgestellt. Er prüft alles haargenau, um Anlass zu weiterem Tadel zu finden.
Plötzlich erblickt Vater ein paar Überreste des Abendbrots der Knaben und beginnt sogleich zu zanken, weil sie Huhn gegessen haben. Woher sie sich das verschafft hätten? Ob sie wie die Prinzen zu leben gedächten? Ob sie sein Geld hinauswürfen, um Hühner zu essen? Dann fällt ihm ein, dass er ihnen ja kein Geld zurückgelassen hat. Er fragt, ob sie das Huhn gestohlen hätten, und gerät ganz außer sich.
Er spricht und ermahnt, zankt und tobt, aber jetzt bekommt er von den Knaben keine Antwort. Sie wollen ihm nicht sagen, woher sie das Huhn haben, sondern lassen ihn austoben. Und er hält ganze Reden, ganze Predigten, er erschöpft seine letzten Kräfte. Schließlich bittet und bettelt er.
»Ich beschwöre euch, sagt mir die Wahrheit! Ich will euch alles verzeihen, was ihr begangen haben mögt, wenn ihr mir nur die Wahrheit sagt.«
Jetzt können es die Knaben nicht länger aushalten. Vater hört einen prustenden Laut. Sie werfen die Decken ab und setzen sich auf, und er merkt, dass sie vor unterdrücktem Lachen ganz rot im Gesicht sind. Und während sie jetzt ungezügelt herauslachen, sagt Lennart, von beständigem Kichern unterbrochen: »Mutter hat uns doch ein Hühnchen in den Esskorb gelegt, den sie uns auf die Reise mitgegeben hat.« Vater richtet sich auf, sieht die Knaben an, will sprechen, findet aber keine passenden Worte. Er richtet sich noch majestätischer empor, sieht sie mit tiefster Verachtung an und geht ohne Weitres auf sein Zimmer.
✳
Vater hat jetzt herausgebracht, wie geschickt die Knaben sind, und er benützt dies, um ein Dienstmädchen zu ersparen. Morgens schickt er Lennart in die Küche und lässt ihn Kaffee kochen, während Hugo den Frühstückstisch deckt und Brot vom Bäcker holt. Nach dem Frühstück setzt Vater sich auf einen Stuhl und sieht zu, wie die Knaben die Betten machen, die Zimmer kehren und die Öfen heizen. Er gibt unaufhörlich Befehle und kommandiert sie von einer Arbeit zur andern, nur um seine Macht zu zeigen. Wenn das Morgenaufräumen vorüber ist, geht er aus und bleibt den ganzen Vormittag weg. Das Mittagessen lässt er aus einer benachbarten Kochschule holen. Dann lässt Vater die Knaben für den Abend allein und verlangt von ihnen nichts andres, als dass sein Bett gemacht sei, wenn er heimkommt.
Die Knaben sind so fast den ganzen Tag allein und können sich beschäftigen, womit sie wollen.
Eine ihrer wichtigsten Arbeiten besteht darin, an Mutter zu schreiben. Sie bekommen von ihr jeden Tag einen Brief, und sie schickt ihnen Papier und Marken, damit sie ihr antworten können.
Mutters Briefe enthalten hauptsächlich Ermahnungen, artig gegen Vater zu sein. Sie schreibt immer, wie liebenswert Vater gewesen sei, als sie ihn kennenlernte, und sie erzählt ihnen, wie hochstrebend und arbeitsam er im Anfang seiner Laufbahn gewesen sei. Sie sollten zärtlich und liebevoll gegen ihn sein. Sie dürften nie vergessen, wie unglücklich er wäre. »Wenn Ihr so recht gut gegen Vater seid, dann hat er vielleicht Mitleid mit Euch und lässt Euch wieder nach Hause zu mir kommen«, schreibt Mutter.
Mutter erzählt, dass sie beim Pfarrer und beim Bürgermeister gewesen sei, um zu fragen, ob es nicht möglich wäre, die Knaben wiederzubekommen. Aber alle beide hätten ihr gesagt, dass es keinen Ausweg gebe. Die Knaben müssten bei ihrem Vater bleiben. Mutter wolle gern nach Stockholm übersiedeln, um ihre Jungen wenigstens ab und zu sehen zu können, aber alle Menschen rieten ihr, sich zu gedulden und noch zu warten. Sie glaubten, dass Vater die Knaben bald satt bekommen und sie wieder heimschicken werde. Mutter wisse nicht recht, was sie tun solle. Einerseits finde sie es schrecklich, dass ihre Knaben in Stockholm ohne irgendjemand lebten, der sich ihrer annehme; und andrerseits wisse sie: Wenn sie ihr Heim verließe und ihre Anstellung aufgäbe, könnte sie sie nicht bei sich aufnehmen und versorgen, falls sie frei würden. Aber zu Weihnachten werde Mutter auf jeden Fall nach Stockholm kommen und nach ihnen sehen.
Die Knaben schreiben und erzählen, was sie den ganzen Tag tun, Stunde für Stunde. Sie lassen Mutter wissen, dass sie Vater das Essen holen und ihm das Bett machen. Sie begreift, dass sie sich bemühen, ihr zuliebe gut gegen ihn zu sein, aber sie merkt, dass sie ihn nicht besser leiden können als früher.
Ihre kleinen Jungen scheinen immer einsam zu sein. Sie wohnen in einer großen Stadt, wo es von Menschen wimmelt, aber niemand fragt nach ihnen, niemand beachtet sie. Und vielleicht ist es noch am besten so. Wer weiß, in was sie hineingeraten könnten, wenn sie irgendwelche Bekanntschaften machten!
Sie bitten sie immer, sich ihrethalben keine Sorgen zu machen. Sie würden sich schon durchschlagen. Sie erzählen, dass sie sich die Strümpfe stopfen und die Knöpfe annähen. Sie deuten auch an, dass Lennart mit seiner Erfindung sehr weit gekommen sei, und sagen, dass alles gut sein werde, sowie die fertig wäre. Aber Mutter lebt in beständiger Angst. Tag und Nacht sind ihre Gedanken bei den Knaben. Tag und Nacht betet sie zu Gott, er möge über ihre kleinen Söhne wachen, die einsam in einer großen Stadt leben, ohne irgendjemand, der ihre Augen gegen die Lockungen der Verderbnis schützt und ihre jungen Herzen vor der Lust zum Bösen bewahrt.
✳
Vater und die Knaben sitzen eines Vormittags in der Oper. Einer von Vaters früheren Kollegen, der der Hofkapelle angehört, hat ihn eingeladen, der Probe zu einem Symphoniekonzert beizuwohnen, und Vater hat die Knaben mitgenommen. Als das Orchester einsetzt und das Haus von den Tonwellen erfüllt wird, gerät Vater in so heftige Bewegung, dass er sich nicht beherrschen kann, sondern zu weinen anfängt. Er schluchzt, schnäuzt sich geräuschvoll und stöhnt einmal um das andre auf. Er legt sich gar keinen Zwang mehr an, sondern wird so laut, dass die Spielenden gestört werden. Ein Diener kommt und winkt ihm ab, darauf nimmt Vater die Knaben bei der Hand und schleicht sich ohne ein Wort des Widerspruchs hinaus, und den ganzen Heimweg hören seine Tränen nicht auf zu fließen.
Vater hat die Hände der Knaben in den seinen behalten und geht mit einem Jungen an jeder Seite einher. Plötzlich fangen auch die Knaben zu weinen an. Sie verstehen nun zum ersten Male, wie Vater seine Kunst geliebt hat. Es war entsetzlich für ihn gewesen, versoffen und verkommen dazusitzen und andre spielen zu hören. Es war ein Jammer, dass er nicht das geworden war, was er hätte werden sollen. Es war für Vater so, wie es für Lennart wäre, wenn er seine Flugmaschine nie fertigbrächte, oder für Hugo, wenn er keine Entdeckungsreise machen dürfte. Zu denken, dass sie einmal als untaugliche Greise dasitzen und sich zu Häupten prächtige Luftschiffe dahinbrausen sehen sollten, die sie weder erfunden hätten noch lenken dürften!
✳
Die Jungen sitzen eines Vormittags daheim und haben ihre Bücher vor sich. Vater hat eine Notenrolle unter den Arm genommen und ist ausgegangen. Er hat etwas davon gemurmelt, dass er eine Musiklektion zu geben hätte, aber die Knaben haben sich keinen Augenblick einreden lassen, dass dies die Wahrheit sei.
Vater ist schlechter Laune, wie er so über die Straße geht. Er hat den Blick bemerkt, den die Knaben wechselten, als er sagte, dass er zu einer Musiklektion ginge. »Sie werfen sich zum Richter auf über ihren Vater«, denkt er.
»Ich bin zu nachsichtig gegen sie. Ich hätte jedem eine Ohrfeige geben sollen. Sicherlich hetzt ihre Mutter sie gegen mich auf.«
»Wie wäre es, wenn ich mich ein wenig nach den Herrchen umsähe?«, fährt er fort. »Es könnte gewiss nichts schaden, sich zu überzeugen, wie sie ihren Studien obliegen.«
Er kehrte um, geht rasch durch den Hof, öffnet ganz leise die Türe und steht in dem Zimmer der Knaben, ohne dass einer von ihnen ihn hätte kommen hören. Und richtig: Die Knaben fahren mit ganz roten Köpfen auf, und Lennart reißt ängstlich ein Bündel Papiere an sich, das er in die Schreibtischlade wirft.
Als die Knaben ein paar Tage in Stockholm waren, da hatten sie gefragt, in welche Schule sie gehen würden, und Vater hatte geantwortet, mit ihrem Schulbesuch sei es jetzt aus. Er würde versuchen, einen Meister zu finden, der sie in die Lehre nehmen wollte. Dies hatte er jedoch nie ins Werk gesetzt, und die Knaben hatten auch nicht weiter von ihrem Schulbesuch gesprochen. Doch nach kaum einer Woche hing in dem Zimmer der Knaben ein Stundenplan an der Wand. Schulbücher wurden hervorgesucht, und jeden Vormittag saßen die Knaben an einem alten Schreibtisch und machten Aufgaben. Es war offenbar: Sie hatten einen Brief von Mutter bekommen, der sie ermahnte, auf eigne Faust zu arbeiten, um nicht alles zu vergessen, was sie gelernt hätten.
Als Vater jetzt so unerwartet zu ihnen hereinkommt, geht er zuerst hin und studiert den Stundenplan. Er zieht seine Uhr heraus und vergleicht. Mittwoch von zehn bis elf: Geografie. Dann kommt er an den Tisch heran. »Hättet ihr in dieser Stunde nicht eigentlich Geografie?«, fragt er. – »Ja«, antworten die Knaben, flammend rot im Gesicht. – »Aber wo habt ihr das Geografiebuch und den Atlas?« – Die Knaben werfen einen Blick auf das Bücherbrett und sehen tödlich verlegen aus. »Wir haben noch nicht angefangen«, sagt Lennart. – »So, so«, sagt Vater. »Ihr habt wohl etwas andres vor.« Und er richtet sich ganz vergnügt auf. Er hat jetzt die Oberhand, und die will er behalten, bis er die Knaben gründlich an die Wand gedrückt hat.
Die beiden Knaben schweigen. Seit dem Tage, da sie mit Vater in die Oper gingen, haben sie Mitleid mit ihm, und es hat ihnen nicht so viel Überwindung gekostet wie früher, artig gegen ihn zu sein. Aber natürlich haben sie keinen Augenblick daran gedacht, Vater ins Vertrauen zu ziehen. Er ist in ihrem Ansehen nicht gestiegen, wenn er ihnen auch leid tut.
»Habt ihr einen Brief geschrieben?«, fragt Vater mit seiner strengsten Stimme. – »Nein«, rufen die beiden Knaben wie aus einem Munde. – »Was habt ihr denn getan?« – »Wir haben nur geplaudert.« – »Das ist nicht wahr! Ich habe gesehen, wie Lennart etwas in die Schreibtischlade gesteckt hat.« – Jetzt schweigen die beiden Knaben wieder. – »Nehmt es heraus!«, ruft Vater, rot vor Zorn. Er glaubt, dass die Söhne an seine Frau geschrieben hätten; und da sie ihm den Brief nicht zeigen wollten, stünde natürlich etwas Hässliches über ihn darin. Die Knaben rührten sich nicht, und Vater hebt die Hand, um nach Lennart zu schlagen, der vor der Schublade sitzt. – »Rühr ihn nicht an!«, ruft Hugo. »Wir haben nur über etwas gesprochen, was Lennart sich ausgedacht hat.«
Hugo schiebt Lennart weg, reißt die Lade auf und zieht einen Bogen Papier hervor, der mit Luftschiffen in den wunderlichsten Formen vollgekleckst ist. »Lennart hat sich heute Nacht ein neues Segel für sein Luftschiff ausgedacht. Und darüber haben wir gesprochen.« Vater will ihm nicht glauben. Er beugt sich hinunter, durchsucht die Lade, findet aber nichts andres als Bogen Papier, bedeckt mit Zeichnungen, die Luftballons, Fallschirme, Flugmaschinen und alles andre vorstellen, was zur Luftschifffahrt gehört.
Zum größten Staunen der Knaben schleudert Vater dies alles nicht gleich fort, er lacht auch nicht über ihre Versuche, sondern er betrachtet Blatt für Blatt genau. Vater hat nämlich auch ein wenig Anlage zur Mechanik; und er hat sich einstmals, als sein Hirn noch zu etwas taugte, für solche Dinge interessiert. Bald beginnt er Fragen nach dem Zweck von diesem und jenem zu stellen; und da seine Worte verraten, dass er großen Anteil nimmt und das, was er sieht, versteht, bekämpft Lennart seine Verlegenheit und antwortet ihm zuerst zögernd, doch allmählich mit immer größerer Bereitwilligkeit.
Bald sind Vater und die Knaben in eine tiefsinnige Diskussion über Luftschiffe und Flugmaschinen vertieft.
Nachdem sie so recht in Zug gekommen sind, plaudern die Knaben unbefangen und teilen Vater alle ihre Pläne und Träume mit. Und wenn Vater auch begreift, dass die Knaben mit den Luftschiffen, die sie jetzt konstruieren, nicht weit fliegen können, imponiert ihm die ganze Sache doch. Seine kleinen Söhne sprechen von Aluminiummotoren, Aeroplanen und Gleichgewichtslagen wie von den selbstverständlichsten Dingen. Er hat sie für rechte Dummköpfe gehalten, weil sie in der Schule nicht gut vorwärts kamen. Jetzt scheint es ihm mit einem Male, dass sie ein paar kleine Gelehrte seien.
Und hochfliegende Gedanken und Hoffnungen –, das versteht Vater besser als irgendjemand. Er erkennt es wieder: Er hat selbst so geträumt und hat durchaus keine Lust, über solche Träume zu lachen.
An diesem Vormittag geht Vater nicht mehr aus, sondern bleibt sitzen und plaudert mit seinen Knaben, bis es Zeit ist, das Mittagessen zu holen und den Tisch zu decken. Und da sind Vater und die Knaben zu ihrer großen Überraschung richtig gute Freunde.
✳
Es ist elf Uhr abends, und Vater taumelt durch die Straßen. Die kleinen Jungen gehen neben ihm. Sie haben ihn im Wirtshaus gesucht und haben sich dicht an die Tür gestellt, ohne ein Wort zu sagen. Vater saß allein an einem Tisch, einen großen dunklen Toddy vor sich, und hörte einer Damenkapelle zu, die am andern Ende des Zimmers spielte. Nach einem Weilchen war er unwillig aufgestanden und zu den Knaben hingegangen. »Was soll das heißen?«, hatte er gefragt. »Warum kommt ihr hierher?« – »Du solltest doch nach Hause kommen, Vater«, sagten die Knaben. »Es ist doch der fünfte Dezember. Du hast ja versprochen – – –«
Da hat sich Vater erinnert, dass Lennart ihm anvertraut hatte, heute sei Hugos Geburtstag, und dass er versprochen hätte, beizeiten nach Hause zu kommen. Aber das hatte er ganz vergessen. Hugo erwartete sich wohl ein Geburtstagsgeschenk von ihm, aber er hatte nicht daran gedacht, eins zu besorgen.
Auf jeden Fall ist er mit den Knaben gegangen, und nun wandert er, unzufrieden mit ihnen und mit sich selbst, die Straße entlang. Als er heimkommt, steht der Geburtstagstisch gedeckt. Die Knaben haben es festlich machen wollen. Lennart hat Kuchen gebacken, die jetzt ein paar Stunden alt sind und wie Lappen aussehen. Sie haben von Mutter ein bisschen Geld bekommen, und dafür haben sie Nüsse, Mandeln und eine Flasche Himbeersaft gekauft.
Alle diese Herrlichkeiten haben sie nicht allein genießen wollen, sondern haben gewartet, dass Vater heimkomme. Nachdem sie sich nun mit Vater befreundet haben, können sie ein so großes Fest nicht ohne ihn feiern. Vater versteht das schon. Es schmeichelt ihm, dass sie sich nach ihm gesehnt haben, und in leidlich guter Laune lässt er sich an dem Tisch nieder. Aber halb betrunken, wie er ist, strauchelt er, als er Platz nehmen will, er hält sich an der Tischdecke fest, fällt zu Boden und zieht alle Herrlichkeiten mit. Als er wieder aufsteht, sieht er, wie der Himbeersaft über den Boden strömt und Backwerk und Konfekt zwischen Scherben und Porzellan und Glas verstreut liegen.
Vater wirft einen Blick auf die langen Gesichter der Knaben, läuft zur Türe hinaus und kommt nicht vor den Morgengrauen heim.
✳
An einem Vormittag im Februar gehen die Knaben mit Schlittschuhen über der Schulter durch die Straße. Sie sind nicht recht dieselben. Sie sind mager und blass geworden und sehen ungepflegt und nachlässig aus. Ihr Haar ist nicht geschnitten, sie sind nicht ordentlich gewaschen, und Strümpfe und Schuhe zeigen Löcher. Wenn sie miteinander sprechen, brauchen sie eine Menge Gassenjungenausdrücke, und es kommt auch vor, dass ein Fluch über ihre Lippen gleitet.
Es ist ein Umschwung bei den Knaben eingetreten, und dies schreibt sich von dem Abend her, an dem Vater vergaß, heimzukommen und Hugos Geburtstag zu feiern. Es war, als hätte sie bis dahin doch die Hoffnung aufrecht erhalten, dass eine baldige Änderung in ihrem Schicksal eintreten würde. In der ersten Zeit hatten sie darauf gerechnet, dass Vater ihrer bald müde werden und sie wieder heimschicken würde. Dann hatten sie sich eingebildet, Vater würde sie lieb gewinnen und um ihretwillen zu trinken aufhören. Ja, sie hatten sich gedacht, dass Mutter und er sich versöhnen könnten, und dass sie alle glücklich sein würden. Aber an jenem Abend wurde es ihnen klar, dass dies alles unmöglich war. Vater konnte nichts andres lieben als das Saufen. Wenn er auch ab und zu einmal gut gegen sie war, so machte er sich doch eigentlich nichts aus ihnen.
Und eine schwere Hoffnungslosigkeit bemächtigte sich der Knaben. Nichts könnte je anders werden. Sie würden nie von Vater loskommen. Sie hatten das Gefühl, als wären sie verurteilt, ihr ganzes Leben lang in einem dunklen Gefängnis eingeschlossen zu sitzen.
Nicht einmal ihre großen Pläne konnten sie trösten. Festgekettet, wie sie hier saßen, könnten sie die ja nie zur Ausführung bringen. Da sie doch nicht einmal etwas lernen durften …! Sie kannten die Geschichte der großen Männer gut genug, um zu wissen, dass jeder, der etwas Bedeutendes leisten will, vor allem Kenntnisse braucht.
Der härteste Schlag aber war gewesen, dass Mutter zu Weihnachten nicht zu ihnen gekommen war. Zu Anfang des Dezembers war sie auf der Treppe gefallen und hatte sich ein Bein gebrochen, sodass sie während der Weihnachtsferien im Krankenhaus liegen musste und nicht nach Stockholm reisen konnte. Jetzt war Mutter wohl auf, aber jetzt hatte auch ihre Schule wieder begonnen. Überdies hatte sie kein Geld zur Reise. Alles, was sie zusammengespart hatte, war während ihrer Krankheit draufgegangen.
Die Knaben fühlten sich von der ganzen Welt verlassen. Es war ganz klar, dass es ihnen nie besser gehen würde, wie sehr sie sich auch anstrengten; und darum hatten sie so allmählich aufgehört, sich mit dem zu plagen, was ihnen langweilig schien. Sie konnten ja ebenso gut etwas tun, was ihnen Spaß machte.
Manchmal betteten sie ihre Betten tagelang nicht auf, und sie hörten ganz auf, die Zimmer zu kehren. Es kam ja auf eins heraus. Es besuchte sie ja doch niemand, um nachzusehen, wie es ihnen ginge.
Vater kam immer tiefer herunter. Er versuchte manchmal, sich aufzurütteln und die Knaben zur Ordnung anzuhalten, aber es waren nur ohnmächtige Anläufe. Er vergaß seine Befehle ebenso rasch, wie er sie gegeben hatte.
Die Knaben hatten auch angefangen, die Vormittagsarbeit zu vernachlässigen. Niemand hörte ihnen die Aufgaben ab; und da hatte es ja keinen Zweck, dass sie lernten. Es war jetzt seit ein paar Tagen gutes Eis; so machten sie sich lieber Ferien und liefen Schlittschuh, solang es Tag war. Auf dem Eise gab es auch immer eine Menge andre Jungen, und sie hatten mit mehreren Bekanntschaft gemacht, die auch lieber Schlittschuh liefen als daheim saßen und lernten.
Heute nun ist ein so wunderschöner Tag, dass sie unmöglich im Zimmer bleiben können. Es sind nur ein paar Grad Kälte –, stille, hohe Luft und klarer Sonnenschein. Es ist so herrliches Wetter, dass die Schulen Eislaufferien gegeben haben. Die ganze Straße ist voll von Kindern, die daheim waren, um ihre Schlittschuhe zu holen, und jetzt dem Eise zueilen.
Wie die Knaben so unter den andern Kindern einhergehen, sehen sie sehr ernst und schwermütig aus. Kein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ihr Unglück ist so groß, dass sie es keinen Augenblick vergessen können. Als sie aufs Eis kommen, herrscht dort Leben und Bewegung. Das Ufer ist von einer dichten Menschenmenge umsäumt, weiter draußen schwirren die Schlittschuhläufer durcheinander wie Ameisen, deren Haufen gestört worden ist; noch weiter weg sieht man einzelne schwarze Punkte, die in blitzschneller Fahrt dahingleiten.
Die Knaben schnallen die Schlittschuhe an und mischen sich unterer die übrigen Läufer. Sie laufen sehr gut; und wie sie so in voller Fahrt über das Eis schießen, bekommen ihre Wangen Farbe und die Augen Glanz, doch nicht eine Minute sehen sie froh und sorglos aus wie andre Kinder.
Auf einmal, als sie gerade eine Wendung zum Ufer machen, erblicken sie etwas sehr Schönes. Ein großer Luftballon kommt aus der Richtung von Stockholm und treibt zur Ostsee hin. Er ist rot und gelb gestreift; und als die Sonne darauf fällt, leuchtet er wie eine Feuerkugel. Die Gondel ist mit einer Menge bunter Fähnchen geschmückt, und da der Ballon nicht sehr hoch fliegt, ist das lebhafte Farbenspiel sehr gut zu sehen.
Als die Knaben den Ballon erblicken, stoßen sie einen Freudenschrei aus. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie einen großen Ballon durch die Luft segeln sehen. Er ist viel schöner, als sie ihn sich vorgestellt haben. Alle die Träume und Pläne, die in so vielen schweren Tagen ihr Trost und ihre Freude waren, tauchen wieder auf, da sie ihn erblicken. Sie bleiben stehen, um zu sehen, wie die Stricke und Leinen befestigt sind, sie bemerken den Anker und die Sandsäcke an der Gondelkante.
Der Ballon streicht mit scharfer Geschwindigkeit über die vereiste Bucht. Alle Schlittschuhläufer, groß und klein durcheinander, stürzen ihm lachend und rufend entgegen, als er sich zeigt, und eilen ihm dann nach. Sie folgen ihm in einer langen, geschwungenen Linie wie ein ungeheures Schlepptau. Und die Luftschiffer vergnügen sich damit, eine Menge Papierchen in verschiedenen Farben auszuwerfen, die langsam durch die blaue Luft flattern.
Die Knaben sind die vordersten in der langen Reihe, die dem Ballon nachjagt. Sie eilen voran, den Kopf zurückgeworfen, den Blick nach oben gerichtet. Zum ersten Male, seit sie von ihrer Mutter getrennt sind, strahlen ihre Augen voll Glück. Sie sind ganz außer sich vor Entzücken über das Luftschiff und denken an nichts andres, als ihm so lange zu folgen wie nur möglich.
Doch der Ballon treibt rasch dahin, und man muss schon ein guter Läufer sein, um nicht zurückzubleiben. Die Schar, die ihm nachjagt, lichtet sich, aber an der Spitze derer, die die Verfolgung fortsetzen, sind die kleinen Knaben. Sie sind so eifrig, dass man auf sie aufmerksam wird. Später sagten die Leute, es sei etwas Eignes über ihnen gewesen. Sie lachten nicht, sie riefen nicht; aber es ruhte ein Glanz der Hingerissenheit auf ihren emporgewandten Gesichtern, als sahen sie eine Vision.
Der Ballon wirkt auf die Kleinen auch fast so wie ein himmlischer Wegweiser, der käme, sie auf den rechten Pfad zurückzuführen und sie zu lehren, ihn mit frischem Mut zu gehen. Wie die Knaben ihn erblicken, schwellen ihre Herzen vor Sehnsucht danach, wieder an der großen Erfindung zu arbeiten. Sie sind wieder gewiss, dass es ihnen gelingen wird. Wenn sie nur ausharren, werden sie sich schon zum Siege durchringen. Und der Tag wird kommen, da sie ihr eignes Luftschiff besteigen und in den Raum hinaufschweben werden. Ja, eines Tages werden sie dort oben hoch über den Menschen fliegen. Und ihr Luftschiff wird weit vollkommener sein als dieses, das sie jetzt sehen. Es wird sich lenken und drehen, senken und heben lassen, wird gegen den Wind und ohne Wind gehen. Es wird sie durch Tage und Nächte tragen, wohin sie nur wollen. Sie werden sich auf den höchsten Berggipfeln niederlassen, die ödesten Wüsten durchfahren, die am schwersten zugänglichen Gegenden erforschen. Sie werden alle Herrlichkeit der Welt sehen.
»Wir dürfen es nicht aufgeben, Hugo«, sagt Lennart. »Es wird prächtig sein, wenn wir nur fertig werden.« Vater und sein Unglück –, das ist etwas, was sie gar nichts mehr angeht. Wer ein so großes Ziel hat wie sie, kann sich wohl nicht von etwas Erbärmlichem hindern lassen.
Je weiter der Ballon kommt, desto größer wird seine Geschwindigkeit. Die Schlittschuhläufer haben nun aufgehört, ihn zu verfolgen. Die Einzigen, die die Jagd fortsetzen, sind die kleinen Knaben. Sie eilen so rasch und leicht dahin, als hätten sie Flügel an den Füßen.
Plötzlich entringt sich den Menschen, die auf dem Lande stehen und weit über die Bucht schauen können, ein Schrei des Entsetzens und der Angst. Sie sehen, wie der Ballon, noch immer von den zwei Kindern verfolgt, dem offnen Fahrwasser zugleitet.
»Draußen ist offnes Wasser! Offnes Wasser!« So rufen die Menschen.
Die Schlittschuhläufer unten auf dem Eise hören die Rufe und wenden ihre Blicke der Mündung der Bucht zu. Sie sehen, dass weit draußen ein Streifen Wasser in der Sonne glitzert. Sie sehen auch, dass zwei kleine Knaben gerade auf diesen Streifen zulaufen, den sie nicht bemerken, weil sie die Augen auf den Ballon geheftet haben, ohne sich auch nur einen Moment zur Erde zu wenden.
Man ruft mit aller Macht, man stampft auf das Eis, Schnellläufer eilen dahin, sie aufzuhalten. Aber die Kleinen merken nichts von alledem, wie sie so dem Luftschiff nachjagen. Sie wissen nicht, dass sie die Einzigen sind, die es verfolgen: Sie hören keine Rufe hinter sich, sie vernehmen nicht das Wogen und Brausen des offnen Wassers vor sich. Sie sehen nur den Ballon, der sie gleichsam mitzieht. Schon fühlt Lennart, wie sein eignes Luftschiff sich unter ihm erhebt, und Hugo schwebt über den geheimnisvollen Gegenden des Nordpols dahin.
Die Leute auf dem Eise und am Strande sehen, wie rasch sich die Knaben dem offnen Wasser nähern. Ein paar Augenblicke herrscht eine so atemlose Spannung, dass sie weder rufen noch ein Glied rühren können. Es liegt wie eine Verzauberung über den beiden Kindern, die in ihrem wilden Dahinstürmen nichts merken, die dem Tode zueilen, einer strahlenden Himmelserscheinung nach.
Die Luftschiffer oben im Ballon haben nun auch die kleinen Knaben bemerkt. Sie sehen, dass sie in Gefahr sind, sie schreien ihnen zu und machen warnende Gebärden, aber die Knaben verstehen sie nicht. Als sie sehen, dass die Luftschiffer ihnen Zeichen machen, glauben sie, jene wollten sie in die Gondel hinaufnehmen. Sie strecken die Arme zu ihnen empor, überglücklich in der Hoffnung, ihnen durch den strahlenden Raum folgen zu dürfen.
In diesem Augenblick haben die Knaben den Wasserrand erreicht, mit emporgewendeten, freudestrahlenden Gesichtern und aufgehobenen Armen gleiten sie ins Meer und verschwinden ohne einen Hilferuf. Die Schlittschuhläufer, die versucht haben, sie einzuholen, stehen ein paar Sekunden später an der Eiskante, aber die Strömung hat die Körper unter das Eis gezogen, und keine helfende Hand kann sie erreichen.
Reors Geschichte
War da ein Mann, der hieß Reor. Er war aus Fuglekärr im Kirchspiel Svarteborg und galt für den besten Schützen der Gegend. Er wurde getauft, als König Olof die alte Lehre in Viken ausrottete, und war fortab ein eifriger Christ. Er war von freier Geburt, aber arm, schön, aber nicht hochgewachsen, stark, aber sanft. Er zähmte junge Fohlen mit Blick und Wort allein, und er konnte mit einem einzigen Zuruf die kleinen Vöglein an sich locken. Er hielt sich fast immer im Walde auf, und die Natur hatte große Macht über ihn. Das Wachstum der Pflanzen und das Knospen der Bäume, das Spiel der Hasen in den Waldlichtungen und der Sprung des Barsches in dem abendstillen See, der Kampf der Jahreszeiten und der Wechsel der Witterung, dies waren die Hauptgeschehnisse in seinem Leben. Schmerz und Freude bereitete ihm derlei, und nicht das, was sich unter den Menschen zutrug.
Eines Tages tat der geschickte Jäger einen guten Fang. Er traf im tiefen Waldesdickicht einen alten Bären und erlegte ihn mit einem einzigen Schuss. Die scharfe Spitze des grünen Pfeiles drang in das Herz des Gewaltigen, und er sank dem Jäger tot zu Füßen. Es war Sommer, und der Pelz des Bären war weder dicht noch glatt, dennoch zog der Schütze ihn ab, rollte ihn zu einem harten Bündel zusammen und ging mit dem Bärenfell auf dem Rücken weiter.
Er war noch nicht lange gewandert, als er einen überaus starken Honigduft verspürte. Der kam von den kleinen, blühenden Pflanzen, die den Boden bedeckten. Sie wuchsen auf dünnen Stielen, hatten lichtgrüne, glatte Blätter, die sehr schön geädert waren, und auf der Spitze des Stängels ein kleines Büschelchen, das dicht mit weißen Blüten besetzt war. Die kleinen Kronen waren nach winzigem Maßstabe geraten, doch aus ihnen ragte eine kleine Bürste von Stempeln auf, deren blütenstaubgefüllte Knöpfchen auf weißen Saiten zitterten. Reor dachte, während er so unter ihnen einherging, dass diese Blumen, die einsam und unbemerkt im Waldesdunkel standen, Botschaft um Botschaft, Ruf um Ruf aussandten. Der starke honigsüße Duft war ihr Ruf, der verbreitete die Kunde ihres Daseins weit unter die Bäume und hoch hinauf in die Wolken. Aber es lag etwas Beängstigendes in dem schweren Duft. Die Blumen hatten ihre Becher gefüllt und ihre Tischlein gedeckt, der geflügelten Gäste harrend, aber niemand kam. Sie sehnten sich zu Tode in ihrer trüben Einsamkeit in dem dunklen, windstillen Waldesdickicht. Sie schienen schreien und jammern zu wollen, weil die schönen Schmetterlinge nicht kamen, um bei ihnen zu Gaste zu sein. Da, wo die Blumen am dichtesten beisammen standen, deuchte es ihn, als sängen sie zusammen ein eintöniges Lied: »Kommt, ihr schönen Gäste, kommt heute, denn morgen sind wir tot. Morgen liegen wir auf dem trocknen Laub.«
Doch es sollte Reor vergönnt sein, das frohe Ende des Blumenmärchens zu sehen. Er vernahm hinter sich ein Flattern wie das allerleiseste Lüftchen und sah einen weißen Schmetterling im Dunkel zwischen den dicken Stämmen umherirren. Unruhig suchend flog er hin und wieder, als wüsste er den Weg nicht. Er war nicht allein, ein Schmetterling nach dem andern tauchte im Dunkel auf, bis endlich ein ganzes Heer der weißbeschwingten Honigsucher versammelt war. Aber der erste war der Anführer, und er fand, vom Dufte geleitet, die Blumen. Nach ihm kam das ganze Schmetterlingsheer herangestürmt. Es stürzte sich auf die sehnsüchtigen Blumen, wie der Sieger sich auf die Beute stürzt. Wie ein Schneefall von weißen Flügeln senkten sie sich auf sie herab. Und nun gab es ein Fest- und Trinkgelage um jede Blume. Der Wald war voll von stillem Jubel.
Reor ging weiter. Doch nun war es, als folgte ihm der honigsüße Duft auf dem Fuße, wohin er auch ging. Und er empfand, dass sich drinnen im Walde eine Sehnsucht verbarg, stärker als die der Blumen. Dass da etwas war, was ihn zu sich zog, so wie die Blumen die Schmetterlinge angelockt hatten. Er ging mit einer stillen Freude im Herzen einher, so, als harrte er eines großen unbekannten Glückes. Das Einzige, was ihn ängstigte, war, ob er auch den Weg zu diesem finden konnte, was sich nach ihm sehnte.
Vor ihm auf dem schmalen Pfade kroch eine weiße Schlange. Er bückte sich, um das Glück bringende Tier aufzuheben, aber die Schlange glitt ihm aus den Händen und eilte rasch den Pfad hinauf. Da rollte sie sich zusammen und lag still, doch als der Schütze wieder nach ihr griff, glitt sie so glatt wie Eis zwischen seinen Fingern durch. Nun war Reor ganz und gar darauf erpicht, das klügste Tier zu besitzen. Er lief der Schlange nach, konnte sie aber nicht erreichen, und sie lockte ihn von dem Pfade fort auf den ungebahnten Waldboden.
Dieser war mit Föhren bestanden, und in einem Föhrenwalde findet man selten Rasen. Aber jetzt verschwand plötzlich das trockne Moos und die braunen Nadeln, Farrenkräuter und Preißelbeerbüsche zogen sich zurück, und Reor fühlte seidenweiches Gras unter seinen Füßen. Über der grünen Matte zitterten federleichte Blumenrispen auf sanft geneigten Stängeln, und zwischen den langen schmalen Blättern zeigten sich die kleinen, halb erblühten Blumen der Steinnelke. Es war nur eine ganz kleine Stelle, und darüber breiteten die hochstämmigen Föhren ihre knorrigen, braunen Äste mit dichten Nadelbüscheln. Doch zwischen diesen konnten die Sonnenstrahlen viele Wege zur Erde finden, und es war erstickend heiß.
Aber gerade vor dieser kleinen Wiese erhob sich eine Felswand lotrecht aus dem Boden. Sie lag im hellen Sonnenschein, und man sah deutlich die moosigen Steinflächen, die frischen Brüche, da wo der Winterfrost zuletzt gewaltige Blöcke gelöst hatte, die großen Stauden Steinwurz, die die braunen Wurzeln in erdgefüllte Spalten drängten, und die zollbreiten Absätze, wo die Säulenflechte ihre rot gestreiften Pokale aufrichtete und eine grasgrüne Moosart auf nadelfeinen Stiftchen die kleinen grauen Mützen erhob, die ihre Befruchtungsorgane enthielten.
Diese Felswand schien in allen Stücken jeder andern Felswand zu gleichen, aber Reor bemerkte sogleich, dass er gerade vor die Giebelwand einer Riesenbehausung gekommen war, und er entdeckte unter Moos und Flechten die großen Angeln, auf denen das Steintor des Berges sich drehte.
Er glaubte jetzt, dass die Schlange sich in das Gras verkrochen habe, um sich da zu verbergen, bis sie unbemerkt in den Felsen schlüpfen konnte, und er gab die Hoffnung auf, sie zu fangen. Er spürte jetzt wieder den honigsüßen Duft der sehnsüchtigen Blumen und merkte, dass hier oben unter der Bergwand eine erstickende Hitze herrschte. Es war auch seltsam still: Kein Vogel rührte sich, keine Nadel spielte im Winde, es war, als hielte alles den Atem an, um in unbeschreiblicher Spannung zu warten und zu lauschen. Reor war gleichsam in ein Gemach gekommen, wo er nicht allein war, obgleich er niemanden sah. Er hatte das Gefühl, als ob jemand ihn beobachtete, es war ihm, als würde er erwartet. Er empfand keine Angst, nur ein wohliger Schauer durchrieselte ihn, so, als sollte er bald etwas überaus Schönes zu sehen bekommen.
In diesem Augenblick gewahrte er wieder die Schlange. Sie hatte sich nicht versteckt, sie war vielmehr auf einen der Blöcke gekrochen, die der Frost von der Felswand abgesprengt hatte. Und dicht unter der weißen Schlange sah er den lichten Leib eines Mädchens, das im weichen Grase lag und schlief. Sie lag ohne andre Decke, als ein paar spinnwebdünne Schleier, gerade als hätte sie sich dort hingeworfen, nachdem sie die Nacht hindurch im Elfenreigen getanzt, aber die langen Grashalme und die zitternden, federleichten Blumenrispen erhoben sich hoch über der Schlafenden, sodass Reor nur undeutlich die weichen Linien ihres Körpers gewahren konnte. Er trat auch nicht näher, um besser zu sehen, aber sein gutes Messer zog er aus der Scheide und warf es zwischen das Mädchen und die Felswand, damit die den Stahl fürchtende Riesentochter nicht in den Berg fliehen konnte, wenn sie erwachte.
Dann blieb er in tiefe Gedanken versunken stehen. Eines wusste er sogleich, das Mägdlein, das hier schlief, wollte er besitzen; aber noch war er nicht recht einig mit sich selbst, wie er gegen sie handeln sollte.
Doch da lauschte er, der die Sprache der Natur besser kannte als die der Menschen, dem großen ernsten Walde und dem strengen Berge. »Sieh«, sagten sie, »dir, der du die Wildnis liebst, geben wir unsre schöne Tochter. Besser ziemt sie dir als die Töchter der Ebene. Reor, bist du der edelsten Gabe würdig?«
Da dankte er in seinem Herzen der großen wohltätigen Natur und beschloss, das Mädchen zu seiner Frau zu machen und nicht nur zu seiner Magd. Und da er dachte, dass sie, wenn sie das Christentum und Menschensitte angenommen hatte, sich bei dem Gedanken, dass sie so unverhüllt dagelegen habe, schämen würde, löste er die Bärenhaut von seinem Rücken, entrollte das steife Fell und warf den grauen, zottigen Pelz des alten Bären über sie.
Doch als er dies tat, erdröhnte hinter der Felswand ein Lachen, von dem die Erde erzitterte. Es klang nicht wie Hohn, nur so, als hätte jemand in großer Angst gewartet, der lachen musste, als er ganz plötzlich davon befreit wurde. Die furchtbare Stille und die drückende Hitze hatten nun auch ein Ende. Über das Gras schwebte ein erquickender Wind, und die Nadeln begannen ihren rauschenden Gesang. Der glückliche Jäger fühlte, dass der ganze Wald den Atem angehalten hatte, in Unruhe, wie die Tochter der Wildnis von dem Menschensohn behandelt werden würde.
Die Schlange schlüpfte jetzt in das hohe Gras; aber die Schlummernde lag in Zauberschlaf versunken und regte sich nicht. Da rollte Reor sie in die grobe Bärenhaut, sodass nur ihr Kopf aus dem zottigen Fell hervorguckte. Obgleich sie sicherlich eine Tochter des alten Riesen im Berge war, war sie doch zart und fein gebaut, und der starke Schütze hob sie in seine Arme und trug sie fort durch den Wald.
Nach einem Weilchen fühlte er, wie jemand seinen breitrandigen Hut abhob. Da sah er auf und merkte, dass die Riesentochter erwacht war. Sie saß ganz ruhig in seinem Arm, aber nun wollte sie sehen, wie der Mann aussah, der sie trug. Er ließ sie gewähren, er machte größre Schritte, aber sagte nichts.
Da musste sie wohl gemerkt haben, wie heiß ihm die Sonne auf den Kopf brannte, nachdem sie ihm den Hut abgenommen hatte. Sie hielt ihn darum über seinen Kopf wie einen Sonnenschirm, aber sie setzte ihn ihm nicht auf, sondern hielt ihn so, dass sie immerzu in sein Gesicht sehen konnte. Da deuchte es ihn, dass er nichts zu fragen, nichts zu sagen brauchte. Stumm trug er sie hinab zu seiner Mutter Hütte. Doch sein ganzes Wesen durchbebte Glückseligkeit, und als er auf der Schwelle seines Heims stand, da sah er, wie die weiße Schlange, die Glück ins Haus bringt, unter die Grundmauer schlüpfte.
Das Mädchen vom Moorhof
1
Es ist in einem Thingsaal, weit draußen auf dem Lande. Am Richtertisch, hoch oben im Saal, sitzt der Richter, ein großer, stark gebauter Mann mit breitem, grobgeschnittenem Gesicht. Schon mehrere Stunden lang hat er einen Fall nach dem andern entschieden, und schließlich ist etwas wie Überdruss und Düsterkeit über ihn gekommen. Es ist schwer zu sagen, ob es die Hitze und Schwüle im Gerichtssaal ist, die ihn bedrückt, oder die Schuld an dieser schlechten Laune die Beschäftigung mit allen diesen kleinlichen Zwistigkeiten trägt, die aus keinem andern Grunde entstanden zu sein scheinen, als um die Händelsucht und Unbarmherzigkeit und Geldgier der Menschen an den Tag zu bringen.
Er hat gerade mit einer der letzten Verhandlungen begonnen, die heute durchgeführt werden sollen. Es handelt sich um die Forderung eines Erziehungsbeitrages.
Dieser Fall ist schon am vorigen Gerichtstag verhandelt worden, und das Protokoll des früheren Prozesses wird eben verlesen. Daraus erfährt man fürs Erste, dass die Klägerin eine arme Dienstmagd ist und der Beklagte ein verheirateter Mann.
Weiter geht aus dem Protokoll hervor, dass der Beklagte erklärt hat, die Klägerin habe ihn zu Unrecht und nur aus Gewinnsucht hierher laden lassen. Er gibt zu, dass die Klägerin eine Zeit lang auf seinem Hof in Dienst gestanden hat; er aber habe sich während dieser Zeit in keinerlei Liebeshändel mit ihr eingelassen, und sie habe kein Recht, irgendwelche Unterstützung von ihm zu begehren. Die Klägerin jedoch hat an ihrer Behauptung festgehalten; und nachdem einige Zeugen vernommen waren, ist dem Beklagten auferlegt worden, einen Eid zu leisten, wenn er nicht verurteilt werden wolle, der Klägerin die verlangte Unterstützung zu zahlen.
Beide Parteien haben sich eingefunden und stehen nebeneinander vor dem Gerichtstisch. Die Klägerin ist sehr jung und sieht ganz verschüchtert aus. Sie weint vor Scham und trocknet mühsam ihre Tränen mit einem zusammengeknüllten Taschentuch; es scheint, als könne sie es nicht auseinanderfalten. Sie trägt schwarze Kleider, die ziemlich neu und ungetragen aussehen, aber sie sitzen so schlecht, dass man versucht ist, zu glauben, sie habe sie sich ausgeliehen, um anständig vor Gericht erscheinen zu können.
Was den Beklagten anlangt, so sieht man ihm gleich an, dass er ein wohlgestellter Mann ist. Er mag etwa vierzig Jahre alt sein und hat ein zuversichtliches und frisches Aussehen. Wie er da vor dem Richterstuhl steht, zeigt er eine sehr gute Haltung. Es sieht ja nicht aus, als fände er ein besonderes Vergnügen daran, da zu stehen, aber er macht auch durchaus keinen befangnen Eindruck.