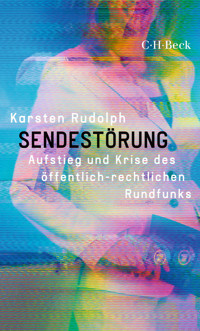
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Sendestörung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Karsten Rudolph
Sendestörung
Aufstieg und Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Einleitung
1. Nach Hitler: Die Anfänge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Große Schwester BBC
NWDR: Die Stimme des neuen Deutschland
Die Gespenster der Vergangenheit
2. Im Wirtschaftswunderland: Aufbau und Ausbau der Anstalten
Der deutsche Sonderweg
Neue Töne im Rundfunkjournalismus
An den Grenzen des Zeigbaren
Über Gebühr: Rundfunkfreiheit als Finanzierungsproblem
3. Proporz und Politisierung in den goldenen Siebzigern
Die Nation im Fernsehzeitalter
Wer regiert die Anstalt?
Objektivität, Neutralität, Ausgewogenheit
Der lange Abschied vom Monopol: Der kommerzielle Rundfunk begehrt Einlass
4. Umbruch und Entmachtung in den Achtzigerjahren
Die medienpolitische Wende
Systemwettbewerb: Tatort gegen Polizeiruf
Die Versportlichung des Rundfunks
Abstumpfung und «Volksverdummung»?
5. Nach der Wiedervereinigung: Krise und Überforderung
Legitimationsprobleme: Mehr Sender, mehr Programme, höhere Gebühren
Wer steuert die Öffentlich-Rechtlichen?
Das Internet als Bedrohung und Chance
Anhang
Abkürzungen
Anmerkungen
Einleitung
1. Nach Hitler: Die Anfänge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
2. Im Wirtschaftswunderland: Aufbau und Ausbau der Anstalten
3. Proporz und Politisierung in den goldenen Siebzigern
4. Umbruch und Entmachtung in den Achtzigerjahren
5. Nach der Wiedervereinigung: Krise und Überforderung
Literatur
Register der Sendungen
Personenregister
Bildnachweis
Zum Buch
Vita
Impressum
Einleitung
«Zum Sehen geboren Zum Schauen bestellt, Dem Turme geschworen, Gefällt mir die Welt.»
Johann Wolfgang Goethe, Faust II
Hans Bausch, der Herausgeber einer vierbändigen Reihe zum Rundfunk in Deutschland, die 1980 erschien, kam in dem von ihm selbst geschriebenen letzten Band seiner Geschichte der Rundfunkpolitik nach 1945 zu dem Ergebnis, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk «in den letzten drei Jahrzehnten niemals ernsthaft gefährdet gewesen sei».[1] Bausch wusste, wovon er sprach, war er doch genau dreißig Jahre zuvor in den Dienst des Südwestrundfunks getreten, bald darauf bei Hans Rothfels in Tübingen mit einem rundfunkhistorischen Thema promoviert worden und seit 1958 Intendant des Süddeutschen Rundfunks. Sein Mandat im Stuttgarter Landtag legte er für dieses Amt, das er drei Jahrzehnte bekleiden sollte, nieder. Die Geschichtsschreibung gab er indessen niemals auf. Fünfzehn Jahre lang leitete er die Historische Kommission der ARD, zwischen 1962 und 1972 und dann noch einmal von 1986 bis 1991. Nach ihm wurde ein Preis benannt, den er als Intendant selbst gestiftet hatte, und der vom Südwestrundfunk und der Universität Tübingen seit 2021 unter der Bezeichnung «Hans Bausch Mediapreis des SWR für gesellschaftliche Verantwortung in digitalen Öffentlichkeiten» verliehen wird. Das alles zeigt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat nicht nur Geschichte gemacht, er hat auch seine eigene Geschichte geschrieben – als Erfolgsgeschichte.
Dass es nach der Befreiung von der NS-Diktatur gelang, in Westdeutschland die Meinungsbildung frei zu gestalten, war nicht allein, aber in entscheidendem Maße das Verdienst eines Rundfunks, der weder eine Staatseinrichtung noch ein Wirtschaftsunternehmen war. Weil der gemeinnützige Rundfunk den Systemwettbewerb mit dem Partei-Funk der DDR haushoch gewonnen hatte, schien seine Osterweiterung nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten nur folgerichtig zu sein. Aber mit der Konsolidierung kommerzieller Rundfunkanbieter geriet der öffentlich-rechtliche Rundfunk in eine ernste Schwächephase. Die Zukunft schien mit einem Mal ungewiss.
Der Nachfolger von Bausch, Programmdirektor Dietrich Schwarzkopf, gab 1999 für die Historische Kommission der ARD eine zweibändige Fortsetzung von Bauschs Rundfunkgeschichte heraus, in der der Optimismus der Aufstiegsjahre allerdings weitgehend verflogen war. Nunmehr ging es um den schweren Gang der Rundfunkpolitik im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Öffentlichkeit, und die meisten Beiträge lesen sich wie Loblieder auf das untergegangene Duopolzeitalter von ARD und ZDF.[2] Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erholte sich wieder, und in den Nullerjahren war es dann die private Konkurrenz, die durch einen Einbruch des Werbemarktes in die Bredouille geriet und deswegen von der Politik gestützt werden musste. Die darauf folgende relative Stabilisierung beider Systeme im Rahmen der verfassungsrechtlich genau austarierten dualen Rundfunkordnung täuschte indes über eine Bedrohung hinweg, die die öffentlich-rechtlichen Sender ebenso massiv traf wie die privat-kommerziellen Anbieter. Die Etablierung des Internets und mit ihm das Aufkommen globaler Suchmaschinen, der Siegeszug sozialer Medien und die Expansion der Streamingportale veränderten die deutsche Medienwelt grundlegend.
Heute ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ernsthaft gefährdet – und das liegt nicht allein an der digitalen Transformation, die die Grenzen des traditionellen Radiohörens und Fernsehens überwand und die Mediengeschichte neu schreibt. Er ist gefährdet, weil er umstrittener ist denn je. Die Kritik entzündet sich an manchem Missmanagement, am Rundfunkbeitrag und am Programm. Schon länger wurden eine vermeintlich einseitige gesellschaftspolitische Ausrichtung, mangelnder Reformwillen und eine lückenhafte Gremienaufsicht sowie eine Überdehnung des öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrags beklagt. Keiner dieser Kritikpunkte ist neu, und die Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben selbst ihre eigene, lange Geschichte. Neu hingegen ist, dass der Rundfunk seine Gemeinnützigkeit immer weniger verständlich machen kann. Machte man ihm früher zum Vorwurf, er dominiere die öffentliche Meinungsbildung über die Maßen, so scheint die derzeitige Legitimationskrise in seinem Bedeutungsverlust zu liegen.
Einer der besten Kenner der deutschen Rundfunkgeschichte, Konrad Dussel, spricht inzwischen vom «Zerfall des traditionellen Rundfunks».[3] Der Kommunikationswissenschaftler Otfried Jarren meint, der gemeinnützige Rundfunk habe seine institutionelle Grundlage verloren, weil die digitale Transformation grundsätzlich anders funktioniere als der industrielle Transformationsprozess, mit dem er einst groß geworden sei.[4] Dieter Dörr, der wie kaum ein anderer den Rundfunk von innen und außen kennt, weil er sowohl Justiziar einer Landesrundfunkanstalt als auch Lehrstuhlinhaber für Medienrecht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz war, spricht von «dramatischen Veränderungen und teilweise disruptiven Prozessen», die sich in den letzten fünfundzwanzig Jahren im Medienbereich abgespielt hätten und weiter andauern würden.[5] Für den Hamburger Mediensenator Carsten Brosda lautet die entscheidende Frage deshalb: «Wie muss ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen, der im 21. Jahrhundert seine demokratische Aufgabe unter veränderten Mediennutzungsbedingungen erbringen kann?»[6]
Die historische Auseinandersetzung mit einer einzigartigen Institution, die die Bundesrepublik über Jahrzehnte geprägt hat und nunmehr in einer veritablen Bestandskrise steckt, scheint schon deswegen dringend geboten, weil sich nur so ihre Wandlungsfähigkeit verlässlich einschätzen lässt. Dies kann und soll hier weder im Stile einer umfassenden Gesamtdarstellung noch einer introvertierten Spezialgeschichte geschehen. Vielmehr werden wesentliche Kontinuitäten und Strukturbrüche, Optionen und Richtungsentscheidungen dargestellt, damit sich die Leserinnen und Leser ein eigenes sichereres Urteil über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des gemeinnützigen Rundfunks bilden können.
1. Nach Hitler: Die Anfänge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Abkehr von Volksempfänger und Propagandarundfunk: Die Firma Schaub-Lorenz präsentierte 1949 auf der Funkschau im Berliner Zoo ein neues Radio, das für einen neuen Rundfunk, ein neues Lebensgefühl und eine neue Verbindung von Frau und Technik steht.
«Derjenige, der seinen Stolz darin setzt, den Menschen das zu bieten, was sie seiner Ansicht nach wollen, verursacht oft eine fiktive Forderung nach einem niedrigeren Niveau, die er dann befriedigt.»
Lord Reith, erster Generaldirektor der BBC
Große Schwester BBC
Am 1. Mai 1945 um 22.26 Uhr verbreitete das Oberkommando der Wehrmacht über die dem Großdeutschen Rundfunk verbliebenen Sender, dass Adolf Hitler «bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist». Die Meldung führte die Hörer gleich zweifach in die Irre: Anders als behauptet, war Hitler schon am Vortag gestorben, und er war auch nicht im Kampf gefallen, sondern hatte die Waffe gegen sich selbst gerichtet, nachdem er zuvor seine Frau und sich selbst vergiftet hatte. Das Berliner Haus des Rundfunks ging in der Nacht zum 2. Mai mit dem theatralischen Satz «Der Führer ist tot, es lebe das Reich» von Sendung. Die Schlacht um Berlin war beendet, die Reichshauptstadt in den Händen der Roten Armee. Zwei Tage später meldete sich der von den Briten weitgehend intakt übernommene Hamburger Sender mit der Ansage: «This is Radio Hamburg, a Station of the Military Government.» Allein der Sender in Flensburg verblieb noch bis zum 13. Mai in den Händen der letzten NS-Regierung und damit sogar über den Tag der bedingungslosen Kapitulation hinaus. Als er verstummte, meldete sich aus einem von den Sowjets notdürftig hergerichteten Übertragungswagen wieder ein Sender aus Berlin.[1]
Damit gehörte der Rundfunk in Deutschland den siegreichen Alliierten, die die Sendeanlagen wieder herstellten und zunächst als Militärsender betrieben. Ursprüngliche Pläne, nach dem Krieg von Königs Wusterhausen aus Deutschland mit einem zentralen Programm der vier Mächte zu versorgen, zerschlugen sich. Wie auch sollten die Wahlen in Großbritannien oder die Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in der Sozialistischen Sowjetrepublik Aserbaidschan unter einen redaktionellen Hut gebracht werden? Eine Aufteilung der Sendezeiten unter den Alliierten war ebenso wenig denkbar. Aber es gab nicht nur praktische Probleme, die gegen einen inter-alliierten Sendebetrieb sprachen. Die Franzosen wollten sich ungern in ihre Zone hineinfunken lassen, und auch die Briten und Amerikaner wussten die Hoheit über den Rundfunk in ihren Zonen bald zu schätzen, von den Sowjets ganz zu schweigen. Einig war man sich darin, den Deutschen sämtliche Rundfunkaktivitäten bis auf Weiteres zu untersagen, sie aber zur Unterstützung des von den Besatzungsoffizieren kontrollierten Sendebetriebs einzusetzen und ihnen erst daraufhin den Betrieb von Rundfunkanstalten unter engmaschiger Überwachung und unter vorläufiger Beibehaltung der alliierten Funkhoheit wieder zu gestatten.[2] Das ging manchmal schneller als erwartet. Radio Frankfurt zum Beispiel brachte auf seiner Mittelwelle ab dem 1. Juli 1945 die Umschau zwischen Rhein und Main sowie der benachbarten Gebiete, eine aktuelle Nachrichtensendung – die erste, die eine deutsche Redaktion kaum drei Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation wieder herstellte.[3]
Die einzige Institution des deutschen Rundfunkwesens, die unbeirrt weiterarbeitete, war die Postbehörde. Sie tat das, was sie seit jeher getan hatte: Sie pflegte die Leitungswege der Sender, trieb Rundfunkgebühren ein und zahlte die Gehälter an die bei den Sendeanlagen angestellten Mitarbeiter aus. Schon in der Weimarer Republik hatte das lukrativste Geschäft der Reichspost nicht im Verkauf von Briefmarken bestanden, sondern im Einzug der Rundfunkgebühren. Obwohl die Lizenzgebühr mit zwei Mark pro Monat stabil blieb, verschaffte sie dem Reichspostministerium eine sprudelnde Einnahmequelle, weil die Zahl der Radiobesitzer stark anstieg (nämlich von 550.000 im Jahre 1924 auf über vier Millionen acht Jahre später), und weil es der Postbehörde gelang, den Selbstbehalt von rund 40 Prozent auf über 50 Prozent zu steigern.[4]
Den Westalliierten wurde rasch klar, dass sich der Rundfunk auch weiterhin viel effektiver über eine an der Wohnungstür vom Postboten kassierte Gebühr unterhalten ließ als über stotternde Steuereinnahmen oder schwankende Werbeerlöse. Das Verfahren war eingeübt und wurde allseits akzeptiert. Die Alliierten mussten nur darauf achten, dass die überschüssigen Einnahmen nicht im deutschen Staatshaushalt verschwanden und der Rundfunk über eine nationale Postbehörde nicht wieder in die Hände einer deutschen Regierung gelangte. Deswegen verblieb nur der Gebühreneinzug bei der Post, Technik und Anlagen musste sie entschädigungslos an die einzelnen Sender abgeben. Aber wenn nicht mehr dem deutschen Staat, wem sollte der Rundfunk in Deutschland dann gehören? Mit dieser Frage kam die BBC ins Spiel.
Eine Übertragung der Organisation des britischen Rundfunks auf Deutschland lag aus zwei Gründen nahe: Erstens bot eine solche Organisationsform die beste Gewähr dafür, einen von der Regierung gesteuerten Rundfunk zu unterbinden, und zweitens stand die BBC der deutschen Rundfunktradition viel näher als alle anderen staatsfernen Modelle.
Die British Broadcasting Company Ltd. war 1922 von privaten Geräteherstellern gegründet worden, die über die Verbreitung eines attraktiven Radioprogramms den Absatz ihrer hochpreisigen Empfangsgeräte sicherstellen wollten. Wie in Deutschland verstand man auch im Vereinigten Königreich die Übertragung von Rundfunksendungen ähnlich dem Überbringen von Sendungen auf dem Postweg. Weil die Nachrichtenbeförderung der Allgemeinheit diente, wurde sie als staatliche Aufgabe verstanden, die entweder vom Staat selbst erledigt wurde oder für die der Staat eine private Gesellschaft beauftragte. Die altehrwürdige Royal Mail war von Heinrich VIII. 1516 gegründet worden und diente nicht mehr nur der Nachrichtenübermittlung zwischen verschiedenen Regierungsstellen, sondern besorgte längst den gesamten Nachrichtenverkehr unter Privatpersonen und Unternehmen. Die Aufnahme eines nationalen Hörfunkbetriebs aber traute sie sich nicht zu. Im Einvernehmen mit der Regierung trat sie ihr Monopol im Bereich des Rundfunks komplett an eine eigens gegründete private Kapitalgesellschaft ab, die sich British Broadcasting Corporation nannte, um so die Entstehung einer instabilen und unübersichtlichen privaten Radiolandschaft wie in den USA von vornherein zu verhindern.
Genau wie im Deutschen Reich erhob im Vereinigten Königreich die Post eine Nutzungsgebühr für Radiogeräte und gab davon einen Teil an die BBC weiter. Außerdem kam ihr der Verkauf von Empfangsgeräten direkt zugute, und sie ließ sich einige ihrer Sendungen von privaten Verlegern sponsern. Dennoch scheiterte das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit. Wie sich herausstellte, konnten die Betriebskosten und der hohe Investitionsbedarf durch die Einnahmen keineswegs gedeckt werden. Der Geräteverkauf kam nicht in Schwung, weil sich die Hörer ihre Geräte lieber selbst preisgünstig zusammenbauten, das Gebührenaufkommen fiel enttäuschend gering aus und die Sponsorengelder tröpfelten mehr, als dass sie flossen.
Ohne die Initialen wechseln zu müssen, wurde zum Jahreswechsel 1926/27 aus der Company kurzerhand eine Corporation, die fortan aus allgemeinen Gebühren finanziert wurde. Selbst der gescheiterte Generaldirektor blieb im Amt und wurde, weil er nun einer öffentlichen Körperschaft im nationalen Dienst vorstand, in den Ritterstand erhoben. John Reith, der legendäre Gründungsvater und erste Generaldirektor der BBC, stammte aus einem einfachen Pfarrhaushalt, hatte aber während des Krieges beim Militär Karriere gemacht und war bei den Unterhauswahlen 1922 für die Tories angetreten. Von 1922 bis 1938 führte der bekennende Konservative die BBC. 1940 übernahm er unter Chamberlain sinnigerweise das Informationsministerium, wechselte im Kriegskabinett Churchills, der ihn nicht mochte, in das Verkehrsressort und wurde später Wohnungs- und Bauminister. Reiths beruflicher Lebenslauf changierte somit zwischen Staat, Politik und Rundfunk.
Überwacht und strategisch geführt wurde die neue BBC von einem Board of Governors, deren zwölf Mitglieder der König ernannte. Für die Ernennung griff er auf eine von der Regierung gefertigte Personenliste zurück, die Vorschläge aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen berücksichtigte. Das Board bestimmte den Generaldirektor und besetzte andere Führungspositionen, ging Beschwerden über die BBC nach und veröffentlichte einen Jahresbericht, der die Erfüllung ihrer strategischen Ziele beschrieb. Für das Programm und die Verwaltung war allein der Generaldirektor zuständig. Er war also in einer Person director-general und editor-in-chief.[5]
Die nunmehr auskömmliche Finanzierung aus allgemeinen Gebühren, die nicht-staatliche Organisationsform, die starke Position des Generaldirektors und die Überwachung durch ein unabhängiges Gremium verschafften der BBC eine besondere institutionelle Stellung in der europäischen Rundfunklandschaft. Es existierte (und existiert) allerdings noch ein anderes Konzept staatsfernen Rundfunks in Europa, und zwar in der Schweiz. Viele Deutsche lernten Radio Beromünster als letzten freien deutschsprachigen Sender in Europa kennen, der sich ungebrochener Beliebtheit erfreute, nachdem der NS-Staat ihn zum «Feindsender» erklärt hatte. Da er über starke Sendeanlagen verfügte, konnte er weit über Österreich und Süddeutschland hinaus empfangen werden. Nur die allerwenigsten Hörer dürften die spezielle Organisationsform des Schweizer Senders gekannt haben. Er gehörte der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft (SRG), einem Zusammenschluss von Vereinen und Genossenschaften, der von der Regierung die alleinige Konzession zur Veranstaltung von Rundfunk erhalten hatte und für diese Dienstleistung über allgemeine Gebühren finanziert wurde. Als Verein privatrechtlich organisiert, aber nach den Grundsätzen des Schweizer Aktienrechts geführt, bewegte sich die Governance der SRG seit jeher im Spannungsfeld von Vereins- und Aktienrecht. Wie die BBC kennt die SRG einen Generaldirektor, der die Geschäftsführung innehat und die Verantwortung für die Programme trägt. Bestellt und überwacht wurde (und wird) er von einem Verwaltungsrat, der von der Delegiertenversammlung der Vereine gewählt wird.[6] Aber die Schweiz hätte schon ihre Neutralität aufgeben, in den Krieg gegen das Deutsche Reich ziehen und Besatzungsmacht werden müssen, um die Alliierten und die Deutschen auf ihre Konstruktion aufmerksam zu machen. Und selbst dann hätten für ein solches Modell die historischen Erfahrungen und kulturellen Gegebenheiten gefehlt. Dass die Zivilgesellschaft das Rundfunkmonopol ausübt, ging in Deutschland über alle Vorstellung hinaus.
Der in den USA rein privat betriebene Rundfunk mit seiner Vielzahl von über das weite Land verstreuten kommerziellen Sendern konnte in den vom Krieg verarmten und zudem viel kleineren Staaten Europas nicht funktionieren. Dafür fehlten jegliche Voraussetzungen. Es mangelte an brauchbaren Frequenzen, an nennenswerten Werbeeinnahmen und – wie das Beispiel der BBC in den 1920er Jahren schon belegt hatte – vor allem an der Mobilisierung ausreichender privater Investitionen. Den Amerikanern war damit von Anfang an klar, dass sich ihr Modell nicht auf Deutschland übertragen ließ. Etwas anders lagen die Dinge für die französische Besatzungsmacht.
In Frankreich hatte es vor dem Krieg zwar auch private, vereinzelt von Amateurclubs betriebene Lokalradios gegeben, doch nach der Befreiung wurde ein rein staatliches Rundfunkwesen aufgebaut, das einem Ministerium in Paris unterstand.[7] Nach dem Führerstaat war den Franzosen allerdings nicht an einem neuerlichen Zentralstaat gelegen; stattdessen setzten sie auf eine föderale Lösung der deutschen Frage, und daraus ergab sich die Zustimmung zu einem föderalen, nicht-staatlichen Rundfunksystem. Und im besetzten Deutschland schien ein anderer als ein föderaler Aufbau des Rundfunks schon deshalb nicht möglich zu sein, weil dort nur die Länder bestanden.
Das in den westlichen Besatzungszonen in Angriff genommene, regional aufgebaute System aus öffentlichen, aber unabhängigen Rundfunkanstalten, die von einer Generaldirektion geführt, durch regierungsferne Aufsichtsgremien kontrolliert und von den Gebühren der Hörergemeinschaft finanziert wurden, entsprang somit keineswegs ausgefeilten alliierten Nachkriegsplanungen. Die meisten Zutaten für den neuen deutschen Rundfunk stammten zwar aus Großbritannien, doch die Zubereitung ergab sich gleichsam naturwüchsig.
Den Deutschen erschloss sich die Konstruktion des neuen Systems nicht auf Anhieb. Sie kannten zwar Unternehmen, deren Vorstände von einem Aufsichtsrat kontrolliert wurden, in dem die Vertreter der Anteilseigner und dann auch der Arbeitnehmer saßen. Doch wer waren die Anteilseigner einer weder privaten noch staatlichen Rundfunkanstalt? Wem sollte sie letztlich gehören, wenn nicht dem demokratischen Staat?
Mit solchen Zweifeln standen die Deutschen keineswegs allein. Auch die Amerikaner waren sich über die genaue Organisationsform eines zukünftigen deutschen Rundfunks nicht gleich im Klaren. Immerhin waren sie von Anfang an der Überzeugung, dass ein so mächtiges Instrument wie der Rundfunk nicht in eine einzige Hand gegeben werden durfte und schon gar nicht in die Hand einer deutschen Regierung (anders verhielt es sich, wenn sie selbst den Sender in der Hand behielten, wie in Berlin den RIAS). Genauer wussten sie hingegen die journalistischen Grundsätze zu formulieren, nach denen der deutsche Rundfunk in Zukunft funktionieren sollte. Die Information Control Division (ICD) des Office of Military Government for Germany (OMGUS) verabschiedete am 14. Mai 1946 den «Entwurf zu einer Erklärung über Rundfunkfreiheit in Deutschland», der als die «Zehn Gebote» für die Rundfunkpolitik der Länderregierungen unter amerikanischer Besatzung galt.[8] In der Präambel wurde der Rundfunk auf die Ziele der «Wahrheit, Toleranz, Gerechtigkeit, Freiheit und Achtung vor den Rechten der individuellen Persönlichkeit» verpflichtet. Er werde sich nicht – so heißt es dort weiter – «den Wünschen oder dem Verlangen irgend einer Partei, irgend eines Glaubens oder irgend eines Bekenntnisses unterordnen». Unabhängig sollte das deutsche Rundfunkwesen sein, aber keineswegs wertneutral, und auch nicht politikfern. Vielmehr sollten die Vertreter unterschiedlicher Standpunkte gleichgewichtig zu Wort kommen. An die Rundfunkanstalten erging die Mahnung, objektiv und wahrheitsgetreu zu berichten, zwischen Bericht und Kommentar zu unterscheiden, stets mehrere, freie und unabhängige Quellen zu benutzen und jegliche Werbung für eine Partei im Programm zu unterlassen. Der staatlichen Politik wurde aufgegeben, das Recht auf demokratisch gesinnte Kritik an Missständen, Regierungsstellen und Amtsträgern nicht nur hinzunehmen, sondern sogar zu sichern und dauerhaft zu gewährleisten. An seine Grenzen stieß das Recht auf freie Meinungsäußerung nur dann, wenn Sendungen Vorurteile oder Diskriminierungen von «Einzelpersonen und Gruppen … wegen ihrer Rasse, Religion oder Farbe verursachen könnten». Außerdem sollten keine Gedanken oder Begriffe verbreitet werden, die «in grober Weise gegen die moralischen Gefühle großer Teile der Zuhörerschaft verstoßen würden». Entwickelten die Amerikaner eher die Software für das deutsche Rundfunksystem, so konstruierten die Briten die Hardware. Vor allem wird man den Besatzungsoffizieren zugutehalten müssen, dass sie dabei journalistische Standards verlangten und rundfunkpolitische Ideale verfolgten, die sie in der Wirklichkeit ihrer Heimatländer nicht immer antrafen.
NWDR: Die Stimme des neuen Deutschland
Die Briten hatten schon bald in ihrer Zone eine zentrale Rundfunkanstalt in Hamburg eingerichtet, deren Sendegebiet die späteren Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie die Britische Zone in Berlin umfasste. Die Wahl der Hansestadt zum Sitz des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) war dem Umstand geschuldet, dass das dortige Sendegebäude unzerstört übernommen werden konnte. Bremen schied schon 1947 aus dem Sendeverbund aus, weil die Briten die Stadt an die Amerikaner abtraten, die über den Hafen ihre Truppen versorgten. Mit der Verordnung Nr. 118 legalisierten die britischen Besatzer den NWDR zum 1. Januar 1948, um ihn von da an Schritt für Schritt an die Deutschen zu übergeben.[9] Bis zu diesem Stichtag befand sich der Sender im Besitz der Besatzungsmacht. Sie stellte das Personal ein und kontrollierte das Programm. Doch gewährten die Besatzer den Redakteuren einen ungeahnt großzügigen redaktionellen Spielraum, was gleich engagierte Programmmacher anzog, die ihn zu nutzen wussten. Ab dem 1. Januar 1948 bezeichnete sich der NWDR als «eine unabhängige Anstalt zur Verbreitung von Nachrichten und Darbietungen unterhaltender, bildender und belehrender Art». Rechtlich wurde er als eine «Anstalt des öffentlichen Rechts» geführt, die sich selbst verwaltet, und zwar nach den Regeln einer Satzung, die sie selbst erlassen konnte und somit quasi Gesetzeskraft besaß. Die Briten wollten anfangs nichts dem Zufall überlassen und gaben der Verordnung eine von ihnen entworfene Satzung als Anlage bei. An die Spitze der Anstalt stellten sie wie bisher einen Generaldirektor, der aber nun von einem Verwaltungsrat beaufsichtigt wurde. Die Ernennung des ersten deutschen Generaldirektors sowie die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates bedurften der Zustimmung der Militärregierung.
Die Lizenzierung der deutschen Presse durch die Alliierten ging ungleich rascher vonstatten als der Aufbau des Rundfunks. Ob Presse oder Rundfunk – in beiden Fällen sollte sichergestellt werden, dass die für die Reeducation der Deutschen so wichtigen Massenmedien in die richtigen Hände gerieten und dort auch verblieben. Wie der Rundfunk blieb auch die Presse nach der Lizenzvergabe vorerst unter alliierter Aufsicht. Der entscheidende Unterschied, den die Briten zwischen den beiden Medien machten, lag darin, die Lizenzen für die Zeitungen nach Parteifarben zu vergeben, wobei sich die Verteilung am Ergebnis der letzten freien Wahl in Deutschland orientierte. Ein solcher Mechanismus konnte in einem Zeitungsmarkt sofort Meinungsvielfalt und Staatsunabhängigkeit herstellen, nicht jedoch in einem Rundfunksystem, das nur einen einzigen Anbieter besaß. Deswegen kostete die Übergabe des NWDR in die deutsche Verantwortung mehr Zeit.[10]
Der Mann, der hinter dem Aufbau des NWDR stand, war ein Berufsoffizier der britischen Armee. Major-General Sir Alexander Bishop hatte im Krieg in Afrika gedient, bevor er aufgrund seiner organisatorischen Fähigkeiten 1944 Quartiermeister im Kriegsministerium geworden war. Direkt nach dem Ende des Krieges wurde er als Chef der Informationsabteilung der Militärregierung nach Deutschland geschickt und noch zum Jahresende beauftragt, die Medienlandschaft in der Britischen Zone neu zu ordnen. Der General verstand rasch, dass der Rundfunk nur von jemandem erfolgreich aufgebaut und geführt werden konnte, der in den deutschen Verhältnissen ebenso bewandert war wie im europäischen Presse- und Rundfunkwesen. Deswegen wandte sich der General an den amtierenden Generaldirektor der BBC, Sir William Haley, und bat ihn um eine Empfehlung. Haley stieß auf den Nachrichtenchef des deutschsprachigen Programms, Hugh Greene, der gerade nach einer neuen Aufgabe suchte. Greene hatte vor dem Krieg einen Studienaufenthalt in Marburg absolviert und war danach Zeitungskorrespondent in München, Berlin, Wien, Paris, Prag und Warschau gewesen. Im Oktober 1946 landete er wieder in Deutschland und wurde zur prägenden Gestalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Westdeutschland. Greenes Credo lautete: Wie die BBC sollte der NWDR keine eigene politische Agenda verfolgen. Denn öffentlich-rechtliche Sender hätten keine Meinung zu haben, aber die Aufgabe, anderen die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern, so dass sich jeder sein eigenes Urteil bilden könne.[11]
Die Verordnung Nr. 118, die «Magna Charta» (Hans Bausch) des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, stammte aus seiner Feder, und er setzte alles daran, sie in kürzester Zeit umzusetzen. In einem Brief an seine Mutter beschrieb der 34-Jährige seine Position so: «Man ist in der Lage, das Leben von mehr als 1000 Leuten zu bestimmen, indem man etwas unterschreibt oder nicht unterschreibt. Das Leben selbst ist eine seltsame Mischung von Luxus und Unbequemlichkeit. Ich habe ein Büro, das Göring grün von Neid gemacht hätte, einen Wagen von der Größe einer Lokomotive, der einem SS-General gehörte, und einen sehr großen, gemütlichen Raum in der Messe mit Blick auf die Alster und eigenem Badezimmer. Aber es gibt nur einmal in der Woche heißes Wasser, bisher keine Heizung und nur die Erwartung einer Art Halb-Heizung während des Winters.»[12]
Auf seiner ersten Belegschaftsversammlung in Hamburg betonte Greene, er sei nur hier, um sich wieder überflüssig zu machen. Denn der Sender solle nicht die Stimme des Eroberers sein, sondern die Stimme des neuen Deutschlands werden. Um diesen Worten Nachdruck zu verliehen, baute er das britische Personal bis auf einen kleinen Stamm von Offizieren sogleich ab.[13]
In Programmfragen hielt sich Greene im Hintergrund und vertraute den von ihm größtenteils übernommenen Programmmachern, allen voran dem Leiter der Abteilung Talks and Features, Peter von Zahn, und dem Redakteur aus dem Bereich Wort, dem Schriftsteller und Kritiker Axel Eggebrecht, der bis 1925 der KPD angehört und sich im «Dritten Reich» mit Drehbüchern für Unterhaltungsfilme über Wasser gehalten hatte. Wenn sie wegen ihrer kritischen Sendungen von außen angegriffen wurden, deckte er sie, eine Haltung, die sich natürlich herumsprach.[14]
Senderinterne Querelen ergaben sich dennoch zuhauf. Es kam zu Abmahnungen, Versetzungen und Entlassungen. Nahezu jede Verfehlung wurde (partei)politisch interpretiert oder instrumentalisiert. Die Fronten verliefen häufig zwischen Remigranten und Dagebliebenen, zwischen jüngeren Journalisten und erfahrenen Redakteuren, zwischen lauten Mitarbeitern mit kritischem Anspruch und verschwiegenen Mitarbeitern, die schon im Großdeutschen Rundfunk stillgehalten hatten. 1947 warf der Kalte Krieg seinen Schatten über den NWDR, und die Auswirkungen trafen vor allem Kommunisten, die zunächst als «unbelastet» eingestuft worden waren und in verantwortlichen Positionen saßen. Der prominenteste unter ihnen war der Kölner Intendant Max Burghardt, der im Februar 1947 infolge zahlloser öffentlicher Attacken der CDU von seinem Amt zurücktreten musste und in die sowjetische Zone wechselte. In der DDR brachte es der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus zum Intendanten der Deutschen Staatsoper, Präsidenten des Kulturbundes und Mitglied des Zentralkomitees der SED.[15]
Der Mann, über den Burghardt gestolpert war, hieß Karl-Eduard von Schnitzler, der als Ressortleiter Politik im Kölner Funkhaus eine recht effektive kommunistische Seilschaft aufgebaut hatte. Die Briten hielten an Schnitzler dennoch lange fest, wohl weil er von ihnen als Kriegsgefangener bei der BBC eine Ausbildung erfahren hatte. Von Köln nach Hamburg versetzt, nahm ihn Greene unter seine Fittiche, konnte dessen politisches Eifertum aber nicht bremsen, so dass er ihn doch noch rauswarf. Schnitzler ging daraufhin zum Berliner Rundfunk nach Ostberlin, wurde in den 1950er Jahren Chefkommentator im DDR-Fernsehen und moderierte seit 1960 den berühmt-berüchtigten Schwarzen Kanal, über den er den faschistoiden Charakter des westdeutschen Staates jeden Montagabend aufs Neue entlarven wollte.[16]
Im Oktober 1946 hatte Hugh Greene in einer weiteren Ansprache, dieses Mal vor den Mitarbeitern des Funkhauses in Köln, umrissen, wie er sich die weitere Zukunft des NWDR vorstellte. «Dieser Sender», so Greene, «darf niemals ein Parteisender werden oder ein Regierungssender oder das Sprachrohr kommerzieller Interessen. Wenn ich die Politik eines solchen Senders in zwei Worten zusammenfassen kann, dann sind es Sachlichkeit und Objektivität auf allen Gebieten. Und das bedeutet nicht, dass man langweilig zu sein braucht.»[17]
Bei Greene selbst kam schon deswegen keine Langeweile auf, weil er sich neben nicht abreißenden internen Querelen zunehmend mit Unmut von außen auseinandersetzen musste. Bei zahlreichen Gesprächspartnern traf er auf ein tradiertes Verständnis von Rundfunk, das diesen als staatlichen Diener der politischen Demokratie betrachtete, ihn sich aber nicht als unabhängiges Element in einer demokratischen Gemeinschaft vorstellen konnte. Besonders deutlich wurde diese grundlegende Meinungsverschiedenheit in den informellen Verhandlungen, die Greene mit dem Rundfunkbeirat des britischen Zonenbeirats über das Statut des NWDR führte. Dem Beirat gehörten Politiker an, die bereits in der Weimarer Republik aktiv gewesen waren und die für die Gründung der Bundesrepublik Deutschland noch eine größere Rolle spielen sollten. Parteiübergreifend betrachtete die deutsche Seite den Aufbau einer unabhängigen Instanz, die im direkten Kontakt mit der Bevölkerung stand, als geradezu demokratiegefährdend.
Zum einen wollte den deutschen Abgeordneten nicht einleuchten, warum eine Einrichtung, die über Einnahmen aus allgemeinen Gebühren verfügte, sich anders als jede Regierung keinen Haushalt vom Parlament genehmigen lassen und keinerlei öffentliche Rechenschaft über die Verwendung ihrer Mittel ablegen musste. Zum anderen betrachteten die Politiker den Aufbau einer gleichsam neutralen Instanz als Versuch, einen – wie es der FDP-Politiker Hermann Schäfer nannte – «Staat im Staate» aufzubauen. Bis 1932 hingegen hatte der Rundfunk der politischen Kontrolle verfassungsgemäßer Regierungen unterstanden und sich geradezu als ein Instrument wehrhafter Demokratie erwiesen, weil er weder Hitler noch einem anderen Nationalsozialsten oder Kommunisten auch nur eine Minute Sendezeit eingeräumt hatte. Nicht zuletzt misstrauten die deutschen Politiker dem eigenen Volk, wie gebrannte Kinder das Feuer scheuen. Denn Hitler hatte sich, um an die Macht zu kommen, auf die Unterstützung willfähriger Funktionseliten ebenso verlassen können wie auf seine wachsende Popularität im Volk. Die Nachkriegspolitiker empfanden jedwede Kritik an ihrer Arbeit oder den entstehenden Institutionen der zweiten Demokratie als zersetzend, schien sie doch den alten Feinden der Demokratie in die Hände zu spielen. Statt verantwortungslos zu kritisieren und zu bemängeln, sollte der Rundfunk einen viel wertvolleren volkspädagogischen Auftrag erfüllen, nämlich die Parteien, Parlamente und Regierungen in ihrer Aufbauarbeit positiv begleiten und in ihrer mühseligen demokratischen Erziehungsarbeit unterstützen.
Dem Selbstverständnis der deutschen Politiker zufolge gehörte der Rundfunk, wenn er denn echte demokratische Wirkung entfalten sollte, dem demokratischen Staat und den politischen Parteien, die diesen trugen, keineswegs aber irgendwelchen angestellten Mitarbeitern und auch nicht länger den Kontrolloffizieren der Besatzungsmächte. Im Selbstverständnis der Briten gehörte der Rundfunk, wenn er denn echte demokratische Wirkung entfalten sollte, der Zivilgesellschaft und denjenigen, die diese trugen, den Kirchen, Verbänden, Organisationen, darunter auch den Parteien, aber keineswegs den Regierungen und deren politischen Hilfsarbeitern.
Greene war jedoch keineswegs blauäugig und durchaus zu Kompromissen bereit, schon um den Deutschen eine selbstverwaltete Rundfunkanstalt schmackhaft zu machen, aber auch, weil er selbst nur allzu gut wusste, dass die BBC kein Leben abgeschirmt von der großen Politik führte.
Greenes Organisationsmodell sah analog zu dem der BBC drei Anstaltsorgane vor: die Intendanz, die von einem Verwaltungsrat kontrolliert wurde, und einen Hauptausschuss, der den Verwaltungsrat wählte. Der Verwaltungsrat entsprach in etwa dem Board of Governors, der Hauptausschuss (später: Rundfunkrat) dem Geheimen Kronrat. Auf dem Reißbrett sah dies gut aus, doch in der Wirklichkeit lagen die Dinge etwas anders. So wie der König keineswegs frei war in der Berufung des Kronrats oder der Besetzung des Boards, weil ihm die Regierung die Vorgaben lieferte, konnte auch die Besetzung des Hauptausschusses und die anschließende Wahl des Verwaltungsrats nicht ohne politische Einwirkungen geschehen, und an denen war nolens volens die Regierungsmehrheit nicht unwesentlich beteiligt.
Es ist interessant, dass Greene solche Zusammenhänge vor einem deutschen Publikum niemals offen ansprach. In einem Festvortrag anlässlich des 35. Geburtstags der National Broadcasting Company (NBC) in New York räumte er dagegen freimütig ein, dass das britische Board of Governors «auf einer Sitzung des Geheimen Rats ernannt (werde), also in Wahrheit von der jeweils im Amt befindlichen Regierung».[18] Dennoch ist dieser Vorgang nicht mit der Ernennung eines Kabinetts, der Besetzung einer Regierungskommission oder der Wahl eines Parlamentsausschusses zu verwechseln. Die Ernennungsprozedur vollzog sich diskret, sie war ein für die Öffentlichkeit intransparenter Vorgang, der dem politischen Tageskampf entzogen war, und die Regierung überprüfte ihre Personalvorschläge dahingehend, ob sie vor dem Monarchen Bestand haben würden. Der Eindruck, das Board sollte in irgendeine Richtung einseitig oder durchgängig regierungstreu besetzt werden, durfte von vornherein nicht entstehen, und deswegen boten sich für die Besetzung integre Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, die zusammen für eine gewisse Ausgewogenheit standen.





























