
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Hartmann, Rachel: Serafina
- Sprache: Deutsch
Kann EIN Mädchen ZWEI Welten vereinen?
Die Drachen könnten die Menschen vernichten. Doch sie sind zu fasziniert von ihnen. Dies ist die Basis des fragilen Friedens zwischen beiden Völkern, die jäh brüchig wird, als der Thronanwärter ihres gemeinsamen Königreichs brutal ermordet wird – auf Drachenart. Die junge Serafina hat guten Grund, beide Parteien zu fürchten. Hütet doch das erst seit kurzem am Hofe lebende Mädchen selbst ein Geheimnis. Als sie in die Mordermittlungen verwickelt wird, kommt der scharfsinnige junge Hauptmann der Garde, Lucian Kiggs, ihm gefährlich nahe und droht, ihre Verstrickung mit der Welt der Drachen zu enthüllen und ihr ganzes Leben auf immer zu zerstören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Rachel Hartman
Aus dem Amerikanischen von Petra Koob-Pawis
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2012 der deutschsprachigen Ausgabe cbj, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2012 Rachel Hartman
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel:
»Seraphina« bei Random House Children’s Books,
einem Imprint von Random House, Inc., New York
Übersetzung: Petra Koob-Pawis
Umschlagillustration: Jacopo Bruno
Umschlaggestaltung: init. Büro für Gestaltung, Bielefeld
MP · Herstellung: hag
Satz und Reproduktion: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06839-4V003
www.cbj-verlag.de
www.serafina-buch.de
In memoriam: Michael McMechanDrache, Lehrer, Freund
R. H.
Prolog
Ich erinnere mich an meine Geburt.
Ich erinnere mich sogar an die Zeit davor. Es war dunkel, aber um mich herum war Musik: das Pling-Pling der Gelenke, das Schu-Schu des Blutes, das Poch-Poch des Herzens lullte mich ein, begleitet vom Gluck-Gluck des Magens. Die Klänge umhüllten mich und ich war geborgen.
Dann brach die Welt auf und ich wurde in eine kalte und stille Helligkeit gedrängt.
Ich wollte diese Leere mit meinen Schreien füllen, doch sie erstreckte sich zu weit. Ich wehrte mich, aber es gab kein Zurück mehr.
Sonst weiß ich von nichts; ich war ein Baby, wenn auch ein besonderes.
Blut und Panik waren mir einerlei. Weder erinnere ich mich an die entsetzte Hebamme noch an meinen weinenden Vater und ebenso wenig an den Priester, der für die Seele meiner Mutter betete.
Meine Mutter hinterließ mir ein kompliziertes und beschwerliches Erbe. Aber die entsetzlichen Einzelheiten verbarg mein Vater vor allen Menschen, selbst vor mir. Wir zogen nach Lavondaville, der Hauptstadt von Goredd, und dort nahm er wieder seine Arbeit als Rechtsanwalt auf. Er ersann sich eine annehmbare tote Ehefrau, ein nettes Mädchen aus der Provinz namens Amaline Ducanahan. Ich glaubte an sie, so wie manche Menschen an den Himmel glauben.
Zudem versah er mich mit einer Stiefmutter, Anne-Marie, und vier jüngeren Geschwistern, sodass ich umringt von solch geballter Normalität nicht weiter auffiel.
Ich war ein heikles Kind und wollte partout nicht trinken, wenn die Amme beim Singen nicht genau den richtigen Ton traf. »Es hat ein sehr feines Gehör«, stellte Orma fest, ein groß gewachsener, hagerer Bekannter meines Vaters, der uns in jener Zeit oft besuchte. Orma nannte mich immer »es«, als wäre ich ein kleines Hündchen. Seine abweisende Art zog mich an, auf die gleiche Art wie Katzen bevorzugt um die Beine jener streichen, die ihnen eigentlich aus dem Weg gehen wollen.
Eines Morgens im Frühling begleitete er uns in die Kathedrale, wo der junge Priester mein zartes Haar mit Lavendelöl salbte und mir erklärte, dass ich in den Augen des Himmels nun eine Königin sei. Ich brabbelte wie jedes kleine Kind, das etwas auf sich hält, mein Geschrei hallte durchs ganze Kirchenschiff. Mein Vater machte sich nicht die Mühe näher zu treten oder von seinen Schriftstücken aufzublicken, als er versprach, mich fromm und im Glauben an alle Heiligen zu erziehen. Der Priester reichte mir den Psalter und ich ließ ihn prompt fallen. Er blieb aufgeschlagen liegen, zuoberst die Seite mit dem Bild der Heiligen Yirtrudis, deren Gesicht geschwärzt war.
Der Priester küsste hastig seine Hand, den kleinen Finger abwehrend gespreizt. »Euer Psalter enthält immer noch das Bild dieser Abtrünnigen!«
»Der Psalter ist sehr alt«, erwiderte Papa, ohne aufzublicken. »Und ich hasse es, wenn man Seiten aus Büchern reißt.«
»Den Bücherliebhabern empfehlen wir, die entsprechenden Seiten mit dem Bildnis der Yirtrudis zusammenzukleben, damit solche Versehen nicht mehr vorkommen können.« Der Priester schlug die Seite um. »Der Himmel meinte sicherlich die Heilige Capiti.«
Mein Vater murmelte etwas über abergläubischen Hokuspokus, gerade laut genug, dass der Priester es hören konnte. Was folgte, war ein wütender Streit zwischen meinem Vater und dem Priester, aber daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Meine Aufmerksamkeit wurde gebannt durch eine Mönchsprozession, die durch das Kirchenschiff schritt. Sie trotteten in weichen Schuhen daher wie eine große Welle aus dunklen, raschelnden Roben, mit klappernden Perlen und nahmen im Chorraum Platz. Sitze knarrten und quietschten, ein paar Mönche husteten.
Dann fingen sie an zu singen.
Die Kathedrale vibrierte förmlich von dem Gesang der Männer, und es kam mir vor, als würde sie sich vor meinen Augen immer weiter ausdehnen. Die Sonnenstrahlen fielen durch die hohen Fenster und ließen den Marmorboden golden und purpur aufleuchten. Die Musik drang in meinen kleinen Leib, erfüllte und umschloss mich, machte mich größer, als ich in Wirklichkeit war. Sie war die Antwort auf eine Frage, die ich nie gestellt hatte, wie nämlich die entsetzliche Leere, in die ich hineingeboren wurde, je ausgefüllt werden sollte. Ich glaubte, nein, ich wusste, dass ich die Weite überwinden und die Wölbung der Decke mit der bloßen Hand erreichen konnte.
Also versuchte ich es.
Meine Amme kreischte, als ich mich aus ihren Armen zu winden versuchte. Erschrocken bekam sie gerade noch mein Fußgelenk zu packen. Ich starrte benommen auf den Boden, der schwankte und wackelte.
Dann nahm mich mein Vater, legte seine großen Hände um meinen dicken, kleinen Leib und hielt mich auf Armeslänge von sich, als würde er einen seltenen Frosch betrachten. Ich blickte in seine meergrünen Augen mit den Trauerfalten.
Wortlos eilte der Priester auf und davon, ohne mich gesegnet zu haben. Orma sah ihm nach, wie er hinter dem Goldenen Haus verschwand, dann sagte er: »Claude, erkläre mir das. Ist er jetzt gegangen, weil du ihn davon überzeugt hast, dass seine Religion Schwindel ist? Oder war er … wie sagt man … beleidigt?«
Mein Vater überhörte die Frage, etwas an mir nahm seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. »Sieh dir ihre Augen an. Ich könnte schwören, sie versteht uns.«
»Für ein Kind hat es einen sehr klaren Blick«, sagte Orma. Er setzte seine Brille auf und beugte sich zu mir herab, sodass er mich auf gleicher Höhe begutachten konnte. Er hatte dunkelbraune Augen, wie ich auch, aber anders als meine waren seine Augen kühl und unergründlich wie der Nachthimmel.
»Ich war dieser Aufgabe nicht gewachsen, Serafina«, sagte Papa ungewohnt zärtlich. »Vielleicht werde ich ihr auch nie gewachsen sein, aber ich glaube, dass ich es besser kann. Wir müssen eine Möglichkeit finden, einander eine Familie zu sein.«
Er küsste den Flaum auf meinem Kopf. Das hatte er noch nie getan. Erstaunt sah ich ihn an. Die klaren Stimmen der Mönche hüllten uns ein und hielten uns drei zusammen. Für einen kurzen, wunderbaren Augenblick verspürte ich wieder das Gefühl, das mit meiner Geburt verloren gegangen war: Alles war so, wie es sein sollte, und ich war genau dort, wo ich hingehörte.
Dann war der Moment auch schon vorbei. Wir schritten durch das bronzebeschlagene Kirchenportal und ließen die Musik hinter uns. Orma ging quer über den Vorplatz der Kathedrale davon, ohne sich zu verabschieden, sein Umhang flatterte wie die Flügel eines riesigen Fledermausjungen. Papa gab mich wieder der Amme, schlang den Mantel fest um sich und stemmte sich gegen den böigen Wind. Ich weinte ihm nach, aber er wandte sich nicht einmal um. Über uns wölbte sich der Himmel, leer und sehr weit entfernt.
Abergläubischer Hokuspokus oder nicht – was uns der Psalter sagen wollte, war klar: Die Wahrheit darf man nicht aussprechen. Hier ist eine akzeptable Notlüge.
Dabei war die Heilige Capiti – möge sie mich in ihrem Herzen bewahren – alles andere als ein armseliger Ersatz. Im Gegenteil, sie war eine vortreffliche Heilige. Sie trug ihren eigenen Kopf auf einer Schale vor sich her wie eine gebratene Gans und starrte einen von der Buchseite geradezu herausfordernd an. Sie verkörperte den Geist und damit die größtmögliche Trennung von den elenden Alltäglichkeiten des Leibes.
Je älter ich wurde und je mehr mich die Albernheiten des Körpers in Beschlag nahmen, desto größeren Gefallen fand ich an dem Bild, aber selbst in meinen jungen Jahren hatte ich stets eine tiefe Zuneigung für die Heilige Capiti verspürt. Wer liebte schon jemanden mit abgeschlagenem Kopf? Wie konnte sie in dieser Welt etwas Sinnvolles vollbringen, wenn sie doch ihre Hände dazu brauchte, die Schale zu halten? Gab es Menschen, die sie verstanden und die sie als ihre Freundin bezeichneten?
Papa erlaubte meiner Amme, die Seiten mit der Heiligen Yirtrudis zusammenzukleben, denn die arme Frau hatte keine ruhige Minute mehr, ehe dies nicht getan war. So konnte ich niemals wieder einen Blick auf die Häretikerin werfen. Wenn ich jetzt die Seite gegen das Licht hielt, sah ich zweierlei Umrisse, beide verschmolzen zu einer schrecklichen Monster-Heiligen. Die ausgestreckten Arme von Yirtrudis ragten der armen Capiti aus dem Rücken wie zwei nutzlose Flügel. Die Umrisse ihres Gesichts zeichneten sich dort ab, wo der Kopf der Heiligen Capiti hätte sein sollen. Sie war die doppelte Heilige meines Doppellebens.
Letztlich lockte mich meine Liebe zur Musik weg aus dem sicheren Hause meines Vaters in die Stadt und an den königlichen Hof. Ich nahm hierfür ein entsetzliches Wagnis auf mich, aber ich konnte nicht anders. Ich verstand noch nicht, dass ich die Einsamkeit in einer Schale vor mir hertrug und Musik das Licht war, das mich von hinten erleuchten würde.
Eins
Im Zentrum der Kathedrale stand ein Modell des Himmels, das Goldenes Haus genannt wurde. Sein Dach entfaltete sich wie eine Blüte um eine Höhlung in Menschenform, in der Prinz Rufus’ armer Körper lag, ganz in Gold und Weiß gekleidet. Seine Füße ruhten auf der Gesegneten Schwelle und sein Kopf lag in ein Nest aus vergoldeten Sternen gebettet.
Zumindest hätte er da liegen sollen. Prinz Rufus’ Mörder hatte ihn nämlich enthauptet. Die Wachleute hatten den Wald und das Sumpfland ergebnislos durchkämmt, aber das Haupt des Prinzen war unauffindbar geblieben. Deshalb musste man ihn ohne Kopf begraben.
Ich stand oben auf den Stufen des Chorraums und beobachtete die Trauerfeier. Der Bischof predigte von der Kanzel über dem Goldenen Haus zu der im vorderen Kirchenschiff versammelten königlichen Familie und den adligen Trauergästen. Hinter einer hölzernen Brüstung drängte sich das trauernde Volk in dem gigantischen Hauptschiff. Sobald der Bischof seine Gebete gesprochen hatte, würde ich die Anrufung des Heiligen Eustach spielen, der die Seele des Prinzen auf den Stufen zum Himmel geleiten sollte. Schwindel und Panik ergriffen mich, als hätte man mich gebeten, Flöte auf einer sturmumtosten Klippe zu spielen.
Tatsächlich hatte mich niemand gebeten zu spielen, ja ich stand nicht einmal auf dem Programm. Beim Abschied von zu Hause hatte ich Papa versprechen müssen, niemals in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich hatte die Anrufung schon ein-, zweimal gehört, aber sie noch nie zuvor gespielt. Nicht einmal die Flöte gehörte mir.
Der Solist meiner Wahl hatte jedoch sein Instrument zerbrochen, und mein Ersatzsolist musste in der vergangenen Nacht zu oft auf das Wohl von Prinz Rufus’ armer Seele anstoßen und spuckte sich jetzt im Klostergarten die eigene Seele aus dem Leib. Einen zweiten Ersatz hatte ich nicht. Ohne die Anrufung wäre die ganze Begräbnisfeier ruiniert. Ich war für die musikalische Gestaltung verantwortlich, also musste ich spielen.
Das Gebet des Bischofs zog sich hin; er schilderte die wunderbare himmlische Heimstatt, in der sämtliche Heiligen wohnten und in der wir alle dereinst in ewiger Glückseligkeit ruhen würden. Er verzichtete darauf, Ausnahmen zu erwähnen. Das war auch gar nicht nötig. Mein Blick huschte unwillkürlich über das Meer der weiß gekleideten Höflinge hinweg zu den Gesandten der Drachen und der Ehrenabordnung ihrer Botschaft. Sie waren in ihren Saarantrai – ihrer menschlichen Form –, aber man erkannte sie selbst aus dieser Entfernung mühelos an den Silberglöckchen, die sie an den Schultern trugen, sowie an dem Platz, der um sie herum leer geblieben war, und nicht zuletzt an ihrer Weigerung, während des Gebets den Kopf zu senken.
Drachen haben keine Seele. Keiner ging davon aus, dass sie fromm waren.
»Amen!«, sang der Bischof. Das war mein Einsatz. Doch genau in diesem Augenblick sah ich meinen Vater in der Menge stehen. Er war blass und wirkte angespannt. In meinen Gedanken hörte ich noch, was er an jenem Tag vor kaum zwei Wochen, als ich mich zum Hof aufgemacht hatte, gesagt hatte: Vermeide es, Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Wenn dir schon nichts an deiner eigenen Sicherheit liegt, dann bedenke wenigstens, was für mich auf dem Spiel steht!
Der Bischof räusperte sich, aber ich war wie zu Eis erstarrt und bekam kaum noch Luft.
Verzweifelt versuchte ich, mich auf etwas anderes zu konzentrieren.
Mein Blick blieb auf der königlichen Familie haften; drei Generationen waren versammelt und boten ein Bild des Kummers in Weiß und Gold. Königin Lavonda trug ihre schulterlangen grauen Locken offen, ihre blassen blauen Augen waren rotgeweint vor Trauer um ihren Sohn. Prinzessin Dionne saß aufrecht und blickte finster, als sinne sie auf Rache an den Mördern ihres jüngeren Bruders oder auch an Rufus selbst, weil er es nicht geschafft hatte, seinen vierzigsten Geburtstag zu erleben. Prinzessin Glisselda, Dionnes Tochter, hatte sich mit ihrem blonden Kopf an die Schulter ihrer Großmutter gelehnt, um sie zu trösten. Prinz Lucian Kiggs, Glisseldas Cousin und Verlobter, saß etwas abseits der Familie und starrte ins Leere. Er war kein Nachkomme von Prinz Rufus, sondern der uneheliche Sohn von Dionnes lange verstorbener Schwester, aber er wirkte so traurig und getroffen, als hätte er seinen eigenen Vater verloren.
Sie brauchten den Frieden des Himmels. Ich wusste wenig von den Heiligen, aber ich kannte mich mit Kummer aus und mit Musik, die der beste Balsam ist. Das war der Trost, den ich ihnen spenden konnte. Ich setzte die Flöte an die Lippen, richtete den Blick auf die verzierten Deckengewölbe und begann zu spielen.
Ich setzte leise an, da mir die Melodie nicht vertraut war, aber die Töne schienen mir zuzufliegen und mein Selbstvertrauen wuchs. Die Musik schwang sich auf wie eine Taube, die man in die Weite des Kirchenschiffs entlässt, die Mauern der Kathedrale verliehen ihr Fülle und gaben sie zurück, als ob dieses herrliche Gebäude ebenfalls ein Instrument wäre.
Es gibt Melodien, die so unmittelbar zu einem sprechen wie Worte und aus einer einzigen reinen Empfindung heraus entspringen. Eine solche Melodie ist auch die Anrufung. Ihr Komponist hatte damit die reine Essenz der Trauer einfangen wollen; es war, als riefe er uns zu: Das bedeutet es, jemanden zu verlieren.
Ich spielte die Anrufung zweimal und zögerte die letzte Note hinaus, weil ich fühlte, dass das Ende der Melodie ein weiterer, fühlbarer Verlust sein würde. Schließlich spielte ich den Schlusston, lauschte auf das verklingende Echo und sank erschöpft in mich zusammen. Der Würde des Augenblicks entsprechend klatschte niemand, allein die Stille war geradezu ohrenbetäubend. Mein Blick schweifte über die Gesichter, über den versammelten Adel und die anderen erlesenen Gäste bis hin zum gemeinen Volk, das sich hinter den Absperrungen drängte. Alle verharrten reglos, alle bis auf die Drachen, die unruhig auf ihren Sitzen hin und her rutschten, und Orma, der an einem Geländer lehnte und mir linkisch mit seinem Hut zuwinkte.
Zu erschöpft, um über diese Ungehörigkeit nachzudenken, verbeugte ich mich und zog mich hinter die Trennwand des Chorraums zurück.
Ich war die Gehilfin des Hofkomponisten; man hatte mich siebenundzwanzig anderen Bewerbern für dieses Amt vorgezogen, darunter wandernde Troubadoure wie auch berühmte Meister ihres Fachs. Es war eine Überraschung gewesen. Niemand am Konservatorium hatte mir, Ormas Schützling, Beachtung geschenkt. Orma war ein mittelmäßiger Lehrer der Musiktheorie, nicht einmal ein richtiger Musiker. Er spielte gut Cembalo – aber wenn man nur die richtigen Tasten anschlug, dann spielte sich das Instrument ja wie von selbst. Ihm fehlten sowohl Leidenschaft als auch Musikalität. Niemand hatte damit gerechnet, dass ausgerechnet einer seiner Studenten es jemals zu etwas Besonderem bringen würde.
Dass mich niemand kannte, war kein Wunder. Papa hatte mir näheren Umgang mit den anderen Studenten wie auch den Lehrern verboten. Zwar verstand ich seine Gründe, doch das änderte nichts an meiner Einsamkeit. Er hatte mir nicht ausdrücklich untersagt, mich für ein Amt zu bewerben, aber ich wusste ganz genau, dass es ihm missfallen würde. So machten wir es immer: Er steckte mir enge Grenzen und ich hielt mich an sie, bis ich es nicht länger aushielt. Und immer war es die Musik, die mich dazu brachte, etwas zu tun, was er als gefährlich ansah. Aber mit der Wucht seiner Wut, als er erfuhr, dass ich von zu Hause weggehen wollte, hatte selbst ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass sein Zorn nur seiner Sorge um mich entsprang, aber deswegen war er nicht leichter zu ertragen.
Jetzt arbeitete ich für Viridius, den Hofkomponisten, der bei schlechter Gesundheit war und einen Gehilfen brauchte. Der vierzigste Jahrestag des Vertrags, der zwischen Goredd und den Drachen geschlossen worden war, kam rasend schnell näher, und Ardmagar Comonot höchstpersönlich, der berühmte Drachengeneral, würde in zehn Tagen zu den Feierlichkeiten erscheinen. Viridius war für die Konzerte, Bälle und die anderen musikalischen Vergnügungen verantwortlich. Ich hatte ihn bei der Auswahl der Musikanten und der Organisation des Programms zu unterstützen. Daneben musste ich Prinzessin Glisselda Cembalo-Unterricht erteilen, weil dies für Viridius zu nervenaufreibend war.
Das alles hatte mich in den ersten beiden Wochen vollauf beschäftigt und das unerwartete Begräbnis hatte mir zusätzliche Arbeit aufgebürdet. Die Gicht hatte Viridius ans Bett gefesselt, weshalb ich für die gesamte musikalische Gestaltung allein verantwortlich war.
Der Leichnam von Prinz Rufus wurde in die Krypta gebracht, geleitet nur von der königlichen Familie, den Priestern und den wichtigsten Gästen. Der Chor der Kathedrale sang das Schlusslied und die Menge begann sich zu zerstreuen. Müde kehrte ich in die Apsis zurück. Ich hatte bisher nie vor mehr als ein, zwei Menschen gespielt und hatte nicht um die Angst zuvor und die Erschöpfung danach gewusst.
Bei den Heiligen im Himmel, es war, als stünde man nackt vor aller Welt.
Müde verließ ich den Chorraum, beglückwünschte meine Musiker und überwachte ihren Auszug aus der Kathedrale. Guntard, mein selbst ernannter Gehilfe, kam von hinten herangeschlurft und legte, sehr zu meinem Missfallen, seine Hand schwer auf meine Schulter. »Musikmamsell, das war mehr als wundervoll!«
Ich nickte dankend und entwand mich seinem Griff.
»Hier ist ein alter Mann, der dich sprechen will«, fuhr Guntard fort. »Er ist während deines Solos aufgetaucht, aber wir haben ihn abgewimmelt.« Er deutete auf die Heiligenkapelle in der Apsis, wo ein älterer Mann lehnte. Sein dunkler Teint verriet, dass er aus dem fernen Porphyrien stammte. Seine grauen Haare waren sorgsam zu Zöpfen geflochten und er lächelte.
»Wer ist das?«, fragte ich.
Guntard schüttelte verächtlich sein zu einem Topfschnitt gestutztes Haar. »Er hat eine Schar Pygegyria-Tänzer im Schlepptau und sich in die verrückte Vorstellung verrannt, wir wollten sie hier beim Begräbnis tanzen sehen.« Guntards Lippen verzogen sich zu jenem voreingenommenen wie neidischen Grinsen, das alle Leute aus Goredd aufsetzen, wenn sie über die dekadenten Fremdländer sprechen.
Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, einen Pygegyria-Tanz aufführen zu lassen. Wir in Goredd tanzen nicht bei Beerdigungen. Aber ich durfte Guntard sein überhebliches Grinsen nicht durchgehen lassen. »Pygegyria ist eine sehr alte und hochgeachtete Form des Tanzes.«
Guntard schnaubte. »Wörtlich übersetzt bedeutet es ›Arschwackeln‹!« Er blickte nervös zu den Heiligen in den Nischen, bemerkte, dass einige von ihnen die Stirn runzelten, und küsste ehrerbietig seine Handknöchel. »Egal, die Truppe ist im Kloster und quatscht die Mönche voll.«
Langsam bekam ich Kopfschmerzen. Ich drückte Guntard die Flöte in die Hand. »Gib sie bitte für mich zurück. Und schick diese Tänzer weg – aber höflich, bitte.«
»Du gehst schon?«, fragte Guntard. »Ein paar von uns machen noch einen Abstecher in den Albernen Affen.« Er legte seine Hand auf meinen linken Unterarm.
Ich zuckte zusammen, aber ich widerstand dem Drang, ihn wegzustoßen oder davonzulaufen. Stattdessen holte ich tief Luft, um mich zu beruhigen. »Danke, aber ich kann nicht.« Ich schob seine Hand weg und hoffte, ihn nicht zu kränken.
Seine Miene verriet, dass er sehr wohl beleidigt war, zumindest ein bisschen.
Es war nicht seine Schuld. Er nahm an, dass ich ein ganz normaler Mensch war, den man ungestraft am Arm fassen konnte. Hatte ich eben noch allen Ernstes gedacht, ich könnte bei meiner Arbeit Freunde gewinnen? Wie vermessen von mir. Ich würde meine Wachsamkeit nie gänzlich ruhen lassen können.
Ich ging Richtung Chorraum, um meinen Mantel zu holen; Guntard schlurfte davon, um zu tun, worum ich ihn gebeten hatte. Hinter mir rief der alte Mann: »Junge Dame, so wartet doch! Abdo ist weiten Weg gegangen, nur zu sprechen mit Euch!«
Ich blickte stur geradeaus, huschte die Treppe hinauf und aus seinem Blickfeld.
Die Mönche hatten das Schlusslied zu Ende gesungen und nun von Neuem begonnen, aber das Kirchenschiff war noch immer halb voll, kaum einer machte Anstalten zu gehen. Prinz Rufus war beliebt gewesen. Ich hatte ihn nur flüchtig gekannt, aber als Viridius mich ihm vorgestellt hatte, war er sehr freundlich gewesen und hatte mit funkelnden Augen zu mir gesprochen.
Nicht nur zu mir, zur halben Stadt hatte er mit funkelnden Augen gesprochen, wenn man den Bürgern Glauben schenkte; sie redeten mit gedämpfter Stimme über ihn und schüttelten dabei fassungslos den Kopf.
Rufus war auf der Jagd getötet worden, aber die Königliche Garde hatte keinerlei Hinweise auf den Mörder gefunden.
Für einige deutete der fehlende Kopf darauf hin, dass ein Drache der Täter gewesen war.
Ich vermutete, dass sämtliche Saarantrai, die soeben am Begräbnis teilgenommen hatten, sich dessen nur allzu bewusst waren.
Es dauerte nur noch zehn Tage bis zur Ankunft des Ardmagar und vierzehn Tage bis zum Jahrestag des Friedensschlusses. Falls tatsächlich ein Drache Prinz Rufus getötet haben sollte, dann hatte er sich einen ausgesprochen ungünstigen Zeitpunkt dafür ausgesucht. Was Drachen anging, waren die Bürger unserer Stadt ohnehin schon empfindlich und furchtsam genug.
Ich ging zum südlichen Seitenschiff, aber der Durchgang war wegen Bauarbeiten gesperrt.
Auf dem Boden stapelten sich Holzstreben und Eisenstützen und nahmen die Hälfte des Raums ein.
Ich durchquerte das Kirchenschiff hin zum großen Portal und rechnete jeden Augenblick damit, dass mich mein Vater hinter einer Säule abpasste.
»Danke!«, rief eine ältliche Hofdame, als ich an ihr vorüberging. Sie presste die Hände aufs Herz. »Nie hat mich etwas so tief bewegt.«
Ich verbeugte mich knapp, aber ihre offenkundige Begeisterung machte einige Höflinge in der Nähe auf mich aufmerksam.
»Hervorragend!«, hörte ich sie sagen und »Großartig!«. Ich nickte freundlich und versuchte zu lächeln, während ich den Händen auswich, die sich mir entgegenstreckten. Hastig bahnte ich mir einen Weg und mein Lächeln kam mir so steif und aufgesetzt vor wie das eines Saarantras. Ich zog vorsichtshalber die Mantelkapuze hoch, als ich an einer Gruppe von Bürgern in selbst gewebten weißen Tuniken vorbeikam.
»Ich habe mehr Menschen beerdigt, als ich zählen kann – mögen sie alle an der himmlischen Tafel sitzen«, rief ein alter Handwerksmann, der sich eine weiße Filzhaube auf den Kopf gestülpt hatte. »Aber heute habe ich zum ersten Mal die Stufen zum Himmel gesehen.«
»Ich habe noch nie jemanden so spielen hören. Glaubt ihr, dass sie eine Frau wie jede andere ist?«
»Vielleicht ist sie eine Ausländerin.« Sie lachten.
Ich schlang die Arme um mich und beschleunigte meine Schritte. Rasch küsste ich meine zum Himmel gewandten Knöchel, denn das macht man so, wenn man eine Kathedrale verlässt, selbst wenn man … jemand wie ich ist.
Ich trat hinaus in das fahle Licht des Nachmittags und atmete die kalte, frische Luft tief ein. Langsam wich meine Anspannung. Der Winterhimmel war strahlend blau; heimkehrende Trauergäste huschten in dem scharfen Wind hin und her wie Blätter.
Da bemerkte ich den Drachen, der auf den Stufen der Kathedrale auf mich wartete und nun lächelte, so gut ein Drache eben lächeln konnte. Niemandem auf der ganzen Welt hätte Ormas schiefer Gesichtsausdruck das Herz erwärmt – außer mir.
Zwei
Orma musste keine Glocke tragen, weil er ein Gelehrter war, deshalb ahnte praktisch niemand, dass er ein Drache war. Natürlich legte er deren Eigenheiten an den Tag: Er lachte nie, er verstand nichts von hübscher Kleidung, von gutem Benehmen oder Kunst; er hatte eine Vorliebe für höhere Mathematik und für Stoffe, die nicht kratzten. Ein anderer Saarantras hätte ihn am Geruch erkannt, aber nur sehr wenige Menschen hatten eine so gute Nase, dass sie den Saar eines Drachen wahrnahmen oder überhaupt wussten, wie er roch. Für die meisten Bewohner von Goredd war Orma ein Mann wie jeder andere: groß, schlank, bärtig und mit Brille.
Der Bart war allerdings falsch. Als kleines Kind hatte ich ihn einmal abgerissen. Männliche Saarantrai hatten keinen Bartwuchs. Das war eine der Besonderheiten, die ihnen blieb, wenn sie sich verwandelten, genauso wie ihr silberfarbenes Blut. Orma trug den Bart nicht zur Tarnung, ich glaube, er gefiel sich so einfach besser.
Er winkte mir mit seinem Hut, dabei war er auch so kaum zu übersehen. »Du spielst die Glissandi immer noch zu schnell, aber das Vibrato scheinst du inzwischen zu beherrschen«, sagte er, ohne sich lange mit einer Begrüßung aufzuhalten. Drachen verstehen nicht, wozu das gut sein soll.
»Ich freue mich auch, dich zu sehen«, sagte ich spitz, bedauerte jedoch sofort meinen Sarkasmus, auch wenn Orma ihn vermutlich gar nicht bemerkte. »Schön, dass es dir gefallen hat.«
Er blinzelte und legte den Kopf schief, so wie er es immer tat, wenn er ahnte, dass er etwas Entscheidendes übersehen hatte, aber nicht wusste, was es war. »Du findest, ich hätte zuerst einen Gruß sagen müssen?«, fragte er aufs Geratewohl.
Ich seufzte. »Ehrlich gesagt bin ich zu müde, um mich darüber zu ärgern, dass meine Spieltechnik nicht vollkommen war.«
»Das ist es, was ich wohl niemals verstehen werde«, sagte er und schlenkerte seinen Filzhut. Anscheinend hatte er vergessen, dass er zum Aufsetzen gedacht war. »Hättest du perfekt gespielt – so perfekt wie nur ein Saarantras es kann –, hättest du deine Zuhörer niemals so bewegt. Die Menschen haben geweint, und das nicht nur, weil du manchmal mitsummst, wenn du spielst.«
»Machst du Witze?«, fragte ich bestürzt.
»Nein, es hörte sich interessant an. Meistens war es harmonisch, mit Quarten und Quinten, aber hin und wieder bist du in eine dissonante Septime verfallen. Warum?«
»Ich war mir nicht bewusst, dass ich das tue.«
Orma blickte plötzlich nach unten. Ein kleines Gassenmädchen, das rührend aussah in seinem Trauermäntelchen, das wohl irgendwann einmal weiß gewesen war, zupfte eifrig am Saum von Ormas kurzem Umhang. »Ich locke Kinder an«, murmelte Orma und drehte dabei den Hut in den Händen. »Tu mir den Gefallen und verscheuch die Kleine.«
»Mein Herr?«, sagte das Mädchen. »Das ist für Euch.« Sie schmiegte ihre kleine Hand in die seine.
Ich sah etwas Goldenes blitzen. Wie seltsam. Eine Bettlerin, die Orma eine Münze schenkte?
Orma starrte auf den Gegenstand in seiner Hand. »Hast du auch eine Botschaft für mich?« Seine Stimme stockte, als er das sagte, und mir lief unwillkürlich ein Schauer über den Rücken. Kein Zweifel, er zeigte Gefühl. So etwas hatte ich noch nie bei ihm erlebt.
»Die Münze ist die Botschaft«, sagte das Mädchen, das die Worte wohl auswendig gelernt hatte.
Orma hob den Kopf und sah sich um. Er ließ den Blick vom großen Kirchenportal die Stufen hinab über den gut besuchten Platz zur Kathedralen-Brücke und dann den Fluss entlang schweifen. Ich sah mich ebenfalls um, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte, wonach wir suchten. Die untergehende Sonne funkelte über den Hausdächern; eine Menschenmenge lief auf der Brücke zusammen; die grellbunte Comonot-Uhr auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes zeigte nochzehn Tage an; kahle Bäume am Flussufer schwankten im Wind. Mehr war nicht zu sehen.
Ich blickte Orma fragend an, der nun wieder nach unten sah, als ob er etwas verloren hätte. Ich nahm an, dass er die Münze suchte, doch nein. »Wo ist sie hin?«, fragte er.
Das Mädchen war verschwunden.
»Was hat sie dir gegeben?«, fragte ich zurück.
Er antwortete nicht, sondern verstaute das Geldstück sorgfältig in seinem wollenen Trauerwams. Dabei erhaschte ich einen Blick auf das Seidenhemd, das er darunter trug.
»Schön«, brummte ich. »Dann sag es mir nicht.«
Er blickte mich erstaunt an. »Ich hatte nie die Absicht.«
Ich seufzte und versuchte, ihm nicht böse zu sein.
In diesem Moment brach ein Tumult auf der Kathedralen-Brücke aus. Ich schaute hinüber und mir stockte der Atem: Sechs Schläger, die sich schwarze Federn an die Kappen geheftet hatten – was sie als Söhne von Sankt Ogdo auswies –, hatten sich auf einer Seite der Brücke im Halbkreis um irgendeinen armen Kerl geschart. Der Lärm zog Menschen von allen Seiten an.
»Gehen wir in die Kathedrale, bis das vorüber ist«, sagte ich und wollte Orma am Ärmel packen, aber es war schon zu spät. Er hatte bemerkt, was vor sich ging, und eilte die Stufen hinunter auf den Pöbel zu.
Der Bursche, den sie gegen das Brückengeländer gedrängt hatten, war ein Drache. Ich konnte das Funkeln seiner Silberglocke sogar hier auf den Stufen von Sankt Gobnait sehen. Orma drängelte sich durch die Menge. Ich versuchte dicht hinter ihm zu bleiben, aber jemand versetzte mir einen Stoß und ich stolperte auf den freien Platz, wo Ogdos Söhne mit Knüppeln auf den sich krümmenden Saarantras einhieben. Dazu riefen sie im Chor den Fluch, den Sankt Ogdo einst gegen das Untier ausgestoßen hatte: »Verflucht seien deine Augen, Wurm! Verflucht seien deine Hände, dein Herz, deine Abkömmlinge bis zum Ende aller Tage! Alle Heiligen mögen dich verfluchen, das Himmlische Auge möge dich verfluchen, jeder deiner hinterhältigen Gedanken komme als Fluch über dich!«
Jetzt, da ich sein Gesicht sah, hatte ich Mitleid mit dem Drachen. Er war ein noch unfertiger Schlupfling, dürr und ungepflegt, mit verdrehten Gliedmaßen und Glupschaugen. Direkt unter seinem fahlen Wangenknochen bildete sich bereits eine große Beule.
Hinter meinem Rücken grölten die Leute; sie waren wie ein Wolfsrudel, das sich auf jeden blutigen Knochen gestürzt hätte, den die Söhne ihm zuwarfen. Zwei von ihnen hatten ihre Messer gezückt, ein Dritter holte eine Kette unter seiner ledernen Joppe hervor und zog sie drohend hinter sich her wie einen Schwanz. Sie polterte unheilvoll auf den Pflastersteinen der Brücke.
Orma stellte sich so, dass der Saarantras ihn nicht übersehen konnte, und zeigte auf dessen Ohrringe, um seinen Kameraden daran zu erinnern, was er tun sollte. Aber der Schlupfling rührte sich nicht. Orma berührte einen seiner eigenen Ohrringe und setzte ihn in Gang.
Drachen-Ohrringe waren ganz erstaunliche kleine Geräte. Man konnte damit sehen, hören und sich über große Entfernungen hinweg unterhalten. Ein Saarantras konnte damit Hilfe herbeirufen, aber auch von seinen Vorgesetzten überwacht werden. Orma hatte einmal seine Ohrringe abgenommen, um sie mir zu zeigen; es waren technische Apparate, aber die meisten Menschen hielten sie für Teufelszeug.
Einer der Söhne, der vor lauter Gebrüll schon ganz rot angelaufen war, schnauzte den Schlupfling an: »Dir wird es noch leid tun, dass du dich jemals aus deiner Höllengrotte hervorgewagt hast, du schmieriger Quig.«
»Ich bin kein Quigutl, ich bin ein Saar«, sagte der Schlupfling mit einer Stimme, die wie eine verrostete Türangel klang.
»Warst du es, der Prinz Rufus den Kopf abgebissen hat, du elender Wurm?«, fragte ein muskelbepackter Bootsmann, der ebenfalls zu den Söhnen Sankt Ogdos zählte. Er packte den dürren Arm des Umzingelten so fest, als wollte er ihn entzweibrechen.
Der Saarantras zappelte wild, wie um sich aus seiner schlecht sitzenden Kleidung herauszuwinden. Die Söhne wichen vor ihm zurück; sie dachten wohl, ihm würden jeden Moment Flügel, Hörner und ein Schwanz wachsen. Er strich sich das dünne Haar aus dem Gesicht und sagte: »Der Vertrag verbietet es uns, Menschen die Köpfe abzubeißen, aber ich will nicht vorgeben, dass ich vergessen hätte, wie sie schmecken.«
Die Söhne hätten sich über jeden Vorwand gefreut, um ihn zu verprügeln, aber was er ihnen soeben geliefert hatte, war so entsetzlich, dass sie einen Herzschlag lang wie gelähmt dastanden.
Plötzlich erwachte der Mob mit tierischem Gebrüll zum Leben. Die Söhne bedrängten den Schlupfling und stießen ihn erneut gegen das Geländer. Ich sah eine Schramme auf seiner Stirn, ein Rinnsal silbernen Blutes lief ihm über das Gesicht, dann hatte mich die Menge ganz eingeschlossen und mir die Sicht genommen.
Ich drängelte mich durch die Schaulustigen und suchte einen Blick auf Ormas strubbeliges schwarzes Haar und seine Adlernase zu erhaschen. Eine aufgesprungene Lippe und sein silbernes Blut, das daraus hervorquoll – mehr hätte der Pöbel nicht gebraucht, um sich auch auf ihn zu stürzen. Ich rief seinen Namen, schrie ihn hinaus, aber in dem Tumult konnte er mich unmöglich hören.
Plötzlich erschollen laute Rufe und vom Vorplatz der Kathedrale kamen Pferde herangaloppiert. Endlich zogen die Wachen mit dröhnenden Dudelsäcken auf. Sankt Ogdos Söhne warfen ihre Hüte in die Luft und tauchten in der Menge unter. Zwei sprangen über das Geländer der Brücke, aber ich hörte nur einen ins Wasser platschen.
Orma hatte sich neben den zusammengekrümmten Schlupfling gekniet. Ich eilte zu ihm, vorbei an den vor der Garde fliehenden Leuten. Ich wagte es nicht, Orma zu umarmen, aber ich war so erleichtert, dass ich mich ebenfalls hinkniete und seine Hand nahm. »Allen Heiligen sei Dank!«
Orma wehrte mich ab. »Hilf mir, ihn auf die Beine zu bringen, Serafina.«
Ich ging um den Verletzten herum und nahm ihn beim Arm. Er starrte mich dümmlich an. Sein Kopf rollte auf meine Schulter und sein silbernes Blut befleckte meinen Mantel. Ich kämpfte einen Anflug von Übelkeit nieder. Wir halfen dem verletzten Saar wieder auf die Füße und stützten ihn, aber er wies unsere Hilfe ab und blieb alleine stehen, schwankend in dem beißend kalten Wind.
Der Hauptmann der Garde, Prinz Lucian Kiggs, kam auf uns zu und die Menschenmenge wich vor ihm zurück wie das Wasser vor der Heiligen Fionnuala. Er trug noch seine Trauerkleidung, einen kurzen weißen Überrock mit langen Flügelärmeln, aber sein tiefer Kummer war deutlicher Verärgerung gewichen.
Ich zog Orma am Ärmel. »Lass uns gehen.«
»Ich kann nicht. Durch meinen Ohrring weiß die Botschaft, dass ich hier bin. Ich muss bei dem Schlupfling bleiben.«
Ich hatte den Prinzen schon mehrfach bei Hofe gesehen, aber stets aus der Ferne und in den von Menschen wimmelnden Hallen. Als mich Viridius der Königin vorstellte, war er nicht dabei gewesen. Er galt als schlauer und gerissener Ermittler, der seine Pflichten sehr ernst nahm, aber viel verschlossener war als sein Onkel. Auch mit dessen gutem Aussehen konnte er nicht mithalten – er hatte nicht einmal einen Bart –, aber als ich ihn nun aus der Nähe sah, fand ich, dass seine klugen Augen dies mehr als wettmachten.
Ich blickte weg. Bei den Heiligen Hunden, überall auf meiner Schulter war Drachenblut.
Prinz Lucian beachtete weder mich noch Orma, sondern wandte sich stirnrunzelnd an den Schlupfling. »Bei Sankt Mashas Stein, du blutest ja!«
Der Geschundene blickte hoch. »Sieht schlimmer aus, als es ist, Euer Gnaden. In Menschenköpfen sind eben viele Blutgefäße, die leicht durchtrennt werden können von –«
»Schon gut, schon gut.« Der Prinz war beim Anblick der Wunde zurückgezuckt, gab jedoch einem seiner Männer ein Zeichen, woraufhin dieser mit einem Tuch und einer Feldflasche herbeigelaufen kam. Der Schlupfling öffnete die Flasche und goss sich das Wasser über den Kopf, sodass es nutzlos in kleinen Bächlein von ihm abperlte und nur seinen Wams nass machte.
Heilige im Himmel, er würde an Ort und Stelle erfrieren, und die Vornehmsten von Goredd standen da und sahen zu. Kurz entschlossen nahm ich ihm das Tuch und die Flasche aus der Hand, was er auch widerstandslos geschehen ließ, benetzte den Stoff und zeigte ihm, wie er sein Gesicht damit abtupfen sollte. Dann machte er es selbst und ich trat zurück. Prinz Lucian nickte mir dankbar zu.
»Du bist anscheinend ziemlich neu, Saar«, sagte der Prinz. »Wie heißt du?«
»Basind.«
Das klang eher wie ein Bellen und nicht wie ein Name. Ich bemerkte die unvermeidliche Mischung aus Bedauern und Abscheu in den dunklen Augen des Prinzen. »Wie hat es angefangen?«, fragte er.
»Ich weiß nicht«, antwortete Basind. »Ich ging gerade vom Fischmarkt nach Hause –«
»Jemand, der so neu hier ist wie du, sollte nicht auf eigene Faust durch die Stadt laufen«, fuhr ihn der Prinz barsch an. »In der Drachenbotschaft hat man dir das doch sicher hinreichend klargemacht?«
Jetzt erst nahm ich Basind genauer in Augenschein: Wams, Pluderhose und seine Abzeichen wiesen ihn eindeutig als Angehörigen der Botschaft aus.
»Hast du dich verlaufen?«, hakte Prinz Lucian nun freundlicher nach. »Sind sie dir gefolgt?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, wie man Schollen zubereitet.« Er fuchtelte mit einem durchweichten Päckchen vor dem Gesicht des Prinzen herum. »Sie haben mich umringt.«
Prinz Lucian wich dem nach Fisch riechenden Paket aus, ließ sich aber nicht ablenken. »Wie viele waren es?«
»Zweihundertneunzehn. Vielleicht auch noch ein paar mehr, die ich nur nicht gesehen habe.«
Dem Prinzen blieb der Mund offen stehen. Er war es anscheinend nicht gewohnt, Drachen zu befragen. Ich beschloss, ihm aus der Patsche zu helfen. »Wie viele hatten schwarze Federn an ihren Mützen, Saar Basind?«
»Sechs«, antwortete Basind und blinzelte wie jemand, der nicht gewohnt ist, nur zwei Augenlider zu haben.
»Hast du sie gesehen, Serafina?«, fragte der Prinz, sichtlich froh darüber, dass ich mich eingemischt hatte.
Ein leichter Schreck durchfuhr mich, als der Prinz mich beim Namen nannte. Ich nickte stumm. Woher um alles in der Welt kannte er den, ich war doch nur ein Niemand unter all den Bewohnern des Palasts?
»Meine Leute werden alle herbeischaffen, die sie geschnappt haben«, fuhr der Prinz fort. »Du, Schlupfling, und dein Freund hier«, er zeigte auf Orma, »solltet sie euch ansehen und wenn möglich jene beschreiben, die uns entwischt sind.«
Der Prinz gab seinen Männern ein Zeichen, die Gefangenen vorzuführen, dann beugte er sich zu mir und beantwortete die Frage, die ich gar nicht gestellt hatte. »Cousine Glisselda redet ständig von dir. Sie wollte schon mit dem Musizieren aufhören. Zum Glück bist dann du gekommen.«
»Viridius war zu streng mit ihr«, murmelte ich verlegen.
Er betrachtete mit seinen dunklen Augen Orma, der sich nach etwaigen Saarantrai aus der Botschaft umsah. »Wie heißt dein hochgewachsener Freund? Er ist ein Drache, nicht wahr?«
Für meinen Geschmack war dieser Prinz eindeutig zu schlau. »Was bringt Euch auf diesen Gedanken?«
»Nur so eine Vermutung. Ich habe also recht, nicht wahr?«
Trotz der Kälte begann ich zu schwitzen. »Sein Name ist Orma. Er ist mein Lehrer.«
Lucian Kiggs blickte mich prüfend an. »Schön und gut. Aber ich möchte die Bestätigung sehen, dass er vom Glockenzwang befreit ist. Ich habe dieses Amt eben erst angetreten und kenne noch nicht alle unsere Tarnkappenlehrer, wie Onkel Rufus sie immer genannt hat.« Seine grauen Augen verdüsterten sich, aber dann fasste der Prinz sich wieder. »Ich nehme an, Orma hat die Botschaft bereits verständigt?«
»Ja.«
»Tja, dann bringen wir das am besten schnell hinter uns, ehe ich mich deren Vorwürfen ausgesetzt sehe.«
Einer seiner Leute ließ die Gefangenen vor uns antreten; sie hatten nur zwei erwischt. Ich hatte angenommen, dass man die beiden, die in den Fluss gesprungen waren, leicht ausfindig machen könnte, wenn sie klatschnass und zitternd aus dem Wasser kamen, aber vielleicht hatten die Wachen das gar nicht mitbekommen.
»Zwei von ihnen sind über das Brückengeländer gesprungen, aber ich habe nur ein Platschen gehört …«, begann ich.
Prinz Lucian verstand sofort, was ich meinte. Mit flinken Handbewegungen schickte er seine Soldaten an beide Enden der Brücke. Nachdem sie leise bis drei gezählt hatten, schwangen sie sich über die Brüstung, und tatsächlich, einer der Söhne war noch da. Er hatte sich an den Balken festgeklammert. Sie zerrten ihn wie ein Rebhuhn hervor, aber im Gegensatz zu einem Rebhuhn konnte er kein bisschen fliegen. Er plumpste ins Wasser und zwei der Wachen sprangen ihm nach.
Der Prinz warf mir einen anerkennenden Blick zu. »Du bist sehr wachsam.«
»Manchmal«, antwortete ich und wich seinem Blick aus.
»Hauptmann Kiggs«, sagte eine leise Frauenstimme hinter mir.
»Jetzt geht’s los«, brummte er und ging um mich herum.
Ich wandte den Kopf und sah, wie eine Saarantras mit kurzen schwarzen Haaren vom Pferd sprang. Sie ritt wie ein Mann, trug Hosen aus Porphyrien und einen geschlitzten Kaftan aus Ziziba. Eine silberne Glocke, groß wie ein Apfel, war demonstrativ an ihrer Mantelschnalle befestigt. Die drei Saarantrai hinter ihr blieben auf ihren Pferden sitzen und hielten ihre unruhigen Rösser im Zaum. Ihre Glöckchen bimmelten seltsam fröhlich im Wind.
»Staatssekretärin Eskar.« Der Prinz ging mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Sie ergriff sie nicht, sondern wandte sich sofort an Basind.
»Berichte«, forderte sie ihn auf.
Basind salutierte, wie es bei den Saar üblich war, indem er zum Himmel zeigte. »Keine Sorge, alles in Ard. Die Garde erschien in vertretbarer Zeit, Staatssekretärin. Hauptmann Kiggs kam sogar direkt vom Grab seines Onkels.«
»Die Kathedrale ist nur zwei Minuten zu Fuß von hier entfernt«, erwiderte Eskar. »Aber die Zeit, die zwischen deinem ersten Signal und dem zweiten verstrichen ist, betrug fast dreizehn Minuten. Wenn die Wachen unverzüglich gekommen wären, hättest du kein zweites Signal geben müssen.«
Prinz Lucian richtete sich zur vollen Größe auf, seine Miene sprach Bände. »Also war das alles nur ein Test?«
»So ist es«, entgegnete Eskar ungerührt. »Wir betrachten die Sicherheitsmaßnahmen als unzureichend, Hauptmann Kiggs. Das ist der dritte Angriff in zwei Wochen und der zweite, bei dem ein Saar verletzt worden ist.«
»Angriffe, die Ihr inszeniert habt, zählen nicht. Ihr wisst selbst, dass dies nicht die Regel ist. Die Menschen sind sehr nervös. General Comonot kommt in zehn Tagen …«
»Und genau deshalb müsst Ihr Euch mehr Mühe geben«, entgegnete sie kühl.
»… und Prinz Rufus wurde eben erst auf eine Art und Weise ermordet, die auf Drachen als Täter hinweist.«
»Es gibt keinerlei Beweis dafür, dass Drachen daran beteiligt waren«, widersprach sie.
»Sein Kopf ist weg!« Der Prinz zeigte auf seinen eigenen; er war so aufgebracht, dass er die Zähne zusammenbeißen musste. Sein vom Wind zerzaustes Haar ließ ihn seltsam wild erscheinen.
Eskar zog die Augenbrauen hoch. »Ach, und ein Mensch könnte so etwas nicht getan haben?«
Prinz Lucian wandte sich ab und fuhr mit der Hand über sein Gesicht. Er fing an im Kreis herumzugehen. Es empfahl sich nicht, vor den Augen eines Saarantras wütend zu werden. Je größer die eigene Wut, desto kühler wurden sie. Eskar blieb auf eine aufreizende Art unbeteiligt.
Der Prinz unterdrückte seinen Groll und setzte erneut an. »Eskar, bitte versteht doch, so etwas erschreckt die Leute. Das Misstrauen sitzt immer noch tief. Die Söhne von Sankt Ogdo machen sich das zunutze, sie schlagen Kapital aus den Ängsten der Menschen …«
»Vierzig Jahre«, unterbrach ihn Eskar. »Wir hatten vierzig Jahre lang Frieden. Ihr wart noch nicht einmal geboren, als der Vertrag mit Comonot unterzeichnet wurde. Eure eigene Mutter –«
»Möge sie Frieden finden an der himmlischen Feuerstelle«, murmelte ich, als wäre es meine Aufgabe, jede gesellschaftliche Unzulänglichkeit aller Drachen auf der ganzen Welt auszugleichen. Der Prinz warf mir einen dankbaren Blick zu.
»… war noch nicht größer als ein Staubkorn im Bauch der Mutter«, fuhr Eskar ungerührt fort. »Nur die Älteren unter euch erinnern sich noch an den Krieg. Aber es sind nicht die Alten, die sich den Söhnen von Sankt Ogdo anschließen oder auf den Straßen randalieren. Wie kann sich in die Herzen von Menschen, die niemals die Feuerstürme des Kriegs erlebt haben, ein so tief sitzendes Misstrauen eingenistet haben? Mein eigener Vater fiel durch eure Ritter und ihre hinterhältige Kriegskunst, die Dracomachie. Jeder Saarantras erinnert sich noch an jene Zeit, denn wir alle haben jemanden aus der Familie verloren. Wir tragen es euch nicht nach, uns bleibt nichts anderes übrig, um des Friedens willen. Wir hegen keinen Groll gegen euch. Gebt ihr Menschen die Gefühle mit eurem Blut weiter, von Mutter zu Kind, so wie wir Drachen unsere Erinnerungen weitergeben? Vererbt ihr eure Ängste? Nur so lässt sich erklären, dass sie so lange erhalten blieben – oder warum ihr sie nicht schon längst ausgemerzt habt«, sagte Eskar.
»Das hieße uns selbst auszumerzen. Ihr mögt das für eine unserer menschlichen Dummheiten halten«, sagte Prinz Lucian und lächelte grimmig. »Vielleicht können wir unsere Gefühle nicht so mit dem Verstand bezwingen wie ihr, vielleicht brauchen wir mehrere Generationen, bis sich unsere Ängste gelegt haben. Andererseits beurteile ich auch nicht alle Drachen nach den Taten einiger weniger.«
Eskar blieb völlig unbeeindruckt. »Ardagmar Comonot wird meinen Bericht entgegennehmen. Man wird sehen, ob er daraufhin seinen bevorstehenden Besuch absagt.«
Prinz Lucian trug sein Lächeln vor sich her wie ein weiße Flagge. »Wenn er zu Hause bliebe, würde mir das jede Menge Schwierigkeiten ersparen. Wie nett von Euch, dass Ihr an mein Wohlergehen denkt.«
Eskar legte den Kopf schief wie ein Vogel, schien jedoch nicht weiter auf Kiggs’ Bemerkung eingehen zu wollen. Sie befahl ihren Begleitern, Basind einzusammeln, der ans Ende der Brücke davongeschlichen war und sich dort wie eine Katze am Geländer rieb.
Der dumpfe Schmerz zwischen meinen Augen hatte sich zu einem hartnäckigen Pochen gesteigert, als ob jemand beständig von innen an meinen Kopf hämmerte, weil er herauswollte. Das war übel, denn meine Kopfschmerzen wurden üblicherweise von weiteren Unannehmlichkeiten begleitet. Andererseits wollte ich nicht gehen, ohne herauszufinden, was das Gassenmädchen Orma gegeben hatte. Eskar hatte ihn beiseitegenommen, sie steckten die Köpfe zusammen und unterhielten sich leise.
»Er ist bestimmt ein ausgezeichneter Lehrer«, sagte Prinz Lucian. Seine Stimme erklang so überraschend und so nahe an meinem Ohr, dass ich zusammenzuckte.
Wortlos machte ich einen kleinen Knicks. Ich durfte anderen nicht zu viel über Orma verraten, am allerwenigsten dem Hauptmann der Königlichen Garde.
»Ja, das ist er ganz gewiss«, sprach der Hauptmann weiter. »Wir waren erstaunt, als Viridius ein Mädchen zu seiner Gehilfin wählte. Womit ich nicht andeuten will, dass ein Mädchen nicht für dieses Amt geeignet wäre. Aber Viridius ist sehr altmodisch. Du musst etwas ganz Außerordentliches an dir haben, dass er auf dich aufmerksam geworden ist.«
Diesmal knickste ich tief, aber er war noch nicht fertig. »Dein Solo war in der Tat sehr bewegend. Das wird dir jeder bestätigen, denn in der Kathedrale blieb kein einziges Auge trocken.«
So wie es aussah, würde ich mich nicht mehr in der Anonymität verstecken können. Das hatte ich nun davon, Vaters Rat in den Wind geschlagen zu haben. »Danke«, antwortete ich. »Entschuldigt mich, Hoheit, ich muss mit meinem Lehrer sprechen wegen meiner, ähm, Triller …«
Ich ließ ihn einfach stehen – der Gipfel an Unhöflichkeit. Er verharrte einen Augenblick unentschlossen, dann ging auch er. Ich drehte mich um. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne tauchten sein Trauergewand in ein goldenes Licht. Er befahl einem seiner Untergebenen, ein Pferd herbeizubringen, saß mit fast tänzerischer Leichtigkeit auf und ließ seine Mannschaft Aufstellung nehmen.
Ich erlaubte mir einen kurzen Augenblick des Bedauerns, denn ich wusste, das Umschlagen seiner Freundlichkeit in Geringschätzung wäre unausweichlich, sollte er je erfahren, wie ich wirklich war. Dann schob ich diese trüben Gedanken beiseite und gesellte mich zu Orma und Eskar.
Orma streckte den Arm aus, aber er berührte mich nicht. »Darf ich vorstellen: Serafina«, sagte er.
Staatssekretärin Eskar blickte mich über ihre Adlernase hinweg an und schien nacheinander jedes Detail meiner Person auf einer Liste abzuhaken. Zwei Arme: vorhanden. Zwei Beine: unklar aufgrund der Länge des Überkleids, aber wohl vorhanden. Zwei Augen, rehbraun: vorhanden. Haar von der Farbe schwarzen Tees, schaut unter der Kapuze hervor: vorhanden. Brüste: nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Groß gewachsen, aber noch im üblichen Rahmen. Wangen gerötet, aus Wut oder Verlegenheit: unübersehbar.
»Hm«, sagte sie. »Es ist gar nicht so grässlich, wie ich es mir immer vorgestellt habe.«
Orma, gepriesen sei sein wenig empfindsames Drachengemüt, fühlte sich bemüßigt, Eskar zu verbessern. »Es ist eine Sie.«
»Ist es denn nicht unfruchtbar wie ein Maultier?«
Mein Gesicht lief so heiß an, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn meine Haare in Flammen aufgegangen wären.
»Sie«, bekräftigte Orma. Als habe er am Anfang nicht denselben Fehler gemacht. »Alle Menschen gebrauchen ein persönliches Fürwort, das ihr Geschlecht bezeichnet, ganz gleich, wie fortpflanzungsfähig sie sind.«
»Andernfalls wird es als Beleidigung aufgefasst«, sagte ich mit einem aufgesetzten Lächeln.
Eskar verlor das Interesse an mir und wandte sich ab. Ihre Untergebenen kamen vom anderen Ende der Brücke zurück und führten Saar Basind auf einem widerspenstigen Pferd hinter sich her.
Staatssekretärin Eskar bestieg ihren eigenen Rotbraunen, ließ ihn in einem engen Kreis wenden und gab ihm die Sporen, ohne mich oder Orma noch eines Blickes zu würdigen. Ihre Begleiter beeilten sich, ihr zu folgen.
Als sie an uns vorbeikamen, ruhte Basinds wirrer Blick ungebührlich lange auf mir, was mich mit jähem Widerwillen erfüllte. Orma, Eskar und die anderen hatten gelernt, nicht aufzufallen, er jedoch führte unmissverständlich vor Augen, wie sein wirkliches Wesen war. Sein Blick war alles andere als menschlich.
»Das war sehr erniedrigend«, sagte ich zu Orma, der geistesabwesend vor sich hin starrte.
Meine Worte rissen ihn aus seinen Gedanken. »Tatsächlich?«
»Was hast du dir dabei gedacht, ihr von mir zu erzählen?«, fragte ich ihn. »Ich bin zwar nicht mehr unter der Fuchtel meines Vaters, aber die alten Regeln gelten immer noch. Wir können nicht wahllos ausplaudern –«
»Ach«, sagte er und hob seine schlanke Hand, um meinen Einwand abzuwehren. »Ich habe ihr nichts gesagt. Eskar wusste es schon immer. Sie war eine der Zensoren.«
Bei seinen Worten drehte sich mir fast der Magen um; die Zensoren gehörten einer Behörde der Drachen an, die niemandem Rechenschaft schuldete als sich selbst. Sie überwachten die Saarantrai auf abartige Verhaltensweisen und unterzogen regelmäßig Drachen einer sogenannten Exzision, sobald sie verdächtigt wurden, Gefühle an den Tag zu legen. Eben jene Gefühle und alle damit verbundenen Erinnerungen wurden dabei getilgt. »Na wunderbar. Und was hast du diesmal gemacht, um die Aufmerksamkeit der Zensoren auf dich zu lenken?«
»Nichts«, beteuerte er eilig. »Sie ist ja auch keine Zensorin mehr.«
»Und ich dachte schon, sie sind hinter dir her, weil du mir eventuell Zuneigung entgegenbringen könntest«, sagte ich und fügte beißend hinzu: »Andererseits hätte ich das ja wohl als Erste bemerken müssen.«
»Ich bringe dir ein gebührendes Interesse entgegen, das sich im Rahmen der allseits anerkannten Gefühlsregungen hält.«
Das wiederum schien mir leicht übertrieben zu sein.
Man musste ihm allerdings zugutehalten, dass er immerhin im Laufe der Jahre bemerkt hatte, wie empfindlich ich auf dieses Thema reagierte. Nicht jeder Saar hätte sich darüber Gedanken gemacht. Er fing an zu zappeln, wie immer, wenn er mit einer Situation überfordert war. »Kommst du diese Woche zum Unterricht?«, fragte er und brachte damit die Sprache wieder auf ein unverfängliches Thema.
Ich seufzte. »Natürlich. Und du sagst mir jetzt, was dieses Kind dir gegeben hat.«
»Du glaubst, da gäbe es etwas zu erzählen«, sagte er ausweichend, fasste sich dabei jedoch an seine Brusttasche, wo er das Goldstück aufbewahrt hatte. Ich machte mir Sorgen, aber ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihn zu drängen. Sollte es etwas zu sagen geben, würde er es mir sagen, wenn er Lust dazu hatte.
Er verbeugte sich, wie immer wenn er sich von mir verabschiedete. Dann drehte er sich wortlos um und schlug den Weg zur Kathedrale ein. Ihre Außenmauern erstrahlten rotgolden in der untergehenden Sonne. Orma warf einen großen dunklen Schatten an die Wand. Ich wartete, bis er hinter dem nördlichen Querschiff verschwunden war, erst dann ergab ich mich der Leere, die er hinterlassen hatte.
Sonst empfand ich meine Einsamkeit kaum noch; ich war immer einsam, notwendigerweise oder gar von Natur aus. Nach den Wirren des heutigen Tages aber bedrückte sie mich mehr als sonst. Orma wusste alles über mich, aber er war ein Drache. An guten Tagen war er auch ein Freund. An schlechten Tagen war sein ungehobeltes Benehmen so, als stolperte man auf einer Treppe. Es tat weh, aber man hatte stets das Gefühl, selbst daran schuld zu sein.
Trotzdem, ich hatte nur ihn.
Der rauschende Fluss unter mir, der Wind in den kahlen Bäumen, eine leise Melodie, die von den Tavernen nahe der Musikschule zu mir herüberwehte, das war alles, was ich hörte. Ich hatte die Arme um mich geschlungen, lauschte und sah zu, wie die Sterne allmählich am Himmel erschienen. Ich wischte mir mit dem Ärmel über die Augen – sicher war es der Wind, der sie tränen ließ – und machte mich auf den Heimweg, dachte dabei an Orma und an jene Gefühle, die ich nicht zeigen durfte, an alles, was ich ihm verdankte und ihm niemals vergelten konnte.
Drei
Dreimal schon hatte Orma mir das Leben gerettet.
Als ich acht Jahre alt war, hatte Orma eine Drachenlehrerin für mich angestellt, ein junges Mädchen namens Zeyd. Meinem Vater hatte es missfallen. Er verachtete Drachen, obwohl er der Berater der Krone in allen Angelegenheiten des Vertrags war und sogar schon Saarantrai als Anwalt verteidigt hatte.
Ich staunte über Zeyds Eigenarten: darüber wie knochig sie war, über ihr Glöckchen, das unablässig bimmelte, über ihre Fähigkeit, die schwierigsten Gleichungen im Kopf zu lösen. Von all meinen Lehrern – und ich musste eine ganze Heerschar erdulden – war sie mir die liebste gewesen.
Bis sie mich vom Glockenturm der Kathedrale werfen wollte.
Sie hatte mich unter dem Vorwand, mir Physikunterricht erteilen zu wollen, auf den Turm gelockt. Dann hatte sie mich, ehe ich mich versah, hochgehoben und auf Armeslänge über die Brüstung gehalten. Der Wind heulte in meinen Ohren und ich musste hilflos zusehen, wie einer meiner Schuhe in die Tiefe stürzte, von den Fratzen der Wasserspeier abprallte und dann auf die Pflastersteine des Kathedralenvorplatzes fiel.
»Warum fallen Gegenstände nach unten? Weißt du das?«, fragte sie so freundlich, als erteilte sie mir diesen Unterricht in meinem Kinderzimmer.
Ich war zu erschrocken, um zu antworten. Ich verlor auch meinen anderen Schuh und hatte Mühe, mein Frühstück bei mir zu behalten.
»Es gibt Kräfte, die uns alle beeinflussen, auch wenn man sie nicht sieht. Aber ihre Wirkung kann man voraussagen. Wenn ich dich vom Turm fallen ließe …« – hier schüttelte sie mich, und die Stadt drehte sich unter mir wie ein Strudel, der im Begriff war, mich zu verschlingen – »dann würdest du mit einer Beschleunigung von etwa zehn Metern pro Quadratsekunde fallen. Genauso wie mein Hut es tun würde, genauso wie deine Schuhe es getan haben. Wir alle werden gleichermaßen von unserem Verhängnis angezogen, alle mit der gleichen Kraft.«
Sie meinte die Schwerkraft – wenn es um bildliche Vergleiche geht, sind Drachen nicht sehr geschickt –, aber ihre Worte brachten etwas tief in meinem Inneren zum Klingen. Die verborgenen Faktoren in meinem Leben würden mich unausweichlich zu Fall bringen. Mir kam es vor, als hätte ich dies schon immer gewusst. Und es gab kein Entrinnen.
Orma tauchte wie aus dem Nichts auf und vollbrachte das Unmögliche. Er rettete mich, ohne als mein Retter zu erscheinen. Erst Jahre später verstand ich, dass dies eine Farce gewesen war, die die Zensoren inszeniert hatten, um Ormas Gefühle und seine Zuneigung zu mir auf die Probe zu stellen.
Diese Erfahrung hat in mir eine tief verwurzelte und durch nichts zu kurierende Höhenangst hinterlassen, aber verrückterweise kein Misstrauen gegenüber Drachen.
Dass ein Drache mich gerettet hatte, spielte dabei keine Rolle – denn niemand hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Mühe gemacht, mir zu sagen, dass Orma ein Drache war.
Als ich elf Jahre alt war, kam es zu einem Zerwürfnis zwischen mir und meinem Vater. Ich hatte die Flöte meiner Mutter gefunden, die in einem der oberen Räume des Hauses versteckt gewesen war. Papa hatte meinen Lehrern untersagt, mich in Musik zu unterrichten. Aber er hatte nicht ausdrücklich verboten, dass ich es mir selbst beibrachte. Ich war ganz die Tochter eines Anwalts, ich fand immer irgendwelche Schlupflöcher. Wenn Papa bei der Arbeit und meine Stiefmutter in der Kirche war, spielte ich heimlich und brachte mir ein kleines Repertoire an Volksliedern bei, die ich halbwegs passabel vortragen konnte.
Als Vater in jenem Jahr zum Friedensfest, das am Vorabend des Jahrestags des Friedensschlusses zwischen Drachen und Menschen begangen wurde, eine kleine Gesellschaft plante, versteckte ich die Flöte beim Kamin, um die Gäste mit einem Stegreif-Konzert zu überraschen.
Leider fand Papa die Flöte, erriet, was ich vorhatte, und schleppte mich in mein Zimmer. »Was erlaubst du dir?«, schrie er mich an. Ich hatte seine Augen noch nie so wütend funkeln gesehen.
»Ich werde erzwingen, dass ich Musikstunden nehmen darf«, sagte ich. Meine Stimme klang ruhiger, als ich in Wirklichkeit war. »Wenn alle hören, wie gut ich spiele, werden sie dich bedrängen, es mir nicht länger zu verweigern …«
Er unterbrach mich mit einer raschen Handbewegung und hob die Flöte. Für einen Moment dachte ich, er wolle mich züchtigen. Ich duckte mich, aber der Hieb blieb aus. Als ich es wagte, wieder zu ihm aufzusehen, schlug er die Flöte mit aller Kraft gegen seine Knie.
Mit einem entsetzlichen Krachen zerbrach sie, zersplitterte wie Knochen, zerbarst wie mein Herz. Fassungslos sank ich auf die Knie.
Papa ließ das zerstörte Instrument zu Boden fallen und taumelte einen Schritt zurück. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. So als wäre die Flöte ein Stück von ihm gewesen. »Du hast es nie verstanden, Serafina«, sagte er. »Ich habe jede Spur von deiner Mutter getilgt. Ich gab ihr einen anderen Namen, eine andere Gestalt, eine andere Vergangenheit, ein anderes Leben. Jetzt können uns nur noch zwei Gefahren drohen: von ihrem unausstehlichen Bruder – aber auf den habe ich ein wachsames Auge – und von ihrer Musik.«
»Sie hatte einen Bruder?«, fragte ich, aber er gab mir keine Antwort. »Wie kann ihre Musik uns schaden? Und wie hieß sie, wenn sie nicht Amaline Ducanahan war?«, wollte ich mit tränenerstickter Stimme wissen. Es gab so weniges, was ich von meiner Mutter besaß, und nun nahm er mir selbst das.
Er schüttelte den Kopf. »Ich schütze uns beide, glaub mir.«
Das Schloss rastete ein, als er die Tür meines Zimmers hinter sich verriegelte. Was völlig unnötig war, ich hätte ohnehin nicht mehr zum Fest zurückkehren können. Mir war übel. Ich drückte meine Stirn gegen die Fußbodenfliesen und ließ die Tränen rollen.
Mitten auf dem Fußboden schlief ich ein, in der Hand die zerbrochene Flöte. Das Erste, was ich dachte, als ich aufwachte, war, dass ich mich am liebsten unter mein Bett verkriechen würde, das zweite, dass es ungewöhnlich still im Haus war, obwohl die Sonne schon hoch am Himmel stand. Ich wusch mir das Gesicht im Waschbecken und das kalte Wasser brachte mich schlagartig zur Besinnung: Gestern war der Abend des Friedensfestes gewesen und alle hatten bis tief in die Nacht gefeiert, genau wie Königin Lavonda und Ardmagar Comonot fünfunddreißig Jahre zuvor, als sie die Zukunft ihrer beiden Völker sicherten.
Das hieß: Ich konnte mein Zimmer nicht verlassen, ehe nicht jemand erwachte und meine Tür aufschloss.
Mein dumpfer Kummer hatte eine ganze Nacht gehabt, um zur Wut heranzureifen, und das machte mich verwegen, verwegener, als ich es jemals zuvor gewesen war. Ich zog mich so warm an wie ich konnte, band mir meine Börse an den Unterarm, öffnete den Fensterflügel und kletterte hinaus.
Unten angekommen überließ ich meinen Füßen die Führung, folgte ihnen durch Alleen, über Brücken und entlang der eisigen Kais. Zu meinem Erstaunen sah ich überall Menschen, geschäftigen Verkehr auf den Straßen und geöffnete Läden. Schlitten glitten bimmelnd an mir vorbei, auf denen Feuerholz oder Heu aufgetürmt war. Diener schleppten Krüge und Körbe von den Geschäften nach Hause, stapften dabei in ihren hölzernen Pantinen achtlos durch den Matsch auf den Straßen; junge Frauen bahnten sich vorsichtig einen Weg um die nassen Schneehaufen. Fleischpasteten und geröstete Kastanien buhlten um die Gunst der Passanten, und ein Glühweinverkäufer versprach becherweise Wärme.
Ich kam an den Sankt-Loola-Platz, wo eine große Menschenmenge rechts und links der leeren Straße zusammengeströmt war. Die Leute schwatzten und schauten erwartungsvoll, drängten sich wegen der Kälte dicht zusammen.
Ein alter Mann neben mir murmelte zu seinem Nachbarn: »Ich kann nicht glauben, dass die Königin dies zulässt. Nach all den Opfern und Kämpfen, die wir auf uns genommen haben!«
»Ich bin überrascht, dass dich überhaupt noch etwas überraschen kann«, sagte sein jüngerer Begleiter und lächelte dabei bitter.
»Bei Sankt Masha, sie wird den Vertragsabschluss noch bereuen, Maurizio.«
»Fünfunddreißig Jahre ist das her und sie hat ihn bisher nicht bereut.«
»Die Königin ist wahnsinnig, wenn sie glaubt, Drachen könnten ihren Blutdurst bezwingen!«
»Entschuldigung«, sagte ich mit piepsiger Stimme, denn ich war es nicht gewohnt, Fremde anzusprechen. Derjenige, der Maurizio hieß, sah mich mit freundlich hochgezogenen Brauen an. »Warten wir auf Drachen?«
Der junge Mann lächelte. Er war auf eine strubbelig-schmuddelige Art recht hübsch. »Genau das tun wir, kleines Fräulein. Es ist die Fünfjahresprozession.« Als ich ihn verdutzt anschaute, erklärte er mir: »Alle fünf Jahre gestattet unsere hochwohlgeborene Königin –«
»Unsere geistesverwirrte Despotin!«, schrie der alte Mann dazwischen.

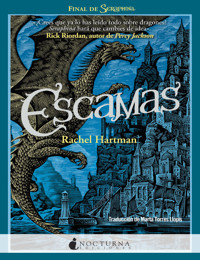
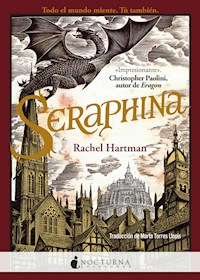














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











