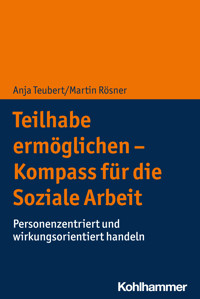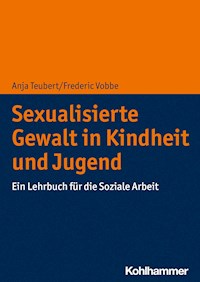
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Zentrales Kennzeichen dieses Lehrbuchs ist die reflexive Anwendungsorientierung: Sozialarbeiterisches Theorie-, Fach- und Handlungswissen werden systematisch auf sexualisierte Gewalt im Kindes- und Jugendalter bezogen. Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend wird dabei als soziales Problem gefasst. Auf diese Weise werden die Zusammenhänge zwischen den Strategien der Täterinnen und Täter und der Psychodynamik der Betroffenen sowie die daraus folgenden Belastungen für die Betroffenen und ihre Familien sicht- und verstehbar. Studierende und Fachkräfte finden im Buch zudem Ansätze für sozialarbeiterisch präventives und intervenierendes Handeln in Abgrenzung zu anderen professionellen Aufträgen sowie Anregungen, die eigene Haltung unter Berücksichtigung berufsethischer Implikationen weiterzuentwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autor*innen
Dr.in Anja Teubert ist Professorin für Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Zu ihren Schwerpunkten zählen sexualisierte Gewalt, Sozialraumorientierung und die fachliche Reflexion. Sie war 25 Jahre Vorständin einer Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt und in der Sucht- und Gewaltprävention tätig. Derzeit forscht sie im Rahmen der Landesforschungsförderlinie für die DHBW mit zwei Dualen Partnereinrichtungen zur Verankerung von Schutzkonzepten vor sexualisierter Gewalt.
Dr. Frederic Vobbe ist Professor für Soziale Arbeit an der SRH Hochschule Heidelberg. Zu seinen Schwerpunkten zählen sexualisierte Gewalt, Devianz und Berufsethik. Zuvor arbeitete er als Berater mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, mit Hilfeeinrichtungen und fachpolitischen Akteur*innen. Siehe auch: Vobbe, Frederic & Kärgel, Katharina (2022) Sexualisierte Gewalt und Digitale Medien. Reflexive Handlungsempfehlungen für die Fachpraxis. Wiesbaden: Springer VS. Online verfügbar unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-35764-1.
Anja Teubert Frederic Vobbe
Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend
Ein Lehrbuch für die Soziale Arbeit
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-037647-2
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-037648-9
epub: ISBN 978-3-17-037649-6
Geleitwort Dr. Peter Caspari
Was muss gewusst werden, wenn man sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt? In einer aktuellen Ausgabe des »Journal of Child Sexual Abuse« beklagen die Herausgeberinnen eine Vielzahl von Wissens- und Erkenntnislücken, die doch angesichts des umfangreichen Bestandes einschlägiger Studien und Metaanalysen eigentlich langsam geschlossen werden müssten (MacIntosh/Ménard 2021). So würden beispielsweise Studien zu den Folgen sexualisierter Gewalt nach wie vor auf Konzepte wie »Pathologie« und »Vulnerabilität« fokussieren, während etwa Fragen nach biografischen Bewältigungsverläufen Betroffener weitgehend unberücksichtigt blieben. Diese kritische Einsicht spiegelt ein im Themenfeld der sexualisierten Gewalt nicht selten anzutreffendes Unbehagen wider, wonach viel, aber nicht genug gewusst wird.
Wie die Autor*innen dieses Lehrbuchs zeigen, basiert Wissen in diesem Bereich keineswegs nur auf der Verfügbarkeit entsprechender Fachinformationen, sondern auf einer Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse und sozioemotionaler Kompetenzen, die etwas mit anforderungsreichen Begriffen wie Haltung, Professionsethik und Handlungsfähigkeit zu tun haben. Die Methode dieser Integration besteht – ganz allgemein formuliert – in Reflexionen. Das vorliegende Lehrbuch bietet insofern einen nützlichen Referenzrahmen für solche Reflexionen, weil es die Lesenden als zunehmend Wissende und potenziell Handelnde anspricht, wobei dazu eingeladen wird, sich fachlichen Widersprüchen zu stellen, Komplexität auszuhalten und dem eigenen Empfinden bei der Beschäftigung mit sexualisierter Gewalt nachzuspüren. Der Anspruch auf Integration wird aber auch dadurch erfüllt, dass zwar einerseits Position und Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext sexualisierter Gewalt geschärft werden, andererseits aber auch die Notwendigkeit der Überschreitung disziplinärer Barrieren überzeugend begründet wird. Auf der Ebene der Interventions- und Präventionspraxis kann Soziale Arbeit die Funktion für sich beanspruchen, Hilfesysteme zum Abbau solcher Barrieren zu animieren und damit allseits vernehmbare Behauptungen von Kooperations- und Vernetzungswilligkeit in nützliche und nachhaltige Formen der Zusammenarbeit überzuführen.
Die inzwischen verfügbare Flut an Fachliteratur zu sexualisierter Gewalt wirft erhebliche Probleme der Rezeption und Selektion auf. Was soll man lesen, um sich in diesem Feld als partiell wissend und hinreichend handlungsfähig zu fühlen? Das vorliegende Buch erscheint hier als erste Wahl – als Einladung zu Reflexion und Diskussion.
Literatur
MacIntosh, Heather B.; Ménard, A. Dana (2021). Where are We Now? A Consolidation of the Research on Long-term Impact of Child Sexual Abuse. Journal of child sexual abuse, 30 (3), S. 253–257.
Geleitwort Prof. Dr. Barbara Kavemann
Die Vermittlung von Wissen über sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend ist der große Schwerpunkt des Lehrbuchs. Dieses Wissen entstammt vor allem den Berichten von Betroffenen. Kinder, Jugendliche und sehr oft Erwachsene haben seit Jahrzehnten in therapeutischen, juristischen und sozialarbeiterischen Kontexten davon erzählt, was ihnen angetan wurde und wie sie die Taten, deren Folgen und die Reaktionen ihrer Umwelt erlebt haben. Häufig wurden diese Berichte nicht anerkannt, inzwischen ist deutlich, dass Betroffene damit die Basis für gute, professionelle Unterstützung einerseits und einen – wenn auch immer noch verkürzten – gesellschaftsweiten Kenntnisstand geschaffen haben. Hätten sie uns nicht die Machtdynamiken und Täterstrategien beschrieben, wären wir noch nicht so weit mit der Konzeptionierung von Prävention. Das gilt ebenso für unser Wissen darüber, was in welchem Alter und den unterschiedlichen Tatkontexten hätte helfen können und heute helfen kann.
Berufseinsteiger*innen in die Soziale Arbeit brauchen dieses Wissen und geeignete Handlungsstrategien. Die Betroffenen begegnen ihnen in der Rolle von Klientinnen und Klienten. Dabei ist wichtig, dass sie nicht nur als »Opfer« und als »anders« zu konstruieren. Zum einen findet sich in allen helfenden Berufen ein hoher Anteil an Personen mit eigener Geschichte von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie ist die Voraussetzung dafür, professionell zu handeln und zu entscheiden. Zum anderen kann im Laufe des Lebens die Opferposition verlassen werden. Klientinnen und Klienten treten uns dann als Betroffene gegenüber, die Ansprüche und Forderungen an die Leistungen der Sozialen Arbeit formulieren. Es gilt sorgfältig hinzuhören, an welcher Stelle biografischer Bewältigungsverläufe man sich begegnet und um welchen Unterstützungsbedarf es geht. Die berufsethischen Überlegungen, die in diesem Lehrbuch geboten werden, unterstützen diesen Prozess.
Kinder und Jugendliche erwarten, dass sie in akuten Gewaltverhältnissen geschützt, unterstützt und beteiligt werden an allen Entscheidungen über ihr Leben. Dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche so lange Zeit in Schulen, Kinderheimen, Kirchen, Vereinen und Familien möglich war, vertuscht und ignoriert wurde, hatte einen Grund in ihrer relativen Rechtlosigkeit. Kinderrechte sind eine historisch gesehen junge Errungenschaft. Das Modell der Partizipation von Lundy (2007) führt aus, was erforderlich ist, um Art. 12 der UN-Kinderrechtekonvention angemessen umzusetzen: »Space, voice, audience and influence«. Sie können auf die Situation von Kindern und Jugendlichen, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren, übertragen werden und bilden einen Rahmen auch für sozialarbeiterisches Handeln. Es braucht einen sicheren Raum, nur wenn dieser vorhanden ist, können Kinder und Jugendliche sprechen über ihre Erlebnisse und Ängste. Ihre Stimme muss hörbar gemacht werden, dazu benötigen sie eine Sprache und Kenntnisse, um sich anderen verständlich machen zu können. Zuhören ist die Voraussetzung für Verstehen und Vertrauen, ihre Hinweise und Erzählungen müssen ernst genommen werden. Und all das muss praktische Konsequenzen haben, sie müssen erleben, dass sie Einfluss nehmen können auf den Lauf ihres weiteren Lebens. Nach der Erfahrung von Ohnmacht und Ausgeliefertsein kann das Erleben von Selbstwirksamkeit und Deutungshoheit den Ausschlag für eine weitere, positive Entwicklung geben.
Früh im Leben sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein – und das oft über lange Zeit –, kann unterschiedliche Folgeprobleme nach sich ziehen. Damit diese gelindert und bewältigt werden können, brauchen betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die sich auskennen; die verstehen und die neben ihrer Fachkompetenz zur Empathie fähig sind; die wissen, wie schwerwiegend sexuelle Gewalt ein Leben beeinträchtigen kann, wenn keine Unterstützung gewährt wurde, die aber eine Vorstellung davon haben, wie trotz der Gewalt ein gutes Leben erreicht werden kann.
Das Lehrbuch geht auf alle diese Seiten der Thematik ein, es nimmt Ängste und bietet die Möglichkeit, Sicherheiten zu erwerben. Das ist es, was Fachkräfte und Betroffene brauchen.
Literatur
Lundy, Laura (2007) ›Voice‹ is not enough: conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. In: British Educational Research Journal 33 (6), S. 927–942.
Inhalt
Geleitwort Dr. Peter Caspari
Geleitwort Prof. Dr. Barbara Kavemann
1 Einleitung
1.1 Ableitungen für dieses Lehrbuch
1.2 Zwei inhaltliche Entscheidungen vorweg
1.3 Aufbau dieses Lehrbuches
1.4 Didaktische Mittel
Teil I Wissen
2 Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend als Querschnittsthema der Sozialen Arbeit
2.1 Sexualisierte Gewalt
2.2 Formen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
2.3 Rechtlicher Kontext
2.4 Prävalenz, Folgebelastungen und Folgekosten
2.5 Soziale Arbeit
2.5.1 Das Triplemandat der Sozialen Arbeit
2.5.2 Das fachlich-reflexive Handlungskonzept Sozialer Arbeit
2.5.3 Soziale Arbeit im Unterstützungssystem
2.5.4 Korrelation sexualisierter Gewalt mit Sozialen Problemen
3 Systemischer Blick auf von sexualisierter Gewalt belastete Verhältnisse
3.1 Systemische Grundbegriffe: System, Umwelt, Differenz, Kommunikation
3.2 Kultur in sozialen Systemen und die Normalitätserwartungen von Systemmitgliedern
3.3 Der systemische Blick auf Verdeckungszusammen- hänge und Wahrnehmungsblockaden sexualisierter Gewalt
3.4 Sexualisierte Gewaltausübung aus systemischer Sicht
3.4.1 Täter*innenstrategien
3.4.2 Exkurs: Gewaltmotivation. Machterleben versus sexuelles Verlangen?
3.4.3 Exkurs: Sexualisierte Gewalt durch Kinder und Jugendliche
3.4.4 Gewalt in medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Systemen
3.5 Die Wahrnehmung Gewaltbetroffener
4 Sexualisierte Gewalt in der Sozialen Arbeit
4.1 Soziale Arbeit als betroffenes System
4.1.1 Sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der Sozialen Arbeit
4.1.2 Risikofaktoren in Einrichtungen der Sozialen Arbeit
4.2 Sexualisierte Gewalt durch Sozialarbeitende
4.3 Sozialarbeiter*innen als von sexualisierter Gewalt Betroffene
4.4 Institutionalisierte professionelle Macht
5 Berufsethische Implikationen I
5.1 Sexuelle Förderung vs. Schutz? Diskussion zur sexuellen Selbstbestimmung
5.2 Allparteilichkeit und Neutralität vs. Parteilichkeit? Diskussion zur professionellen Haltung
5.3 Gegenübertragung vs. Sensibilisierung? Diskussion zum Peer-Counseling
5.4 Zur Bedeutung ethischer Prinzipien der Sozialen Arbeit
Teil II Können
6 Prävention
6.1 Ganzheitliche Prävention
6.1.1 Universelle Prävention
6.1.2 Selektive Prävention
6.1.3 Indizierte Prävention
6.2 Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt
6.2.1 Entwicklung eines Schutzkonzepts
6.2.2 Sozialräumliche Schutzkonzepte
7 Krisenintervention
7.1 Sexualisierte Gewalt als Krise
7.2 Pflichten Sozialarbeitender
7.3 Umgang mit Hinweisen
7.3.1 Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte (Beratungsanspruch Sozialarbeitender § 8b SGB VIII)
7.3.2 Äußerungen betroffener oder anderer Kinder und Jugendlicher
7.3.4 Hinweise im Verhalten gewaltausübender Personen
7.4 Schutzmaßnahmen
7.5 Beteiligungsmöglichkeiten für Betroffene
7.6 Überlegungen zur Strafanzeige
8 Zu Gewalt sprechen
8.1 Unterscheidung zwischen Gesprächen im Kontext der akuten Krisenintervention und Gesprächen der Aufarbeitung
8.2 Besonderheiten des Gesprächs mit Personen, die akute Gewalt offenlegen (Primär- und Sekundärbetroffene)
8.3 Besonderheiten des Gesprächs mit erwachsenen Personen, die Sozialarbeitenden eigene Gewaltwiderfahrnisse in Kindheit und Jugend anvertrauen
8.4 Einmaleins der Gesprächsführung
8.4.1 Gesprächsphasen gestalten, Frageformen und Stimuli
8.4.2 Sicherheit geben
8.5 Psychohygiene und Selbstsorge für Sozialarbeitende
9 Berufsethische Implikationen II
9.1 »Schlafende Hunde weckt man nicht …« Ist die Offenlegung von sexualisierter Gewalt für Betroffene schädlich?
9.2 Verschwiegenheit vs. Datenschutz
9.3 Überlegungen zur Arbeit mit Täter*innen
10 Am Schluss ein paar Gedanken zu Statements und Mythen rund ums Thema
10.1 »Muss das wirklich auch noch sein? Bisher ging es doch auch …«
10.2 »Das ist alles wichtig, aber dafür haben wir weder Zeit noch Geld!«
10.3 »Früher Opfer, heute Täter*innen!«
10.4 »Da kann ja jede*r kommen und Entschädigung fordern. Irgendwann muss auch mal gut sein.«
10.5 »Wenn wir den*die Täter*in nicht bestrafen, können wir andere Kinder und Jugendliche nicht schützen!«
10.6 »Die muss sich ja nicht wundern. Wer so rumläuft …«
Literaturverzeichnis
Zum Schluss
1 Einleitung
Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend zu thematisieren, war gesellschaftlich lange Zeit ein absolutes Tabu. Erst in den vergangenen Jahren wird sie durch öffentliche und Fachdiskurse zunehmend aussprechbar. Dazu beigetragen hat die umfassende Offenlegung sexuellen Kindesmissbrauchs in pädagogischen und kirchlichen Einrichtungen ab 2010. Es ist grundsätzlich erfreulich, dass eine Sensibilisierung für diese Form der Gewalt stattfindet und Betroffene dadurch leichter Unterstützung erhalten. Bei der Betrachtung der Fachdiskussion und des Umgangs mit sexualisierter Gewalt fällt jedoch auf, dass Unternehmungen im Bereich der Gewaltvorbeugung sehr oft erziehungswissenschaftlich-pädagogisch ausgerichtet sind, was mitunter daran liegen mag, dass in pädagogischen Einrichtungen ein erhöhtes Risiko sexualisierter Gewalt besteht. Kriseninterventionen wird demgegenüber vorwiegend psychotherapeutisch, medizinisch oder sogar kriminologisch verstanden. Der Fokus liegt dann entweder auf Ansätzen der Traumabewältigung Gewaltbetroffener oder der Diagnostik bei und Therapie von Gewaltausübenden. Die Soziale Arbeit nimmt in den Fachdiskussionen eine vergleichsweise unauffällige Rolle ein. Das ist bemerkenswert, weil sie eine wichtige Funktion in der Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Schutz innehat. Freilich können Teilbereiche der Sozialen Arbeit im weitesten Sinne der Pädagogik zugeordnet werden.
Die Zurückhaltung der Profession Soziale Arbeit hat zur Folge, dass eine originär sozialarbeiterische Sicht in Fachdebatten zu wenig vertreten ist. Aufgrund der mehr als sechzigjährigen Entwicklung ihrer Disziplin hat sie wichtige Perspektiven beizutragen. Ihr Auftrag orientiert sich nicht nur an der Erziehung und Bildung von Kindern, sondern zielt auf deren ganzheitliche Teilhabe. Die Profession beschränkt sich dabei nicht auf eine Reflexion gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, sondern folgt als Handlungswissenschaft einem Gestaltungsauftrag. Das gilt besonders angesichts sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, die weder ein abstraktes noch ausschließlich individuelles, sondern ein Soziales Problem darstellt und entsprechende Handlungsbedarfe nach sich zieht.
Jener Zurückhaltung wollen wir mit diesem Buch entgegenwirken. Daher laden wir auf den folgenden Seiten zu einer sozialarbeiterischen Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt ein. Wir, die Autor*innen, haben mehrere Jahre als Sozialarbeiter*innen in der sozialpädagogischen Familienhilfe, der Jugendsozialarbeit, der Gewaltprävention und der spezialisierten Fachberatung mit betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren erwachsenen Bezugspersonen gearbeitet. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Auseinandersetzung mit Gewalt selbstverständlich belastend sein kann. Letzteres hängt unserem Dafürhalten nach mit Widerständen zusammen, mit denen wir als Sozialarbeitende wiederholt konfrontiert wurden. Zum Beispiel begegnete uns die verbreitete Meinung, dass man bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sehr vorsichtig sein müsse. Man könne ganze Familien und Lebenswege damit zerstören. In der Beratung von Einrichtungen trafen wir auf die Pauschalbehauptung, bei uns gibt es keine sexualisierte Gewalt. Betroffene Kinder und Jugendliche, zu denen wir Kontakt hatten, erzählten uns, dass ihnen zunächst oftmals nicht geglaubt wurde, wenn sie versuchten sich anderen Menschen anzuvertrauen. Beruflich belastend ist das, weil eine intensive Beschäftigung mit den aus der Gewalt resultierenden Verletzungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen ohnehin schon schwer genug auszuhalten ist. Die genannten Widerstände erschweren Hilfen zusätzlich und zermürben die Beteiligten.
Bestärkt wurden wir demgegenüber durch die Erfahrung, dass betroffene Kinder und Jugendliche sich weiterentwickeln und erholen, wenn ihnen geglaubt wird, es Menschen in ihrem Umfeld gibt, die mit ihnen gemeinsam besprechen, was gerade für sie wichtig ist, es ein (professionelles) Netzwerk gibt, das die Dynamiken sexualisierter Gewalt kennt und für den Schutz junger Menschen eintritt. Dabei haben wir es als hilfreich erlebt, dass wir als Sozialarbeitende über interdisziplinäres Anschlusswissen zu angrenzenden Zuständigkeiten in Hilfenetzwerken verfügen und – im positiven Sinne – die Autorität besitzen, für das Kindeswohl einzustehen.
1.1 Ableitungen für dieses Lehrbuch
Für dieses Buch leiten wir daraus ab, dass die Soziale Arbeit gute Voraussetzungen mitbringt, sich des mitunter belastenden Themas sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend anzunehmen und die Gewalt professionell aufzufangen. Die Soziale Arbeit verfügt als Profession über differenzierte Instrumente und Befugnisse zur Prävention und Intervention, zum Beispiel in Form ihrer steuernden und koordinierenden Funktion in Hilfenetzwetzwerken sowie rechtlich geregelter und methodisch fundierter Interventionskompetenzen. Diese werden in der Publikation dargestellt und Interessierten zugänglich gemacht.
Eine Basis der genannten Instrumente sind Wissenschaftswissen und Handlungswissen (Dewe & Otto 2012) (bezugsdisziplinär, sozialarbeitswissenschaftlich). Sie sollen dem*der einzelnen Sozialarbeiter*in Handlungssicherheit ermöglichen. Die Wissensformen dienen dazu den gesellschaftlichen Auftrag der Profession besser begründen zu können. Dazu gehört, dass wir uns in dieser Publikation fachlich mit Mechanismen beschäftigen, die eine Tabuisierung sexualisierter Gewalt hervorbringen und Widerstände gegen funktionierende Hilfen darstellen. Wir beschreiben bzw. antizipieren diese Widerstände, um gesellschaftliches Zusammenleben durch unsere politische Einflussnahme – sich Einmischen (Thiersch 2014) – im Sinne Betroffener besser gestalten zu können. Was umfasst sozialarbeiterische Professionalität im Umgang mit sexualisierter Gewalt? Welche Konflikte ergeben sich aus unterschiedlichen professionellen Zugängen? Dazu streben wir keine abstrakten Theoriediskurse an, Theorien werden vielmehr in ihrer Bedeutung für den sozialarbeiterischen Umgang mit sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend konkret eingewoben. Die theoretischen Ansätze in diesem Buch schließen vor allem Reflexionen zu berufsethischen Fragen mit ein. Wir möchten die Leser*innen dazu anregen, sich mit ihrer eigenen werte- und einstellungsbasierten Handlungsorientierung, also der eigenen Haltung, zu beschäftigen. Das umfasst Selbstbeobachtungen während der Lektüre insbesondere hinsichtlich eigener Betroffenheit, eigener Vorbehalte gegen das Thema oder gegenüber angebotenen Konzepten sowie Ängsten. Denn selbst wenn Sozialarbeitende über fundiertes Wissen und Instrumente zum Umgang mit sexualisierter Gewalt verfügen, ersetzen diese nicht eine reflektierte Haltung zur Orientierung auf oftmals unsicherem Terrain.
Von Wissen unterscheiden wir letztlich Können. Können bedeutet mit Otto und Dewe (2012) die reflexive Anwendung von Wissen am konkreten Fall. Können kann mit einem Lehrbuch kaum vermittelt, sondern bestenfalls angeregt werden. Es baut darauf, dass wir selbst Erfahrungen sammeln, entscheiden und Wissen in eigene Arbeitspraxen transformieren. Sprechen wir in diesem Buch von sozialarbeiterischem Können, so meinen wir damit Handlungswissen, dessen Ziel eine Aneignung und reflexive Übertragung in eigene Praxen ist.
1.2 Zwei inhaltliche Entscheidungen vorweg
Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend ist ein emotional beladenes Thema. Im Umgang erfordert es ein hohes Maß an Sensibilität, die sich auch in der Wortwahl und Sprache widerspiegelt. Das führt dazu, dass in Fachdiskursen über die angemessene Verwendung von Begriffen gestritten wird. Wir möchten dies an zwei inhaltlichen Entscheidungen verdeutlichen, die wir vorweg getroffen haben.
Die Bezeichnung sexueller Kindesmissbrauch ist in sozialwissenschaftlichen Fachkreisen deswegen umstritten, weil sie suggeriert, dass es in ihrem Gegensatz einen sexuellen Gebrauch junger Menschen gäbe, der vielleicht irgendwie legitim sei. Die Vorstellung eines sexuellen Gebrauchs widerspricht jedoch dem Konzept sexueller Selbstbestimmung in ihrem Kern. Gegenstände kann man gebrauchen, Menschen – so unsere Auffassung als Autor*innen – jedoch nicht. Weil es also keinen legitimen sexuellen Gebrauch irgendeines Menschen – schon gar keines Kindes – geben sollte, steht auch der Begriff des sexuellen Kindesmissbrauchs infrage. Zugleich handelt es sich um einen Rechtsbegriff, der unter § 176 StGB Strafhandlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern beschreibt. Hinzu kommt, dass der Begriff nach wie vor gesellschaftlich verbreitet ist und Betroffene bisweilen veranlasst, Hilfen anhand des Begriffs zu suchen. Wir verzichten trotz unserer Kritik daher nicht vollständig auf die Begrifflichkeit. In diesem Buch setzen wir ihn jedoch nur dann ein, wenn wir ausdrücklich von strafbaren Handlungen nach § 176 StGB sprechen. Sonst verwenden wir zumeist die Bezeichnung sexualisierte Gewalt.
Wie wir noch zeigen werden, umfasst sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend mehr als ausschließlich strafbare Handlungen. Zum Beispiel können wir ihr auch beabsichtigte Grenzverletzungen durch andere Kinder zuordnen. Aus diesem Grund wird in Fachdiskursen darüber diskutiert, inwieweit die Bezeichnung Täter*in für Gewaltausübende uneingeschränkt Sinn macht. Der Begriff Täter*in vermittelt, dass es eine klare Verantwortung für die Gewalt aufseiten des*der Gewaltausübenden für sein*ihr Handeln gibt. Er ist diesbezüglich wenig missverständlich und stellt sich gegen eine Bagatellisierung von Gewalt. Zugleich assoziieren wir mit dem Label ein hohes Maß an Kriminalität. Vermutlich hängt auch dies mit seiner Verwendung in strafrechtlichen Kontexten zusammen. Der Begriff ist dahingehend moralisch besetzt. Er erzeugt Bilder in uns. Er birgt das Risiko, die Auseinandersetzung mit Gewalt auf die Ebene von Strafbarkeit zu verlagern. Wir, die Autor*innen, haben gerade im Falle sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende in Institutionen erlebt, dass im Kollegium darüber gestritten wird, ob ein*e grenzverletzende*r Kolleg*in das personenumfassende Urteil Täter*in verdient hat. Solche Spaltungen lenken davon ab, sich am Kindeswohl zu orientieren.
Wir verwenden darum auch die Bezeichnung Täter*in in dieser Publikation maßvoll. Meistens greifen wir auf die Sammelbezeichnung Gewaltausübende zurück. Diese kann Kinder und Jugendliche, die sich sexualisiert grenzverletzend verhalten, umfassen. Den Begriff Täter*in gebrauchen wir vor allem für erwachsene Personen, die strategisch vorgehen, um Kinder und Jugendliche sexuell zu missbrauchen. Jenseits unserer begrifflichen Kritik verweisen wir so gezielt hie und da darauf, dass sexueller Kindesmissbrauch ein schweres Verbrechen darstellt.
1.3 Aufbau dieses Lehrbuches
Der erste Teil, Wissen, beginnt mit Kapitel 2, in dem begründet wird, weshalb sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend ein Querschnittsthema der Sozialen Arbeit ist. Dort wird dargestellt, weshalb sexualisierte Gewalt nicht nur ein individuelles, sondern ein Soziales Problem ist, dessen Dringlichkeit den Handlungsauftrag der Sozialen Arbeit begründet (Kap. 2).
Kapitel 3 behandelt die Verhältnisse, in denen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend verübt wird, aus einer systemischen Sichtweise. Dazu werden Grundlagen der Systemtheorie als wichtige Perspektive der Sozialen Arbeit eingeführt und auf die Dynamik sexualisierter Gewalt angewendet (Kap. 3).
Kapitel 4 bespricht sexualisierte Gewalt als Problem in der Sozialen Arbeit. Dazu wird die Soziale Arbeit selbst als betroffenes System und Tatort in den Blick genommen und Ursachen der Gewalt im Spannungsverhältnis zwischen professioneller Ohnmacht sowie beruflichem Machtmissbrauch beleuchtet (Kap. 4).
Der Teil Wissen schließt mit konzentrierten berufsethischen Implikationen in Kapitel 5. Dort wenden wir uns nochmals Haltungsfragen entlang des Verhältnisses zwischen sexueller Förderung und Schutz, Fragen nach einer konstruktiven Nutzbarkeit eigener Gewaltbetroffenheit Helfender sowie Kontroversen zwischen den Ansätzen von Parteilichkeit und Allparteilichkeit zu (Kap. 5).
Der zweite Teil, Können, beginnt mit Ausführungen zur Prävention sexualisierter Gewalt in Kapitel 6. Vorbeugung wird dort als ganzheitliches Unternehmen erörtert, das sozialräumliche Schutzfaktoren stärkt (Kap. 7).
Kapitel 7 stellt Prinzipien der Krisenintervention dar. Das Kapitel gibt eine Orientierung, wie Hinweisen auf sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend begegnet werden kann, stellt Schutzmaßnahmen vor und verweist auf Handlungsvoraussetzungen, um betroffene Kinder und Jugendliche an Schutzmaßnahmen zu beteiligen (Kap. 7).
In Kapitel 8 werden Grundlagen für Gespräche über sexualisierte Gewalt mit Betroffenen dargelegt. Dazu wird zwischen Gesprächen im Rahmen akuter Krisenintervention und Gesprächen zur Aufarbeitung vergangener Gewaltwiderfahrnisse unterschieden (Kap. 8).
Mit Kapitel 9 werden weitere berufsethische Implikationen konzentriert verhandelt. Die Herausforderungen Verschwiegenheit versus Schutz und der Arbeit mit Täter*innen werden dort besprochen (Kap. 9).
Typische Gewaltmythen, deren verbreitete Vorstellung die Soziale Arbeit erschweren kann, diskutiert Kapitel 10. Anstelle eines zusammenfassenden Fazits werden dort Argumente gegen die genannten Mythen und Verdeckungszusammenhänge vermittelt (Kap. 10).
1.4 Didaktische Mittel
Lernziele
Zu Beginn jedes Kapitels formulieren wir Ziele, die Aufschluss darüber geben, welcher Wissenserwerb mit dem Kapitel beabsichtigt wird. Lesende können sich dieserart eine differenziertere Übersicht der jeweiligen Inhalte verschaffen.
Marginalspalte
Die Kapitel werden außerdem mithilfe einer sogenannten Marginalspalte strukturiert. Dort stehen zentrale Begriffe des jeweiligen Sinnabschnitts, die der besseren Übersicht, der Rekapitulation und der Orientierung im Buch dienen.
Fallbeispiel
Inhalte werden zudem entlang von Fällen dargelegt. Es handelt sich dabei um konkrete Erfahrungen der Autor*innen in der Arbeit zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, die lediglich zum Zwecke der Anonymisierung etwas verändert wurden.
Merke
Mithilfe des Hinweises Merke werden wichtige Zusammenhänge vorangegangener Erörterungen nochmals prägnant zusammengefasst.
Literaturhinweise
Vertiefungen, die über das in diesem Buch Verhandelbare hinaus gehen, unterfüttern wir durch Literaturhinweise. Im Gegensatz zum Literaturverzeichnis handelt es sich dabei um konkrete Tipps bei weitergehendem Interesse.
Reflexion
Die Kapitel enthalten Reflexionsfragen, die einen Transfer des Vermittelten in den eigenen Erfahrungshorizont anstoßen sollen.
Abgesehen von der Zielformulierung zu Beginn jedes Kapitels, der Marginalspalte und den Reflexionsimpulsen können die didaktischen Mittel je Kapitel bedarfsabhängig variieren.
Teil I Wissen
2 Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend als Querschnittsthema der Sozialen Arbeit
In diesem Kapitel soll verdeutlicht werden, weshalb sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend für Sozialarbeitende in allen Feldern ein bedeutsames Thema ist und wie Sozialarbeitende das Wissen um die Thematik in ihr fachlich-reflexives Handlungskonzept aufnehmen. Folgende ›Wissens-Ziele‹ verfolgen wir mit diesem ersten Kapitel.
Lernziele
Die Leser*innen wissen um die Thematik der sexualisierten Gewalt in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung.
Sie kennen das fachlich-reflexive Handlungskonzept Sozialarbeitender als ›Werkzeug‹.
Sie kennen die Rolle und Aufgaben Sozialarbeitender in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt.
Für den Aufbau und die Weiterentwicklung einer fachlich-reflexiven Handlungskompetenz von Sozialarbeitenden ist es in diesem Kapitel hilfreich, sehr bewusst zu lesen und Gefühle, die beim Lesen aufkommen, wahrzunehmen (ggf. zu notieren).
2.1 Sexualisierte Gewalt
Gewalt ist ein Phänomen, das auch ungeachtet einer Sexualisierung allen Menschen als Betroffene (Opfer) und auch als Gewaltausübende begegnet. Wir befinden uns immer mal wieder in Situationen, in denen wir mit Macht durchsetzen, was für uns wichtig ist. Dabei verletzen wir Grenzen anderer manchmal unbewusst und oft tritt das Bewusstsein darüber erst zeitversetzt ein. Zeitweise nutzen wir unsere Macht auch mit Absicht, um andere zu verletzen, uns durchzusetzen und/oder uns anwaltschaftlich für die Rechte von anderen Menschen einzusetzen, wenn diese selbst nicht in der Lage dazu sind.
Die World Health Organisation (WHO) (2002) definiert Gewalt als:
»The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation« (ebd., S. 4).
Gewalt beginnt demzufolge dann, wenn die machtvolle intentionale Durchsetzung eines persönlichen oder kollektiven Willens bzw. persönlicher oder kollektiver Bedürfnisse gegen die Bedürfnisse anderer zur Schädigung und Verletzung Letzterer führt. Gewalt kann daher nicht getrennt von existierenden Machtstrukturen und -asymmetrien betrachtet werden. Zum Beispiel äußert sich Macht auch durch Privilegien bestimmter Gruppen gegenüber anderen wie bei Erwachsenen gegenüber Kindern. Die Durchsetzung eigener Bedürfnisse ist dann auch durch Vernachlässigung und die Behinderung von Teilhabemöglichkeiten junger Menschen denkbar (Weber 1973, Galtung 1975 & 1993).
Nährboden für Gewalt
In diesem Zusammenhang ist es unter anderem von Bedeutung, die generationale Ordnung zu betrachten: Wie ist das Verhältnis zwischen Jüngeren und Älteren? Andresen et al. (2021) stellen hier die Frage, inwieweit ein Staat es Erziehungsberechtigten ermöglicht, »ihre Macht im Namen der Erziehung zu missbrauchen« (ebd., S. 17). Das heißt, wir nehmen herrschende gesellschaftliche Verhältnisse in den Blick, um Normalitätsvorstellungen zu reflektieren, die einen sogenannten Nährboden für Gewalt (Imbusch 2002) bedingen (Abb. 2.1). Als Nährboden für Gewalt sind gesellschaftliche Verhältnisse zu verstehen, die Gewalt legitimieren, bagatellisieren, beschönigen oder gar verschleiern. Solange Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten die Erziehungsgewalt oder -hoheit überlassen wird, indem davon ausgegangen wird, Familie sei als System für sich und in ihrer Privatheit zu schützen und Kindern und Jugendliche damit keine grundrechtlichen Selbstbestimmungs- und Beteiligungsrechte zugestanden werden, bleiben die Machtverhältnisse ungleich und Kinder und Jugendliche in einer deutlich schwächeren Position.
Kultur der Gewalt
In einer Gesellschaft, in der Ressourcen und Macht ungleich verteilt sind, entsteht ein Nährboden für Gewalt, der zu wachsen droht. Es geht in dem Zusammenhang beispielsweise um das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, Reichen und Armen, Männern und Frauen, Führungskräften und Angestellten, Menschen mit und ohne Migrationserfahrungen. Legitimiert, beschönigt, verschleiert oder verherrlicht eine Gesellschaft das Vorkommen von Machtunterschieden, um damit diese in Form von Gewalt gegen andere Menschen auszunutzen, führt dies zu einer Art von ›Selbstverständlichkeit‹, die das Ausmaß von Gewaltvorkommnissen beeinflusst. Wenn beschönigt wird, dass eine Leitungskraft ihre Angestellten herablassend behandelt und/oder vor anderen bloßstellt, wenn legitimiert wird, dass Fachkräfte entscheiden, wann und von wem Kinder geduscht werden oder wenn sexualisierte Gewalt gegenüber einem Kind in einer Einrichtung als Spiel verschleiert wird, können wir von einer Kultur der Gewalt sprechen.
Abb. 2.1: Nährboden sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft in Anlehnung an Imbusch 2002 (eigene Darstellung)
Merke
Bei sexualisierter Gewalt handelt es sich um Verletzungshandlungen, mit denen gewaltausübende Personen absichtsvoll eigene Bedürfnisse nach Macht, Anerkennung, Körperkontakt und Intimität gegen die sexuelle Selbstbestimmung und/oder das Einvernehmen einer anderen Person durchsetzen. Dabei ist vorranging zu berücksichtigen, was Betroffene als Verletzung erleben.
Absichtsvoll wird hier in einem devianztheoretischen Sinne verstanden, was meint, dass Widerstände ignoriert und überwunden werden, weil der eigene Nutzen aus einer Handlung als wichtiger angesehen wird. Die Tat ist auch schon absichtsvoll, wenn ein Widerstand, und sei er noch so gering, überwunden wurde (Dollinger & Raithel 2006). ›Absichtsvoll‹ markiert also den Unterschied zu einer versehentlichen Grenzverletzung.
Das hiesige Verständnis von Einvernehmen orientiert sich am Konzept der informierten Einwilligung. Sie setzt in Anlehnung an Finkelhor (1979) voraus, dass Kinder und Jugendliche prinzipiell verstehen, was während und als Folge der Beteiligung an sexualisierten Handlungen mit ihnen passiert. Außerdem müssten sie die Freiheit haben, die Handlungen auch abzulehnen. Dies schließt Finkelhor für sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen aufgrund von Machtasymmetrien und unter Verweis auf die Entwicklungspsychologie grundsätzlich aus.
Dass wir von Gewalt sprechen, wenn eine Handlung gegen das Einvernehmen der*des Betroffenen passiert, muss dabei differenziert betrachtet werden. Denn oft werden diese manipuliert, zu sexuellen Handlungen überredet oder sie befinden sich in einer Lage, aus der heraus sie das Gefühl haben, nicht nein sagen zu können, weil sie Nachteile befürchten, sich schämen oder weil sie einfach nicht wissen, dass sie einen eigenen Willen haben. Besonders Kinder und Jugendliche, deren einzige Zuwendung der sexuelle Kontakt zu Erwachsenen ist, die keine andere Form des Körperkontakts kennen und/oder die aufgrund von täglich erlebten Pflegesituationen gewöhnt sind, dass Grenzen überschritten werden, sind oft nicht in der Lage, überhaupt zu beschreiben, dass ihnen etwas passiert, das sie verletzt.
Sexuelle Grenzverletzungen
Sexuelle Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen, die Menschen als Überschreitungen ihrer intimen Bereiche empfinden. Sie werden von erwachsenen Frauen und Männern oder Jugendlichen, auch gleichaltrigen oder ältere Kindern verübt. Die von der Grenzverletzung Betroffenen definieren, wann sie sich verletzt fühlen.
Wir sprechen bei sexuellen Grenzverletzungen auch von Verletzungen, die unabsichtlich verübt wurden oder aufgrund von einer Kultur der Grenzverletzungen als normal angesehen werden.
Die Aufarbeitungskommission definiert sie folgendermaßen:
»[Bei sexuellen Grenzverletzungen handelt es sich um] Verhaltensweisen, die die körperlichen, psychischen oder Schamgrenzen anderer überschreiten, ohne bereits einen sexuellen Übergriff oder strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt darzustellen. Grenzverletzungen werden meist unabsichtlich verübt, können subjektiv aber als sehr unangenehm erlebt werden, wie beispielsweise das Betreten von Duschräumen« (Fasholz-Seidel 2021).
Ein Beispiel dafür ist ein Nacktfoto, das ein Junge seiner Freundin schickt, weil er gerne eines von ihr hätte, und meint, sein Foto würde ihr gefallen. Sie ist jedoch entsetzt und fühlt sich gar nicht gut beim Betrachten des Bildes und auch danach geht es ihr nicht gut im Umgang mit ihrem Freund. Der Freund dagegen findet schade, dass sie ihm nicht zurückschreibt, ist etwas enttäuscht, vergisst das aber dann wieder. Die Situation steht zwischen den beiden. Daher ist ein Präventionsziel das Bemerken und Ansprechen von Verletztheit (ausführlich dazu Kap. 6).
sexuelle Übergriffe
Von sexuellen Übergriffen sprechen wir im Fall von absichtsvollen, wiederholten oder massiven Grenzverletzungen. Sie werden als Täter*innenstrategie eingesetzt, um das Umfeld, in dem die Kinder und Jugendlichen sich befinden, zu desensibilisieren bzw. sexuellen Kindesmissbrauch vorzubereiten (zu Täterstrategien Kap. 3).
2.2 Formen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
Sexualisierte Gewalt hat viele unterschiedliche Erscheinungsformen, die im Folgenden aufgeführt werden. Das Wissen um diese Formen ist insofern von Bedeutung als dass die Thematik dazu einlädt, sich nicht vorstellen zu können, was Betroffene erleben. In den Beschreibungen gehen wir selbstverständlich nicht ins Detail. Betroffene erfahren beschriebene Gewaltformen konkreter und sprechen darüber in ihrer eigenen Sprache, mit den Worten, die sie dafür zur Verfügung haben. Daher ist es von Bedeutung, sich individuell mit der Sprache und Kultur der Adressat*innen auseinanderzusetzen, um sexualisierte Gewalt als solche deuten zu können (dazu beispielsweise Kizilhan 2013, Teubert & Kizilhan 2018, Helfferich et al.2021).
Hands-off-Taten
›Hands-off-Taten‹(ohne Körperkontakt) sind Formen sexualisierter Gewalt, bei der eine Person eine andere dazu überredet oder zwingt, bei sexuellen Handlungen zuzusehen: Dazu zählt beispielsweise, dass vor einem Kind masturbiert wird, sich jemand exhibitioniert, dem Kind gezielt pornografische Darstellungen zeigt und/oder zusendet. Film oder Fotoaufnahmen, die den Jungen oder das Mädchen auf eine sexualisierte Art darstellen und verbale sexuelle Belästigung zählen ebenfalls zu den ›Hands-off-Taten‹.
Hands-on-Taten
›Hands-on-Taten‹(mit Körperkontakt) sind Formen direkter Gewalt am oder mit dem Körper des Kindes/Jugendlichen: Die*der Betroffene wird so manipuliert oder dazu gezwungen, dass er*sie die Genitalien anderer, die eigenen oder die des*der Gewaltausübenden berührt. Das Überreden zu sexuellen Handlungen vor der Webcam oder Filmen der Handlungen gehören genauso zu den Taten mit Körperkontakt wie vaginale, orale oder anale penetrative Handlungen. Das besonders Verstörende an dieser Form der sexualisierten Gewalt ist, dass sie oft sehr zärtlich und in enger Beziehung mit dem*der Täter*in passiert. Der Körper des Opfers reagiert nicht selten mit sexuellen Lustgefühlen, Erregung bis hin zum Orgasmus. Für die Betroffenen ist das wie ein Verrat des Körpers an der Seele (ausführlich Kap. 3).
kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen
Die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, alltagssprachlich Kinderprostitution1 genannt, ist eine besondere Form der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, weil sie sehr vielschichtig ist. Zunächst handelt es sich dabei um eine Hands-off-Tat, weil der*die Täter*in das Kind an andere Erwachsene ›verkauft‹, die direkte sexualisierte Gewalt Hands-on am Kind ausüben. Oder das Kind wird anderen Erwachsenen zur Verfügung gestellt, die es verkaufen. Erwachsene nutzen also einmal ihre Macht, um mit dem Körper des Kindes wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen, und andere nutzen ihn, um sich sexuell zu befriedigen. Dazu kommt, dass es Menschen gibt, die sich die Gewalthandlungen ansehen, um sich zu stimulieren. Das tun sie, indem sie über eine Webcam der aktuell verübten Straftat zuschauen oder indem sie Kinderpornografie konsumieren. Dabei handelt es sich um eine andere Form von Hands-off-Taten, deren Auswirkungen jedoch nicht weniger folgenreich für das betroffene Kind sind (Jud et al. 2013).
organisierte sexualisierte und ritualisierte Gewalt
Organisierte sexualisierte und ritualisierte Gewalt ist ein Phänomen, das erst seit 2019 als eine Form des sexuellen Kindesmissbrauchs offiziell auf der Homepage des Beauftragten der Bundesregierung für sexuellen Kindesmissbrauch (UBSKM) als solche benannt wurde. In die Rechtsprechung ist diese Form noch nicht aufgenommen (ausführlicher dazu Nick et al. 2018). Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Existenz solcher Fälle. Es handelt sich hier um die systematische Anwendung schwerer sexualisierter in Verbindung mit körperlicher und seelischer Gewalt. Die Kinder werden nicht selten durch Konditionierung und Programmierung (»Mind Control«) zu Funktionalität und Gehorsam gezwungen. Es wird beabsichtigt, die kindliche Persönlichkeit in verschiedene Teile zu spalten. Das führt dazu, dass die Kinder sich im Alltagsleben nicht an die Taten erinnern (Becker et al. 2019). Ein weiteres Charakteristikum dieser Form ist, dass mehrere Täter*innen, oft auch in Täter*innennetzwerken, beteiligt sind. Von ritueller Gewalt sprechen wir, wenn eine Ideologie zur Begründung oder Rechtfertigung der Gewalt herangezogen wird (Arbeitsstab des UBSKM 2019a).
Diese Form der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wurde in der Vergangenheit meist als für nicht möglich, reine Fantasie gehalten: den Betroffenen wurde nicht geglaubt. »›In diesem mystischeren Zusammenhang wurde mir und wurde uns Kindern vermittelt, dass wir Opfer seien, um den Teufel zu besänftigen und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Hierfür wären wir auserwählt und es sei eine Ehre. Die Täter wollen uns eigentlich keine Gewalt antun.‹ (Betroffene)« (Kavemann et al. 2019, S. 121
»Diese extreme Form sexualisierter Gewalt findet oft über einen langen Zeitraum statt, der auch Kindheit und Jugend überdauern kann, denn Ausstiegswillige werden unter Druck gesetzt, erpresst und verfolgt« (Arbeitsstab des UBSKM 2019a).
Digitale Medien
Digitale Medien spielen eine große Rolle im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Denn digitale Kommunikation erleichtert das Darstellen von Kindern/Jugendlichen in erotischen Posen (Posing) sowie das Anbahnen von Kontakten (Cybergrooming). Es existiert ein großer Markt von Missbrauchsabbildungen im Netz. In kaum einem Fall spielen digitale Medien keine Rollen.
Dekker et al. (2016) schätzen, dass weltweit viele Millionen von bildlichen und filmischen Darstellungen sexualisierter Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Netz kursieren. Es ist inzwischen möglich, diese zu löschen (ebd.), wenngleich der Zugriff auf Kopien, die sich auf anderen Seiten befinden, nicht immer gelingt. Die Bilder können also immer wieder auftauchen. Das heißt, die Betroffenen bleiben in der Gefahr, immer wieder mit den Taten konfrontiert zu werden (Kap. 6).
Missbrauchsabbildungen
Das Fotografieren oder Filmen von sexualisierten Gewalthandlungen stellt eine besondere Ausprägung von Gewalt dar. Sie kann alle Formen sexualisierter Gewalt begleiten und dazu führen, dass Bilder und Filme jahrzehntelang im Netz kursieren. Die Gefahr, dass Betroffene immer wieder mit der Tat konfrontiert, erpresst und bloßgestellt werden, ist sehr groß. Dabei handelt es sich um Aufzeichnungen sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige, die fachsprachlich als Missbrauchsabbildungen bezeichnet werden, um Material das zum Herstellen für die sexuelle Erregung genutzt wird. Weiter wird der Begriff auch für Bilder verwendet, die zur Stimulation von Täter*innen genutzt werden. Vielen Nutzer*innen ist dabei nicht klar, dass es sich um eine spezifische Form der Gewalt handelt, die sie damit zu ihrer sexuellen Stimulierung gebrauchen. Der freie Zugang zu pornografischen Darstellungen im Netz, die ›Normalität‹, mit der pornografisches Bildmaterial insgesamt genutzt werden kann, stellt eine Form der kulturellen Gewalt dar, der unter anderem mit Gesetzen auf struktureller Ebene begegnet werden kann.
Sogenannte kinderpornografische Inhalte stellen einen Straftatbestand dar, der unter § 184b StGB geregelt ist. Dies sind sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind), die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in aufreizend geschlechtsbetonter Körperhaltung oder die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes. Spezialisierte Fachpraktiker*innen kritisieren den Begriff der Kinderpornografie da er die ihm zugrundliegenden Missbrauchshandlungen bagatellisiere. Daher sprechen wir von Missbrauchsabbildungen.
Cybergrooming
Das Netz erleichtert es Täter*innen, die Tat vorzubereiten. Cybergrooming bezeichnet das Vorgehen der Kontaktanbahnung mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche online oder offline zu sexuellen Handlungen zu überreden oder zu zwingen. Die Täter*innenstrategien (Kap. 3) unterscheiden sich hier nur darin, dass sich hinter der Person, die die Kinder und Jugendlichen online treffen, jemand anderer verbirgt als der Mensch, der sich im Netz vorstellt. Außerdem wird das Netz auch für die Anbahnung von Kinderprostitution oder -sextourismus weltweit genutzt: Haben Kinder/Jugendliche sich gefilmt, sind sie aus ihrer Sicht erpressbar, weil sie so ›blöd‹ waren, Filme oder Fotos zu versenden (Arbeitsstab des UBSKM 2019b). Der Onlinekontakt führt einerseits zu einem verstärkten Sicherheitsgefühl, die Betroffenen schreiben gerne von sich und geben Dinge preis, die sie sonst einem Fremden nicht mitteilen würden, andererseits nutzen Betroffene auch leichter die Möglichkeit des Abschaltens als des Nein-Sagens bei persönlichen Kontakten (Dekker et al. 2016).
Sexting
Als Sexting wird das konsensuelle, einvernehmliche Versenden von erotischen Botschaften, Bildern und Filmen bezeichnet, das zu Gewalthandeln zählt, wenn Zwang oder Manipulation zum Versenden der Botschaften geführt hat. Kinder/Jugendliche und Erwachsene nutzen Messengerdienste, um sich in erotischer Weise darzustellen. Die Empfänger*innen der Botschaften werden aus Sicht des*der Sender*in als Vertrauenspersonen eingeordnet (Arbeitsstab des UBSKM 2019a). Die Motive der Sender*innen sind vermutlich vielfältig. Im Kontext von indizierter Prävention ist es bedeutsam, personenorientiert die jeweiligen Motive für das Versenden von erotischem Bildmaterial der Betroffenen ernst zu nehmen (Kap. 6).
Posing
Posingbezeichnet das erotische Darstellen von Babys und Kindern im Netz. Fotos in Windeln, Nacktfotos, aber auch Kinder beim Turnen werden von Konsument*innen zur sexuellen Stimulierung als Fetisch genutzt, manchmal bearbeitet und als pornografische Darstellung im Netz verbreitet. Seit 2015 sind nun auch solche Dateien/Bilder, die früher als (zum Teil strafloses) Posing eingestuft wurden, als »kinder-/jugendpornografisch« zu bewerten und entsprechend zu behandeln, das heißt strafrechtlich zu verfolgen. Dies gilt auch für selbst hergestelltes Material (Bundeskriminalamt 2021).