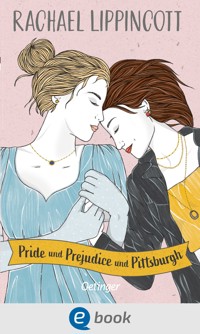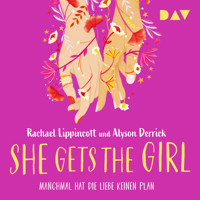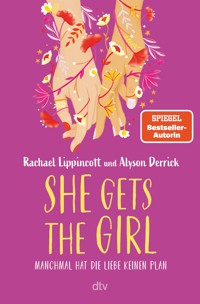
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer verliebt sich hier eigentlich in wen? Der nächste TikTok-Erfolg und NY-Times-Bestseller der Autorin von ›Drei Schritte zu dir‹ endlich auf Deutsch! Für Leser*innen von John Green, Adam Silvera und Jenny Han Unterschiedlicher als Alex und Molly kann man kaum sein: Alex weiß genau, wie man Mädels rumkriegt. Sie dann auch zu halten, ist allerdings nicht ihre Stärke … Molly dagegen tut sich schwer im Umgang mit Menschen. Als die beiden sich eines Abends über den Weg laufen, wittert Alex ihre Chance: Hilft sie der schüchternen Molly, ihre Traumfrau zu erobern, könnte Alex damit endlich ihrer Ex beweisen, dass ihr die Gefühle anderer nicht egal sind. Widerwillig lässt sich Molly auf den Plan ein. Doch bald wird klar: Liebe lässt sich nicht planen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Oft findet man die große Liebe dort, wo man sie nicht erwartet
Alex weiß einfach, wie man Mädels rumkriegt. Sie dann auch zu halten, ist allerdings nicht ihre Stärke … Molly dagegen tut sich schwer im Umgang mit Menschen. Kein Wunder, dass sie gegenüber ihrem Schwarm Cora kein Wort herausbringt. Alex und Molly haben nichts gemeinsam. Als sie sich eines Abends über den Weg laufen und Alex von Mollys Interesse an Cora erfährt, wittert Alex ihre Chance: Hilft sie der schüchternen Molly, ihre Traumfrau zu erobern, könnte Alex damit endlich ihrer Ex beweisen, dass ihr die Gefühle anderer nicht egal sind. Widerwillig lässt sich Molly auf den Plan ein. Doch bald ist nicht mehr klar: Wer verliebt sich hier eigentlich in wen?
Das erste gemeinsame Buch von Bestsellerautorin Rachael Lippincott und ihrer Frau!
Von Rachael Lippincott sind bei dtv außerdem lieferbar:
Drei Schritte zu dir (mit Mikki Daughtry und Tobias Iaconis)
All this time (mit Mikki Daughtry)
Rachael Lippincott / Alyson Derrick
She gets the girl
Aus dem amerikanischen Englisch von Nina Frey
Das hier ist für uns
R.L. & A.D.
Kapitel 1
Alex
Alle Blicke kleben an Natalie Ramirez.
Der Hipstertyp, der sein IPA umklammert, als wär’s sein neugeborener Stammhalter. Das Mädchen in dem ausgewaschenen Nirvana-Shirt, fabrikgegrungt von Urban Outfitters. Brendan hinter der Bar, der vor lauter Ablenkung gar nicht merkt, dass er nicht nur ein, sondern gleich zwei Cola-Rum ohne Rum gemacht hat. Alle sehen zur Bühne.
Ich wische ein paar hartnäckige Feuchtigkeitsringe vom Tresen, schwinge mir mein weißes Barhandtuch über die Schulter und recke den Hals, um über die vielen Köpfe hinweg auch noch was mitzukriegen.
Die Bühnenbeleuchtung taucht alles in ein unwirkliches Lila, tupft Schatten in Flieder und Violett auf ihr Gesicht und lässt ihr langes schwarzes Haar weinrot aufglühen. Ich verfolge, wie ihre Hände am Gitarrenhals auf- und abwandern, ohne dass ein Blick nötig wäre, sie ist eins mit ihrem Instrument. Denn obwohl alle zu ihr schauen, sieht Natalie Ramirez nur mich.
Sie schenkt mir ein kleines, verstohlenes Lächeln. Genau das Lächeln, von dem ich vor fünf ganzen Monaten das Flattern im Bauch gekriegt habe, beim ersten Aufritt ihrer Band im Tilted Rabbit.
Das war eines der besten Konzerte in den drei Jahren, die ich hier arbeite. In unserem kleinen Club treten ausschließlich Bands aus der Gegend auf, weshalb hier jede Menge Möchtegern-Alanis-Morissettes und Freizeit-Coverbands auf der Matte stehen. Erst letzte Woche hatten wir einen Typen da, der einen auf Neutral Milk Hotel machen wollte und eine ganze Stunde lang eine Säge aufkreischen ließ, bis alle außer meinen Kollegen und seiner Freundin das Weite gesucht haben.
Tja, dank der zweifelhaften Musik, den unorthodoxen Arbeitszeiten und der erbärmlichen Bezahlung wechselt hier ständig das Personal. Ich hätte selbst schon vor Ewigkeiten das Handtuch geworfen, aber … meine Mutter braucht das Geld für die Miete. Und ich auch, jetzt, wo ich zur Uni gehe.
Und das ist wahrscheinlich ganz gut so. Denn hätte ich gekündigt, dann wäre ich auch an dem Abend vor fünf Monaten nicht hier gewesen und dann stünde ich jetzt nicht hinter der Bar und finge Natalie Ramirez’ Blick auf.
Mir sackt das Herz in die Magengrube, als mir klar wird, dass ich sie heute wohl vorerst das letzte Mal spielen höre, und sosehr ich auch dagegen ankämpfe, das Gefühl will nicht weichen. Es ist da, während ich mich von meiner bunt zusammengewürfelten Kollegenschar verabschiede, die mich hier an Schulabenden unter der Woche hat lernen lassen, und es ist da, während ich auf Natalie warte, bis sie hinter der Bühne ihren Auftritt begossen hat, den letzten vor ihrer ersten großen Tour nächste Woche, und es ist da, als Natalie und ich uns aufmachen, um meine letzte Nacht in der Stadt genau so zu verbringen, wie ich es mir erhofft habe.
Mit ihr.
Wir sind kaum durch die Tür ihrer winzigen Wohnung mitten im Szeneviertel, da liegen ihre Lippen schon auf meinen, schmecken nach Käsepizza und warmem Bier wie nach jedem Auftritt.
Converse werden abgestreift und Hände streichen mir die Taille hinauf, sie zieht mir mein schwarzes T-Shirt über den Kopf und gemeinsam stolpern wir durch die Wohnung, in die sie letztes Jahr nach ihrem Schulabschluss an der Central High, der Schule am anderen Ende der Stadt, geflüchtet ist.
Diese Wohnung ist den ganzen Sommer über auch meine Zuflucht gewesen und so lotse ich uns mühelos über die abgewetzten Dielen in ihr Zimmer, weiche den Instrumenten ihrer Bandkollegen aus, den herumfliegenden Schuhen. Wir taumeln rückwärts auf ihr ungemachtes Bett, der Lattenrost quietscht, hinter uns fällt die Tür ins Schloss.
Der Moment ist so lebendig, so perfekt, aber das Gefühl von vorhin sitzt mir noch tief in den Knochen. Ich werde den Gedanken an den Bus nicht los, der mich am Morgen Richtung Uni entführen wird. Die Nervosität, die in mir brodelt, weil ich den Ort verlasse, an dem ich mein ganzes Leben verbracht habe. Meine Mutter am anderen Ende der Stadt, vermutlich mit einer halben Flasche Tequila intus, nachdem sie mir den ganzen Nachmittag lang ein schlechtes Gewissen gemacht hat, dass ich sie »sitzen lasse«, wie uns mein Vaters damals hat sitzen lassen.
Aber vor allem möchte ich endlich das Gespräch führen, um das ich mich bislang gedrückt habe. Das Gespräch darüber, wie wir das mit uns auf die Ferne hinbekommen sollen.
Ich konzentriere mich darauf, wie Natalies Haut sich unter meinen Fingern anfühlt, ihr Körper auf meinem, kratze allen Mut zusammen, um mich von ihr zu lösen, um irgendwas zu sagen, da spüre ich ihr sanftes Flüstern auf meinen Lippen.
»Ich liebe dich.«
Ich ziehe sie enger an mich, bin so in Gedanken, dass ich kaum wahrnehme, was sie da gesagt hat. Bin so beschäftigt mit dem, was ich auszudrücken versuche, dass ich es fast erwidere.
Mehr als fast. Mein Mund formt die Worte: »Ich lie–«
Moment.
Plötzlich sind meine Augen offen und mein Herz rast, und ich reiße mich los, weil bei diesen drei Worten Erinnerungen über mir zusammenschlagen, die mit der Situation hier rein gar nichts zu tun haben.
Zerschmetterte Teller, Geschrei. Mein Dad, der sich zu mir niederbeugt und »Ich liebe dich« sagt, um dann in sein Auto zu steigen und davonzufahren, in sein neues Leben.
Ein Leben ohne mich. In dem von ihm nie wieder etwas zu sehen oder zu hören war.
Auf keinen Fall kann ich ihr das jetzt sagen. Nicht so. Nicht, wenn ich diejenige bin, die geht.
Im gelben Licht der Straßenlaterne vor ihrem Fenster sehe ich die Erwartung in ihren Augen und so versuche ich meinen Schreck zu überspielen, indem ich mit den Fingerspitzen am Träger ihres schwarzen BHs entlangfahre.
»Äh, ich … euer neuer Song vorhin, der hat mich echt umgehauen«, flüstere ich im Bemühen, das zu übertünchen, was ich da um ein Haar gesagt hätte. Ich küsse sie wieder, fester, die Art von Kuss, der gewöhnlich signalisiert, dass der Worte jetzt genug gewechselt sind. Doch ihr Satz hängt schwer und hartnäckig in der Luft.
»Alex«, sagt sie und löst ihre Lippen von meinen. Sie blickt mir forschend ins Gesicht, als suche sie etwas.
»Ja?« Ich weiche ihr aus, blicke auf unsere ineinander verwobenen Finger, ihren abgesplitterten schwarzen Nagellack.
»Manchmal …« Sie seufzt tief auf. »Manchmal frag ich mich, was das hier für dich bedeutet.«
Ich lehne mich zurück und sehe sie unter gesenkten Lidern heraus an, wage es schließlich, ihr in die Augen zu sehen. »Was meinst du?«
»Ich meine, dass meine Band jetzt auf Tour geht. Und du morgen weg zur Uni fährst. Du bist dann irgendwo in Pittsburgh«, sagt sie, richtet sich auf und zieht sich das schwarze Haar in einen Knoten, ein sicheres Zeichen dafür, dass mir hier gerade alles durch die Finger rinnt. Rasant.
Langes Schweigen. Ich weiß, dass sie immer noch auf eine Antwort wartet. Darauf wartet, dass ich die Worte sage, die sie hören will. »Das hier ist unsere letzte Nacht und ich möchte wissen, woran ich mit uns bin. Was ich dir bedeute. Dass das hier auf die Ferne funktionieren wird und du nicht einfach abtauchst und dir was anderes auftust. Dass ich nicht einfach nur …«
Na klar, na klar. »Natalie.« Ich rutsche näher an sie heran. »Darüber wollte ich ja mit dir reden. Ich …«
Mein Handy vibriert lautstark auf dem weißen Bettzeug unter uns und das Display erstrahlt mit einer Nachricht von Megan Baker, die zwischen Tonnen von Zwinkersmileys schreibt: Meld dich, wenn du mal wieder im Land bist!
Natalie kneift die Augen zusammen. Jetzt ist sie wütend, als hätte sie die Antwort gefunden, aber nicht die, die sie hören wollte. »Megan Baker? Die, die in dieser Fleetwood-Mac-Coverband die Triangel spielt? Echt jetzt, Alex?«
»Natalie«, sage ich und will ihre Hand nehmen. »Komm schon. Es ist nicht, wie …«
»Nein!«, sagt sie, schubst meine Hand weg und steht auf, mit verkniffenem Gesicht. In ihren braungrünen Augen glitzern Tränen, die aus den Winkeln zu kullern drohen. »Das ist so typisch. Das ist so verdammt typisch. Ich versuch dir näherzukommen und du kommst mir mit so was. Fünf Monate sind wir jetzt zusammen und keinen einzigen davon hab ich dir trauen können!«
»Natalie! Echt jetzt! Das Thema ist doch längst durch! Ich hab mich dreimal mit einer anderen getroffen. Höchstens viermal. Ich hab geglaubt, zwischen uns wär alles kaputt! Ich dachte, es wär aus mit uns.« Ich schwinge die Beine über den Bettrand und stehe auf. Alles fühlt sich so sehr vertraut an, genauso, wie ich den heutigen Abend nicht verbringen wollte. »Und mit Megan hab ich mich gerade ein Mal getroffen. Die ist mir doch so was von egal!«
»Wie soll ich dir in Pittsburgh vertrauen, wenn du schon hier in derselben Stadt solche Nachrichten kriegst?«, fragt sie und blickt finster zu mir auf.
»Wie, solche Nachrichten?«, schnaube ich und halte ihr das Handy hin. »Sie hat mir gute Reise gewünscht und ich hab mich bedankt, mehr nicht. Dann ist sie diejenige gewesen, die …«
»Jetzt gib’s doch einfach zu, Alex! Du bist einfach nicht fähig auch nur irgendeine Unterhaltung zu führen, ohne einen Flirt draus zu machen! Ich hab doch heute Abend gesehen, wie du beim Auftritt an der Bar mit dem Mädchen geredet hast. Genau deshalb hast du dich letzten Monat auch geweigert dein Studium zu verschieben und mit uns auf Tour zu kommen, obwohl ich dich drum gebeten hab. Deshalb bist du jedem Gespräch darüber ausgewichen, wie das mit uns laufen soll, wenn du gehst. Du willst dich lieber quer durch ganz Pittsburgh flirten, als wirklich mit mir zusammen zu sein!« Sie schüttelt den Kopf, ihre Stimme bricht und sie wendet den Blick zum Fenster. »Du hast dich nie für mich entschieden. Du warst nie mit ganzem Herzen dabei.«
Eine vertraute Welle aus Schuldgefühlen schlägt über mir zusammen. Wegen all dieser Dates, die ich anfangs noch hatte, und der paar Male, die ich vielleicht bei meinen Schichten im Tilted Rabbit die Grenze zwischen Reden und Schäkern überschritten habe.
Aber ich bin mit ganzem Herzen dabei. Ich bin während meiner ganzen Highschoolzeit mit niemandem so eng gewesen wie mit Natalie. Ich habe immer versucht alles unverbindlich zu halten, weil … ich nie wollte, dass jemand die Wahrheit kennt. Die Seite von mir, die ich verborgen halte. Ein kaputtes Familienleben und eine Mutter, die zu besoffen ist, um sich um sich selbst zu kümmern, und schon gar nicht um mich.
Aber Natalie ist anders.
Sie war anders, seit sie nach unserer dritten Verabredung versucht hat mich mit Take-away-Essen zu überraschen und meine Mutter im Vollsuff vor unserer Haustür gefunden hat. Danach habe ich mich zwei Wochen vor Scham nicht bei ihr gemeldet, mich mit anderen getroffen, weil ich mir sicher war, dass es damit vorbei wäre mit uns, aber … sie hat nicht aufgegeben. Sie ist der einzige Mensch, der je nah genug an mich herangekommen ist, um die Wahrheit zu erfahren, und trotzdem nicht das Weite gesucht hat, trotz meines Ballasts.
Aber jetzt ist ihr Ton eisig. »Du hast vielleicht tausend Nummern im Handy, aber wenn’s drauf ankommt, hast du ohne mich niemanden. Du bist allein.«
Das trifft mich wie ein Keulenschlag. Wir haben uns schon oft gestritten, aber so habe ich sie noch nie erlebt. »Allein? Was soll der Quatsch!«
»Quatsch? Freundschaften. Beziehungen. Du schubst doch jeden Menschen weg, der dir zu nahe kommt. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch hier bin! Wir sind seit fünf Monaten zusammen und ich hab noch nie jemanden kennengelernt, mit dem du befreundet bist! Nur Frauen, mit denen du mal irgendwann was hattest! Was anderes gibt’s bei dir nämlich nicht, Alex. Du hast keine Freunde!« Sie wendet sich wieder zu mir. »Ich bin hier und du bist mir wichtig. Ich hab dich während dieser ganzen Scheiße mit deiner Mutter unterstützt, was kein anderer Mensch je tun würde. Echt, du hättest eben beinahe ›Ich liebe dich auch‹ gesagt, Alex. Ich weiß, dass es so ist«, sagt sie. »Aber dann hast du es dir gerade noch verkniffen. Warum?«
»Ich … ich weiß nicht. Ich hab nur …«
Ich schwimme. Ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll, dass ich so was nie, nie im Leben erwartet hätte.
»Also gut, Alex«, sagt sie und verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich geb dir noch eine Chance. Sag mir, wie du wirklich empfindest. Sag mir, dass du mich auch liebst.«
Jetzt hat sie mich in die Enge getrieben und das weiß sie auch. Warum tut sie das? »Natalie, schau, ich …«
Meine Stimme erstirbt.
»Wow.« Natalie schnaubt und schüttelt den Kopf. »Manchmal glaub ich echt, du endest genau wie deine Mutter.«
Ich stehe da, völlig gelähmt. Gerade sie muss doch wissen, was für ein Schlag unter die Gürtellinie das ist. Dass ich nichts auf der Welt so sehr fürchte wie das.
Ich versuche mich auf den Beinen zu halten, doch das Zimmer um mich schrumpft zusammen und in meiner Brust wird es eng, als ich gegen die Erinnerungen ankämpfe, die jetzt auf mich einstürzen. Meine Eltern, die sich durchs ganze Haus anschreien. Splitterndes Geschirr. Das Autoheck meines Vaters, das in der Ferne verschwindet.
Und zum ersten Mal in fünf ganzen Monaten will ich einfach nur weglaufen, so wie ich es immer getan habe.
Ich schnappe mir mein T-Shirt und ziehe es mir wütend über den Kopf. »Du glaubst wohl, du weißt alles, hä? Du willst wissen, was ich fühle, Natalie?«, sage ich und Angst und Zorn brechen aus mir heraus. »Gerade fühle ich, du weißt einen Scheißdreck über mich!«
»Und wer ist dran schuld?«
Wir starren einander lange an, ihre Brust hebt und senkt sich, ihr Schlüsselbein tritt scharf hervor.
»Verschwinde«, sagt sie schließlich mit gesenkter Stimme.
Ich unternehme nicht mal den Versuch, ihr zu widersprechen. »Mit Freuden«, sage ich und pflastere mir ein Grinsen ins Gesicht, als wäre es mir so was von egal. Es fühlt sich vertraut an und ich kann es nicht ab.
Ich dränge mich an ihr vorbei aus dem Schlafzimmer, schnappe mir meine Sporttasche vom Boden und hänge sie mir über die Schulter, während ich zornig in meine Schuhe schlüpfe. Die Ferse klappt mit nach innen und ich muss sie mit einer Fußbewegung wieder an ihren Platz schieben und gleichzeitig die Wohnungstür aufreißen.
Mit einem letzten bösen Blick schnappe ich mir meinen Koffer, das Lächeln auf der Bühne ist lang vergessen, die Schmetterlinge, die mir seit fünf Monaten im Bauch herumflattern, sind hiermit offiziell plattgemacht. Mit aller Kraft, die ich aufbringen kann, und genug Wumms, um die alte Mrs Hampshire zwei Stockwerke tiefer in Rage zu versetzen, knalle ich die Tür hinter mir zu.
Mit schwirrendem Kopf renne ich die abgetretenen Stufen hinunter, mein Koffer rumpelt geräuschvoll hinter mir her. Ich dränge mich aus der Tür und hinaus auf die Straße, versuche mich abzuregen, aber die warme Luft der späten Augustnacht befeuert meinen Zorn nur noch mehr.
Es ist mitten in der Nacht und immer noch keinen Hauch kühler.
Ich stürme die Straße hinunter und knalle an der Ecke zur Hauptstraße fast in eine Gruppe von Nachtschwärmern, sehe überall verschwommene Gesichter und Formen und Farben. Ich drehe meinen Kopf zur Seite und werde langsamer, als ich das kleine Café erkenne, in dem wir bei unserem ersten Date waren. Hier haben wir über ihre Band, die Cereal Killers, und meinen bevorstehenden Schulabschluss geredet und unsere Lieblingsorte in der Stadt.
Neben dem Café ist das Diner, wo wir jeden Sonntag den hinteren Ecktisch belegt und abwechselnd unsere Riesenpfannkuchen gegessen und uns geküsst haben.
Dort hätten wir auch morgen früh sein sollen, vor meiner Abreise, aber jetzt …
Ich ziehe den Kopf ein und schaue weg. Meine Wut weicht einem anderen Gefühl. Trauer. Um diese Samstage im Diner, um die gemeinsame Nacht, die wir hätten haben können, und um dieses Mädchen, das geblieben ist, obwohl es meine schlimmsten Geheimnisse kannte. Auch wenn es mir die gerade alle vor die Füße gekotzt hat.
Unter schwerem Keuchen erreiche ich die Straßenbahnhaltestelle. Ich breche auf einer Bank zusammen und ziehe mein Handy raus. Das Display leuchtet auf, es ist erst … ein Uhr früh.
Ein Uhr morgens? Scheiße. Mein Bus geht erst um acht.
Und … ich kann nicht nach Hause. Ich kann nicht noch eine weitere Nacht meine Mutter vom Boden kratzen, während sie mir vorhält, dass ich weggehe. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann fürchte ich, dass ich für immer dort bleibe.
Also, wo zur Hölle soll ich …
Mein Blick fällt auf Megans Nachricht.
Wäre … einen Versuch wert. Sie beginnt gerade ihr zweites Semester in Temple und ihr neues Wohnheim ist nicht weit vom Busbahnhof.
Ich tippe auf die Nachricht, dann auf Anrufen und halte den Atem an, während es klingelt.
»Hallo?«
»Hey, Megan«, sage ich und spüre, wie Erleichterung mich durchflutet, weil sie rangegangen ist. »Kann ich vorbeikommen?«
»Ach«, sagt sie und ihre Stimme verändert sich fast unmerklich. »Ich fände es sehr schön, wenn du … vorbeikommst.«
Wie peinlich kann man sein. Himmel. Kein Wunder, dass Natalie sich so aufgeregt hat über meine Verabredung mit ihr.
»Also, ich mein«, sage ich und schiebe das Handy ans andere Ohr, »ich will eigentlich … nur schlafen, weil mein Bus erst um acht Uhr morgens fährt, aber …«
Aber … Was hab ich groß zu verlieren? Mit Natalie ist grad alles in die Brüche gegangen. Und Megan ist offensichtlich nicht auf der Suche nach irgendwas Ernstem. Wär’s denn wirklich so schlimm, alles zu vergessen, nur eine Nacht lang?
»Oh«, sagt sie schnell, bevor ich auch nur die Chance zum Zurückrudern habe. »Könntest du schon, aber … meine Mitbewohnerin ist krank.«
»Julie?« Ich runzle die Stirn. »Die war doch vorhin auf Natalies Konzert. Die hat …«
»Ja, ich glaube … ich glaube, das ist erst hinterher losgegangen.« Mit gedämpfter Stimme gibt sie vor, ihrer Mitbewohnerin etwas zuzurufen. »Was sagst du, Julie? Du musst kotzen? Warte, ich komm und helf dir!«
Wow, diese Frau lügt echt schlecht.
»Alex! Ich glaub, ich muss«, sagt sie im Versuch, ihre One-Woman-Show zu Ende zu spielen. »Julie musste gerade …«
Ich lege mitten im Satz auf, damit sie ihren Auftritt abbrechen kann.
Seufzend öffne ich meine Kontakte und scrolle sie nach jemand anderem durch. Allein schon unter A eine meterlange Liste. Mit Megan hat Natalie vielleicht richtiggelegen, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht noch eine Million anderer Leute kenne, bei denen ich unterkommen kann.
Mein Blick wird glasig, als ich bei einzelnen Namen hängen bleibe: Melissa, Ben, Mike. Kolleg:innen, die immer Bekannte geblieben sind. Leute, mit denen ich hinter der Bar oder in der Schule zusammengearbeitet habe – jeder Chat, den ich aufrufe, ist abgebrochen, weil ich einfach … den Kontakt zu ihnen verloren habe, Monate vergangen sind, in denen ich auf Fragen oder Einladungen nicht geantwortet habe, weil ich so überlastet war mit Schularbeiten und der Versorgung meiner Mutter, dass ich für nichts anderes Zeit hatte.
Aber jetzt geht mir auch auf, dass die meisten nur … Leute sind, mit denen ich was hatte. Oder vermutlich was hätte haben können, genau wie Natalie meinte. Jede Menge davon. Mädchen, mit denen ich einfach nur geflirtet habe, um zu schauen, was geht. Bei denen ich wusste, dass ich mich nie auf mehr einlassen würde als auf diesen Moment.
Ein paar haben noch nicht mal Namen.
Braune Haare, Starbucks.
Sommersprossen, Pizzeria.
Allein davon gibt’s schon zehn. Vielleicht mehr. Einfach irgendeine nichtssagende Beschreibung eines Mädchens und dahinter, wo ich es getroffen hatte.
Ich scrolle weiter, bis das Display einen Hüpfer macht, weil ich unten angekommen bin. Niemand dabei, den ich um ein Uhr in der Nacht anrufen kann. Nichts außer dem Busbahnhof, wo ich sieben Stunden herumsitzen und auf den Bus warten werde.
Du bist allein. Natalies Stimme hallt in meinem Kopf, ihr vielsagender Blick benebelt mich.
Aber hey, ich musste mich schließlich um meine Mutter kümmern. Und es war klar, dass ich irgendwann weggehen würde. Nach Pittsburgh. Die meisten dieser Menschen würde ich nie wiedersehen. Natürlich habe ich den Kontakt abgebrochen. Die flüchtigen Bekanntschaften, die Aufrisse, die Freundinnen und Freunde, mit denen ich außerhalb der Schule fast nie ein Wort gewechselt hatte, weil niemand wissen sollte, wie es bei mir zu Hause zugeht.
Der einzige Mensch, an dem ich je festgehalten habe, war sie. Bis heute Abend.
Ein heißer Windstoß und direkt vor mir bremst unter lautem Kreischen eine Bahn. Taub stolpere ich hinein und sinke auf einen der blau gepolsterten Sitze. Ich stütze die Arme auf die Knie, drücke die Augen zu und reibe mir das Gesicht. Ich kann ihre Worte nicht abschütteln, weil deren Wahrheit mich so kalt erwischt hat.
Sie hatte recht. Sie hat mich besser durchschaut als ich mich selbst.
Sie hat gesagt, dass sie mich liebt, und ich habe mir verboten es zu erwidern. Sie hat mich gebeten ihr zu sagen, was sie mir bedeutet, und ich habe es nicht über mich gebracht.
Ich konnte ihr einfach nicht sagen, dass die Samstagvormittage mit ihr der schönste Teil meiner Woche sind. Dass ihre Songtexte mich berühren, wie kein anderer das je getan hat, und dass ich mich, wenn ich sie auf der Bühne sehe, so … leicht fühle, als hätte ich keinerlei Sorgen. Ich konnte ihr nicht sagen, wie dankbar ich diese letzten Monate gewesen bin, dass sie für mich da war, trotz all dieses Mists mit meiner Mom.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ohne ihre Unterstützung morgen in diesen Bus steigen könnte.
Aber das habe ich ihr alles nicht gesagt. Gar nichts habe ich ihr gesagt. Ich habe es versaut, weil sie wollte, dass ich für sie Wunder vollbringe, und das habe ich noch nicht fertiggebracht.
Sie ist der erste Mensch, den ich nicht verlieren will, und trotzdem bin ich hier, auf der Flucht.
Was stimmt bitte nicht mit mir?
Ich schlucke mühsam den dicken Kloß in meinem Hals hinunter, sehe, wie Philadelphia hinter der Scheibe an mir vorbeisaust, und weiß, dass ich etwas ändern muss.
Keine Ahnung, wie ich das wiedergutmachen soll, aber ich habe die ganze Reise nach Pittsburgh vor mir, um es herauszufinden.
Kapitel 2
Molly
Kaum bin ich wach, ringe ich schon nach Luft, weil mein uralter, zentnerschwerer Labrador sich voll auf mein Bett wirft und mir seine gelbe Riesenpfote direkt in die Niere bohrt.
»Leonard, runter da!« Ich versuche meine Stimme ein paar Oktaven tieferzulegen, aber es ist sinnlos. Er hört nur auf meinen Vater. Die nächsten fünf Minuten attackiert er mich mit seinen Zuneigungsbekundungen und trampelt mir auf jedem Organ einzeln herum, um schließlich nach getaner Arbeit zufrieden hinunterzuspringen.
Dieses Aufwachritual werde ich nicht vermissen.
Zumindest nicht allzu sehr.
Ich wische mir den Sabber vom Gesicht und taste auf dem Nachttisch nach dem Handy, stoße jedoch nur an den Stapel meiner fünf frisch etikettierten Ordner. Gestern Abend bin ich mit allen Vorbereitungen fertig geworden und bereit für das anstehende Semester. Was könnte schöner sein als so eine Nacht – nur ich und meine Etikettiermaschine.
Ich lange an den Ordnern vorbei und ziehe mein Handy vom Aufladekabel. Und zum zehntausendsten Mal diesen Sommer rufe ich Cora Myers’ Twitteraccount auf, wobei ich achtgebe, ihr nicht versehentlich zu folgen.
Gestern bin ich um halb zehn eingeschlafen, genau wie immer, und habe deshalb ihren spätabendlichen Tweet verpasst: Morgen werde ich offiziell eine Pantherin! #pittrules
Eine Übelkeitswelle überrollt mich, aber grinsen muss ich doch, als ich mir das Handy ans Herz drücke.
Heute.
Drei Monate ist es her, seit wir mit der Schule fertig sind.
Siebenundachtzig Tage, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe.
Nur damit es klar ist: Ich folge ihr nicht an die Uni. Ungefähr die Hälfte meiner Schule studiert an der Pitt. Wir gehören nur einfach zufällig beide zu dieser Hälfte.
Und … wenn man mich fragt, es kommt mir echt vor wie Schicksal. Als täte mir das Universum endlich mal einen Gefallen nach den letzten vier beschissenen Jahren.
Ich habe aufrichtig versucht den Sommer über auf andere Gedanken zu kommen, aber wenn man ein Mädchen wie Cora Myers kennt, dann ist so ein Vorhaben zum Scheitern verurteilt.
Also, vielleicht ist »kennt« etwas hochgegriffen, aber sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit sie in der Neunten in einem roten Vintage-Samtmantel und ein Paar überdimensionalen, sich völlig damit beißenden gelben Kampfstiefeln in den Aufenthaltsraum gekommen ist.
Aber mir haben sie trotzdem gefallen.
Und da war ich nicht die Einzige.
Sie hatte eine richtige Sogwirkung. Alle haben sich ganz automatisch um sie geschart, vor jeder Stunde, auf den Gängen, nach dem Unterricht, aber ihr scheint das nie zu Kopf gestiegen zu sein. Sie war nie gemein, hat nie jemanden ausgeschlossen und sie war immer sie selbst, egal in welcher Gesellschaft. Als könnte sie sich mit jedem über alles unterhalten.
Nicht, dass sie sich je mit mir unterhalten hätte, aber man bekommt eigentlich immer alles mit, was zwei Tische weiter passiert.
Es ist auch nicht so, dass ich nicht mit ihr hätte reden wollen. Ich bin nur nicht gut darin, auf Leute zuzugehen, Freundschaften zu schließen. Wenn man so viel Zeit damit verbringt, sich darüber zu sorgen, was man sagen soll und wie man es sagen soll, und es dann trotzdem noch verbockt, dann wird es irgendwann leichter, einfach ganz den Mund zu halten.
Dieses Jahr muss ich allerdings nicht mehr die stille Molly Parker mit der quälenden Sozialphobie sein. An der Pitt kann alles anders werden.
Ich bin jetzt Studentin. Ein Neuanfang, eine Chance, mich neu zu erfinden. Es heißt immer, an der Uni wird alles besser und daran muss ich einfach glauben. Es muss ja mehr geben als das.
Es muss besser werden.
Ich glaube nicht, dass ich noch vier weitere Jahre so …
Schepper.
Eine riesige vollgepackte Kiste. Irgendwas krachte so laut auf den Fliesenboden, dass es bis nach oben durch meine Dielen hallt.
Mom.
Obwohl ich ihr gestern tausendmal gesagt habe, dass alles, was ich brauche, schon im Auto ist, weiß ich genau, dass sie gerade noch mehr Schrott zusammenpackt, den ich mitnehmen soll. Und wenn ich da jetzt nicht runtergehe, dann wird sie noch das gesamte Haus in den Kofferraum ihres SUVs stopfen.
Ich atme tief durch, springe aus dem Bett und nehme zwei Stufen auf einmal. Als ich in die Küche schaue, sehe ich meine Mutter dort herumwirbeln, sie reißt Schubladen und alle Oberschränke auf, an die sie mit ihren eins fünfzig rankommt. Ihr graubraunes kinnlanges Haar hat sie seitlich mit einer schwarzen Spange festgeklammert.
»Wo steckt jetzt dieser Hurensohn?«, murrt sie, so auf die Jagd nach dem Irgendwas konzentriert, dass sie mich nicht mal bemerkt. Ich höre die Zeitung rascheln und sehe die graugrünen Augen meines Vaters über die Pittsburgh-Post-Gazette hinweg aus der Frühstücksecke zu mir rüberblicken.
Seine Augenwinkel runzeln sich, wie immer, wenn er lächelt.
»Schön, dass du wach bist.« Er kichert schon jetzt über das, was er gleich sagen wird. »Dachte schon, ich muss dich auf die Seite rollen, damit du dich nicht wund liegst.« Ein echter Charlie-Parker-Kracher, gleich auf nüchternen Magen.
»Es ist erst halb neun«, sage ich und schneide eine Grimasse. Lachen würde ihn nur noch ermutigen.
»Molly!« Bei meinem Anblick wird aus dem finsteren Blick meiner Mutter sofort ein Grinsen. Einzelne Haarsträhnen fliegen um ihr rundes Gesicht, als sie auf mich zusaust, um mich zu umarmen. Auch ich lege beide Arme um sie, einen oben, einen unten, sonst muss ich es gleich noch mal machen, »weil es sich nicht richtig angefühlt hat«. Sie führt sich auf, als zöge ich in den Krieg, aber obwohl sie mir fast die Luft raubt wie Leonard, kann ich kaum so tun, als würde es mir nicht in Zukunft fehlen.
Als sie mich freigibt, gehe ich zu den Schränken, schließe ein paar Türen und stupse unterwegs eine Schublade mit der Hüfte zu. Mein Ordnungszwang stammt mit Gewissheit nicht von meiner Mutter. »Was wird das hier?«
»Ich hab ihr gesagt, sie soll’s lassen«, mischt sich mein Vater ein, ohne von seiner Zeitung aufzublicken.
»Ach, mach dein Kreuzworträtsel, Charlie.« Meine Mutter wedelt ihn fort und schickt sich an einen weiteren Schrank zu durchwühlen. »Ich such noch ein paar Dinge für dich zusammen. Nur noch einen Quirl und ich hab’s, aber ich find meinen Ersatz nicht.«
»Mom«, sage ich mit größtmöglicher Bestimmtheit, »ich brauche keinen Quirl.«
»Jeder braucht einen Quirl«, entgegnet sie, als sprächen wir hier von einer Toilette oder so.
»Was soll ich in einem Wohnheimzimmer mit einem Quirl?«, frage ich sie in der Hoffnung, einen Hauch von Logik in dieses morgendliche Gespräch zu bringen, doch sie wühlt sich nur weiter durch die Schränke.
Ich bücke mich und öffne den Karton, den sie gerade befüllt, völlig verwirrt von seinem Inhalt: eine Rolle Frischhaltefolie, den Tacker aus unserer Chaosschublade, einen Spachtel, zwei Dosenöffner, eine Teflonpfanne.
»Mom, nichts davon brauche ich!« Ich lege ihr meine Hand auf den Arm, damit sie nicht noch eine Schublade aufreißt.
»Aber was, wenn doch?«, fragt sie mit leicht bebender Stimme. »Was, wenn du was brauchst und es nicht hast? Was, wenn du mitten in der Nacht Hunger bekommst …«
»Dann muss ich mir eben selbst zu helfen wissen.« Ich zerre sie von der Schublade weg, zwinge sie mich anzusehen. Ihre Augen sind tränennass.
»Bitte geh nicht weg«, sagt sie, auch wenn sie es nicht so meint. Oder es zumindest versucht.
»Mom, ich krieg das schon hin«, versichere ich überzeugter, als ich es bin.
»Aber ich nicht«, gibt sie mit einem jämmerlichen Lachen zu.
Ich umarme sie noch mal, denn, so bescheuert es auch klingt – wir sind im Grunde beste Freundinnen. Wir haben einander nie so genannt, aber das muss man auch nicht, wenn man sich so nahe ist. Sie war die ganze Highschoolzeit hindurch meine beste Freundin. Meine einzige Freundin, um ehrlich zu sein.
Aber jetzt muss ich mich irgendwie von ihr verabschieden, von diesem Menschen, der immer an meiner Seite war. Es fühlt sich unmöglich an, aber wenn dieses Jahr alles anders werden soll, muss ich sie ein bisschen loslassen.
Und sie muss mich ein bisschen loslassen.
»Molly, wir müssen in ungefähr einer Stunde los. Wenn wir noch länger warten, dann packt sich deine Mutter noch selbst in eine der Kisten«, sagt mein Vater und meine Mutter wirft ein Handtuch nach ihm.
***
Eine Stunde darauf sind wir offiziell unterwegs zur Pitt. Mein Dad hat angeboten mein Auto runterzufahren und so sitze ich alleine mit meiner Mutter in ihrem SUV und bereue es schon, weil sie mir unterwegs einfach alles zeigt, was irgendwie vertraut ist. Meine alte Schule, das Kino, die Rollschuhbahn abseits der Straße, wo ich so viele Abende mit meinem Bruder Noah verbracht habe. Ich reiße den Blick los, die Erinnerungen machen den Abschied nur noch schwerer.
Zum Glück ist alles sofort nach der Ankunft wie weggeblasen, denn am Campus regiert der Wahnsinn. Jeder Kofferraum in Sichtweite ist aufgerissen, Minikühlschränke, Bettdecken und Ikeamöbel verstopfen die Straße. Die Gehwege sind voller Eltern, die vergeblich versuchen ihre jüngeren Kinder einzufangen. Ein Mädchen in einem Unifußballpulli verliert die Kontrolle über seine riesige Umzugskarre und sieht entgeistert zu, wie diese ein geparktes Auto rammt. Dann sehe ich entgeistert zu, wie es einfach mir nichts, dir nichts in die andere Richtung davonschlendert. Nur zur Sicherheit lassen wir Dad zurück, um das Auto zu bewachen, nachdem er meins auf dem Studierendenparkplatz abgestellt hat.
»Hi! Willkommen an der Pitt!«, begrüßt mich ein perfekt frisierter Typ, als ich mit meiner Mutter im Schlepptau den Hof betrete. »Ich kann dir beim Einchecken helfen«, fügt er hinzu und führt mich an einen Tisch. Ich gebe ihm all die notwendigen Unterlagen und er überreicht mir eine Begrüßungstasche und meinen Studierendenausweis mit dem völlig überbelichteten Foto, das in der Orientierungswoche im Sommer von mir gemacht worden war.
»Wie findet sie raus, wer ihre Mitbewohnerin ist?«, fragt meine Mum und tritt an den Tisch.
»Oh!« Der Typ runzelt die Augenbrauen. »Die Mail hättest du schon vor Monaten bekommen sollen.«
Aber … ich hab doch ganz regelmäßig in mein Postfach geschaut, ich kann sie auf keinen Fall übersehen haben. Oder? Mir rutscht das Herz in die Hose, aber die Art von Ersti will ich nun wirklich nicht sein.
»Ach, okay, ich schau noch mal«, sage ich.
»Gibt’s denn sonst keine Möglichkeit, das rauszufinden? Sie hat keine Mail bekommen«, mischt sich meine Mutter ein und schon bekomme ich eine Gänsehaut. Wünsche mir, dass sie mich wenigstens einmal etwas selbst regeln lässt.
»Mom, schon okay«, flüstere ich ihr zu. »Das find ich eh raus, wenn ich reingeh. Außerdem ist Noah gleich da, oder?« Ich bedanke mich bei dem Typen und zerre meine Mutter weg vom Tisch.
Zum Glück funktioniert die Ablenkung.
»Er hat gesagt, er kommt mit dem Rad und … trifft uns im Hof. Ist das hier der Hof?«, fragt sie. Ich nicke, sehe mich unter den vier identischen Wohnheimen nach … da hinten! … Holland Hall um.
»Ich renn schnell rauf und schau mir mein Zimmer an. Bin gleich wieder da«, versichere ich, doch sie bleibt mir trotzdem auf den Fersen. »Mom, kannst du hier warten und nach Noah Ausschau halten?« Ich lege einen Zahn zu, ohne eine Antwort abzuwarten. Eigentlich möchte ich doch gerne, dass sie dabei ist, wenn ich das neue Zimmer sehe, aber ich rufe mir immer wieder in Erinnerung, dass es jetzt anders laufen muss. Und damit es anders läuft, ist es einfach nicht drin, dass meine Mutter mit reinplatzt, wenn ich zum ersten Mal meine Mitbewohnerin treffe.
Beide Türen stehen offen und ein ständiger Strom von Mädchen fließt hinein und heraus. Der Fahrstuhl scheint hoffnungslos belegt und so renne ich die fünf Treppen bis zu meinem Zimmer hinauf und bleibe genau vor der Tür stehen, versuche zu Atem zu kommen und mich zu wappnen.
Erster Eindruck, Molly. Dein neues Ich. Du kannst das. Du musst nur sagen: »Hi, ich bin Molly.«
Tief durchatmen.
Ich öffne die Tür und erwarte meine Mitbewohnerin, doch was sich mir stattdessen bietet, wirft mich fast um.
»Das ist ein Scherz«, flüstere ich, während ich mich in dieser Schuhschachtel von einem Zimmer umsehe.
Ein Bett. Ein Schreibtisch. Obwohl es meine letzte Wahl war. Obwohl ich eigens gebeten habe, alles zu bekommen, nur das nicht.
Ein Einzelzimmer.
Als täte ich mich nicht schon schwer genug damit, Freundschaften zu schließen, jetzt muss ich auch noch in Einzelhaft leben. Ich trete ein, blicke mich in meinem Zimmer um, während ich die Mädchen auf dem Flur höre, wie sie mit ihren Zimmergenossinnen darüber verhandeln, wo was hinkommen und wer welche Seite belegen soll.
»Hey, Moll, wohin damit?«, fragt eine Stimme hinter mir und lässt mich kurz mein Leid vergessen. Ich drehe mich um und erblicke einen riesigen Kistenstapel, der den ganzen Flur verstopft, und darunter zwei muskulöse Beine, die unter dem Gewicht meiner gesammelten Besitztümer beinahe zusammenbrechen.
»Hey, Noah«, sage ich und bei seinem Anblick wird mir leichter zumute. »Du weißt schon, dass es für so was Karren gibt.« Ich hüpfe auf meine Plastikmatratze, um ihm Platz zu machen, und mit einem Rums stellt er alles auf dem Boden ab. Ein paar Sekunden lang ringt er nach Luft, die Hände auf den Knien.
»Voilà, zwei perfekt funktionierende Karren«, sagt er und tätschelt seine Bizepse. Ich verdrehe die Augen. »Ist doch mein Job als großer Bruder«, grinst er und fällt mir um den Hals.
»Charlie, hör auf mir in die Hacken zu fahren!« Die Stimme meiner Mutter hallt durch den Flur. Sie lacht so laut, dass ich die Leere im Zimmer vergesse. Noah und ich drehen uns zur Tür, durch die meine Eltern gerade einen Rollwagen mit einer weiteren Ladung meiner Sachen ziehen.
Das Lächeln meiner Mutter erstirbt, sobald sie mein Zimmer von innen sieht.
»Die haben dir ein Einzelzimmer gegeben!«, sagt sie fassungslos.
»Ja, so ein Glück, was? Mann, ich hätte echt einen Mord begangen, um an ein Einzel zu kommen«, sagt Noah und pflanzt sich auf meinen Schreibtisch.
»Ja, das ist echt toll, Molly. Dein eigenes kleines Reich«, ergänzt Dad.
Ich sehe zu meiner Mutter, dem einzigen Menschen, der überhaupt nachvollziehen kann, was das für mich bedeutet. Dem einzigen Menschen, der weiß, dass dies meine realistischste Chance auf ein reibungsloses Sozialleben an der Uni gewesen wäre.
Ich wende den Blick ab, bevor sie etwas sagt, denn darüber zu sprechen wäre noch schmerzhafter. Also stürze ich mich in das, was jetzt getan werden muss. Organisieren. Meine Leidenschaft.
Noah und Dad bringen eine Ladung nach der anderen rauf, während meine Mutter und ich alles an seinen Platz räumen. Ich versuche jeden Gedanken an das zu verdrängen, was ich mir von einer Mitbewohnerin erhofft habe. Die vielen Nächte, die wir wach im Bett verbringen sollten, um all die aufregenden Dinge zu besprechen, die einem hier passieren, oder die mitternächtlichen Ausflüge zur Hauptmensa, um uns die berühmten Pitts-Waffeln mit Eis zu beschaffen, von denen Noah mir vorgeschwärmt hat. Ich versuche zu verdrängen, dass ich dieses Zimmer mit ihr hätte einrichten sollen und nicht mit meiner Mutter.
»Also, ich hab mir gedacht«, sagt meine Mom, als ich mich neben sie auf den Boden setze, um ein paar T-Shirts neu zu falten. »Warum bestellst du dir nicht was zu essen und lädst ein paar der Leute auf deinem Stockwerk ein dich zu besuchen?« Sie versucht es als aufregend zu verkaufen, aber das Mitleid in ihren Augen ist mir nur allzu vertraut.
»Die haben gerade genug damit zu tun, ihre eigenen Mitbewohnerinnen kennenzulernen. Und ich kenne niemanden, den ich fragen könnte«, sage ich und senke den Blick wieder auf das Oberteil, das ich gerade zusammenlege.
»Was ist mit Cora?« Sie knufft mich spielerisch. »Vielleicht hat die ja Zeit?«
»Können wir jetzt bitte nicht darüber sprechen? Lass uns lieber alles in Ruhe zusammenlegen«, sage ich, aber sie kann es einfach nicht lassen. Wie jede wahre beste Freundin weiß sie wie keine andere, wie sie mich quälen kann, und heute scheint sie auf Hochtouren.
»Warum schreibst du ihr nicht, ob sie heute Abend was mit dir machen will?«
»Mom«, sage ich entschieden und drehe mich zu ihr um. »Ich kann sie nicht einfach so fragen, ob sie was mit mir machen will, okay? Das ist nicht …« Ich seufze frustriert auf, nehme mir mein Handy und tue so, als würde ich tippen. »Hallo, Cora. Ich bin dir völlig unbekannt und ich hab noch nicht mal deine Nummer, aber wir waren auf derselben Schule und ich bin eigentlich verliebt in dich.«
»Wieso solltest du das nicht können? Also, irgendwer hier hat doch bestimmt ihre Nummer. Der letzte Teil ist vielleicht etwas gewagt, aber …« Sie hört endlich auf und kichert. »Was weiß ich schon?«
»Oh Gott.« Ich schubse sie um und sie setzt sich sofort wieder auf. »Du treibst mich echt in den Wahnsinn.«
»Ich mein’s ja nur gut. Das weißt du, oder?«, fragt sie und ich nicke. »Okay, wenn du das mit Cora nicht willst, wie wär es, wenn ich morgen wiederkomme und wir gehen einkaufen oder so was?«
»Mom …« Ich halte inne, um mich zu sammeln, damit ich das auch ja richtig hinbekomme. Schrecklich, dass ich am liebsten zustimmen würde. Aber genau das sagt mir, dass ich ihr das jetzt klarmachen muss. Ich möchte sie nur nicht zu sehr verletzen. »Es ist unheimlich wichtig für mich, dass es an der Uni anders läuft. Okay?« Ich blicke auf, ihr in die Augen. »Es wird schon schwer genug für mich, das hinzukriegen. Wenn du jetzt noch die ganze Zeit hier aufkreuzt, dann weiß ich nicht, ob ich jemals andere Freundschaften schließe. Und ich kann nicht, ich kann nicht noch mal vier Jahre so weitermachen.«
Sie wirkt etwas verletzt, aber hauptsächlich schuldbewusst.
»Ich weiß. Ich weiß. Es tut mir leid.« Sie schlingt die Arme um sich und drückt zu. »Ich lasse dich in Ruhe«, sagt sie.
Kurz schaue ich sie misstrauisch an, weil ich kaum glaube, dass sie dazu wirklich fähig ist. »Ich verspreche es!«, fügt sie hinzu und streckt mir ihren kleinen Finger hin, und endlich kann ich lachen.
»Okay. Wenigstens ein Weilchen«, entgegne ich und hake meinen ein.
»Also, das wär’s dann«, verkündet mein Vater und erscheint neben Noah in der Tür. »Wie sieht’s aus, Beth?«
Jetzt?
Das geht alles viel zu schnell. Gerade hab ich noch davon geredet, wie sehr ich will, dass alles anders wird. Aber … doch nicht jetzt gleich, in dieser Minute.
Hinter meinen Augen drücken die Tränen, denn jetzt liegt er in der Luft, der Abschied, den ich den ganzen Tag gefürchtet habe.
Mom erhebt sich ächzend vom Boden und streckt die Beine. »Ich glaube, wir sind hier durch. Es sei denn, du willst noch, dass ich dir beim Zusammenlegen helfe, Molly?« Sie blickt zu mir herab, als zwinge sie sich meine Bitte zu erfüllen, obwohl es ihr völlig gegen den Strich geht.
Ich werde noch zusammenbrechen, wenn sich dieser Abschied weiter in die Länge zieht.
»Geh ruhig mit. Ich krieg das hin«, sage ich mit Blick auf den Klamottenstapel.
»Bist du sicher?«, fragt sie.
Kein bisschen. »Absolut.«
Ich umarme meinen Vater hastig, weil ich weiß, dass ich ihn nicht so aufgewühlt sehen soll. Aber ich merke trotzdem, wie er mit sich ringt und die Augen aufreißt, damit er nicht weint.
»Gut, dass du jetzt in der Stadt bist«, sagt Noah mit einem Lächeln und zieht mich in eine einarmige Bro-Umarmung. Ich bin wirklich dankbar, dass er in der Nähe wohnt. »Meld dich, wenn du was machen willst. Und Molly?«, sagt er, als er schon halb durch die Tür ist. »Türen offen, wen getroffen.« Er schwingt die Tür weit auf und folgt meinem Vater auf den Flur. Als wäre es so leicht jemanden kennenzulernen, indem man einfach seine Tür offen lässt.
Aber bei ihm war es wahrscheinlich so. Für Noah war immer alles einfach – Freundschaften schließen, Sport machen. Irgendwie hat er es sogar zum Ballkönig geschafft. Mal ernsthaft … an welcher anderen Schule mitten im ländlichsten Pennsylvania bringt es bitte ein asiatischer Typ zum Ballkönig? So was passiert einfach nicht.
Ich schließe die Augen, atme tief durch und da dreht sich meine Mutter noch mal nach mir um.
Hand auf die Wange. Ich trete vor, umarme sie und diesmal bin ich diejenige, die zu fest drückt.
»Okay«, flüstere ich, obwohl es sich gerade wirklich nicht danach anfühlt.
»Okay«, sagt sie mit zitternder Stimme und macht einen Schritt zurück in den Flur. »Ruf mich später an. Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch«, sage ich und beiße mir in die Wange, bis ich Blut schmecke. Sie verschwindet aus meiner Tür und ich drehe mich nach meinem neuen Zuhause um. Meine Brust schnürt sich zusammen bei dem nur allzu vertrauten Gefühl der Einsamkeit, nur diesmal habe ich keine Mutter, auf die ich mich verlassen kann. Hier bin ich wirklich alleine.
Konzentrier dich einfach auf deine Aufgaben. Auspacken. Organisieren.
Ich atme tief durch, versuche den Kloß in meinem Hals zu ignorieren und klappe den letzten Karton auf.
Mein Blick trübt sich, als ich hineingreife und einen Metallquirl herausziehe, an dem ein säuberlich geschriebener Zettel hängt:
Für den Fall der Fälle
Kapitel 3
Alex
Mir dreht sich der Kopf, als ich endlich in Pittsburgh ankomme. Mein Zehn-Minuten-Nickerchen im Greyhound-Bus war ein Tropfen auf dem heißen Stein und hat null dazu beigetragen, meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Aber tja, wer braucht schon Schlaf, wenn man sieben volle Stunden lang aus dem Fenster starren und jede Entscheidung bereuen kann, die man je in seinem Leben getroffen hat?
Sosehr ich mir auch das Hirn nach einer Lösung zermartert habe … Fehlanzeige.
Sie kennt mich einfach. Alles, was ich vor ihr zu verbergen glaubte. Alles, was ich vor mir selbst verborgen habe. Und sie liebt mich tatsächlich.
Das ist mir vorher noch nie passiert.
Und genau deshalb will ich auch mit ihr zusammen sein. So richtig. Statt immer nur wegzulaufen und sie einfach sitzen zu lassen, wie mein Vater es gemacht hat. Statt sie auf Abstand zu halten, bis sich die Sache im Sand verläuft, wie bei meinen übrigen Beziehungen.
Bei Pretty Games, dem Cereal-Killers-Song, der ihnen vor ein paar Monaten den Vertrag bei einem Indie-Label verschafft hat, drücke ich auf Pause und schaue zum x-ten Mal auf mein Handy, auf dem immer noch keine Antwort auf meine Nachricht vor Abfahrt des Busses eingegangen ist: Können wir reden? Kein Anruf. Nicht mal meine Insta-Storys hat sie angeschaut.
Diesmal hab ich’s echt versaut. So lange hat sie mich noch nie ignoriert.
Das ist viel schlimmer als unsere anderen kleinen Kräche wegen meiner Flirterei oder meinem »Dichtmachen« oder was eben morgens so an Nachrichten auf meinem Handy war.
Also … was sie da gestern Abend gesagt hat. Was ich gesagt habe. Als hätten mir gleich zehn Mädchen während meiner Schicht im Tilted Rabbit ihre Nummer aufgedrängt.
Frustriert werfe ich einen weiteren Blick auf Google Maps. Noch zwei Haltestellen und dann kann ich aus diesem schwankenden Reisebus steigen, in dem mir ein seltsam gemusterter Sitzbezug die Schenkel aufreibt. Ich rutsche vor, um aus dem Fenster zu spähen, und sehe in der Ferne ein gewaltiges Gebäude, dessen grauer Stein in der hellen Nachmittagssonne beinahe schon strahlt.
Die »Kathedrale des Lernens«, das vierundvierzig Stockwerke hohe Herzstück des Unigeländes der Pitt.
Ich bin tatsächlich hier. Studentin, ganz offiziell. Eine Sekunde lang scheint Natalie nicht so wichtig.
Mir ist, als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Luft bekäme.
Ich kann es nicht fassen, dass ich es geschafft habe. Ich kann es nicht fassen, dass ich es tatsächlich geschafft habe. Ich bin entkommen.
Genau das wollte ich. Herausfinden, ob es für mich noch etwas anderes gibt, als mich ständig nur abzustrampeln. Mich endlich mal nur um mich selbst sorgen.
Also … meistens jedenfalls.
Instinktiv blicke ich auf mein Handy, wo meine Mutter immer noch nicht auf die Nachrichten reagiert hat, die ich ihr während der Fahrt geschickt habe. An sich nichts Besonderes. Aber mir wird flau im Magen, weil ich jetzt nicht schnell nach Hause rennen und schauen kann, ob sie noch atmet.
Der Bus bremst ruckartig ab und ich stecke mein Handy ein, schnappe mir meinen Kram und stolpere den Gang hinunter. Mit einem Dank an den Fahrer steige ich an der Atwood Street aus, von wo aus es angeblich nur noch vier Querstraßen bis zu meiner neuen Wohnung sind, die ich über die Kleinanzeigen gefunden habe, und sehe mich in der grellen Sonne um.
Hier ist alles so anders als in Philadelphia. So winzig. Mir ist schon klar, dass das nicht die Innenstadt von Pittsburgh ist, aber … das wird schon etwas Gewöhnung brauchen. Von den Gebäuden über die Anzahl der Fußgänger auf den Gehsteigen bis zu den Läden entlang der Straße wirkt alles, als hätte sich wer mein Zuhause geschnappt und die Hälfte davon gekappt. Und dann noch zehnmal halbiert.
Ich folge Google Maps bis zur nächsten Kreuzung, vorbei an einem Starbucks, einem Drogeriemarkt und einem mexikanischen Lebensmittelladen, und schrecke beim Anblick meines Spiegelbilds in einer Fensterscheibe zusammen. Ich sehe aus, als wäre ich nicht mit dem Bus gefahren, sondern unter ihn geraten.
Mein blondes Haar ist in einen Knoten geknautscht, aus dem sich lauter feine Strähnen gelöst haben. Mein T-Shirt ist so zerknittert, als hätte ich es ein ganzes Jahr im Trockner gelassen. Mein sonst so gleichmäßiger Eyeliner ist seltsamerweise vom rechten Auge völlig verschwunden, aber am linken noch intakt. Wie kann das bitte sein? Rasch ziehe ich das Haargummi ab, kämme mich mit den Fingern und reibe mir die Eyelinerreste vom Auge, bis die Ampel vor mir auf Grün springt.
Mein Handy surrt und in der Hoffnung auf eine Antwort von Natalie rupfe ich es so schnell heraus, dass es mir beinahe auf die Straße fällt.
Aber es ist meine Mutter. Sie hat sich doch tatsächlich auf eine meiner Nachrichten gemeldet.
Angekommen?
Sofort verschwindet die leichte Übelkeit, werden Haare und Eyeliner unwichtig. Eine Nacht ist überstanden. An der überquellenden Mülltonne an der Ecke halte ich an, weil ich eine knallrote Tür entdecke, an der in rostigem Silber die Nummer 530 hängt. Dasselbe Gebäude, das auch in der STUDENTINANDERPITTSUCHTMITBEWOHNERIN-Anzeige vor einem Monat hochgeladen war.
Das Bild war, wie’s scheint, sehr auf die Schokoladenseite konzentriert.
Meine neue Mitbewohnerin, Heather Larkin, hat offensichtlich eine Variante eines Snapchatfilters verwendet, um die Poren und Augenringe des Gebäudes zu kaschieren, die sich jetzt ungeschönt offenbaren, in Form von blätternder Farbe und bröckelndem Gemäuer.
Aber zu Hause bei mir sah es auch nicht viel besser aus, also was soll’s.
Ich schreibe zurück: Jupp. Eben gerade, trete näher an das uralte Klingelschild und drücke den Knopf, der hoffentlich zu Apartment 3A gehört, ohne dabei die offenen Elektrodrähte zu berühren. Ein langes Schrillen und ein statisches Rauschen, dann eine gedämpfte, aber fröhliche Stimme aus dem Lautsprecher: »Komm gleich runter!«
Ich fahre mir ein paarmal durch die Haare und versuche noch etwas Eyeliner abzuwischen und mir ein Lächeln ins Gesicht zu kleben, bevor die Tür aufgeht. Erleichtert sehe ich die lockige Heather Larkin vor mir stehen, der ich präventiv auf den sozialen Medien nachgespürt habe, und keinen Axtmörder.
»Hi«, sagt sie und streckt mir die Hand entgegen. »Du bist sicher Alex.«
»Ja! Heather, oder? Freut mich!« Ich schüttle ihr die Hand und nicke in Richtung ihrer sorgfältig manikürten Hände. »Ich mag deine Fingernägel!«
Sie lächelt mir dankbar zu und ich folge ihr hinein. Für zwei Leute ist es ganz schön eng in der Diele. Der gepunktete Teppich ist abgewetzt, die Briefkästen quellen über, aber … es riecht weder nach Katzenpisse noch nach Müll. Das ist doch schon mal was.
Außerdem habe ich ohnehin nichts anderes gefunden, das möbliert war und weniger als 500 Dollar Monatsmiete kostete – wesentlich billiger als ein Studentenwohnheim und die einzige Möglichkeit, mir die Uni und die ganzen überteuerten naturwissenschaftlichen Lehrbücher in »Spezialausgaben« leisten zu können.
Wir steigen hinauf in den zweiten Stock und Heather redet in einem fort, während ich meinerseits auf der zweiten Treppe versuche nicht mit meinem riesigen Koffer zu kollabieren.