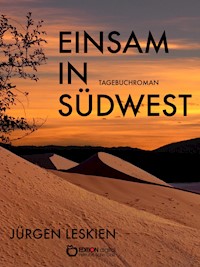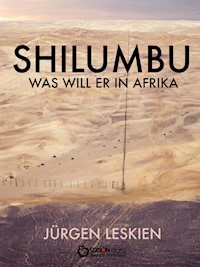
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Trittbrett des Autos sitzend, kratzte ich mir den Schlamm von den Schuhen. Ein gellender Schrei ließ mich zusammenfahren. „SHILUMBU“ - und noch einmal: „SHILUMBU!“ Ich wandte mich um, der Junge war nicht zu sehen. Einen Augenblick später höhnisches Gelächter, das merkwürdig widerhallte. Ich kletterte auf die Pritsche des Wagens, wartete. Die Sonne löste die letzten Nebelfetzen auf. Plötzlich entdeckte ich zwischen den Kaffeesträuchern eine Gestalt, die regungslos verharrte. Ein Mann. Er trug zum zweireihigen Jackett ein helles Hemd. Wie ein Strick zog die Krawatte den Hemdkragen zusammen, der Hals wirkte seltsam spindlig. Kinn und auch Nase standen dem Mann schief im Gesicht. Ich winkte ihm zögernd. Ein Sonnenfleck strich über den Hügel. Lautlos zog sich die Gestalt ins Grün der Plantage zurück. Schweiß rann mir am Körper herab. „Hallo“, rief ich, „hallo!“ Niemand zeigte sich. Da war es wieder dieses Wort, das dem Helfer aus der GDR galt, der jetzt zum wiederholten Male in Afrika war, in Angola, um Mitte der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts dort beim friedlichen Aufbau zu helfen – Solidarität konkret. SHILUMBU – das bedeutet so viel wie weißer Mann. Aber wie war es hier gemeint? Freundlich? Unfreundlich? Es ist nicht einfach für ihn zu verstehen. Denn während ihm wieder versichert wurde, dass SHILUMBU kein Schimpfwort sei, erlebte er es dennoch anders: Lidya und Morningstar, Elisabeth und Joe, alle versicherten mir, dass SHILUMBU kein Schimpfwort sei. Aber das änderte nichts. Tauchte ich in einem Winkel des Camps auf, in dem man mich nicht kannte, erwiderten die Erwachsenen meinen Gruß, mich neugierig anschauend, mit Zurückhaltung, aber keineswegs unfreundlich. Die Kinder indes, die kleinen vor allem, schrien es heraus, angstvoll mit schreckensweiten Augen. In Panik zerrten sie die kleineren Geschwister hinter sich her, brachten sich in Sicherheit. In den ersten Tagen machte ich den Versuch, ihnen zu folgen, ich wollte sie beruhigen, ihnen zeigen, dass ich nicht der bin, für den sie mich hielten. Noch viel schlimmer empfand er Ablehnung und Verachtung der Halbwüchsigen: Sie verschränkten die Arme vor der Brust und legten all die Herablassung, zu der sie fähig waren, in die Stimme - SHILUMBU. Es traf mich jedes Mal von Neuem, auch später, als wir uns kannten und sie sich an schlechten Tagen einen Jux daraus machten, es mir nachzurufen. Und da musste er an seinen Großvater denken und an eine ganz bestimmte Ausstellung, die Kolonialausstellung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Jürgen Leskien
Shilumbu
Was will er in Afrika
ISBN 978-3-86394-597-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1988 im Verlag Neues Leben GmbH, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Johannes Leskien
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
PROLOG
Unter dem schmalen Dach des Duschcontainers, dicht gedrängt am Boden hockend, verkrochen wir uns vor dem Regen. Vergebens. Das Wasser schlug vom Dach in den zu Staub zermahlenen Sand, warf uns Dreck in die Gesichter.
Lidya rückte näher heran, legte mir den Arm auf die Schulter, schloss die Augen.
Der Regen war zur rechten Zeit gekommen, meine Kraft an diesem Nachmittag war verbraucht. Die Handflächen auf den Boden gepresst, genoss ich die unerwartete Pause.
Behutsam griff Lidya meinen Arm, drückte meine Hand an ihre Wange. Sie sah die aufgeriebenen Blasen, fuhr mit den Lippen über die abgefetzte Haut.
Beton bestimmte seit Tagen unseren Kalender. Wie viel Karren in der Stunde, wie viele an einem Tag, immer im Wettlauf mit dem Regen.
Die Konturen des Mischplatzes verschwanden im Dunst, schwer trugen die Palmen an der Nässe. Vom flachen Hügel stürzte Wasser in die Baugrube, riss ein Stück der angeschippten Böschung mit. Niemand in der Runde rührte sich.
„Aber bald werden Kinder drin wohnen“, flüsterte Lidya wie zum Trost. „Und schon am dritten Tag geht eine Fensterscheibe zu Bruch. Die Zeitung, die den Bau des Neuen Kindergartens meldete, ist dann schon eine sehr alte Zeitung.“
Mit einem Blick auf den Sturzbach fügte sie hinzu: „Das ist dann alles vergessen. Das und der Schnaps für die Schweden. Und unsere Angst und unsere Freude über den ganz anderen SHILUMBU. Und das ausgemachte Spiel, dich zu verführen!“
Ich schüttelte den Kopf.
Botsuana mischte sich in unser Gespräch.
„Es bleibt also dabei!“
„Ejuva", rief Josepha, „ejuva!“
Träge hoben wir die Köpfe. Es tropfte nur noch vom Dach, wir nahmen die Werkzeuge auf.
Ejuva heißt Sonne in der Sprache der Herero. Lidya nennt die Sonne otango. Lidya kommt aus Oshidundumbe, das liegt im Ovamboland, dort spricht man Oshivambo.
Einen Augenblick stützte ich mich auf den Stiel meiner Schippe, zögerte, durch den Schlamm zu waten. Botsuana sah mich unverwandt an.
„Natürlich bleibt es dabei“, antwortete ich ihm leichthin, wohl wissend, wie schwierig es sein wird. Längst waren die Tage vorbei, an denen mir Zeit blieb für ausführliche Notizen. Aber alle hier wussten von den kleinen Heften, und alle hofften, dass ich nichts Wichtiges vergaß.
DAS TRANSIT-CAMP
Letztmögliche Zuflucht für den einen, schon Zwischenstation für den anderen.
Wer direkt aus der Heimat kam, sich in den für eine Flucht viel zu kurzen Nächten durch das Kaokoveld geschleppt hatte, wer den Cunene erreichte und übersetzen konnte, wer über das Mondgebirge in die freie Stadt Lubango gelangte, der war auch bald hier, im Camp Viana, am Rande Luandas.
Die Zelte, ohne sichtbare Ordnung aufgestellt zwischen den Mangobäumen einer Fazienda, verhießen Ende und verhießen Neubeginn. Leben ohne Angst vor allem.
Mancher kam allein, obwohl sie zu dritt aufgebrochen waren, dann bestimmte Trauer die ersten Tage im Camp, und ein Gefühl von Schuld kam auf. Oft fanden sich hier Familien, endlich nach Jahren der Trennung. Wiedersehensfreude, die alle einschloss, Wehklagen auch um den, der nun für immer fortblieb. Und dann tiefer Schlaf, der von allen hier durchlebte ohnmachtsähnliche Schlaf nach der Flucht. Einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag. Erwachen zur Unzeit, weil aufgeschreckt vom Lärm eines Autos. Das beruhigende Wort des unbekannten Pritschennachbarn.
Ungelenke Schritte aus dem Zelt ins Freie, wie nach einer langen, schweren Krankheit. Die niedrigen Feuer vor den Zelten, das morgendliche Flüstern der Frauen. Wieder seien fünf angekommen, hörte man. Über Botsuana, Sambia, London, Paris hierher. Der freudige Aufschrei, da einer den Totgeglaubten wiederfand, die Betroffenheit, wenn sich die schlimme Ahnung bestätigte. Lebensäußerungen, die sich, variiert, täglich wiederholten. Die erste, mit Genuss verzehrte warme Mahlzeit. Essen ohne Gier, Gindungo herausschmeckend und das Pfefferkorn. Nachsalzen möglich, wo hatte man das je erlebt! Und plötzlich wieder dieses verhasste Wort - Abschied. Der Truck wartet bereits. Abfahrt ins große Camp, ins Camp Kwanza-Sul. Über vierzigtausend leben bereits dort, hatte man erfahren. Vierzigtausend Menschen. Ist das viel, ist das wenig? Vier Menschen gehören zu einer kleinen Familie. Vierzig Menschen sich vorzustellen ist einfach, dreiundvierzig waren bei der Hochzeit der ältesten Tochter zu Gast. Vierhundert leben im Nachbardorf am Fluss. Das war noch gut in Erinnerung. Aber vierzigtausend! Der einzelne ist dann der vierzigtausendste Teil eines Ganzen! Wird er nicht verloren gehen, wird man ihn überhaupt in seiner Winzigkeit als einzelnen erkennen?
Und neben dem hoch beladenen Truck der Bus, der zum Flugplatz fährt. In ihm und um ihn die anderen, die auf Zwischenstation, jene, die eben aus den Bergen kamen. Gesund und selbstbewusst, ein wenig Melancholie in der Stimme. Die Schwüre, einander nicht zu vergessen, auch wenn man im fernen Europa studiert ... In den Gesichtern noch Spuren einer letzten, hastigen Umarmung, irgendwo hinter einem der Zelte, auf irgendeiner Lastwagenplane. Angst, sich zu verlieren, nun für immer vielleicht, da sie nach Berlin fliegt, um Krankenschwester zu werden, und er zur Elektrikerausbildung auf die Bahamas.
Im Schweiß schon hocke ich im spärlichen Schatten eines Mango. Längst habe ich es aufgegeben, dem Staub zu entweichen, den ein träger Morgenwind über den festgetretenen Boden wälzte. Beim Nahen der Sandfahne schloss ich die Augen, ich spürte ihn zwischen den Zähnen, den feinen Abrieb, der entsteht, wenn Füße und Erde einander berühren. Mein Kontakt mit der Wahlheimat war inniglich. Ich lauschte, versuchte, dem Stimmengewirr zu entnehmen, was unserer Abfahrt im Wege stand. Der auf- und abschwellende Strom aus Oshivambo und Afrikaans, aus Herero und Damara verriet mir, dem Neuling, nichts. Selten nur ein Brocken Englisch. Herbeigewünscht, aber nicht zu vernehmen, das Portugiesisch. Ich tastete nach der Tasche mit den Projektunterlagen.
Warum hatte es niemand eilig? Häuser sollten gebaut werden für Kinder, Termin des Baubeginns: der gestrige Tag ...
Der Singsang der Wartenden hüllte mich ein, trug mich davon. „Comrade!“ Ich schreckte auf. Vor mir kauerte eine junge Frau, sie bot mir in einem verbeulten Blechnapf Wasser an. Neugier sah ich in ihrem Blick. Der Anflug eines Lächelns löste sich auf, als ich sie länger, als es Takt gebot, anschaute.
Unterhalb der Augen zierten winzige Narben ihr Gesicht, Schmucknarben. Ich unterdrückte die Regung, die Zeichnung mit den Fingerspitzen zu berühren, nahm ihr hastig das Gefäß aus den Händen. Ein Schwapp Wasser benetzte unsere Arme, die junge Frau fuhr zusammen. Ein unwilliger Zug machte sich in ihrem Gesicht breit.
Ich trank in vollen Zügen, augenblicklich brach mir der Schweiß aus. Über den Rand des Blechnapfes sah ich erwartungsvolle Blicke auf mich gerichtet. Der Konvoi hatte sich formiert. Als ich den Napf absetzte, fuhr der erste Wagen an. Ein Zehntonner, bepackt mit Maismehlsäcken, auf denen Soldaten mit geschulterten Panzerbüchsen hockten.
ÜBER DONDO NACH N’DALATANDO. ODER RICHTUNG CALULO
Wir fuhren Richtung Calulo.
Dondo - wie vertraut mir die Stadt noch war!
Die Fabrikhalle mit den blauen Fenstern, die Rinnsteinkante in der Kurve, an der Hubert den Achsschenkel seines Wagens zertrümmert hatte, die Einschüsse am Kaffeelagerhaus, die Tankstelle von SONANGOL, an der Edwin die Uhr verhökerte, deren defekte Unruhe dazu geführt hatte, dass alle Tankwarte des Landes einen bestimmten Mann suchten - Vollbart, starke Brille, mittelgroß, weinroter VW-Brasil. Bis Manuel von SONANGOL sein Geld wieder hatte und der Bärtige die Uhr, die keine war.
Fünf Jahre - vergangen. Fünfmal Regenzeit, fünfmal Tag der Unabhängigkeit, fünfmal dreihundertfünfundsechzig Tage aufgezwungener, unerklärter Krieg ...
Und dann der Markt, gelegen zwischen Stadt und großer Straßenkreuzung auf dem Hügel.
Mandarinen, Mangos, Maniok, Zuckerrohr, Zwiebeln, Gindungo, Süßkartoffeln, Tomaten, Bananen, Papaya, Zitronen, Erdnüsse. Auf Tüchern feilgeboten, in Schüsseln präsentiert, zu kleinen Pyramiden aufgeschichtet - fünf Zwiebeln, fünf Tomaten, fünf Bataten, fünf Mangos - die Pyramide für tausend Kwanza. Das Wertgefüge war aus den Fugen geraten, ein Schlosser verdiente im Monat achttausend Kwanza. Ware gegen Ware war gefragt. Die Bauern offerierten das ihre und erhofften sich von den Städtern Zucker, Seife, Waschpulver, Fleischkonserven, Kochtöpfe, Hemden, Hosen, Werkzeuge, Taschenlampen, Nähnadeln.
Kriegszeit, Nachkrieg, ich erinnere mich. Der Bauer Luchs aus Kerzendorf bot meinem Vater für eine Garnitur Bettzeug zehn Pfund Kartoffeln, und weil ich barfuß im kühlen Spätsommerwind mit großen Augen danebenstand, legte er noch zwei Eier dazu, rückte sich selbst in die Reihe der gütigen Heiligen. Unser Teppich erbrachte mehr als einen Zentner, und wir kamen einigermaßen über den Winter. Aber ein bitterer Rest blieb, bis heute, vierzig Jahre danach. Es gibt noch dieses Dorf, es gibt noch diese Toreinfahrt aus hart gebrannten märkischen Klinkern. Es kam vor, dass ich die Landstraße befuhr, die den Ort in zwei ungleiche Teile schnitt. Ein Dorf wie viele Dörfer im Lande, umgeben von gepflegten Feldern, geschmückt mit herausgeputzten Häusern.
Aber immer ging der Blick dorthin, und immer bedrängte mich der gleiche Gedanke ...
Wer sagte, wir treffen uns in Dondo, der meinte die große Kreuzung mit der Tankstelle, der Kneipe, der Brauerei in der Nachbarschaft. Umschlagplatz für Waren und Gerüchte. Die Trucks der Diamantminen hielten hier, die Personenautos der Beamten aus Luanda und die Karren der Bauern aus der Niederung des Rio Kwanza.
Wir versagten uns die Pause, bogen nach rechts ab, Richtung Süden.
Aufgeheizter Asphalt bis Calulo, dann blieb uns nur noch die Piste. Anstieg, Stich ins Tal, wieder Anstieg. In Wellen hob sich das Land aus der Ebene.
Kaffee beherrschte das Bild. Er war König hier. Die Siedlungen schmiegten sich an seine grünen Flanken, bereit, ihm zu dienen.
Ausgewaschen war die Piste. Mit fußhohem Staub angefüllt die Löcher und Rinnen und Gräben, durch die sich der Jeep wälzte.
Staub stieg auf, färbte die Raine der Pflanzungen braun ein, ließ die Luft im Wagen unerträglich werden. Christophs beruhigende Geste. Es mehrte sich das Buschwerk, wuchs in die Höhe, wölbte sich zu einem grünen Himmel.
Die Räder summten auf glattem, festem Boden, das Kreischen aufgeschreckter Vögel begleitete uns Eindringlinge. Dem grünen Chaos folgte bald die unnatürliche Ordnung einer Palmenallee, ein knorriger Schlagbaum zeigte das Ende der Fahrt an.
Vor sieben Stunden hatten wir Luanda verlassen, nun endlich - angekommen.
Watokelwapo - Guten Abend!
Das ist es also, das Camp der SWAPO, das „Namibia Health and Education Center“.
Der Posten, der uns anhalten ließ, eine junge Frau, sie trug ihr Kind im Tuch auf dem Rücken.
Freudiges Erkennen meiner beiden Begleiter. Christoph und seine Frau Doris arbeiteten im Education-Camp als Lehrer. Ja, dem Söhnchen gehe es wieder gut, so die junge Frau am Schlagbaum, die Diarrhoe habe er gut überstanden. Nein, es gäbe nichts besonderes, sie habe Dienst bis zwanzig Uhr. Natürlich komme sie morgen zum Unterricht ..., erste Stunde Chemie und danach Mathematik ..., alles klar ..., kaleni narva! Eine knappe Unterhaltung in getragenem Englisch, die Grußformel in Oshivambo, versteht sich. Für mich nur einen Blick, keine Frage.
Wer mit den Lehrern kommt, ist ein Freund.
Ein kleiner Umweg durchs Boys-Camp. Wir stoppten den Wagen vor einem kugligen Lumpenbündel, mit dem die Halbwüchsigen Fußball spielten. Aus starken Ästen hatten sie ein Tor errichtet, gegen das sie einen Augenblick später wieder lärmend anrannten.
Zwischen den Sträuchern notdürftig aus Plasteresten und Gras errichtete Behausungen, aus denen mich Jungen neugierig anschauten. Wenig intakte Zelte.
Der zukünftige Bauplatz war nur zu erahnen. Unsicher folgte ich einem schmalen Pfad, wenige Schritte nur. Unter dem Schattendach der Palme sollte die Speisehalle stehen, dachte ich mir, im Schutz dichter Büsche, abseits von der befahrenen Piste, das Haus, in dem die Kinder schlafen werden. Und hinter einem alten Kassavastrauch die Powerstation, die Elektrostation ...
So wird es sein in einem Jahr, vielleicht in acht Monaten schon ...
Ein Jahr oder acht Monate - errechnetes Maß für den technologischen Vorgang, Lebenszeit aber auch, unwiederbringliche.
Ich entzog mich meinen Freunden, stahl mich davon, gerade jetzt - so das Mädchen Inis. Wolle wohl die allzu nahe Geliebte vergessen, auf Zeit, versteht sich, spottete Freund Peter, Briefe nur empfangen, stumm bleiben gar ...
Tatsächlich war der Wunsch gewachsen, die afrikanische Sonne möge ein wenig von der Angst ausbrennen, die als Ungeheuer in mir saß, mich seit Wochen zu lähmen drohte. Inmitten des Baustellenlärms, so hoffte ich, ginge das schrille Signal unter, das mir das baldige Vorrücken der Raketenbatterien bis an den eigenen Garten ankündigte. Unerhörtes musste geschehen, um Unerhörtes zu verhindern.
Und plötzlich diese Versuchung - Bauleiter im afrikanischen Busch. Das richtige Tun, für die richtigen Leute. Greifbare Resultate, wenn der Bogen der Sonne sich neigte. Die Gelegenheit war günstig, und die Größe des Gegenstandes entsprach meiner inneren Zerrissenheit. Unvermittelt wieder das Gefühl haben - wir rechnen mit dir, auf dich kommt es an.
Meine Ankunft war durch ein Radiotelegramm angezeigt worden. Die Depesche hatte rechtzeitig das Old Center erreicht.
Jochen resluier of GDR - one of the builders.
Der Diensthabende am Funkgerät im Administration Camp hatte den Text auf die Rückseite der Gebrauchsanweisung einer Quarzuhr „Modell 246“ geschrieben. Der Stempel im Kopf der Anleitung vermeldete, dass diese Uhr vor einem halben Jahr bei Poul Halse - urmager - 8706 Horsen, Sondergade 33 gekauft worden war. Ein ganz eigener, sicher ungewollter Willkommensgruß der schwedischen Bauleute hier im Camp.
Bereit zur Begrüßung auch Karin, von kräftiger Statur, Kindergärtnerin, Frau des Lehrers für polytechnische Ausbildung.
Als wir die Autotüren zuschlugen, trat sie, angetan mit einer das Knie nicht bedeckenden Kittelschürze, aus der Reihe der Versammelten und reichte mir ein Glas kühler Limonade. Noch während ich trank, wurde ich mit den anderen Lehrern bekannt.
Karin behielt mich im Auge, nahm mir das leere Glas aus der Hand, geleitete mich über die kleine Terrasse, auf der flache, selbst gebaute Schuhschränke standen und die mit dem Bild unseres Staatsratsvorsitzenden einerseits und dem des Präsidenten der SWAPO andererseits dekoriert war, in die Unterkunft.
Das einzige feste Wohngebäude im Old Center, wurde erklärt.
An die Dämmerung im langen Flur, der die Mitte des Hauses bildete, mussten sich die Augen erst gewöhnen. Er war mit Schränken vollgestellt, die schlecht schlossen. Von innen drängte in Stapeln lagerndes Agitationsmaterial gegen die Türen, dazu die Feuchtigkeit, die den Pressspanmöbeln schlecht bekam. Karin stieß die Tür zu einem großen Zimmer auf. Die Laden vor den Fenstern waren wegen der Hitze geschlossen. Couchgarnitur der heimatlichen Industrie, Schrankwand. Dekorfolie Nussbaum, wenn der Eindruck nicht täuschte.
Mein Zögern wurde sofort bemerkt. Karin legte mir die Hand auf die Schulter. Es sei ja nur ein Übergang, meinte sie, bald kämen die eigentlichen Bewohner des Zimmers aus dem Jahresurlaub zurück. So lange sollte ich mich hier wie zu Hause fühlen, alles benutzen, auch die dazugehörige Küche.
Ja, fügte sie nicht ohne Stolz hinzu, jedes Ehepaar habe seine eigene kleine Küche mit einem zweiflammigen Kocher. Die Gewerkschaftsgruppe sei froh, dies durchgesetzt zu haben. In unser Gespräch hinein rief Christoph, er lade mich zum Abendessen ein.
Wir hockten in der winzigen Küche, bemüht, einander mit dem Ellenbogen nicht zu berühren. Blumen standen auf dem Tisch, durch das geöffnete Fenster der Abglanz später Dämmerung. In Schüsseln das Hauptgericht - Makkaroni und Gulasch aus der Büchse, mit Gindungo verfeinert.
Meine Gastgeber waren wortkarg, das wenige, das gesprochen wurde, bezog sich auf die Konsistenz des Fleisches aus der Büchse, auf die mangelnde Versorgung mit Spiritus. Die Worte klangen gepresst, als litten Christoph und auch Doris unter der Enge des Küchenverschlages, als nähme er ihnen die Luft.
Am Abend lief für eine Stunde der Generator. Ich aber saß im dunklen Zimmer vor meinem Rucksack, unfähig, mich zu rühren.
MEIN ERSTER MORGEN IM CAMP
In der Pflanzung gegenüber dem Kaffeetrocknungsplatz hing Nebel. Wenige Schritte nur waren es vom Haus zum Jeep, aber mein Haar war nass, als ich in den Fond kletterte, und an den Schuhen klebte zäher rotbrauner Schlamm. Im zweiten Gang zum Hohlweg, von den Blättern der Palmen schlugen große Tropfen auf das Dach des Wagens.
Nahe der Baustelle, wenige Meter nur von der Straßensperre des Boys-Camp entfernt, musste ich anhalten. Langsam, bedächtigen Schrittes kamen halbwüchsige Jungen aus dem Grund des Tales, überquerten den Weg und verschwanden im Buschwerk.
Ich stellte den Motor ab. Es war still. Die Jungen gingen in einer Reihe, es kam vor, dass ein Zweig gegen einen der schmalen Körper klatschte. Die großen regennassen Blätter des Kassavastrauches verursachten ein merkwürdiges, schmatzendes Geräusch, wenn sie auf die Haut der Jungen trafen. Kaum ein menschlicher Laut, verhaltenes Hüsteln manchmal.
Die Jungen trugen schwer an braunen, bröckligen Quadern. Steine aus Gras und Erde in einfachen, hölzernen Formen, unten im Tal am flachen, dünnen Fluss gepresst. Sie trugen die Steine tief gebeugt auf dem Rücken, trugen sie auf den Schultern oder zu zweit in einem Tuch, in Fetzen zerschlissener Maismehlsäcke. Einer der Jungen stolperte, er war am Umschlag seiner Hose hängen geblieben. Der Quader zerplatzte vor den Rädern des Jeeps. Gleichmütig wandte er sich um, stieg wieder hinunter ins Tal, seine Gestalt verlor sich im Dunst.
Der letzte der Prozession verschwand im Busch, der Weg war frei, ich ließ den Motor an.
Die Boys hatten den Wohnplatz noch nicht aufgegeben. Das sah ich sofort, als ich den Wagen abstellte. Öde Flecken zwischen dem Gesträuch verrieten ehemalige Standorte von Hütten, aber es gab nur wenige solcher Plätze.
An kleinen Feuern saßen die Jungen zusammen. Vier waren es oder fünf, selten mehr. Sie hockten auf verbeulten Konservendosen, auf Resten alter Autoreifen oder einfach auf den eigenen Fersen. Ich ging zu einem der Feuer, kauerte mich zu ihnen. Ein Luftzug wehte mir Qualm ins Gesicht, die Jungen kicherten verstohlen. Auf Gerten hatten sie Maniokstücke gespießt, die im Feuer garten.
Der Junge zu meiner Rechten trug eine gefleckte Militärmütze aus leichtem Tuch. Er hatte meinen Blick bemerkt, zog die Mütze vom Kopf, reichte sie mir. Sie passte, und ich spürte noch die Wärme, die in ihr war. Eine Wärme, wie sie nur Kindern eigen ist, wie man sie spürt, wenn man ihnen des Nachts das Kissen zurechtrückt oder ihnen das Haar nach hitziger Jagd im Schnee unter den Wollpudel steckt.
Mein Nachbar forderte mit einer energischen Handbewegung die Mütze zurück. Er zog eine der Gerten aus der Asche, bot mir von seinem Frühstück an. Ich kaute bedächtig, die Jungen beobachteten jede meiner Regungen. Das Feuer schürend, forderte plötzlich mein Gegenüber in klarem Englisch eine Zigarette von mir. Ich zuckte bedauernd mit der Schulter, augenblicklich wurde mir die Gerte mit dem Maniok aus der Hand genommen.
Weitab der helle Klang von Metall, ein Signal wurde geschlagen.
Die Jungen erhoben sich zögernd. Ich sah, dass sie Bücher und Hefte dabeihatten. Sie entfernten sich grußlos, winkten den anderen, die aus den Behausungen krochen, sich von ihren Feuern erhoben.
Wenig später schien das Boys-Camp verlassen.
Ein unwirkliches Bild. Zwischen verfaulten, mit Plasteresten geflickten Zelten, zwischen Hütten aus Blechen platt gewalzter Fässer die glimmenden Feuer und Dampf, der sich unter der aufsteigenden Sonne vom Boden löste. Und noch in Hörweite - Jungen zwischen sechs und sechzehn Jahren, auf dem Weg ins Education-Camp, unterwegs zur Schule. Dreitausend Boys sollen es sein, oder mehr. Mit dem Schuh scharrte ich Asche auf die Glut, streckte mich und ging tiefer ins Boys-Camp hinein. Am Nordhang des flachen Hügels drei Hütten in traditioneller Bauweise. Die kegligen Dächer ruhten auf Wänden aus Geflecht und Lehm. Trotz des Holzmangels die Andeutung einer Palisade.
Neugierig trat ich an eine der Hütten heran, hob das Sacktuch, das den brusthohen Eingang verschloss. Ich fuhr zurück. Auf den Pritschen hockten vier Jungen, die mit wilden Strichen ihr Geschlecht bearbeiteten.
Ich stahl mich davon, den verklärten Blick der Jungen noch vor Augen.
Wer ist ihnen nah, wenn die Sehnsucht nach Wärme zu groß wird? Wer, wenn sie sich als Mann und das Mädchen als Frau entdecken?
Sie wachsen auf, fernab von den Riten der Beschneidungslager, und sind noch nirgends angekommen. Entwurzelte, die, abgeschnitten vom Lebensnerv ihres Krals, den Kookerbaum durch das Lehrbuch kennenlernen werden und den Waterberg durch die Fotografie. Jungen, die sich vielleicht daran gewöhnen, dass Mais durch Trucks ins Lager kommt und nicht durch eigene Arbeit. Jungen, die nicht wissen, wie man das keimende Korn vor den Stachelschweinen schützt und das Bananenfeld vor den gefräßigen Affen.
Ich stolperte den Hügel hinauf, vorbei an einer Pyramide jener Quader, die die Jungen aus dem Tal in ihr Camp geschleppt hatten.
Plötzlich stand ich vor ihm. Er überragte mich um Haupteslänge, lehnte lässig am niedrigen Dach seiner Rundhütte. Es schien, als habe er mich erwartet. Meinen Gruß erwiderte er nicht, in der Rechten hielt er eine Keule, eine Waffe, wie sie die Jäger zu ihrem Schutz bei sich tragen. Er postierte sich breitbeinig mit der Pose eines Wächters.
Der Junge war dreizehn oder vierzehn Jahre alt und von kräftiger Statur. Ich schaute mich um, wir waren allein. Ein krächzender Vogelschrei zerschnitt die Stille. Ich ging einen Schritt näher heran, wiederholte meinen Gruß. Der Junge hob die Augenbrauen, zog die Keule an den Leib. In seinen Augen las ich Wut. Erschreckt wich ich zurück. Sein Mund verzog sich zu einem herablassenden Lächeln.
Es wird ihm nichts nützen, seine Hütte steht inmitten des Baugeländes. Auch er wird umziehen müssen, auf diesem Platz wird der Speisesaal gebaut.
Auf dem Trittbrett des Autos sitzend, kratzte ich mir den Schlamm von den Schuhen.
Ein gellender Schrei ließ mich zusammenfahren.
„SHILUMBU“ - und noch einmal: „SHILUMBU!“
Ich wandte mich um, der Junge war nicht zu sehen. Einen Augenblick später höhnisches Gelächter, das merkwürdig widerhallte. Ich kletterte auf die Pritsche des Wagens, wartete. Die Sonne löste die letzten Nebelfetzen auf. Plötzlich entdeckte ich zwischen den Kaffeesträuchern eine Gestalt, die regungslos verharrte. Ein Mann. Er trug zum zweireihigen Jackett ein helles Hemd. Wie ein Strick zog die Krawatte den Hemdkragen zusammen, der Hals wirkte seltsam spindlig. Kinn und auch Nase standen dem Mann schief im Gesicht. Ich winkte ihm zögernd. Ein Sonnenfleck strich über den Hügel. Lautlos zog sich die Gestalt ins Grün der Plantage zurück. Schweiß rann mir am Körper herab. „Hallo“, rief ich, „hallo!“ Niemand zeigte sich.
DIE LETZTEN HÜTTEN CAXICAS
Ein zerfallenes Haus am Hang. Ich stieg, dem ausgetretenen Pfad folgend, den Hügel hinauf, leicht schwitzend trotz der mäßigen Steigung, trotz des frühen Tages.
Auch schwitzte ich an den Händen, was selten vorkam und mir stets als schlechtes Zeichen erschienen war. Vegetative Dystonie. Mehr Sport, mein Lieber! Die Handfläche kräftig unter kaltem Wasser gebürstet! Ausgesprochen, was dich bedrückt! Heraus aus dem Dunkeln mit den schwelenden Konflikten! Nur zu, sonst wird’s dir die Prostata heimzahlen und der Magen, der Infarkt ist dann nicht mehr fern.
Infarkt, was ist das? Mein Freund Makamba, Arzthelfer im Kral der Fischer, dort, wo Wüste und Ozean einander berühren, er kannte dieses Krankheitsbild nur aus Büchern. Diarrhoe, Tuberkulose, keine Frage. Typhus und Kinderlähmung, sattsam bekannt. Aber Infarkt? Erzähl mir, wie sind die Symptome! Ich war gut dran, noch konnte ich bedauernd die Schultern heben.
Mich auf dem Weg sehend, würde Makamba sagen, du, du hast einfach Angst vor den Weibern! Vor den jungen, frechen, vor den nicht mehr so jungen, aber erfahrenen. Vor ihrer Gier nach Mann hast du Angst, vor ihrem Wunsch nach heimlichen Zärtlichkeiten. Und vor deinen eigenen Träumen fürchtest du dich, vor dem Gespinst, dessen Fäden die Mädchen am Tage mit ihren Blicken knüpfen und das dich in der Nacht einhüllt, immer fester, dich würgt, dir endlich das Laken nass werden lässt, allein. Obwohl sie warten! Tausendfach Sehnsucht nach Wärme, nach Haut, nach dem Schauer fremder Berührung. Die eine kriecht zur anderen, und man tut, was man füreinander tun kann.
Und dich werden sie bald verfluchen - wenn du immer nur träumst.
Makamba war so.
In einer ersten Regung reduzierte er alle Probleme zunächst auf jenen Aspekt, und es war schon seltsam, in diesem Moment gerade daran zu denken.
Ich hielt mich an der roten Mappe fest. Die Plastehülle, die die Projektunterlagen umschloss, klebte an den Händen. Ein Bündel von Bauzeichnungen, Detailerläuterungen, papiergewordenes Ingenieurswissen - an diesem Morgen mein wichtigstes Requisit. Nicht dass mir die Abmaße der Montageeinheiten entfallen waren oder gar die concrete strength, die geforderte Druckfestigkeit des Betons. Nachts geweckt, könnte ich auf Anfrage Auskunft geben. Sieben Fundamente, dreiunddreißig Komma elf Meter mal sieben Komma einunddreißig Meter die einen, mit Leitungskanälen für Frisch- und Abwasser die anderen. Stahlbewehrt alle sieben. Wegen der Hanglage, wegen des heftigen Regens, der einmal im Jahr das Bergland heimsuchte. Und jenen Satz - The maximum tolerance for the surface of casted concret slab is 5 mm in any 3000 mm of length - eine Maßhaltigkeit, wie sie im modernen Hochbau üblich ist. Wir aber bauen im Busch.
Im Busch wird seit jeher mit dem gebaut, was die Natur hergibt. Und so entstanden über Generationen von Großfamilien die für die Regionen charakteristischen Hütten. Im Ovamboland ist ihr Grundriss rund, und die Wände sind aus Geflecht, das mit Lehm beworfen wird. Es tut nichts zur Sache, dass die Hereros statt des Lehms Kuhdreck verwenden. Wo ihre Rinder weiden, ist Lehm selten, und sie ziehen mit ihren Herden ohnehin bald weiter.
Die Leute leben wohlbehaust. Das Grasdach schützt vor Sonne und Regen. In den Hütten ist es am Tage kühl, und sie bieten Schutz gegen Kälte, die mit dem zeitigen Morgen in den Kral kriecht.
Das in irdenen Gefäßen aufbewahrte Wasser blieb in den ondunda frisch, die Luft war frei von Moskitos.
Meine Nächte unter Grasdächern waren Nächte ruhigen Schlafs, und die Öffnung im First war ein nächtliches Fenster zum Universum, nie ein irritierendes, nach Reparatur schreiendes Loch im Dach des Hauses.
Nun aber lagen im Hafen Zement und Stahl bereit, türmten sich in Plastehäute eingepuppt Wände, Fenster, Türen. Bündel von Stahlträgern, Kisten voller Schrauben und Muttern, kilometerlange Kabelschlangen - ein Baukasten für ausgebuffte Monteure, wie es der angolanische Hafenmeister nannte, Männerspielzeug.
Männer aber werden wir nur vier sein, oder fünf. Mehr als zwanzig Frauen und Mädchen aber, keine unter siebzehn, so wurde mir erklärt, und überhaupt sei niemand in der Brigade älter als achtundzwanzig Jahre.
Mein Nachbar zu Haus, am Prenzlauer Berg, hat als siebzehnjähriger Lehrling einen solch akkuraten Bogen gemauert, dass der Lehrmeister aufschrie, sich an die Gesellen wandte und schwor, hier habe einer von ihnen geholfen.
Und ich kenne Männer über dreißig, die, würde man sie dazu auffordern, allen Ernstes die Gewichte für die Wasserwaage suchten.
Aber, wer wollte das von mir wissen?
Ich war dabei, mit mir selbst zu reden, mir die Dinge zurechtzulegen. Schönwettervariante, Schlechtwettervariante. Was wird, wenn wir den Sand fürs Bauen aus dem Fluss klauben müssen, was, wenn wir den Kies aus Dondo holen? Und wenn der große Regen schon im September kommt, oder wenn er ausbleibt, was dann, wenn der Brunnen versiegt?
Dieser uralte Wunsch, der Zeit in Gedanken voraus zu sein, ihre zukünftige Gestalt jetzt schon zu erahnen, um sich einrichten zu können, um nicht herumgeweht zu werden.
Mensch sein, heißt auch Bilder von der Zukunft haben.
Aber was ist Zukunft für die jungen Frauen? Der fertige Kindergarten, das erste Fundament, ein regendichtes Dach über der Pritsche im halb verfaulten Zelt, genügend Wasser, um sich das Haar zu waschen, die Zärtlichkeit eines geliebten Menschen, ein gutes Stück Seife, eine Fleischmahlzeit, wenigstens aller zwei Wochen, ein Lippenstift, Schuhe, die passen? Natürlich, ein freies Namibia! Aber was fange ich mit diesem Gedanken an, wenn ich hier endlich Zuflucht gefunden habe als Flüchtling, nun aber eine bin unter den vielen? Wenn ich nicht Mais pflanzen, sondern Beton mischen soll! Dabei hat mich mein ganzes kurzes Leben lang der Gedanke begleitet, Mais zu pflanzen. Das Korn in die Erde zu senken für die eigenen Leute, den jungen Trieb, der mit seinen winzigen Spitzen die rotbraune Haut durchstößt, ihn wässern wollt ich, ihn pflegen. Und nun wird erwartet, dass ich Beton mische. Aus pudrigem Staub, aus Kies, Sand und Wasser. Und das in streng vorgeschriebener Weise, deren Grund ich nicht begreifen kann. Wenn ich mich dann, weil es viele so halten, dem Wunsch beuge und der graue, meine Haut ätzende Brei endlich in die Schalung kleckert, dann kommt ein Fremder und sagt: „Tolerance is 5 mm in any 3000 mm ...“
Ich verstehe kein Wort, er zeigt mit der Hand, kratzt eine Zeichnung in den Sand. Ich ahne, was er meint, und habe das Gefühl, dass er Unerhörtes von mir verlangt, bin ich doch vorgestern erst über die Grenze, habe ich gestern erst das Alphabet begriffen ...
Ich wünschte mir, sie sagten einfach walelepo oder good morning und wir begännen mit der Arbeit. Dann wüssten wir bald, was wir voneinander zu halten hätten.
Die Steigung wurde flacher, der Hügel rundete sich.
Ein leises Klirren, als schlüge Eisen gegen Stein, ließ mich aufmerken. Ich blieb stehen, hob den Kopf, wehrte die Fliegen ab, die, kaum dass ich verharrte, sich auf mich stürzten. Noch geschützt durch einen schmalen Streifen Buschwerk, breitete sich vor mir der Wohnplatz der Boys aus. Sehr nahe die Hütte des trotzigen, starken Jungen.
Ich duckte mich. Der Junge kniete auf der Erde, riss mit einem flachen Eisen den Boden auf. Er schnaufte vor Anstrengung, sein Rücken glänzte schweißnass.
Neben dem Eingang seiner Hütte hatte er einen kleinen Garten angelegt. Vier oder fünf winzige Bananenstauden waren gesetzt, nun hob er eine flache Mulde aus, in deren losen Grund er eine Maniokknolle schob. Für einen Augenblick legte er die Hände in den Schoß, schaute in Andacht auf sein Werk, um sogleich, heftig scharrend, den Maniok völlig mit Erde zu bedecken. Dabei sah er sich gehetzt um, als fürchte er, bei einer unredlichen Sache ertappt zu werden. Erneut warf er sich mit dem Eisen gegen die Erde. Busch und Berg schienen unter der Kraft des gespannten Rückens zu beben.
Mehr kriechend als gehend, tastete ich mich hügelab, bis das Kegeldach der Hütte hinter dem grünen Horizont verschwand. Verwünscht der Einfall, am ersten Arbeitstag unbedingt zu Fuß auf der Baustelle zu erscheinen!
Eilig schlug ich einen Bogen und erreichte Minuten später die Baustelle auf der dem Jungen abgewandten Seite. Das Hemd klebte an der Haut. Hosenbeine und Schuhe waren schwarz vor Nässe.
Die Gruppe wartete bereits, sie ließen es mich durch betont lässige Bewegungen erkennen. Die rote Mappe fest unter den Arm geklemmt, stelzte ich die letzten Schritte auf sie zu, wischte verstohlen meine schweißige Rechte am Hosenbein blank. Zehn Personen zählte ich oder zwölf.
„ Walelepo!" versuchte ich und reichte dem Mann, er stand mir am nächsten, die Hand. „Ey!“, antwortete er überrascht. „Nao tu?" schob ich zaghaft nach. „Ey!“, antwortete der Mann amüsiert, während ich die anderen mit Handschlag begrüßte.
Er setzte die Zeremonie fort. „Walelepo!“ Nun war es an mir, zu antworten. Am Frühstückstisch hatte Christoph mir ja die Grußzeremonie gestenreich vorgeführt.
Mein ey klang dann doch gequetscht. Zurückhaltendes Lächeln sah ich. Verstecktes Kichern auch. Neugieriges Fixieren.
Maria ..., Elisabeth ..., Theodora.
Meine Beklemmung legte sich.
Ester, Piska, Monika. „Walfish Bay!“, rief jemand. Gelächter. Was hatte das zu bedeuten - Walfish Bay und Monika? Das Mädchen überragte mich um Haupteslänge. Ihre ein wenig schräg gestellten Augen blickten kühl auf mich herab, der Händedruck war flüchtig. Eliakim ..., Aganusa ..., Elipuse ...
„Wath’s?“
„E-li-pu-se!“
Ich wiederholte.
„Verry well!“ Das Mädchen trat belustigt einen Schritt zurück.
Raimi ..., Lidya.
Lidya? Ich starrte die junge Frau an. Ihre raue Hand lag schwer in der meinen. Ein Irrtum schien ausgeschlossen.
Lidya hatte mir im Transit-Camp den Napf mit Wasser gereicht. Das breite Gesicht, die tiefschwarze, unter den Augen geritzte Haut.
„Transit-Camp?“, fragte ich aus meiner Verlegenheit heraus.
„Yes ...!“ Sie zog ihre Hand zurück. Nun wurde ich unverhohlen gemustert.
Jemand tippte mir auf die Schulter, ich drehte mich um. Hinter mir stand Eliakim.
Er zeigte auf Werkzeuge, die am Boden lagen. Zwei breitmäulige Schippen, drei Spaten, ein Beil. Ich nahm einen der Spaten auf. Das Blatt rutschte vom Stiel, fiel scheppernd zu Boden. Eliakim zuckte hilflos mit den Schultern.
Das sollte alles sein, das unser Werkzeug? Dies unsere Gerätschaften, mit denen wir in den Lateritboden hineinwollten? Keine Spitzhacke, keine Schubkarre. Weder Axt noch Säge? Ein Junge hatte sich indes zu uns gesellt. Dünn, acht oder neun Jahre alt und für sein Alter nicht sehr groß. Im Arm trug er eine Puppe.
Die Puppe war nackt und aus fleischfarbenem Kunststoff, ihr fehlte das rechte Auge. Eines der Mädchen war dabei, ein grob aus Holz geschnitztes Bein am Puppenkörper zu befestigen, dazu zog sie ein Stück Draht unter ihrer Pudelmütze hervor. Der Junge beobachtete kritisch die Manipulationen, sein Spielzeug gab er nicht aus der Hand.
Als das hölzerne Bein am Puppenbalg baumelte, riss er den kleinen Körper an sich und lief eilig davon.
Gehörte der Junge zu einem der Mädchen, zu Maria vielleicht oder zu Piska?
Eliakim hatte sich einen Stein gesucht und trieb damit das Spatenblatt auf den Stiel.
Wenigstens ist ihm das Werkzeug nicht gleichgültig, dachte ich.
Im spärlichen Schatten eines Baumes breitete ich die Lageskizze der Baustelle aus.
„The first ...", begann ich.
Wir, die DDR und das Finnische Solidaritätskomitee „Taksvärkki“, wir haben das Geld zusammengetragen für diesen Kindergarten. Lasst uns so schnell wie möglich die Fundamente in die Erde bringen. In Helsinki sitzen die Monteure schon auf den Koffern, bereit, hierherzukommen, um die Wände der Häuser zu errichten.
Politische Einstimmung, motivierender Termindruck von Anfang an - ich zögerte und unterließ es schließlich, ein Spruchband zu entrollen.
Die Mädchen hockten vor dem Kartonpapier, rückten die Skizze zurecht, blickten auf, verglichen unsicher die abstrakte Strichlandschaft mit dem uns umgebenden Terrain. Respektlos wurde das Blatt hin und her gezerrt, war Minuten später gezeichnet durch viele Hände, durch rote Erde, durch Tropfen, die sich von den Blättern des Baumes lösten.
Eingekeilt in den Weiberhaufen, war meine Person nun doch an den Rand des Interesses gerückt.
Ein herber Geruch von Seife umgab mich und ein Hauch von kaltem Rauch und Schweiß.
Die Mädchen drückten sich zu meiner Rechten, zu meiner Linken, waren über mir und hinter mir. Ich spürte Ellenbogen und Schenkel und Lenden und Brüste. Und unruhige Hände auf meinen Schultern. Zwischen Hosenbund und Pulli nackte Haut, und bloße Füße, Zehen mit verwachsenen Nägeln in ungleichen Sandalen.
Ein waches Auge für Sekunden, ein breiter sinnlicher Mund. Lippen mit verwirrendem Glanz ...