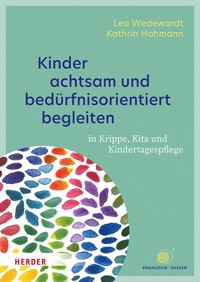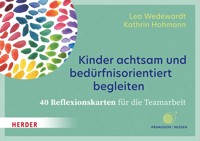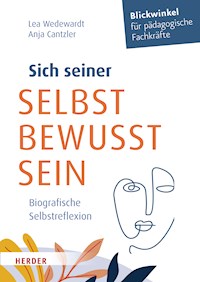
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Ein professioneller Umgang mit Kindern erfordert es, sich seiner eigenen Muster und Strategien, ihrer Ursprünge und ihrer Auswirkungen bewusst zu sein. Dafür ist es wichtig, sich im Alltag zu beobachten, das eigene Handeln zu reflektieren und auf diese Weise Veränderungen anzustoßen. Was triggert mich, welche Gefühle regen sich in mir, welche Beziehungsmuster lebe ich, und wo könnte das seinen Ursprung haben? Nur wer sich selbst kennt, kann als Fachkraft auch mit Kindern achtsam umgehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lea Wedewardt
Anja Cantzler
Sich seiner
Selbst
bewusst
sein
Biografische Selbstreflexion für pädagogische Fachkräfte
© Verlag Herder GmbH,
Freiburg im Breisgau 2022
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung, Layout, Satz & Gestaltung: wunderlichundweigand, Schwäbisch Hall
Covermotiv: © Ardea-studio – shutterstock Illustrationen im Innenteil: © bioraven, Bibadash, Kupriianova Alesia, lineartestpilot, Nadia Grapes, Olga Strel, Ruslana_Vasiukova, Rvector, Tanya Leanovich – shutterstock, © wunderlichundweigand
Herstellung: Graspo CZ, Zlín Printed in the Czech Republic
ISBN (Print) 978-3-451-39290-0
ISBN EBook (PDF) 978-3-451-82771-6
ISBN EBook (EPUB) 978-3-451-82772-3
Inhalt
Vorwort: Zwei Generationen – ein Thema
Einleitung
1. Relevanz biografischer Selbstreflexion für die pädagogische Arbeit
1.1 Der Einfluss der eigenen Biografie auf das professionelle Handeln
1.2 Die Sache mit dem Bauchgefühl
1.3 Veränderungen brauchen Zeit und Wiederholung
2. Die Haltung als Ausdruck pädagogischer Professionalität
2.1 Die Einstellung zur Kinderbetreuung vergegenwärtigen
2.2 Die wahre Motivation ergründen
2.3 Eigene Werte und Normen erkennen
2.4 Die professionelle Rolle reflektieren
3. Das menschliche Gehirn und die drei Ebenen der Reflexion
3.1 Die drei Ebenen des Gehirns
3.2 Die drei Ebenen der Reflexion
4. Wunde Punkte verstehen
4.1 Der Körper als wichtiger Signalgeber
4.2 Trigger wahrnehmen
5. Beziehungserfahrungen reflektieren
5.1 Die Entstehung von Beziehungserfahrungen
5.2 Die Weitergabe von Beziehungserfahrung
5.3 Fokus auf Beziehung oder Autonomie?
6. Erfahrungen mit Autonomie und Abgrenzung reflektieren
6.1 Angst vor Selbstständigkeit
6.2 In die Selbstständigkeit drängen
6.3 Grenzen spüren und „Nein“ sagen
7. Strategien beobachten
7.1 Kampf, Flucht und Erstarrung
7.2 Beziehungsstrategien reflektieren
7.3 Abwehrmechanismen
7.4 Reinszenierung als Schutzstrategie
7.5 „Es hat mir doch auch nicht geschadet!“ als Abwehrstrategie
8. Das innere Kind und seine Glaubenssätze entdecken
8.1 Das innere Kind und sein Einfluss auf das Bild vom Kind
8.2 Das innere Kind und seine Glaubenssätze
8.3 Das Selbstwertgefühl stärken
9. Gefühle spüren und annehmen
9.1 Unverarbeitete Gefühle bemerken
9.2 Gefühle als wichtige Signalgeber verstehen
9.3 Was Gefühle mit mir machen
9.4 Gefühle und Bedürfnisse der Gegenwart und der Vergangenheit annehmen
10. Inneren und äußeren Stress reflektieren und bewältigen
10.1 Die Entwicklung der Stresstoleranz
10.2 Den Umgang mit den Stressoren verändern
11. Sich selbst annehmen, um Kinder annehmen zu können
Literatur
Vorwort: Zwei Generationen – ein Thema
Es gibt keine Zufälle, nur eine Unkenntnis der Zusammenhänge. Heinrich Fallner
Im Sommer 2020, mitten in der Pandemie, begegneten sich zwei Frauen über Social Media − Lea Wedewardt (geb. 1987), studierte Kindheitspädagogin (M.A.), verheiratet und Mutter zweier Kinder, wohnhaft in Brandenburg, und Anja Cantzler (geb. 1968), diplomierte Sozialpädagogin, Mastercoach und Supervisorin, seit über 25 Jahren verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter mit der Wahlheimat Ostwestfalen.
Als Tochter minderjähriger Eltern wurde Anja Cantzler in ihren ersten Lebensjahren von den Großeltern und deren Geschwistern mit erzogen und nachhaltig geprägt. Der eine Großvater erzählte viel über den Krieg, der andere hüllte sich in Schweigen. Die ostdeutsche Vergangenheit väterlicherseits war durch Traumata geprägt. In ihrer Kindergartenzeit kam Anja Cantzler erstmalig mit bedürfnisorientierter Pädagogik in Kontakt. Sie durfte erleben, dass sie als Person mit ihren Interessen und Wünschen von ihren Erziehern und Erzieherinnen ernst genommen wurde. Anjas Lebensweg verlief nicht immer geradlinig. Er war geprägt durch Geldsorgen, Krankheiten und Krisen. Es gab immer wieder wichtige Personen, die zu ihr standen, als sie dies am meisten brauchte. Ihre fast zehnjährige Tätigkeit als Fachkraft und Leiterin in verschiedenen Kindertageseinrichtungen eröffnete ihr einen intensiven Blick in die Praxis, der sich heute in ihrem Einfühlungsvermögen für die Praxis widerspiegelt. Mit ihrer Coaching- und Supervisionsausbildung wuchs ihr Interesse an der Bedeutsamkeit der eigenen Biografie, für das eigene Fühlen, Denken und Handeln. Sie lernte die biografische Selbstreflexion als Schlüssel für professionelles Handeln schätzen und nutzt jede sich bietende Gelegenheit, dies Fachkräften aus Krippe, Kita und Kindertagespflege in ihren Weiterbildungen und Fachbüchern mit auf den Weg zu geben.
Lea Wedewardt wuchs behütet in einer bodenständigen Baden-Württemberger Familie auf und hat ihre Kindheit als sehr wohltuend in Erinnerung. Mit zwei jüngeren Schwestern stellte sie allen möglichen Schabernack an, stritt sich mit ihnen und vertrug sich wieder. Ihre Kindergarten- und Schulzeit verbrachte sie in Waldorfkreisen. Als eher schüchternes, sensibles und feinsinniges Kind tat ihr die Waldorfpädagogik gut und sie konnte dort ihre Persönlichkeit entwickeln. Die Realität nach der Schulzeit stellte Lea mit ihrer einfühlsamen Art jedoch vor Herausforderungen. Sie konnte oft nicht fassen, wie grausam die Welt doch sein kann. Insbesondere während ihres Studiums zur Kindheitspädagogin erlebte sie einprägsame Momente in den Praxisphasen in Kindertagesstätten. Diese manchmal für sie im Nachgang traumatisch empfundenen Szenarien, die so gar nicht mit ihren eigenen Kindheitserfahrungen zusammenpassten, ließen sie die Kraft entwickeln, sich für die Rechte der Kinder in Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Besonders einprägsam und für dieses Buch ebenfalls wichtig waren die psychoanalytische Schwerpunktsetzung in ihrem Studium und die damit selbst erlebten Selbsterfahrungsabschnitte. So kam es, dass Lea Wedewardt in allem, was sie bisher tat, als Evaluatorin, Weiterbildnerin, Fachschullehrerin, Autorin, Podcasterin, Bloggerin und Beraterin immer ein Ziel verfolgte: die pädagogischen Fachkräfte zum Nachdenken anzuregen und so das Wohl der Kinder in den außerfamiliären Betreuungseinrichtungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
Als Vertreterinnen zweier unterschiedlicher Generationen und trotz all ihrer biografischen Unterschiede verbindet diese beiden Frauen vor allem ihr leidenschaftliches Engagement dafür, die Praxis der Kinderbetreuung zu verändern. Beide stehen für eine gewaltfreie, achtsame und bedürfnisorientierte Pädagogik. Es ist immer wieder traurig, damit konfrontiert zu werden, welche Missstände in einzelnen Einrichtungen der Kinderbetreuung herrschen. Und genau deshalb möchten beide aktiv dazu aufrufen, die eigenen Denk- und Verhaltensmuster zu reflektieren.
Anja Cantzler und Lea Wedewardt wissen, dass es −neben der Verbesserung der Strukturbedingungen − nur einen wirkungsvollen Weg gibt, diese Missstände aktiv zu beheben: die biografische Selbstreflexion. Beide sind der festen Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie eine Grundvoraussetzung für das Ergreifen eines pädagogischen Berufes sein sollte. Biografiearbeit gehört grundlegend in die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte und sollte auch selbstverständlicher Bestandteil jeder Teamarbeit sein.
Dieses Fachbuch leistet einen Beitrag dazu, sich der biografischen Selbstreflexion als pädagogische Fachkraft alleine und gemeinsam im Team anzunähern. Begleitend kann das Workbook genutzt werden. Die darin enthaltenen Übungen wollen dazu einladen, sich analog der Inhalte des Buches selbst zu reflektieren und das eigene Fühlen, Denken und Handeln besser zu verstehen.
Einleitung
Es ist viel schöner, an seinen Stärken zu wachsen als an seinen Schwächen zu verzweifeln. Margret Carr
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und die damit verbundene Selbstreflexion gewinnen in der Kindertagesbetreuung zunehmend an Bedeutung. Aus entwicklungspsychologischer und neurobiologischer Sicht entwickeln sich Stärken, Ressourcen und Besonderheiten eines Menschen durch die Gesamtheit seiner Erfahrungen und Erlebnisse im Verlauf seines Lebens. Fühlen, Denken und Handeln werden dadurch maßgeblich beeinflusst.
Auch in der Kinderbetreuung haben die biografischen Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte mehr oder minder bewusst Auswirkungen auf das pädagogische Handeln im Umgang mit Kindern, Eltern, Kollegen und Kolleginnen. Bedeutsam ist hier, dass jegliches Handeln wiederum Einfluss auf die Identitätsentwicklung des Kindes nimmt und somit Bestandteil dessen Biografie wird. Daher ist es unabdingbar für die Professionalität, sich umfassend mit der eigenen Lebensgeschichte und dem damit verbundenen Erleben auseinanderzusetzen.
In der kompetenzorientierten Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen wird dem zunehmend Rechnung getragen, dadurch, dass die Biografiearbeit im Curriculum verankert ist. Die Ausbildungspraxis an sich weist jedoch in diesem Punkt immer noch große Lücken auf – nicht zuletzt, weil das konkrete Handwerkszeug und geeignete Methoden fehlen. Die Autorinnen schließen sich hier der Meinung von Anke Elisabeth Ballmann an, die sagt, dass die Biografiearbeit maßgeblich in die Ausbildung gehört, um frühzeitig aufzudecken, wer nicht für diesen Beruf geeignet ist.
Pädagogische Fachkräfte, die bereits in der Ausbildung die biografische Selbstreflexion verinnerlicht haben, werden diese mit größerer Selbstverständlichkeit auch in das weitere Berufsleben integrieren. Die Autorinnen gehen so weit zu fordern, dass eine erste biografische Auseinandersetzung schon zu Beginn der Ausbildung als Eignungsprüfung verankert werden sollte.
Der Begriff „Biografie“ stammt aus dem Griechischen und bezeichnet die mündliche oder schriftliche Lebensbeschreibung einer Person. Im Unterschied zu einem Lebenslauf geht es dabei nicht nur um die Erfassung aller Daten und deren zeitlichen Abfolge im Leben eines Menschen. Diese Daten und Fakten werden vielmehr dahingehend interpretiert und dargestellt, welche Bedeutung sie für einen Menschen haben (vgl. Miethe 2011, S. 12). Es geht also nicht darum, die eigene Kindheit objektiv korrekt nachzustellen, sondern vielmehr um das Gefühl, das mit Erinnerungen an die eigene Kindheit und einzelne Szenen verbunden ist.
Die verschiedenen Methoden der Biografiearbeit bieten vielfältige Möglichkeiten zur professionellen Auseinandersetzung mit der individuellen Lebensgeschichte und der Be- und Verarbeitung lebensgeschichtlicher Ereignisse. Die biografische Selbstreflexion fördert die individuelle Identitätsfindung (vgl. Gudjons et al. 2008, S. 16ff.). Durch das Reflektieren und Verstehen der eigenen Lebensgeschichte kann eine Person Ressourcen und Kompetenzen entdecken, was wiederum als Grundlage für die persönliche Weiterentwicklung dient.
Es geht darum, „Vergangenes zu erinnern“, „Gegenwärtiges zu entdecken“, um daraus „Künftiges entwickeln“ zu können (vgl. Klingenberger 2003, S. 141ff.). Der Blick in die Vergangenheit ermöglicht, das gegenwärtige Fühlen, Denken und Handeln besser zu verstehen, einzuordnen und somit andere Bewältigungsstrategien für die Gegenwart an die Hand zu bekommen. Das kann Veränderungsmöglichkeiten für die Zukunft eröffnen.
Reflexionsprozess
•Erinnern, was war.
•Verstehen,wozu es gut war.
•Verändern der erlernten Strategien nach und nach.
Im Wesentlichen benennen Klingenberger und Ramsauer (2017, S. 71f.) ergänzend folgende Ziele der Auseinandersetzung mit Biografien:
•Erlangen einer biografischen Gestaltungskompetenz; es geht dabei um die Fähigkeit, die eigene Lebensgeschichte zu überdenken, zu bewältigen und zukunftsorientiert zu gestalten.
•Entwicklung von Biografizität; das beinhaltet die Bereitschaft, neue Erfahrungen, neues Wissen und gesellschaftliche Veränderungen mit dem bisherigen Erlebnissen und Erkenntnissen zu verknüpfen und in die eigene Persönlichkeitsentwicklung mit einzubeziehen.
•Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit durch biografisches Bewusstsein; das bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebens- und Berufsweg auch auf dem Hintergrund der Endlichkeit des Lebens stattfindet.
Wer sich mit seiner eigenen Lebens- und Berufsgeschichte beschäftigt, sollte überprüfen, mit welcher Motivation diese Selbstreflexion im Einzelnen geschieht. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Möglichkeiten und gute Gründe zu benennen:
•Einzelne Episoden und Fragmente des eigenen Lebens so zusammenfügen, dass sie nachvollziehbar und verständlich werden
•Erlebte Verletzungen erkennen, um sie ressourcenorientiert im Leben zu integrieren
•Neue Erkenntnisse gewinnen, um sich persönlich weiterzuentwickeln
•Orientierung finden durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Ursprung von Werten, Entscheidungen und Sinnvorstellungen
•Neue Berufs- und Lebenswegweichen stellen
•Verborgene Ressourcen (wieder-)entdecken, um gegenwärtige Herausforderungen besser meistern zu können
•Ermutigung bekommen, dass anstehende Veränderungen und Weiterentwicklung sich lohnen
•Gemeinsamkeiten mit anderen, zum Beispiel im Team, entdecken, um sich als Teil einer Gemeinschaft zu erleben
•Bejahung der Berufswahl und des pädagogischen Handelns, um aus ganzem Herzen „Ja“ sagen zu können zu dem, was ist und was kommen wird
Bei aller Tiefe, die mit der biografischen Auseinandersetzung und Selbstreflexion verbunden ist, darf dieses Vorhaben durchaus spielerisch mit viel Lust und Freude angegangen werden. Ziel ist es, sich selbst zu beobachten und nicht in Selbstvorwürfe zu verfallen. Frei nach Heinrich Fallner, Coach und Supervisor: „Tiefe muss nicht immer schwer sein“ – sie kann auch Spaß machen, erhellende Momente liefern, eine Bewusstwerdung bewirken und die eigene Kraft spüren lassen.
Interview zum Thema Ausbildung und Auswahlverfahren Podcast: Ein Interview mit Dr. Anke Elisabeth Ballmann, Folge 34
Lea Wedewardt: Der Kita Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung
Online unter:https://www.beduerfnisorientierte-kinderbetreuung.de/34-anke-elisabeth-ballmann-im-interview-zum-thema-ausbildung-und-auswahlverfahren
Warum pädagogische Fachkräfte sich mit ihren Kindheitserfahrungen auseinandersetzen sollten, Folge 2
Lea Wedewardt: Der Kita Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung
Online unter: https://www.beduerfnisorientierte-kinderbetreuung.de/02-warum-paedgogische-fachkraefte-sich-mit-ihren-kindheitserfahrungen-auseinandersetzen-sollten
1. Relevanz biografischer Selbstreflexion für die pädagogische Arbeit
Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Bewusstsein eigener Gesinnung und Gedanken, das Erkennen seiner selbst, welches ihm die Einleitung gibt, auch fremde Gemütsarten innig zu erkennen. Johann Wolfgang von Goethe
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und die Reflexion des damit einhergehenden Fühlens, Denkens und Handelns im beruflichen Kontext ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für das professionelle Handeln jeder pädagogischen Fachkraft. Die hohe Bedeutung der biografischen Selbstreflexion liegt darin begründet, dass die pädagogische Fachkraft selbst als Person immer auch ihr wichtigstes Werkzeug und ihre wichtigste Intervention darstellt. Sie bringt sich als ganze Person mit all ihren Erfahrungen, Erlebnissen und Überzeugungen im Gepäck in die Beziehung zu den Kindern ein (vgl. Übung 1 im Workbook).
Die Kinder sind angewiesen auf eine Beziehung, die ihnen Halt, Sicherheit und Orientierung gibt. Ohne diese Sicherheit kommt es zu anhaltendem Stress, der in der Regel dauerhaft zu Schädigungen im kindlichen Organismus führt (vgl. Behncke 2013). Eine sichere und verlässliche Beziehung bildet das Fundament für das emotionale Wohlbefinden eines Kindes. Nur ein Kind, das sich sicher und wohl fühlt, kann sich angst- und stressfrei in seiner Persönlichkeit entfalten. Die pädagogische Fachkraft hat deshalb die Aufgabe, diese sichere Basis feinfühlig und bedürfnisorientiert bereitzustellen.
Stärken und Kompetenzen
An welche positiven und negativen Erlebnisse und Erfahrungen aus meiner Kindheit kann ich mich noch gut erinnern?
Welche Überzeugungen habe ich aus diesen positiven wie negativen Erlebnissen gewonnen?
•Worin bestehen meine Stärken?
•Was fällt mir spontan ein, wo ich mich gerne noch weiterentwickeln würde?
•Wie gut kann ich mich auf mein Bauchgefühl in meiner pädagogischen Arbeit verlassen?
•Was gelingt mir in der Arbeit mit den Kindern schon richtig gut?
Es ist bekannt, dass Kinder durch Nachahmung und in Ko-Konstruktion von den pädagogischen Fachkräften lernen, oder wie Philippa Perry (2021, S. 17) formuliert: „Kinder tun nicht, was wir sagen; sie tun was wir tun.“ Deshalb ist es so wichtig, die eigenen Handlungen, Gefühle und Reaktionen im Blick zu behalten.
Beispiel: Nachahmung
In der Elternberatung erzählt eine Mutter, dass ihre Tochter recht perfektionistische Züge an den Tag lege. Alles, was sie tut, führt sie gründlich und gewissenhaft aus. Oftmals zerreißt sie ihre gemalten Bilder, weil sie unzufrieden damit war. Die Mutter versichert, dass sie und auch ihr Mann versuchen, ihre Tochter zu bestärken, dass das, was sie tue und wie sie sei, genau richtig und gut ist. Die Tochter fände es trotzdem ganz schrecklich, Fehler zu machen und habe einen sehr hohen Anspruch an sich selbst.
Die pädagogische Fachkraft meint darauf: „Das, was Sie zu Ihrer Tochter sagen, ist das eine; aber das, was Sie selber vorleben, ist das andere.“ Diese Worte öffnen der Mutter schlagartig die Augen. Bei genauerer Überlegung erkennt sie, dass sie und ihr Mann selbst sehr ehrgeizig und leistungsorientiert sind. Das, was sie also zu ihrer Tochter sagen, widerspricht dem, was sie ihr vorleben. Das Mädchen spiegelt das Verhalten der Eltern und ahmt sie nach.
Die pädagogische Fachkraft ist ebenso ein Vorbild und Handlungsmodell für die Kinder. Insbesondere in der heutigen Zeit, in der immer mehr Kinder manchmal bis zu zehn Stunden in den Einrichtungen verbringen, ist dieser Einfluss nicht zu unterschätzen. Eigene Erfahrungen, Einstellungen zu Kindern, Bindungserfahrungen, Konflikterfahrungen und Glaubenssätze – seien sie bewusst oder unbewusst – fließen in die Interaktion mit den Kindern ein. Das Kind ahmt nach, was es bei der Fachkraft beobachtet und erlebt. Die Pädagogin bzw. der Pädagoge hat somit einen unmittelbaren Einfluss darauf, welche Beziehungserfahrungen ein Kind macht, welche Glaubensgrundsätze es verinnerlicht und welche Handlungsstrategien es in den verschiedensten Situationen entwickelt. Pädagogische Fachkräfte nehmen auf diese Weise nachhaltig Einfluss auf die Biografie und die damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
1.1 Der Einfluss der eigenen Biografie auf das professionelle Handeln
Jede pädagogische Fachkraft ist ein Mensch mit einer ganz eigenen Geschichte, eigenen Erfahrungen, eigenen Persönlichkeitsmerkmalen und eigenen Motivationen. Sie trägt ganz persönliche, meist unbewusste Erfahrungen über Beziehungen, den Umgang mit Gefühlen, mit Glaubenssätzen und unter Umständen traumatischen Erlebnissen in sich. Wenn eine pädagogische Fachkraft sich dieser Erfahrungen nicht bewusst ist, keinen Blick auf ihre „blinden Flecken“ wirft, besteht die Gefahr, dass diese direkt in der pädagogischen Beziehung wirksam werden.
Sehr gut lässt sich diese Behauptung in Anlehnung an das Eisbergmodell (siehe Abbildung S. 20) verdeutlichen. Hier ist das Handeln der pädagogischen Fachkraft anhand von Verhalten, Körperhaltung, Mimik, Gestik, Worten, Stimmlage im Vordergrund und sichtbar. Gespeist wird dieses jedoch von den im Laufe des Lebens entwickelten, nicht sichtbaren Persönlichkeitsanteilen wie zum Beispiel von Normen und Werten, Glaubenssätzen, Beziehungserfahrungen und gegebenenfalls auch unverarbeiteten Traumata.
Der Teil des Eisberges, der unterhalb der Wasseroberfläche liegt, hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf das pädagogische Handeln. Eine pädagogische Fachkraft, die in einem guten Kontakt zu den Prägungen aus ihrer eigenen Vergangenheit steht, kann diese mit ihrem Handeln im Hier und Jetzt reflektiert in Zusammenhang bringen und bleibt so auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig. Bei Fachkräften, die weniger gut im Kontakt mit ihrer Vergangenheit sind, bei denen die Erfahrungen und Erlebnisse nicht aufgearbeitet und integriert wurden, können Konflikte oder Gefühle triggern (siehe Kapitel 4.2) und die Beziehung zum Kind stören.
Das Eisbergmodell
1.2 Die Sache mit dem Bauchgefühl
Eine weit verbreitete Annahme in der Pädagogik lautet: „Hör doch einfach auf dein Bauchgefühl, dann wird das schon richtig sein.“ Vor dem Hintergrund, dass viele prägenden Erfahrungen und Erlebnisse aus der Vergangenheit oftmals unbewusst und somit unreflektiert das Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen, lässt sich aus psychologischer Sicht sagen, dass das Bauchgefühl nicht immer die günstigsten Strategien vorhält. Traumatische Erfahrungen, Trigger (siehe Kapitel 4) und unbewusste Glaubenssysteme (siehe Kapitel 8) führen zu verinnerlichten Prägungen, aus denen heraus sich im Gehirn bestimmte Handlungsmuster abspeichern. In den unterschiedlichsten Situationen, vor allem dann, wenn es stressig wird oder schnell gehen muss, greift unser Gehirn automatisch auf die ihm bekannten Handlungsmuster zurück. Diese sind für die feinfühlige Begleitung von Kindern jedoch nicht immer sinnvoll.
Beispiel: Bauchgefühl
Fachkraft Anne möchte den zweijährigen Lutz wickeln und kündigt an: „Lutz, ich wickel dich gleich.“ Als sie ihn hochnimmt, macht er seinen Körper ganz steif und ruft laut: „Nein!“ Anne reagiert aus ihrem Bauchgefühl heraus und setzt ihn trotzdem gegen seinen Willen auf den Wickeltisch. Ihr Glaubenssystem sagt ihr, dass Kinder hören müssen und sie sich als Erwachsene durchsetzen muss. Ihr Bauchgefühl ist in diesem Moment der Autonomieentwicklung des Kindes nicht dienlich und verhindert die Anwendung alternativer Handlungsstrategien.
In unserem Beispiel basiert das automatisierte Handlungsmuster der Fachkraft auf einem Glaubenssatz aus ihrer Vergangenheit, der dem Ansatz der autonomie- und bedürfnisorientieren Pädagogik entgegensteht. Philippa Perry beschreibt das sehr anschaulich in ihrem Werk „Das Buch, von dem Du Dir wünschst, Deine Eltern hätten es gelesen“, das viele Situationen enthält, in denen Erwachsene genau die Worte oder das Verhalten der eigenen Eltern wiederholen (vgl. Perry 2021, S. 18).
Perry verweist darauf, dass dieses intuitive Handeln auch hilfreich sein kann, wenn sich die daraus resultierenden eigenen verinnerlichten Handlungsmuster auf positive Erfahrungen in der eigenen Kindheit stützen. Bei vielen Menschen ist ihr Handeln jedoch auch auf schmerzliche und unverarbeitete Erfahrungen und Erlebnisse zurückzuführen. In diesen Momenten ist die Fachkraft dann nicht mehr bei dem Kind und seinen Bedürfnissen, sondern agiert aus ihren mit Wut, Trauer und Angst verbundenen Verletzungen heraus. Die Fachkraft wird in Situationen, die eine negative Erinnerung hervorrufen, von starken Emotionen überschwemmt und reagiert mit ihren basalsten Handlungsstrategien aus der frühen Kindheit. Doch ist es schwer, die Gefühle der Kinder zu spiegeln, wenn einen die eigenen Gefühle überschwemmen. Der Kontakt und die Verbindung zum Kind brechen schließlich für diesen Moment ab, und es kann keine emotionale Unterstützung mehr vonseiten der Fachkraft gewährleistet werden. Aus der Bindungsforschung ist bekannt, dass eine Person in stressigen Momenten in aller Regel auf ihre innersten, bekanntesten Handlungsstrategien zurückgreift (Fonagy & Target 2003), auch wenn sie, rational gesehen, diese Handlung nie gutheißen würde. Unter Druck verhält sie sich so, wie sie es viele Jahre in ihrer Kindheit gelernt hat.
Dieses Phänomen lässt sich auch neurowissenschaftlich begründen. In emotional aufgeladenen Momenten ist das limbische System (Amygdala) aktiv, und der Mensch wird so stark von seinen Emotionen überflutet, dass er nicht mehr planvoll, überlegt und kontrolliert handeln kann. Wenn eine Fachkraft in ihrem Leben bereits viele schmerzhafte Erfahrungen machen musste, speichern sich diese als unbewusste (implizite) Erfahrungen, gekoppelt an explosive Emotionen, im Unterbewusstsein ab und kommen dann zum Vorschein, wenn eine ähnliche Situation die Erinnerung zutage treten lässt.
Beispiel: Automatische Gefühlsreaktion
Die Kinder sitzen beim Essen. Einige sind bereits fertig und werden zunehmend unruhig. Andere nehmen sich noch ein weiteres Mal nach. Fachkraft Beate merkt, wie sie selbst immer angespannter und unruhiger wird. Nach einer Weile poltert sie los: „Könnt ihr nicht mal langsam fertig werden? Ihr haltet den ganzen Betrieb auf.“ Im Nachhinein ist sie selbst sehr erschrocken über ihren heftigen Ausbruch, der ihr bei genauerer Betrachtung nicht verhältnismäßig erscheint. Bei der Reflexion der Situation wird deutlich, dass sie von Gefühlen überflutet wurde, die in ihrer Kindheit verankert sind. Sie war selbst ein Kind, das gerne langsam und gemütlich aß. Am elterlichen Tisch wurde diesem Bedürfnis jedoch wenig Beachtung geschenkt. Vielmehr ging es darum, fertig zu werden und dann die weiteren Pflichten zu erledigen. Beim Mittagessen in der Kita holte sie dann genau dieses Erleben wieder ein, da sie in diesem Augenblick die anstehenden Aufgaben vor Augen hatte und durch die Unruhe der anderen Kinder getriggert (siehe Kapitel 4.2) wurde.
Verschiedene Studien über Traumatisierungen, Delinquenz und Gewalt zeigen, dass es darüber hinaus eine transgenerationale Weitergabe von Handlungsstrategien in Eltern-Kind-Beziehungen gibt (vgl. Rauwald 2020; Schulze 2020; Loch 2007). Das bedeutet: Wird der Ursprung der einzelnen Handlungsstrategien nicht reflektiert und damit der erste Schritt in Richtung Veränderung getan, können die schmerzhaften Erfahrungen und die damit verbundenen schädlichen Handlungsmuster von Generation zu Generation weitergegeben werden.