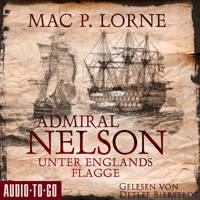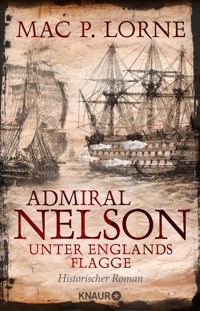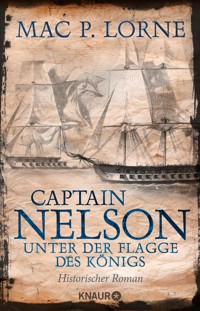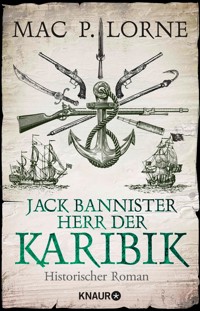14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn der Tod unsterblich macht: die Geschichte von El Cid Mac P. Lorne widmet sich in seinem historischen Abenteuer-Roman einer der größten Legenden der spanischen Geschichte, dem National-Helden El Cid. Spanien im Mittelalter, zwischen 1058 und 1099: Schon früh verdient sich der junge Rodrigo Diaz de Vivar, den sie später ehrfürchtig »El Cid« nennen werden, den Beinamen »Der Kämpfer«, denn keiner kann ihn im ritterlichen Zweikampf besiegen. Doch für den erwachsenen Mann hält das Schicksal Wechselvolles bereit: Sein König, Sancho II. von Kastilien, wird von der eigenen Schwester ermordet. Rodrigo findet zwar in Jimena die Liebe seines Lebens, doch ahnt er nicht, dass sie ihn im Auftrag des neuen Königs ausspionieren soll. Als er auch noch aus dem Königreich Kastilien verbannt und von seiner Familie getrennt wird, errichtet Rodrigo mithilfe maurischer Verbündeter ein eigenständiges Heerfürstentum im Osten Spaniens. Doch dann landet eine gewaltige muslimische Streitmacht aus Nordafrika in Spanien und für El Cid naht die Schlacht um Valencia, die ihn endgültig zur Legende machen wird. Action, Abenteuer und echte Helden – das sind die Zutaten, die Mac P. Lornes akribisch recherchierte historische Abenteuer-Romane zu opulentem Kopf-Kino machen. Entdecken Sie auch Mac P. Lornes historische Romane über weitere Helden der Geschichte: - »Die Pranken des Löwen« (Band 1 der Serie um Robin Hood - »Das Herz des Löwen« (Band 2 der Serie um Robin Hood) - »Das Blut des Löwen« (Band 3 der Serie um Robin Hood) - »Das Banner des Löwen« (Band 4 der Serie um Robin Hood) - »Der Sohn des Löwen« (Band 5 der Serie um Robin Hood) - »Der Pirat« (Sir Francis Drake, England im 16. Jahrhundert) - »Der Herr der Bogenschützen« (John Holland und Jeanne d'Arc, England und Frankreich 1400 – 1431) - »Der Herzog von Aquitanien« (Eudo von Aquitanien, der im 8. Jahrhundert die Mauren in Europa aufhielt) - »Der englische Löwe« (Richard Löwenherz, England im Mittelalter)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mac P. Lorne
Sie nannten ihn Cid
Eine spanische Legende
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Schon früh verdient sich der junge Rodrigo Díaz de Vivar, den sie später ehrfürchtig »El Cid« nennen werden, den Beinamen »Der Kämpfer«, denn keiner kann ihn im ritterlichen Zweikampf besiegen. Aus Kastilien verbannt und von Frau und Kindern getrennt, verbündet sich Rodrigo mit den Mauren und errichtet im Osten Spaniens ein eigenständiges Heerfürstentum. Doch dann landet eine gewaltige muslimische Streitmacht aus dem Maghreb in Spanien, und El Cid steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Personenregister
Prolog Königshof von Burgos, 1058
1. Kapitel Kastilien, 1063
2. Kapitel Saragossa, Valencia, Kastilien, 1063–1065
3. Kapitel Kastilien, León, Galicien, 1065–1072
4. Kapitel Zamora, Burgos, 1072–1078
5. Kapitel Burgos, Sevilla, Cabra, 1079
6. Kapitel Burgos, Saragossa, Levante, 1080–1082
7. Kapitel Saragossa, Toledo, Valencia, 1082–1086
8. Kapitel Sagrajas, Toledo, Valencia, 1086–1091
9. Kapitel Toledo, Valencia, 1091–1099
Epilog Valencia, 09./10.07.1099
Historische Anmerkungen des Autors
Zeittafel
Glossar
Bibliografie
Für meine drei Frauen Inga, Jette und Svea
Personenregister
Historische Personen, denen der Leser im Laufe des Romans begegnen wird:
Rodrigo Díaz de Vivar – genannt el Campeador, später el Cid
Jimena Díaz – seine Frau
Cristina, Diego und Maria – ihre drei Kinder
Minaya, Bermudez und Ramón – Gefährten und entfernte Verwandte des Cid, ihre Existenz ist nicht eindeutig belegt, sie werden aber explizit im Cantar de mio Cid genannt
Ferdinand I. – König von León, Kastilien und Galicien, genannt der Große
Sancha von León – seine Gemahlin
Sancho – Ferdinands ältester Sohn und Nachfolger als König von Kastilien
Alfonso – sein zweitgeborener Sohn und Nachfolger als König von Léon
García – sein jüngster Sohn und Nachfolger als König von Galicien
Urraca – seine Tochter, Herrin über Zamora und Verbündete von Alfonso
Ramiro I. – Ferdinands Halbbruder und Widersacher, König von Aragón
García Ordóñez – zuerst ein Feind, dann ein Freund des Cid
Vellido Dolfos – Ritter aus Zamora, ein Verräter und Mörder
Álvar Fáñez – ein kastilischer Feldherr und Freund des Cid
Yahya al-Mamun – Emir von Toledo
Yahya al-Qadir – sein Nachfolger, später Emir von Valencia
Ahmad I. al-Muqtadir – Emir von Saragossa
Yusuf al-Mutaman – sein Sohn und Nachfolger
Ahmad II. al-Musta’in – dessen Sohn und Thronfolger
Muhammad al-Mu’tamid – Emir von Sevilla
Yusuf ibn Taschfin – Herrscher über die strenggläubigen Almoraviden
PrologKönigshof von Burgos, 1058
Selbst in den entfernten Gemächern des Palas hörte man, dass im Innenhof der Burg ein Kampf im Gange war, der sehr heftig sein musste und dadurch nach und nach zahlreiche Zuschauer anlockte. Auch Ferdinand I., König von León, Kastilien und Galicien, gesellte sich mit seinem Besucher, der sein Halbbruder und zudem der König von Aragón war, zu den Schaulustigen. Von einem Bogenfenster des Palastes aus beobachteten die beiden Männer das Gefecht, das sich bereits seinem Ende zu nähern schien.
Zwei Knappen, beide mit Schwert und Schild ausgerüstet und zusätzlich durch Gambesons und Nasalhelme geschützt, kämpften mit einer Verbissenheit gegeneinander, als ob sie sich auf einem Schlachtfeld befänden und es wirklich um Leben und Tod ginge. Der Waffenmeister, der sie gewöhnlich anleitete und trainierte, war zur Seite gewichen und beobachtete seine beiden Schützlinge ebenso aufmerksam wie die beiden königlichen Prinzen Sancho und Alfonso. Die Söhne Ferdinands standen allerdings nicht beieinander, sondern jeder in gebührendem Abstand hinter einem der beiden Streiter, den sie mit lauten Zurufen anfeuerten. Offenbar trugen hier zwei ihrer Knappen einen Zweikampf aus, der mehr war als nur ein Übungsgefecht. Wohl eher ein Stellvertreterkrieg, wie ihn im Ernstfall die Bannerträger für ihre Könige führten. Es war am Hofe nämlich allgemein bekannt, dass die beiden königlichen Sprösslinge einander keineswegs in brüderlicher Liebe zugetan waren, sondern in ständiger Rivalität zueinander standen, die durchaus über bloße Wortgefechte hinausging und zu Handgreiflichkeiten führen konnte.
Hier nun allerdings vor vielen Zuschauern schien Sanchos Streiter mittlerweile die Oberhand zu gewinnen. Sein Hieb mit der abgestumpften Übungswaffe auf den Schild seines Gegners war so heftig, dass dieser sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, strauchelte und zu Boden ging. Sofort war sein Kontrahent über ihm, trat dem Unterlegenen das Schwert aus der Hand und setzte ihm sein eigenes an die Kehle.
Der Kampf war nur kurz gewesen und sein Ausgang eindeutig. In einem richtigen Gefecht wäre der im Staub Liegende jetzt tot gewesen, aber da es sich nur um ein Übungsgefecht unter Knappen gehandelt hatte, kam der Unterlegene mit dem Schrecken davon. Der Sieger des Zweikampfes streckte seinem Gegner die Hand entgegen, um ihm auf die Beine zu helfen, doch dieser schlug sie wütend zur Seite. Ächzend erhob er sich und blickte sich nach seinem Dienstherrn Alfonso um, doch dieser hatte den Kampfplatz bereits ohne ein aufmunterndes Wort an seinen Knappen verlassen.
Ganz anders Sancho, der seinem Streiter anerkennend auf die Schulter klopfte und dem jungen Mann offensichtlich freundschaftlich zugetan war, denn das Lächeln und die Freundlichkeit seiner Worte gingen weit über das normale Maß zwischen Knappen und Dienstherren hinaus.
»Wer ist das?«, wollte Ramiro von seinem Halbbruder wissen und wies mit der Hand in den Burghof hinab auf den siegreichen Streiter.
»Das ist Rodrigo Díaz de Vivar, den sie schon jetzt el Campeador, den Kämpfer, nennen«, klärte Ferdinand seinen Gast auf. »Bereits heute ist er in Zweikämpfen mit jedweder Waffe nahezu unbesiegbar und dabei noch nicht einmal zum Ritter geschlagen worden! Ich glaube ganz fest, dass der Junge aus dem Holz gemacht ist, aus dem auch die legendären Recken in alten Zeiten geschnitzt waren.«
Ramiro nickte zustimmend mit dem Kopf.
»Wohl wahr. Dabei ist er nicht einmal übermäßig breitschultrig und auch kein Hüne von Gestalt. Aber selten habe ich jemanden gesehen, der das Schwert einerseits so meisterlich, andererseits aber auch so gnadenlos führt wie er. Wer sind denn seine Eltern, und wie ist er an deinen Hof gekommen?«
»Sein Vater war Diego Laínez, einer meiner besten Ritter, der bedauerlicherweise vor Kurzem in einem Gefecht gegen die Streifscharen meines Neffen Sancho von Navarra gefallen ist«, gab Ferdinand bereitwillig Auskunft. »Deshalb fühlte ich mich auch verpflichtet, seinen Sohn hierher an den Hof zu holen, und lasse ihm nun eine angemessene Ausbildung angedeihen. Seine Mutter, Teresa Rodríguez, stammt aus altem, kastilischem Adel und führt ihre Abstammung bis auf den Helden Pelayo zurück, der als Erster aus den Bergen Asturiens heraus vor mehr als dreihundert Jahren den Kampf gegen die Mauren aufgenommen hat. Ihr Vater verwaltet für mich mehrere Burgen im Grenzgebiet zu den Taifa-Königreichen im Osten und ist mir treu ergeben. Je stärker ich diese einflussreiche Familie an mich binden kann, desto besser«, meinte der König, und ein spöttisches Lächeln spielte um seine Lippen.
Ramiro sah es wohl und wusste es auch zu deuten, bekämpften sich in ihrer Familie doch die Brüder, Schwestern, Neffen und Schwager seit Jahrzehnten untereinander bis aufs Messer, weil jeder Einzelne, der mit dem verstorbenen König Sancho III., genannt der Große, verwandt war, nach der Vorherrschaft über die anderen christlichen Königreiche im Norden der Iberischen Halbinsel strebte. Das galt für ihn selbst ebenso wie für den jüngeren Ferdinand, der den jahrelangen Kampf gegen seine legitimen Brüder mittlerweile gewonnen und aus der ihm von seinem Vater vererbten, eher unbedeutenden Grafschaft Kastilien ein mächtiges Königreich geformt hatte. Zumindest vorläufig, dachte Ramiro, denn noch war nicht aller Tage Abend und er nach Burgos gekommen, um mit eigenen Augen zu sehen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, die Vorherrschaft Kastiliens zu brechen oder zumindest zurückzudrängen. Und was zeigte ihm sein Bruder als Erstes? El Campeador, einen Kämpfer, den er wohl bald zusammen mit seinen anderen Streitern auf ihn hetzen würde, um sich nach Teilen von Navarra, León und Galicien auch noch Aragón unter den Nagel zu reißen.
Aber vielleicht wollte Ferdinand ihm ja auch nur zu verstehen geben, dass es besser war, sich freiwillig seiner Oberherrschaft zu beugen, doch dazu war der Ältere, wenn auch unehelich Geborene, keineswegs bereit. Ramiro versuchte bereits, Bündnisse mit den Emiren der Taifa-Reiche zu schmieden, die sich nach dem Zerfall des Kalifats von Córdoba vor etwas mehr als fünfzig Jahren gebildet hatten. Diese bekämpften sich mit ähnlicher Inbrunst untereinander wie die christlichen Könige, ein Umstand, der es wiederum leicht machte, ständig wechselnde Allianzen zu bilden. Was dabei letztlich überhaupt keine Rolle spielte, war der jeweilige Glaube, mochten die Priester und Bischöfe auf der einen und die Mullahs und Imame auf der anderen Seite noch so sehr gegen den Pakt mit den jeweils als Ungläubige Bezeichneten wetterten. Doch das wusste auch Ferdinand, der sich die Schwäche der muslimischen Fürsten ebenso zunutze machte wie Ramiro und sich seinen Schutz durch reichliche Tribute vergelten ließ.
»Was sind denn nun deine weiteren Pläne, nachdem du unseren Bruder García in der Schlacht von Atapuerca besiegt und getötet hast?«, fragte Ramiro lauernd. »Oder willst du darüber vielleicht lieber nicht sprechen? Steht Aragón womöglich als Nächstes auf deiner Wunschliste, und muss ich mir ernsthafte Sorgen machen, vielleicht bald einem von dir befehligten Heer gegenüberzustehen?«
»Solange du mir nicht mein Seniorat über die christlichen Königreiche streitig machst, Ramiro, hast du von mir nichts zu befürchten«, entgegnete Ferdinand süffisant. »Genau das hat García nämlich getan, und es ist ihm nicht gut bekommen. Also hüte dich besser, es ihm gleichzutun.«
»Aber er war immerhin der Älteste von uns und hatte damit Anspruch auf die Vorherrschaft. Meinst du nicht auch?«
»Nein, hatte er nicht, denn durch meine Heirat mit Sancha herrsche ich nun neben Kastilien auch über León und Galicien, er hingegen nannte nur Navarra sein Eigen. So wie du Aragón das deine. Also lass dir das Schicksal unseres Bruders eine Lehre sein und strebe nicht nach für dich unerreichbaren Früchten, kann ich dir nur raten.«
Ferdinands Stimme war schneidend geworden, und Ramiro konnte nicht anders, als den Blick zu senken, damit seine Augen nicht verrieten, was er dachte.
»Warum hast du dir dann die Krone von Navarra nicht gleich auch noch genommen, wenn du sie García schon vom Kopf schlagen musstest?«, wollte der König von Aragón wissen und harrte gespannt der Antwort.
»Weil ich kein Thronräuber bin«, fuhr Ferdinand seinen Halbbruder wütend an. »Begreif das endlich! Garcías Sohn kann ruhig über Navarra herrschen, solange er mein Seniorat anerkennt. Auch du solltest dich besser damit abfinden, Ramiro, dass ich jetzt das Oberhaupt der Familie und der Jiménez-Dynastie bin. Fällt es dir denn so schwer, dich den Realitäten zu beugen? Muss ich wirklich erst nach Aragón kommen, um dir die Sachlage zu verdeutlichen?«
»Als Gast bist du mir jederzeit herzlich willkommen, Bruder«, entgegnete der Angesprochene liebedienerisch. »Aber lass deine Streiter lieber zu Hause. Sie sind die weiten Hochebenen Kastiliens gewohnt und würden sich in unseren Bergen nur unwohl fühlen.«
»Mein Augenmerk gilt eher dem Süden als dem Norden, wie du wissen solltest, Ramiro«, versuchte Ferdinand zu beschwichtigen. »Im vergangenen Jahr habe ich die Grafschaft Portucale von den Mauren zurückerobert und gedenke, demnächst an den Duero vorzustoßen und vielleicht sogar das Tal des Mondego zu besetzen. Wir sollten uns die gegenwärtige Schwäche der Mauren zunutze machen, so wie sie sich vor mehr als dreihundert Jahren die unserer Vorfahren, um die ganze Iberische Halbinsel zu unterwerfen. Stoße mit deinen Streitern zu mir, Ramiro, und habe Teil am Ruhm und der Beute, die unser sein wird! Überleg es dir. Ich biete dir an, an meiner Seite als gleichberechtigter Heerführer zu reiten. Was willst du mehr?«
»Dein Angebot ehrt mich, Ferdinand. Doch du weißt, wie es an meinen Grenzen bestellt ist. Der Graf von Barcelona bedrängt mich ebenso wie der Emir von Saragossa. Nein, in dieser Situation kann ich mich dir nicht anschließen. Außerdem, ist es nicht besser, ich halte dir den Rücken frei? Wer sagt dir denn, dass die Mauren nicht in Kastilien einfallen, während du dich nach Süden wendest?«
»Das lass nur meine Sorge sein, für die Sicherheit meiner Reiche besteht keine Gefahr. Komm da besser auf keine dummen Gedanken, hörst du?«
»Nichts liegt mir ferner«, log Ramiro, ohne rot zu werden, der schon lange mit dem Gedanken spielte, sich bei passender Gelegenheit zu nehmen, was ihm seiner Meinung nach sowieso zustand. Doch solange sein Bruder so stark war wie gegenwärtig, war dies wohl nicht mehr als reines Wunschdenken. Aber vielleicht fiel Ferdinand ja auf einem seiner vielen Feldzüge oder wurde von einer in den Lagern grassierenden Seuche dahingerafft. Mit dessen untereinander zerstrittenen Welpen würde er dann schon fertigwerden, das konnte kein großes Problem sein. Eines Tages wollte jedenfalls er das Seniorat über alle christlichen Königreiche im Norden der Iberischen Halbinsel übernehmen und sie unter seiner Krone vereinen. Dann würde auch sein Neffe in Navarra die seine und zudem vielleicht gleich noch sein Leben verlieren. Ebenso wie die Nachkommen Ferdinands, denn von dessen Brut durfte keiner zurückbleiben, der Rache nehmen konnte. Doch bis dahin galt es, die Füße stillzuhalten und geduldig zu warten, bis Gott der Herr es fügen würde.
»Nun, wenn du mit solchen Streitern wie diesem el Campeador in den Kampf ziehst, kann ja nichts schiefgehen, und der Sieg wird ganz sicher der deine sein«, biederte Ramiro sich an. »Wie war doch gleich noch einmal sein richtiger Name?«
»Rodrigo Díaz de Vivar. Merke ihn dir besser, Ramiro, denn ich bin mir sicher, du wirst ihn noch des Öfteren hören.«
1. Kapitel Kastilien, 1063
Das gewaltige Zelt König Ferdinands, den man mittlerweile wie einst seinen Vater Sancho den Großen nannte, da er nun nach mehreren glücklich verlaufenen Feldzügen über alle christlichen wie auch muslimischen Länder von den Pyrenäen im Norden bis weit hinein in die Mitte der Iberischen Halbinsel herrschte, konnte man nur einen Palast aus Leinen und Seide nennen. Nachdem die Könige von Navarra und Aragón Ferdinands Seniorat anerkannt hatten und Galicien, León und Kastilien fest in seiner Hand waren, hatten sich ihm nach verlorenen Schlachten auch die Emire von Badajoz und Saragossa unterwerfen müssen und waren zu tributpflichtigen Vasallen des mächtigen, christlichen Königs geworden. Und nun schickte sich auch noch Yahya al-Mamun, Herrscher über Toledo, dem größten der Taifa-Königreiche, an, es ihnen gleichzutun.
Dem stolzen Emir fiel dieser Schritt nicht leicht, doch ihm blieb keine andere Wahl, wollte er nicht gänzlich unterliegen und womöglich für alle Zeit aus dem lieblichen al-Andalus vertrieben werden. Seit dem Zerfall des Kalifats von Córdoba, dessen Untergang die Muslime auf der Iberischen Halbinsel durch ihre ständigen Kriege und Fehden untereinander selbst verschuldet hatten, befanden sich die christlichen Herrscher kontinuierlich auf dem Vormarsch nach Süden und unterwarfen ein muslimisches Fürstentum nach dem anderen. Kein Wunder, gab es doch zeitweise mehr als vierzig davon auf dem den Mauren verbliebenen Territorium, die sich noch dazu bis aufs Blut bekämpften. Die muslimischen Herrschaftsgebiete glichen dadurch einem sich ständig verändernden Flickenteppich und waren daher leichte Beute für die unter der Oberhoheit Ferdinands stehenden christlichen Herrscher, die ihre Raubzüge Reconquista – Rückeroberung – nannten. Eine Wortwahl, die sich auf die Unterwerfung Iberiens durch die aus Nordafrika stammenden Araber und Berber vor mehr als dreihundert Jahren bezog.
Aber haben wir neben dem Glauben an den einzigen, wahrhaften und barmherzigen Gott – Allahs Name sei für alle Zeit gepriesen – nicht auch Kunst und Kultur nach al-Andalus gebracht, die Wissenschaften gefördert und die Landschaften zum Blühen und Gedeihen gebracht?, fragte sich al-Mamun auf dem Weg zu seiner Unterwerfung. Waren die Bauwerke, die von den maurischen Meistern und Handwerkern errichtet worden waren, nicht voller Leichtigkeit und Anmut? Im Gegensatz zu den düsteren Burgen und Kathedralen der Christen, die zwar mächtige Bollwerke waren, denen aber der Charme des Südens fehlte. Warum nur hatte der Allmächtige sein Haupt von seinen Söhnen in al-Andalus abgewandt? War es, weil er des ständigen Streites unter ihnen überdrüssig war? Oder vielleicht, weil man hier nördlich der Meerenge von Gibraltar den Glauben an ihn nicht so streng praktizierte wie im Maghreb oder gar im arabischen Kalifat?
Al-Mamun wusste es nicht zu sagen, haderte aber mit seinem Schicksal und hoffte, nicht allzu sehr gedemütigt zu werden, wenn er sich Ferdinand nun gleich notgedrungen beugte. Von seinen fürstlichen Leidensgenossen, die Ähnliches über sich hatten ergehen lassen müssen, war ihm allerdings berichtet worden, dass der christliche König sich meist gnädig und nachsichtig zeigte, wenn man seinen Wünschen nachkam. Er ließ den sich ihm unterwerfenden Emiren ihre Würde, den Muslimen ihren Glauben, und verlangte nur jährliche Tributzahlungen in nicht unbedeutender Höhe von ihnen. Gelder, die er für seine Kriege und aufwendige Hofhaltung dringend benötigte. Dafür standen die Vasallenfürstentümer aber auch unter seinem Schutz, und es hatte schon Fälle gegeben, wo Christen an der Seite von Mauren gegen die eigenen Glaubensbrüder gekämpft hatten, wenn sie von ihnen bedrängt worden waren. Außerdem hatte al-Mamun noch ein kostbares Geschenk für den großen König in seinem Gepäck, von dem er hoffte, dass es diesen besänftigen und gnädig stimmen würde.
Der Zug der prächtig gekleideten Muslime auf ihren herausgeputzten, edlen und im Vergleich zu den Streitrössern der christlichen Ritter leichten Pferden näherte sich, von Talamanca herkommend, dem Zelt Ferdinands, das auf einem Hügel inmitten des Feldlagers errichtet worden war. Dessen Vorderfront hatte man komplett aufgeklappt, damit jeder Edle, aber auch die einfachen Kriegsknechte verfolgen konnten, was sich gleich ereignen würde.
Die Stadt an der alten Römerstraße von Saragossa nach Toledo hatte am Vortag kapitulieren müssen, weshalb al-Mamun nun gezwungen war, in den sauren Apfel der zukünftigen Abhängigkeit von König Ferdinand zu beißen, denn dieser konnte von hier aus notfalls in wenigen Tagen bis vor die Tore der Hauptstadt seines Emirats ziehen. Und das galt es unter allen Umständen zu verhindern, denn Toledo würde wohl lange, aber sicher nicht ewig widerstehen können, entschlossen sich die Christen zum Angriff.
Der König thronte, umgeben von seinen engsten Würdenträgern und flankiert von seinen Söhnen, auf einem Podest im hinteren Teil des Zeltes. Gerade ihnen gedachte er heute eine Lektion im Umgang mit besiegten Feinden zu erteilen. Denn besonders García, sein Jüngster, hatte sich in letzter Zeit durch übermäßige Grausamkeit hervorgetan. Der Grund dafür war wohl seine übergroße Frömmigkeit. Er glaubte offenbar, das Christentum ebenso mit Feuer und Schwert verbreiten zu müssen wie die Mauren den Islam bei der Eroberung Iberiens. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so fanatisch, verhielt sich Alfonso. Nur Sancho, der Älteste, handelte meist überlegt und pragmatisch. Und vor allem umgab er sich mit den richtigen Freunden wie zum Beispiel dem jungen Rodrigo de Vivar, den Ferdinand erst vor Kurzem zum Ritter geschlagen hatte und der einer ohne Furcht und Tadel zu werden versprach, wie man immer öfters zu sagen pflegte. Zu Alfonsos eigenen engsten Vertrauten gehörte hingegen der zwielichtige Graf García Ordóñez, den der König am liebsten vom Hofe verbannt hätte, weil ihm dessen stetes Intrigenspiel mehr als zuwider war.
Doch Sancho hatte sich zu Ferdinands Leidwesen angewöhnt, ihm ständig zu widersprechen, und dies sogar im Kronrat. Er sah sich wohl schon als Herrscher und Nachfolger auf dem Thron der drei Königreiche.
Nun, wenn er sich da mal nicht zu früh freut, sinnierte der Vater, dessen besondere Zuneigung zu dem sich gern einschmeichelnden Alfonso seinen anderen beiden Söhnen ein steter Dorn im Fleische war. Fernando war sich dessen wohl bewusst, aber was sollte er tun? Sein Zweitgeborener glich nun einmal im Äußeren wie auch im Verhalten und im Charakter seiner Mutter am meisten – und diese war schließlich die Liebe seines Lebens. Deshalb stand ihm Alfonso von seinen drei Söhnen auch am nächsten und wurde, was seine väterliche Liebe betraf, nur von der zu seiner Tochter Urraca übertroffen, Ferdinands Augenstern. García war einfach ein verzogener Balg und bestimmt nicht geeignet zum Herrschen, Sancho dagegen schon eher. Doch mit seinem spröden Wesen und seiner zurückhaltenden Art gelang es ihm einfach nicht, das Herz seines Vaters im gleichen Maße zu gewinnen, wie es dem leutseligen und stets gut gelaunten Alfonso mit Leichtigkeit glückte. Dass aus dieser Konstellation Konflikte entstehen würden, war allen Familienmitgliedern schon seit Jahren bewusst, und vor allem Sancha, die Mutter seiner drei Söhne, litt darunter und betete tagtäglich darum, vor ihrem Gemahl von Gott dem Herrn abberufen zu werden, um nach dessen Tod womöglich nicht noch einmal einen Bruderkrieg, wie er unter ihren eigenen Geschwistern blutig getobt hatte, mit ansehen zu müssen.
Ferdinand war, zumindest gegenwärtig, jedoch mehr an Ausgleich und gutnachbarlichen Beziehungen als an ständigem Krieg mit den Mauren interessiert. Jedenfalls so lange, wie die Tribute flossen, die er zur Finanzierung seines Reiches dringend benötigte, der Handel gedieh und ihm das friedliche Nebeneinander auch ansonsten nutzte. Dass er auch anders konnte, hatte er hinlänglich bewiesen, dazu bedurfte es sicher keiner erneuten Demonstration. Keinem nützte es etwas, wenn es vor allem in den Grenzgebieten erneut zu Überfällen und Plünderungen kam, Bauern abgeschlachtet, Felder verwüstet und kleine Städte niedergebrannt wurden. Dies galt es zu beenden, und wenn es hier und heute zu einem Tribut- und Bündnisabkommen mit dem Emir von Toledo käme, sollte es ihm recht sein, und er wollte Gott dafür auf Knien danken.
Ähnlich dachte al-Mamun, als er sich, den Schwertarm quer vor der Brust, tief vor dem christlichen König verbeugte. Den Kniefall hingegen verweigerte er, doch Ferdinand bestand auch nicht darauf. Aber es war an ihm, das erste Wort an den Emir zu richten, und von diesem Recht des Siegers gedachte er auch, Gebrauch zu machen.
»Nun, Fürst von Toledo, es war wohl nicht gerade ein weiser Entschluss von Euch, sich gegen mich zu stellen. Das ist noch niemandem gut bekommen. Was gedenkt Ihr als Wiedergutmachung zu leisten und mir anzubieten, damit ich von hier nicht umgehend weiter nach Süden ziehe, um Eure Residenz einzunehmen? Ihr könntet mich in Ketten als mein Gefangener begleiten, damit Ihr Eure Hauptstadt noch einmal wiederseht, bevor Allah Euch mit meiner Hilfe zu sich abberuft.«
Al-Mamun lächelte still in sich hinein, wusste er doch, dass den Worten Ferdinands wohl kaum Taten folgen würden.
»Ich denke, großer König, dass zwei Dinge dagegensprechen. Erstens Euer Wort, von dem man sagt, dass Ihr es noch nie gebrochen habt. Schließlich wurde mir und meinem Gefolge freies Geleit zugesichert. Zum anderen ist Euer Reich doch jetzt schon so groß, dass Ihr es kaum beherrschen könnt. Wäre es da nicht eher angeraten, einen Verbündeten als einen Feind an Euren Grenzen zu haben?«
»Beantwortet meine Frage besser nicht mit einer Gegenfrage, Emir!« Ferdinands Miene hatte sich deutlich verfinstert. Auf der Nase herumtanzen lassen durfte er sich von einem Mauren auf gar keinen Fall, wollte er nicht seine Reputation verlieren. Er wusste, dass sein Hofstaat darauf wartete, dass der Emir sich vor ihm in den Staub warf, wenigstens der guten Form halber um sein Leben winselte und das Blaue vom Himmel herunter versprach, nur um es später nicht zu halten, was ihnen wiederum den Vorwand für einen erneuten Kriegszug liefern würde. Doch was sollte das bringen? Besser, man ließ dem stolzen Mauren seine Würde und gewann einen wahren Verbündeten als einen halbherzigen, der einem bei der erstbesten Gelegenheit in den Rücken fiel.
»Ich habe Euren Unterhändlern gestern bereits gesagt, dass ich bereit bin, mich Euch zu unterwerfen«, antwortete der Emir bereitwillig. »Aber sollten wir Könige wirklich um die Details feilschen oder das nicht besser unseren engsten Ratgebern überlassen? Mein Großwesir hat diesbezüglich alle Vollmachten, und sicher könnt auch Ihr einen Mann benennen, der für Euch sprechen soll. Stattdessen möchte ich Euch …«
Al-Mamun konnte nicht weitersprechen, weil die königlichen Prinzen García und Alfonso nahezu gleichzeitig aufgesprungen waren und empört auf ihren Vater einsprachen.
»Was erdreistet sich dieser Ungläubige?«, keifte der Jüngste von Ferdinands Söhnen. »Wieso liegt er nicht vor uns auf dem Boden oder kniet zumindest? Du bist viel zu nachsichtig mit diesen Mauren, Vater! Lass sie unsere Stiefel in ihren Nacken spüren, dann werden sie schon merken, was es heißt, sich gegen uns Christen zu erheben!«
»Ich kann in diesem Fall nur zustimmen«, meldete sich jetzt auch noch Alfonso ungefragt zu Wort. »Wir sollten die Gunst der Stunde nutzen und weiter nach Süden vorstoßen. Was gilt ein gegebenes Wort gegenüber einem Ungläubigen? Wenn wir drohen, den Emir vor den Mauern von Toledo zu Tode zu schleifen, werden sich die Tore der Stadt schon öffnen. Und vielleicht ist das sogar die Gelegenheit, bis ans Meer vorzustoßen und die Mauren endgültig dorthin zurückzudrängen, woher sie einst gekommen sind – nach Afrika.«
Eher setzen von dort ihre Glaubensbrüder über, und es ergeht uns wie den Visigoten unter ihrem letzten König Roderich vor langer Zeit, du unbedarfter Jungspund!, dachte Ferdinand, der die Lage wesentlich realistischer sah. Damals war in wenigen Jahren die ganze Iberische Halbinsel von den Arabern und Berbern besetzt worden, die man jetzt Mauren nannte. Erst in Aquitanien nördlich der Pyrenäen und im Reich der Franken war ihr Vormarsch zum Stehen gekommen. Rückte man den kleinen Taifa-Königreichen zu schnell und zu unnachgiebig zu Leibe, könnte es ohne Weiteres passieren, dass sich ihre Herrscher an ihre Glaubensbrüder im Maghreb wendeten. Die dort lebenden strenggläubigen Almoraviden warteten nur darauf, über die Meerenge zu setzen und endlich gegen die in ihren Augen Ungläubigen ziehen zu können. Noch lagen die maurischen Emirate, in denen man mit der radikalen almoravidischen Auslegung des Islam wenig anfangen konnte, wie ein Bollwerk zwischen den Christen und den gewaltigen Heerscharen aus Nordafrika. Aber schwächte man diese Mauer zu sehr, ja, brachte man sie womöglich sogar zum Einsturz, dann konnte nichts und niemand mehr die Sturmflut aufhalten, die dann erneut über die Iberische Halbinsel hereinbrechen würde, da war sich Ferdinand ganz sicher, und deshalb kam das für ihn auch nicht infrage.
»Was sagst du denn zu den Vorschlägen deiner Brüder, Sancho?«, wollte der König von seinem Ältesten wissen und hoffte, dass dieser mehr Verstand als die beiden anderen erkennen lassen würde.
Der Prinz wiegte den Kopf, als müsse er die Antwort genau abwägen, doch dann verblüffte er mit seinen Worten selbst seinen Vater.
»Lasst statt meiner Don Rodrigo antworten, mein König«, entgegnete er. »Seine Familie lebt seit Generationen im Grenzgebiet zu den Mauren. Niemand kennt die Schrecken der fortwährenden Kriege besser als er. Rät er zu, die Muslime gnadenlos zu bekämpfen, will ich mich dem gern anschließen.«
Ferdinand neigte zustimmend den Kopf und unterbrach den aufwallenden Protest seiner jüngeren Söhne, die nicht einsehen wollten, warum hier das Wort eines einfachen Ritters gleichberechtigt neben dem ihren gelten sollte, mit einer herrischen Handbewegung.
»So möge es sein. Tretet vor, Rodrigo de Vivar, und sagt uns, was Ihr darüber denkt. Sollen wir weiter vorrücken, Toledo einnehmen und gar bis ans Meer im Süden vorstoßen? Oder stattdessen lieber das Friedensangebot des Emirs annehmen und seine Tribute akzeptieren? Ich bin begierig, Eure Meinung zu erfahren.«
Der junge Rodrigo wusste im ersten Moment nicht, wie ihm geschah. Er gehörte zwar zum Gefolge von Prinz Sancho und war zu dem Empfang befohlen worden, hatte aber wie alle seinesgleichen in der hinteren Reihe gestanden. Niemals wäre ihm der Gedanke gekommen, in dieser Versammlung der Edlen zu sprechen oder dass gar der König das Wort an ihn richten könnte. Und hatte da nicht eine Spur Sarkasmus in der Stimme Ferdinands mitgeschwungen und dessen Aufforderung vielleicht gar nicht ernst gemeint? War das Ganze eventuell nur als eine erneute Demütigung Sanchos gedacht, die dieser vor allem gegenüber seinem Bruder Alfonso des Öfteren einstecken musste? Doch der Blick des Königs, mit dem dieser den jungen Ritter musterte, war ohne Arg, und so fasste sich Rodrigo ein Herz.
»Majestät, wenn ich offen sprechen darf, dann rate ich eher zu Friedensverhandlungen als zu weiterem Krieg. Wir in den Grenzgebieten wissen, welche Schrecken er in sich birgt. Mauren überfallen unsere Dörfer und Burgen, wir die ihren. Das geht schon seit ewigen Zeiten so, das Land verarmt, es kann kaum noch gesät und geerntet werden. Ehemals fruchtbare Landschaften, in denen Ölbäume und Weinstöcke gediehen, liegen brach und verwildern. Das kann weder Gottes noch Allahs Wille sein. Ich denke, wenn wir es hier und heute beenden können, sollten wir es zumindest versuchen. Fordert von Emir al-Mamun einen solch hohen Tribut, dass er nur noch ein kleines Heer unterhalten kann. Mit diesem soll er in den Grenzgebieten auf seiner Seite für Frieden sorgen, so wie wir es auf der unseren tun. Damit wäre allen am ehesten gedient, und die Menschen kämen endlich zur Ruhe.«
Schweigen breitete sich in der Runde aus, und der Emir fragte sich, wer denn dieser junge Mann war, den Allah offenbar mit der Weisheit des Alters gesegnet hatte, als sich eine weitere Stimme, ebenfalls aus der hinteren Reihe, vernehmen ließ.
»Ihr seid doch nur zu feige, um gegen die Ungläubigen in den Kampf zu ziehen«, zischte Graf Ordóñez. »Denn das ist etwas ganz anderes, als lediglich mit stumpfen Waffen auf einem Burghof zu kämpfen. Dabei kann man leicht sein Leben verlieren und nicht nur ein paar blaue Flecken davontragen.«
Rodrigos Hand fuhr sofort zum Schwertgriff. Das musste er sich von niemandem sagen lassen. Hatte er sich nicht erst unlängst in den Kämpfen um Gormaz und Berlanga ausgezeichnet, war als einer der Ersten die Sturmleitern hinaufgestürmt und hatte auf der Burg von Vadorrey die kastilische Flagge gehisst? Dafür hatte König Ferdinand ihn zum Ritter geschlagen, und diese Ehre war soeben von Ordóñez beschmutzt worden, was nur mit Blut abgewaschen werden konnte. Doch bevor er sein Schwert ziehen konnte und dabei gänzlich vergaß, dass das niemals vor dem König geschehen durfte, griff dieser selbst ein. Das fehlte gerade noch, dass sich hier im Angesicht der Mauren zwei Männer aus seinem Gefolge offen bekriegten und damit vor aller Welt offenbarten, wie uneins die Christen untereinander waren.
»Genug!«, donnerte der König. »Hier wird niemand der Feigheit bezichtigt, der auf mein Verlangen hin seine Meinung kundtut und seinen Mut im Kampf schon mehrfach bewiesen hat! Graf, Ihr werdet Don Rodrigo dafür Abbitte leisten, habt Ihr mich verstanden? Und Ihr, Don Rodrigo, nehmt die Hand vom Schwert, oder wollt Ihr sie verlieren? Denn das wäre die Strafe, wenn Ihr es in meiner Gegenwart unaufgefordert zieht, wie Ihr wisst. Also, García Ordóñez, ich höre!«
Der Graf knirschte mit den Zähnen und hoffte, dass Prinz Alfonso ihm beispringen und ihn vor dieser Demütigung, die er wieder einmal seinem überschäumenden Temperament zu verdanken hatte, bewahren würde. Aber der hielt sich wohlweislich zurück, wollte er doch seinen Vater nicht noch mehr reizen, und so musste Ordóñez seinen Stolz hinunterschlucken und sich wohl oder übel in das Unabwendbare fügen.
»Vergebt mir meine Worte, Don Rodrigo«, brachte der Graf mühsam zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. »Sie waren vorschnell gesprochen.«
Der Campeador, der für sein Leben gern die Sache in einem Zweikampf bereinigt hätte, neigte gleichfalls notgedrungen zustimmend das Haupt.
»Ich sehe sie als nicht gesprochen an«, entgegnete Don Rodrigo de Vivar, doch allen Anwesenden war klar, dass sich hier zwei Feinde fürs Leben gefunden hatten.
»Nachdem das nun geklärt ist und wir auch die Meinung meines ältesten Sohnes, kundgetan durch den Mund dieses jungen Ritters, vernommen haben, möchte ich gern an der Stelle fortfahren, an der der Emir so unhöflich unterbrochen wurde«, meinte Ferdinand ganz so, als wäre nichts geschehen und es nicht um ein Haar zu Mord und Totschlag vor den Mauren gekommen. »Was sagtet Ihr zuvor nicht gleich, Herr von Toledo?«
»Mein König, wie ich schon anmerkte, sollen sich doch unsere Untergebenen mit den Details unseres Friedensabkommens beschäftigen. Selbstverständlich bin ich wie die anderen Emire der Taifa-Königreiche vor mir ebenfalls dazu bereit, an Euch einen angemessenen Tribut zu entrichten, wenn ich dafür auf Euren Schutz und Beistand zählen darf. Niemand ist mehr an Ruhe und Frieden an den Grenzen gelegen als uns Mauren. Zum Beweis meiner zukünftigen Freundschaft habe ich Euch ein Geschenk mitgebracht, das sicher Euer Herz, wenn nicht sogar das all Eurer Glaubensbrüder, erfreuen wird.«
Der Emir winkte einem seiner Begleiter, und dieser trat, eine kleine, aber kostbar mit Goldbeschlägen verzierte Truhe in den Armen haltend, nach vorn. Tief verbeugte sich der Eunuch, denn jeder in der Runde sah, dass es sich um einen solchen handelte, vor dem König und öffnete dann den Schrein. In seinem Inneren lag ein kleines Gefäß aus Stein, das al-Mamun jetzt so vorsichtig heraushob, als wäre es der kostbarste Gegenstand auf dem ganzen Erdenrund. Und vielleicht war er das auch, denn als der Emir nun zu sprechen begann, wurde es totenstill im Zelt.
»Seht, mein König, auf diese eher unscheinbar wirkende Steinschale, auch wenn sie aus kostbarem Achat gefertigt worden ist. Denn sie ist eine unschätzbare Kostbarkeit, zumindest für euch Christen. Ein Verwandter von mir, der Herr über Oberägypten, hat sie mir geschickt, damit ich sie Euch überreiche und dadurch Euer Wohlwollen erringe. Auf verschlungenen Wegen ist sie nach Kairo und in den Besitz meines Vetters gelangt. Und zwar aus Jerusalem, wo sie über Jahrhunderte in der Kirche aufbewahrt wurde, die über dem Grab Eures Herrn und unseres Propheten Jesus Christus errichtet worden ist.«
Ein »Ah« und »Oh« ging durch die Reihen der christlichen Ritter, und vor allem die zahlreichen Priester und Bischöfe, die sich im Gefolge Ferdinands befanden, bekamen große Augen. Sollte es der Wahrheit entsprechen, was der Emir verkündete, erblickten sie hier erstmals einen Gegenstand aus dem Heiligen Land. Dieses war christlichen Pilgern seit der religiösen Intoleranz, die unter dem ägyptischen Kalif al-Hakim ihren Anfang genommen hatte, verschlossen. Zuvor hatten die Gläubigen die heiligen Stätten der Christenheit ohne große Gefahr für Leib und Leben besuchen können und mit den Juden und Muslimen in Palästina in gutem Einvernehmen zusammengelebt. Doch vor etwas mehr als sechzig Jahren hatte der Kalif, ein Fanatiker im Glauben, die Grabeskirche zerstören lassen, um seine radikale Auffassung vom Islam durchzusetzen, unter der seither vor allem die Christen und Juden, aber auch die Muslime anderer Glaubensrichtungen als der seinen, litten. Ein Aufschrei war durch das gesamte Abendland gegangen, doch die Christenheit zu zerstritten und zu schwach, um das Heilige Land unter ihre Kontrolle zu bringen, auch wenn die amtierenden Päpste ständig dazu aufriefen. Vielleicht gelingt die Rückeroberung ja irgendwann einmal, sinnierte Ferdinand, aber ob ich das noch erlebe?
»Nun, das ist eine schöne Geschichte«, meinte der König und lächelte al-Mamun nachsichtig an. »Aber habt Ihr denn einen Beweis dafür, dass sie auch nur ein Körnchen Wahrheit enthält? Märchen dieser Art erzählt man sich bei Euch in al-Andalus, im Maghreb und in Arabien doch auf jedem Marktplatz.«
»Aber keines über diese Schale, denn sie birgt ein großes Geheimnis. Christliche Priester haben sie in Jerusalem als ihr größtes Heiligtum verehrt und rechtzeitig vor der Zerstörung der Grabeskirche in Sicherheit gebracht. Mein Vetter, der sich in der Tradition der Ägypter immer um Ausgleich und Toleranz zwischen den Religionen verdient gemacht hat, wurde von ihnen gebeten, sie zu schützen. Er hat sich bemüht, die Geschichte der Schale zu erforschen, doch als ihm aufging, welches Heiligtum ihm da anvertraut worden war, traf ihn fast der Schlag. Er trennte nur ein kleines Stück von dem Stein ab und trägt es nun ständig als Talisman bei sich. Seither ist er nie wieder erkrankt, obwohl er reich an Jahren ist. Die Geschichte und den Weg, den die Schale zurückgelegt hat, hat er aufgezeichnet und diese nach al-Andalus geschickt, damit sie in die Hände derer gelangt, die ihren Wert wirklich zu schätzen wissen. Eure Schriftgelehrten werden das Papyrus sicher lesen können, auch wenn es in arabischer Sprache verfasst ist, und die Wahrheit hinter den Worten meines Vetters erkennen.«
»Nun spannt uns nicht länger auf die Folter, Yahya al-Mamun.« Ferdinand wurde langsam ungeduldig. »Dass die Schale aus der Kirche stammt, die über der Kreuzigungsstätte und dem Grab unseres Herrn Jesus Christus errichtet worden ist, mag ja durchaus sein. Vielleicht haben Mönche und Priester sie benutzt, wer weiß das schon zu sagen? Aber was soll denn nun ihr großes Geheimnis sein, sodass sie sogar vor Krankheiten schützen kann? Lasst es uns endlich wissen, denn langsam ermüdet mich Eure Geschichte.«
»Ich bin sicher, Ihr werdet gleich hellwach sein, mein König«, antwortete der Emir selbstbewusst. Er streckte seine Arme aus, wobei seine Hände die Steinschale nach wie vor fest umschlossen hielten, und blickte tief in Ferdinands Augen. »Weder Mönche noch Priester haben aus ihr getrunken, das hätten sie nie gewagt. Sie mag unscheinbar und nicht aus Gold und mit Edelsteinen verziert sein, aber war Jesus Christus, den ihr als Gottes Sohn verehrt, nicht ein einfacher Mann, der keine großen Reichtümer besaß? Und doch gelten seine Worte bis heute. Wir Muslime verehren ihn als Propheten unseres Glaubens, ihr Christen ihn als euren Erlöser. Aus dieser Schale, so die Überlieferung, hat er am Abend vor seiner Verhaftung seinen Wein getrunken und sie dann an seine Begleiter – ihr nennt sie, glaube ich, Jünger oder Apostel – weitergereicht. Später wurde sein Blut darin aufgefangen, als er am Kreuz hing und ein römischer Soldat seine Lanze in seine Seite bohrte. Ich denke, Ihr wisst nun, was ich hier in den Händen halte und Euch offeriere – die Schale ist das, was Ihr den Heiligen Gral nennt.«
War es vorhin bei der ersten Ankündigung des Emirs totenstill im Zelt geworden, so brach nun ein unbeschreiblicher Tumult los. Gestandene Ritter warfen sich auf die Knie, und Tränen flossen ihnen wie Sturzbäche aus den Augen, andere bekreuzigten sich unzählige Male, und viele drängten sich wie die drei Prinzen nach vorn, um die Schale wenigstens zu berühren.
Yahya al-Mamun, der nicht hatte abschätzen können, was seine Worte bewirkten, zog seine Arme schnell zurück und barg das kostbare Gefäß an seiner Brust. Doch auch dort wäre es nicht in Sicherheit gewesen und bestimmt in tausend Teile zersprungen, wenn die aufgebrachte Menge es zu greifen bekommen hätte. Ferdinand erkannte das wohl und brüllte seine Leibgarde an, die Steinschale zu schützen und niemanden in ihre Nähe zu lassen. Und hätten einige besonnene Männer wie Rodrigo de Vivar die Wachen dabei nicht unterstützt, wäre der Emir wohl in Stücke gerissen worden und von der Schale nicht viel übrig geblieben.
Nur langsam gelang es, die Ruhe und Ordnung im Zelt wiederherzustellen, und als Ferdinand sich endlich Gehör verschaffen konnte, merkte man auch ihm an, wie sehr ihn die Aussage des Emirs bewegte.
»Seid Ihr Euch wirklich sicher, Yahya al-Mamun, dass diese Steinschale das Gefäß ist, aus dem unser Herr beim letzten Abendmahl getrunken hat? Und in der Josef von Arimathäa später sein Blut aufgefangen hat? Welchen Beweis könnt Ihr uns dafür liefern?«
»Nur die Dokumente meines Vetters, der sehr sorgfältig nachgeforscht und alles aufgeschrieben hat, was er in Erfahrung bringen konnte«, räumte der Emir ein. »Es ist an Euch, ob Ihr ihm vertraut oder die Echtheit des Grals bezweifelt. Aber glaubt Ihr nicht ebenso an die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten? Wir Muslime tun das nicht, deshalb hat diese Schale für uns auch keine so große Bedeutung wie für Euch. Doch denkt einmal nach. In Euren Kirchen stehen goldene Kelche, in denen Eure Priester vorgeblich Wein in Christi Blut wandeln, wenn Ihr das letzte Abendmahl zelebriert. Ich habe mir das oft angesehen und, ich gebe es zu, den Kopf darüber geschüttelt.«
»Gotteslästerer!«, klang es plötzlich aus den hinteren Reihen, und »Du gottverdammter Heide!« wurde gerufen, doch Ferdinand hob nur die Hand, sodass al-Mamun weitersprechen konnte.
»Hätte der Zimmermann und Sohn eines Zimmermanns Jesus sich jemals ein solch kostbares Gefäß leisten können? Sicher nicht. Es ist also weitaus wahrscheinlicher, dass er aus einem Stein- oder Holzbecher getrunken hat. Mein Vetter ist bereit, bei Allah zu schwören, und hat dies auch auf dem Papyrus bekräftigt, dass die Schale aus der Grabeskirche stammt. Ebenso versichert er, dass die byzantinischen Priester, die in der Kirche bis zu ihrer Zerstörung lebten, die Schale als ihre kostbarste Reliquie angesehen haben. Mehr kann ich Euch dazu leider auch nicht sagen. Eure Schlüsse aus dem Papyrus und all dem, was ich Euch gerade berichtet habe, großmächtiger König, müsst Ihr nun selbst ziehen.«
»Diese lächerliche Schale ist niemals der Kelch des letzten Abendmahles!«, schrie der Bischof von Santiago de Compostela voller Zorn, der Konkurrenz befürchtete, würde diese Reliquie womöglich anerkannt werden. Schließlich wachte er über das Grab des heiligen Jakobus, und damit über das größte Heiligtum der Christenheit auf der Iberischen Halbinsel. »Das wollen uns diese Heiden nur weismachen, um uns davon abzuhalten, weiter nach Süden vorzustoßen und sie dorthin zurückzudrängen, wo sie einst hergekommen sind. Jesus Christus, der Himmelskönig, hätte sich niemals mit solch einem einfachen Gefäß für eine heilige Handlung zufriedengegeben. Der Gral kann nur aus dem Edelsten bestehen, was es auf dem Erdenrund gibt! Und niemals nur aus einem einfachen, ausgehöhlten Stein.«
»Mag sein, mag aber auch nicht sein«, meinte Ferdinand nachdenklich. »Genau werden wir es wohl nie erfahren, denn niemand von uns war schließlich beim letzten Abendmahl dabei. Und auch nicht bei der Kreuzigung unseres Herrn, soweit ich weiß. Deshalb muss die Geschichte nicht unwahr sein, die uns der Emir berichtet, und ich könnte es mir nie verzeihen, würde das Heiligtum durch Unglauben Schaden nehmen. Deshalb vernehmt alle meinen Willen: Die Schale soll in Gold gefasst und mit Edelsteinen verziert werden, so wie es für Kelche in großen Kathedralen der Brauch ist. Dann möchte ich, dass sie nach León gebracht wird. Alvito, könnt Ihr Euch vorstellen, dem Kelch in Eurer Kirche eine angemessene Heimat zu geben, auch wenn nicht zweifelsfrei bewiesen ist, dass es sich dabei um den Heiligen Gral handelt? Sprecht freiheraus.«
»Es wird mir eine große Ehre sein«, entgegnete der ob seiner großen Frömmigkeit und Nächstenliebe schon zu seinen Lebzeiten als Heiliger verehrte Bischof von León. Nicht ganz frei von der Todsünde des Stolzes, betrachtete er die an ihn gerichtete Frage seines Königs als einmalige Gelegenheit, endlich mit seinem ewigen Konkurrenten um das Primat der Kirche in den christlichen Königreichen gleichzuziehen. Cresconio, der Bischof von Santiago de Compostela, würde sich schwarzärgern und die Pilger jetzt wohl eher nach León als an das Grab des heiligen Jakobus strömen. Ob der Apostel allerdings tatsächlich darin lag, war dabei ebenso umstritten wie, ob es sich bei der Schale um den Abendmahlskelch handelte.
»Gut, dann ist es entschieden«, beendete Ferdinand die Diskussion. »Wie ich gesagt habe, so soll es geschehen. Euch, Emir, danke ich aus vollem Herzen für Eure Gabe. Sie soll ein Zeichen der nun herrschenden Freundschaft zwischen Eurem Fürstentum und den drei von mir beherrschten Königreichen sein. Und nun lasst uns, wie es der Brauch ist, ein Festmahl genießen, das meine Köche bereits vorbereitet haben. Seid mein Gast, ich bitte Euch. Die Details des Vertrages, da habt Ihr recht, sollen unsere Ratgeber aushandeln. Wir wollen uns nun lieber einen guten Wein und edle Speisen gönnen, wie es sich für Könige geziemt.«
Der Emir war überaus erfreut, dass es ihm gelungen war, Ferdinand für sich zu gewinnen, und neigte zustimmend sein Haupt. Eigentlich war ihm als Muslim der Wein verboten, aber in al-Andalus sah man das nicht so eng, und auch die Mauren bauten die edlen Reben an. Hier interpretierte man die Gebote des Propheten Mohammed schon länger etwas lockerer als im Maghreb auf der anderen Seite des Meeres oder gar im fernen Arabien.
Das Festmahl fand im Freien statt, wo lange Tafeln errichtet worden waren und alles, was die Küche und die Keller des Abend- und des Morgenlandes an Köstlichkeiten zu bieten hatten, aufgetragen wurde. Schließlich gab es etwas zu feiern, denn das größte der Taifa-Königreiche auf der Iberischen Halbinsel hatte sich an diesem Tag vor Ferdinand von Kastilien, León und Galicien gebeugt und zugestimmt, dem großen König zukünftig Tribut zu zahlen. Die Stimmung war bald gelöst, der Wein floss in Strömen, doch nicht wenige der Krieger sowohl auf christlicher als auch auf muslimischer Seite warfen sich finstere Blicke zu.
Die Stimmung des Festes wurde jäh getrübt, als Boten des Emirs von Saragossa eintrafen und verlangten, unverzüglich König Ferdinand zu sprechen. Sie hätten wichtige Nachrichten von Ahmad al-Muqtadir zu überbringen, die keinen Aufschub duldeten.
Seufzend gab Ferdinand den Befehl, die Boten zu ihm zu bringen. Dann lehnte er sich in seinem Sessel zurück und harrte der Dinge, die da kamen. Yahya al-Mamun hingegen war gespannt, wie der christliche König mit den Abgesandten umging und auf die Botschaft des Emirs reagierte, befand er sich doch seit heute im gleichen Abhängigkeitsverhältnis zu Kastilien wie Ahmad al-Muqtadir schon seit Jahren.
Die Boten warfen sich Ferdinand zu Füßen und reichten ihm mit demütig gesenktem Blick ein versiegeltes Pergament, das der König unverzüglich aufbrach. Je länger er las, umso mehr verfinsterten sich seine Gesichtszüge, und als er geendet hatte, schlug er mit der Faust derart heftig auf die Tischplatte, dass sämtliche Trinkgefäße in seiner Umgebung zuerst hochsprangen und dann umstürzten. Ihr Inhalt ergoss sich über die Tafel, die auf einmal so aussah, als ob Ströme von Blut über sie rannen.
»Verdammt, ich habe ihn gewarnt!«, donnerte Ferdinand in die Runde. »Aber er denkt wohl, weil ich hier unten im Süden beschäftigt bin, tun und lassen zu können, was er will. Nun, dann wollen wir einmal dafür sorgen, dass ihm das alles andere als gut bekommt.«
»Von wem und was sprichst du, Vater?«, wollte Alfonso wissen, der wie stets zur Rechten des Königs saß, während für Sancho, seinen Erstgeborenen, meist nur der Platz zu dessen Linken blieb.
»Von deinem nichtsnutzigen Onkel Ramiro, von wem sonst?«, gab Ferdinand wütend zurück. »Ständig versucht er, zu zerstören und einzureißen, was ich mühsam aufbaue! Er ist mit einem Heer in das Emirat Saragossa eingefallen, und Ahmad al-Muqtadir bittet nun um unsere Unterstützung, so wie es der Tributvertrag mit mir vorsieht. Jetzt müssen Christen an der Seite von Muslimen gegen Christen kämpfen, und das nur, weil mein Halbbruder nicht die Füße stillhalten kann und in seiner Gier nach mehr Land und Macht einen neuen Krieg vom Zaun bricht.«
Keiner seiner Söhne hatte den Vater schon einmal derart aufgebracht gesehen, aber die Situation war auch mehr als unglücklich.
Wäre der Emir von Toledo nicht gerade anwesend gewesen, hätte Ferdinand die Sache sicher auf sich beruhen lassen und Ramiro erst zur Räson gerufen, nachdem dieser von seinem Feldzug zurückgekehrt war. Sollte sich sein Halbbruder doch mit den Muslimen von Saragossa herumschlagen, wenn ihm danach war. Er, Ferdinand, würde dann schon zusehen, die Früchte zu ernten, die dabei für ihn abfielen. Aber unter den jetzigen Umständen ging das natürlich nicht an, sollte der Vertrag mit al-Mamun nicht platzen, bevor er überhaupt aufgesetzt worden war. Denn wenn der Emir sähe, dass trotz geleisteter Tributzahlungen im Notfall keine Hilfe von König Ferdinand zu erwarten war, warum sollte er einen solchen Vertrag dann unterzeichnen?
Ferdinand war ein Mann von schnellen Entschlüssen, und so zögerte er auch diesmal keinen Lidschlag lang, um seinen Willen kundzutun.
»Nun werdet Ihr gleich mit ansehen können, wie wertvoll ein Bündnis mit mir für Euch ist, Emir.« Mit diesen Worten wandte sich der König an Yahya al-Mamun. »Selbst gegen meinen eigenen Bruder wende ich mich, wenn meine Bündnispartner in Gefahr sind. Ahmad al-Muqtadir hat ein Hilfeersuchen an mich gerichtet, dem ich gedenke, auf der Stelle Folge zu leisten. Sancho, höre meinen Willen! Gleich morgen in aller Frühe brichst du mit dreihundert Rittern und ihrem Gefolge auf und reitest nach Norden. Nimm den Kelch mit, mach in Burgos Station und übergib ihn deiner Schwester Urraca. Sie soll die Schale in einen würdigen Rahmen kleiden lassen, sodass jeder sieht, um was für eine Kostbarkeit es sich handelt. Bischof Alvito, Ihr begleitet meinen Sohn, und wenn der Gral seine endgültige Form gefunden hat, bringt Ihr ihn nach León in die Basilika San Isidoro, in der auch ich einmal begraben werden möchte. Du, Sancho, begibst dich danach mit deinen Rittern unverzüglich nach Saragossa und leistest dem Emir Waffenhilfe. Notfalls so lange, bis Ramiro geschlagen und wieder aus dem Emirat vertrieben ist. Meinst du, dass du das schaffen kannst?«
Sancho wusste natürlich, welche Antwort sein Vater von ihm erwartete, und war überglücklich, sich endlich vor ihm auszeichnen zu können.
»Wenn ich mir die Ritter selbst aussuchen darf, die mich begleiten, bin ich sicher, dich nicht zu enttäuschen«, lautete deshalb auch seine unverzüglich gegebene Antwort.
»So sei es«, stimmte Ferdinand zu. »Weißt du schon, wer dein Kontingent befehligen soll?«
»Don Rodrigo Díaz de Vivar«, gab Sancho auf der Stelle zurück. »Ich vertraue ihm vorbehaltlos.«
»Denkst du nicht, dass er noch sehr jung und zu wenig erfahren für diese Aufgabe ist?«, schaltete sich Alfonso süffisant ein, der dem Himmel dankte, nicht mit diesem Himmelfahrtskommando betraut worden zu sein. Er erwartete, dass sein Vater ihm beistimmte und folglich eine Zurechtweisung seines Bruders, doch diesmal sollte er sich getäuscht haben.
»Eine gute Wahl«, meinte Ferdinand stattdessen. »Draufgängertum, gepaart mit kühler Überlegung, das ist eine gute Mischung. Ich wünsche dir viel Glück, mein Sohn. Jetzt geh und triff deine Vorbereitungen. Morgen, bevor du aufbrichst, werde ich dir noch meinen Segen geben.«
Sancho tat, wie ihm geheißen, und Rodrigo de Vivar zögerte keinen Lidschlag lang, sich ihm anzuschließen.
Emir Yahya al-Mamun hingegen fragte sich, ob trotz der Niederlage heute nicht sein Glückstag war. Wenn der christliche König sogar seinen Sohn gegen den eigenen Bruder zum Schutz von Muslimen ins Feld schickte, konnte ein Bündnis mit ihm so falsch sicher nicht sein.
Zwei Dinge trieben Sancho an, so schnell wie möglich nach Norden zu reiten: einerseits der Befehl des Königs und andererseits die Sehnsucht nach seiner Frau. Erst kurz vor dem Kriegszug gegen Toledo war ihre Vermählung erfolgt, die auf Betreiben seines Vaters stattgefunden hatte. Alberta war die Tochter von Ferdinands älterem Bruder García, der bis zu seinem Tod in der Schlacht von Atapuerca König von Navarra gewesen war. Die beiden Brüder hatten sich, nachdem ihr Vater sein Reich unter ihnen aufgeteilt hatte, bis aufs Blut bekämpft, aber dass García von einem seiner kastilischen Ritter getötet worden war, hatte Ferdinand doch sehr erschüttert. Als kleine Wiedergutmachung sollte Sancho deshalb seine Cousine ehelichen, auch wenn die Kirche diese Verbindung aufgrund der zu nahen Verwandtschaft nicht guthieß. Doch ein Dispens war schnell erwirkt, und so hatte der Vermählung nichts mehr im Wege gestanden.
Sancho war von der Schönheit seiner Cousine schier überwältigt und nach der Hochzeitsnacht kaum noch aus ihrem Bett herauszubekommen gewesen. Nun wollte er die Gelegenheit, die sich ihm so unverhofft bot, natürlich nutzen, um ihre junge Liebe aufzufrischen. Deshalb hetzte er auch geradezu Richtung Burgos, sodass Rodrigo de Vivar ihm mit dem Kontingent von dreihundert Rittern nebst deren Knappen, Ausrüstung und Fouragewagen kaum folgen konnte. Zehn Meilen vor der Hauptstadt Kastiliens verabschiedete sich der Prinz dann endgültig von seinem Gefolge und befahl nur el Campeador an seine Seite, der ihm mittlerweile zu einem guten Freund geworden war. Beide ließen ihre Pferde ausgreifen, was das Zeug hielt. Sie hätten gut daran getan, sich noch mehr zu beeilen, dann wäre es ihnen vielleicht gelungen, etwas zu verhindern, was Prinz Sanchos ganzes, weiteres Leben beeinflussen und unter einen dunklen Stern stellen sollte.
Alberta hatte wie jeden Abend nach dem Nachtmahl und vor dem Zubettgehen mit ihrer Schwiegermutter und Prinzessin Urraca geplaudert, dabei jedoch die ganze Zeit über die Blicke ihres Halbbruders Garcés auf sich ruhen gespürt. Der Ritter, Herr über die Burgen und Ländereien von Uncastillo und Sangüesa, der zu ihrem Gefolge gehörte und sie nach Burgos begleitet hatte, war die Frucht einer Liaison ihres Vaters mit einer Hofdame ihrer Mutter. Es war keineswegs ungewöhnlich, dass hochgestellte Männer während der Zeit, in der ihre Ehefrauen auf ihre Niederkunft warteten, sich anderen Bettgespielinnen zuwandten. Auch ihre Mutter hatte ihrem Gemahl diesbezüglich nie Vorwürfe gemacht und die Bastarde aus diesen Liebesnächten zusammen mit den legitimen Kindern aus ihrer Ehe aufgezogen. Doch Garcés haderte ständig mit dem Schicksal, auf der falschen Seite des Bettes geboren worden zu sein, und sann schon lange darauf, sich an denen zu rächen, die ihn seiner Meinung nach stets etwas abschätzig behandelt hatten. Ganz oben auf seiner Liste stand dabei Alberta, deren Unsicherheit ihm gegenüber er immer als Hochmut empfunden hatte. Dass sie jetzt auch noch mit dem wohl zukünftigen Erben dreier Reiche vermählt worden war, sein wie auch ihr Vater hingegen im Kampf gegen ihren eigenen Bruder, Albertas jetzigen Schwiegervater, gefallen waren, konnte er nicht verwinden und vergeben.
An diesem Abend hatte Garcés dem Wein besonders kräftig zugesprochen, weil er sich Mut für den Plan antrinken musste, der langsam in ihm gereift war und den er endlich in die Tat umzusetzen gedachte. Zuerst hatte er darüber nachgedacht, bei einer günstigen Gelegenheit König Ferdinand oder zumindest einen seiner Söhne umzubringen. Aber an sie heranzukommen, war schwer, und überleben würde er ein solches Attentat sicher nicht. Da war ihm etwas noch Perfideres eingefallen, wie er die königliche Familie aus dem verhassten Haus Jiménez, bei der er sich nun schon seit mehreren Wochen aufhalten musste, in Schande stürzen könnte.
Nachdem seine Halbschwester wegen vorgeblicher Unpässlichkeit die Tafel verlassen hatte, um nicht bis zum Ende des Gelages bleiben zu müssen, wartete er noch etwas in der großen Halle. Denn er wusste, dass sie zunächst noch beten und sich danach von ihren Hofdamen entkleiden lassen würde. Erst wenn diese sich entfernt hätten und nur noch zwei Dienerinnen für die Nacht bei Alberta verblieben, konnte sein Plan gelingen. Dass er nach Vollendung seiner Tat sofort vom Hofe fliehen musste, war Garcés selbstverständlich klar, und er hatte dafür bereits im Laufe des Tages Vorbereitungen getroffen.
Als auch Königin Sancha sich endlich erhoben und damit das Gelage beendet hatte, sah Garcés die Gelegenheit gekommen, sich an seiner Halbschwester zu rächen. Während die meisten anderen Ritter sich Schlafstellen auf Strohschütten in der Halle suchen mussten und sich nur mit ihren Umhängen zudecken konnten, hatte man ihm zumindest eine kleine Kammer in der Nähe der Gemächer Albertas zugewiesen. In den Burgen war der Platz immer knapp bemessen, und selbst hochrangige Gäste mussten mit bescheidenen Unterkünften vorliebnehmen. Es fiel daher nicht weiter auf, dass Garcés sich den Räumlichkeiten näherte, die Prinz Sancho mit seiner Gemahlin bewohnte, und als er vor der Bogentür ankam, die in die Kemenate Albertas führte, holte er noch einmal tief Luft. Zu ungeheuerlich kam ihm selbst für einen Moment vor, was er plante, doch dann gab er sich einen Ruck und betrat das unbewachte Gemach.
Im Vorraum, das wusste er, nächtigten die beiden Dienerinnen auf Stroh, während sich das große Baldachinbett des Prinzenpaares im angrenzenden Turmgemach befand. Von dort aus führte noch eine Tür zu Sanchos Räumlichkeiten, doch diesen Weg wollte sich Garcés für seine spätere Flucht aufsparen. Mit einem Fußtritt, einer herrischen Geste und einem leise gemurmelten: »Raus hier, ich habe mit meiner Schwester unter vier Augen zu sprechen!«, forderte er die beiden jungen Frauen auf, den Vorraum zu verlassen.
Hastig rafften die beiden Dienerinnen ihre Kleider zusammen, denn keine von ihnen hatte Lust, sich mit dem allseits bekannten Rauf- und Trunkenbold abzugeben. Sollte doch ihre Herrin sehen, wie sie mit ihrem Herrn Bruder klarkam. Sie selbst würden sich jedenfalls erst wieder im Morgengrauen oder frühestens, nachdem Garcés die Räumlichkeiten verlassen hatte, wieder sehen lassen. Kaum waren sie hinausgehuscht, hörten sie, wie von innen der Riegel vorgeschoben wurde, und nun fragten sich die beiden Mägde schon, was das alles zu bedeuten hatte.
Garcés öffnete vorsichtig die Tür, die in die Kemenate seiner Halbschwester führte. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass sie knarrte, und da Alberta, solange ihr Gemahl nicht anwesend war, die dicken Bettvorhänge nicht zuzog, hörte sie das Geräusch und richtete sich auf. Im fahlen Mondlicht sah sie eine schemenhafte, männliche Gestalt in ihrem Gemach, deren Gesicht sie zwar nicht erkennen konnte, die ihr aber trotzdem irgendwie bekannt vorkam. War ihr Ehemann womöglich zurückgekehrt, weil er es vor Sehnsucht nach ihr nicht mehr ausgehalten hatte? Das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber so richtig konnte Alberta es nicht glauben. Doch wer sollte es sonst sein? Furcht begann nach dem Herzen der jungen Frau zu greifen, denn die Gestalt bewegte sich nicht, stand nur regungslos da und sagte kein Wort.
Endlich fasste sich Alberta ein Herz und hob ihrerseits zu sprechen an.
»Sagt, wer Ihr seid, sonst schreie ich um Hilfe, und meine Dienerinnen werden die Wachen holen. Oder kommt Ihr womöglich vom Himmel oder gar aus der Hölle? Seid versichert, ich fürchte Euch nicht, und tut Ihr mir etwas an, wird die Rache meines Gemahls furchtbar sein.«
»Zuerst einmal ist die meine an der Reihe, Schwesterchen. Und schrei nur, wenn du willst. Keiner wird dich hören, und in meinen Ohren werden die Laute, die du gleich von dir geben wirst, wie der Gesang der Sirenen klingen.«
Mit zwei Schritten war Garcés an das große Baldachinbett herangetreten und hatte dabei seinen Gürtel mit dem Schwertgehänge geöffnet. Er ließ beides achtlos zu Boden fallen und packte seine Schwester am Arm, die gar nicht wusste, wie ihr geschah.
Was, bei allen Heiligen, will Garcés nur von mir?, fragte sie sich naiv. Hatte sie sich nicht immer gut mit ihm verstanden, ja, ihn den anderen Geschwistern gegenüber sogar bevorzugt behandelt, weil er als Kind oft so still und traurig gewirkt hatte? Doch jetzt machte er ihr Angst, und es sollte noch viel schlimmer kommen.
Garcés zog, nein, riss seine Schwester zu sich heran und drückte seine Lippen fest auf die ihren. Seine Zunge versuchte, in ihren Mund vorzudringen, aber Alberta presste ihre Zähne fest aufeinander, als sie endlich begriff, was ihr Halbbruder von ihr wollte. Mit all den ihr zur Verfügung stehenden Kräften wehrte sie sich gegen seine Zudringlichkeiten, doch er war einfach um ein Vielfaches stärker als sie. Garcés hatte rasch seine Beinlinge abgestreift, die Brouche geöffnet und sich auf seine Schwester geworfen. Ihre Hände konnte er leicht mit nur einer seiner Pranken über ihrem Kopf festhalten, mit der anderen zerriss er ihr Nachtgewand, sodass sie jetzt halb entblößt vor ihm lag. Wieder versuchte er, sie zu küssen, und diesmal schien es ihm zu gelingen, denn Alberta ließ seine Zunge in ihren Mund eindringen. Allerdings nur, um im nächsten Moment kraftvoll zuzubeißen, was Garcés einen entsetzten Schmerzensschrei ausstoßen ließ. Er schmeckte sein eigenes Blut, doch das entfachte seine Gier nach seiner Schwester nur noch mehr, andererseits machte ihn ihr Widerstand aber auch unsagbar wütend.
»Na warte, du Luder!«, stieß er hervor und schlug Alberta mit seiner freien Hand mit aller Kraft ins Gesicht. Deren Kopf wurde zur Seite geschleudert, die Haut über ihren Wangenknochen platzte auf, und für einen Moment schwanden ihr die Sinne.
Diese Gelegenheit nutzte Garcés, um die Beine seiner Schwester auseinanderzudrücken und in sie einzudringen. Obwohl sie völlig trocken war, gelang es ihm ohne große Probleme, denn zumindest ihn hatte die Situation so sehr erregt, dass sein Glied annähernd so hart war wie der Schaft einer Lanze.
Alberta, die wieder zu sich gekommen war, wehrte sich verzweifelt. Sie warf sich hin und her, versuchte, ein Bein anzuwinkeln, um ihrem Bruder das Knie in die Hoden zu rammen, doch sie hatte keine Chance, sich gegen ihn durchzusetzen. Tief holte sie Luft, um lauthals um Hilfe zu rufen, doch als Garcés das mitbekam, drohte er ihr unverhohlen.
»Ein Laut, und ich schlage dir die Zähne ein, sodass du an ihnen erstickst. Hast du das verstanden, mein Täubchen? Füge dich und empfange meinen brüderlichen Samen, in der Hoffnung, dass du davon schwanger wirst. Ich will sehen, wie du den Balg aufziehst, den du von mir empfangen hast und deinem Gemahl unterschiebst. Oder noch besser. Er soll ruhig wissen, wer der Vater ist, denn die Schande wäre zu groß, als dass er sie der Welt verkünden könnte. Und vielleicht bekommst du danach nie wieder ein Kind, und unser Bastard herrscht später einmal über ganz Nordiberien.«
»Niemals trage ich von dir ein Kind aus, dessen sei gewiss«, stieß Alberta mühsam hervor, während sie sich weiter nach Kräften, aber immer schwächer werdend, wehrte. »Eher bringe ich mich und damit auch die Frucht meines Leibes um. Das ist Blutschande, was du hier treibst, dafür schmorst du für alle Ewigkeit in der Hölle!«
Garcés lachte nur höhnisch.
»Ich werde schon einen willfährigen Bischof finden, der mich von meinen Sünden losspricht, dessen sei dir gewiss. Aber du hast ein ewiges Andenken an mich. Dafür will ich tun, was auch immer ich kann. Und sollte es mir nicht gelingen, dich zu schwängern, dann liegt es nicht an mir, sondern an dir, weil du nichts weiter bist als ein dürrer, vertrockneter Acker, auf dem keine Frucht gedeihen kann.«
Mit diesen Worten verströmte sich Garcés in mehreren Schüben in seiner Schwester, blieb noch einen Moment schwer auf ihr liegen und richtete sich dann mit zufriedener Miene auf.