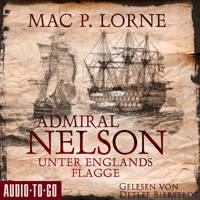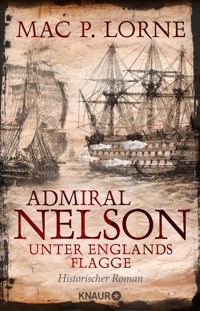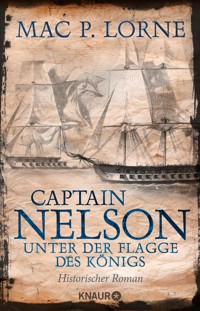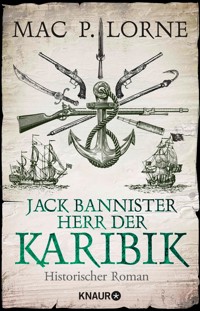12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ritter, König und zu Lebzeiten schon eine Legende: Reiten Sie Seite an Seite mit dem Mann, den sie »Löwenherz« nannten! In seinem historischen Roman lässt Mac P. Lorne mit Richard I. von England einen der berühmtesten Herrscher des Mittelalters lebendig werden. Nur wenig Zeit ist Richard Löwenherz in seiner Heimat England vergönnt: Nachdem er die Rebellion seines Bruders Johann Ohneland niedergeschlagen hat, bricht Richard mit einem kleinen Heer nach Frankreich auf. In der Normandie und Aquitanien hält der französische König Philipp II. Gebiete besetzt, die rechtens ihm gehören und die er von seinem Vater geerbt hat.. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit schlägt das Heer des englischen Löwen seine Gegner ein ums andere Mal, doch Richards Kriegskassen sind fast erschöpft. Schließlich stimmt er einem Waffenstillstand mit Philipp zu. Noch während sie ihr Siegel unter den Vertrag setzen, wissen beide Männer, dass es zwischen ihnen keinen Frieden geben kann … Mac P. Lornes große Leidenschaft gilt der englischen Geschichte. Nachdem er bereits mehrere erfolgreiche historische Romane veröffentlicht hat – darunter die fünfbändige Robin-Hood-Reihe – hat er mit Richard Löwenherz nun einem der berühmtesten englischen Könige des Mittelalters ein Denkmal gesetzt und schildert auf bewegende Weise die Jahre des Königs nach seiner Rückkehr aus deutscher Gefangenschaft, an die sich andere Autoren bisher kaum heranwagten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mac P. Lorne
Der englische Löwe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ritter, König und zu Lebzeiten schon eine Legende:
In seinem historischen Roman lässt Mac P. Lorne mit Richard I. von England einen der berühmtesten Herrscher des Mittelalters lebendig werden.
Nur wenig Zeit ist Richard Löwenherz in seiner Heimat England vergönnt: Nachdem er die Rebellion seines Bruders Johann Ohneland niedergeschlagen hat, bricht Richard mit einem kleinen Heer nach Frankreich auf. In der Normandie und Aquitanien hält der französische König Philipp II. Gebiete besetzt, die rechtens ihm gehören und die er von seinem Vater geerbt hat.
Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit schlägt das Heer des englischen Löwen seine Gegner ein ums andere Mal, doch Richards Kriegskassen sind fast erschöpft. Schließlich stimmt er einem Waffenstillstand mit Philipp zu. Noch während sie ihr Siegel unter den Vertrag setzen, wissen beide Männer, dass es zwischen ihnen keinen Frieden geben kann …
Inhaltsübersicht
Widmung
Stammbaum
England/Frankreich um 1190
Personenregister
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Epilog
Historische Anmerkungen des Autors
Zeittafel
Glossar
Bibliografie
Für Jette, die Tapfere!
Stammbaum
England/Frankreich um 1190
Personenregister
Historische Personen, denen der Leser im Laufe des Romans begegnen wird:
Die Plantagenets
Richard I., genannt »Löwenherz« – geb. 08.09.1157 in Oxford, gest. 06.04.1199 in Châlus, von 1189–1199 König von England und Herrscher über das angevinische Reich
Berengaria von Navarra – seine Frau und Königin von England
Eleonore von Aquitanien – seine Mutter
Philipp von Cognac – sein illegitimer Sohn
Amélie von Cognac – dessen Frau
John Plantagenet, genannt »Johann ohne Land«, später »König Weichschwert« – sein ungeliebter Bruder
Joan Plantagenet – seine Schwester
Geoffrey – sein Halbbruder, Erzbischof von York
William, genannt »Longsword« – ebenfalls sein Halbbruder
Otto IV. von Braunschweig – sein Neffe, später römisch-deutscher König und Kaiser
Die Angevinen
William Marshal – 1. Earl von Pembroke, oft Richards Stellvertreter
Baudouin de Béthune – Ritter und Freund von Richard, der bei seiner Gefangennahme vor Wien anwesend war
Ranulph de Blondeville – 4. Earl von Chester, ein lausiger Ehemann und Intrigant
Hubert Walter – Vertrauter Richards, Erzbischof von Canterbury, Kanzler von England
Walter de Coutances – Erzbischof von Rouen
Mercadier – Richards Söldnerführer und Vertrauter
William de Braose – ein Marcher-Lord, der bei Richards Tod vor Châlus anwesend war
Robert de Beaumont – 4. Earl von Leicester, Kampfgefährte von Richard I. und zeitweise Kommandant von Rouen
Elias de la Celle – Seneschall Richards im Süden Aquitaniens
Blondel de Nesle – Troubadour und Teilnehmer am 3. Kreuzzug
Milo – über viele Jahre Richards Leibarzt und Almosengeber
Adémar von Limoges und Aymar von Angoulême – zwei rebellische Grafen, die Tochter des Letzteren wurde später Königin von England
Die Franzosen
Philipp II. – seit 1180 König von Frankreich, ehemaliger Freund und späterer Feind Richards I.
Gottfried von Le Perche – angeheirateter Verwandter von Richard I.
Philipp von Dreux – Bischof von Beauvais, Cousin König Philipps und Erzfeind von Richard Löwenherz
Alain de Dinan – ein bretonischer Ritter
Petrus Bru und Pierre Basile – zwei Ritter auf Burg Châlus
Die Deutschen
Heinrich VI. – von 1191 bis 1197 Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.
Leopold V. – von 1177 bis 1194 Herzog von Österreich
Adolf I. von Altena – von 1193 bis 1205 Erzbischof von Köln
Die Päpste
Papst Coelestin III. – von 1191–1198 Kirchenoberhaupt, der es ablehnte, Kaiser Heinrich VI. wegen der Gefangennahme Richards zu bannen
Innozenz III. – sein Nachfolger als Heiliger Vater und einer der größten Kriegstreiber der Kirchengeschichte
Prolog
Normandie, März 1194
Philipp, der Zweite seines Namens auf dem französischen Thron, wusste, dass ihm die Zeit wie der feine Sand vom Strand der Seine zwischen den Fingern zerrann. Anfang Februar hatte Kaiser Heinrich VI. in Mainz seinen Erzrivalen und Todfeind – obwohl sie in früheren Jahren einmal eng befreundet und wie Brüder gewesen waren – König Richard von England, genannt Löwenherz, freigelassen. Nach mehr als einem Jahr Haft in deutschen Kerkern war dafür ein unermesslich hohes Lösegeld aus dem angevinischen in das römisch-deutsche Reich geflossen. Einhunderttausend Mark in Kölner Gewicht – sage und schreibe dreiundzwanzig Tonnen Silber – hatten die Menschen in England, Aquitanien, der Normandie, der Touraine und des Anjou aufbringen müssen, um ihren König und Herzog wieder in Freiheit zu sehen. Philipp konnte es immer noch nicht fassen, dass diese Summe dank der Unnachgiebigkeit und des Einfallsreichtums von Richards Mutter Eleonore von Aquitanien und Erzbischof Hubert Walter zusammengekommen und unbeschadet nach Deutschland gebracht worden war. Weitere fünfzigtausend Mark sollten noch folgen, erst danach würde Heinrich die Geiseln freilassen, die Richard hatte stellen müssen. Darunter befanden sich so hochkarätige Fürsten wie Otto von Braunschweig, der Neffe des englischen Königs, und sein Schwager Fernando von Navarra. Diese Verwandtschaft würde Richard sicher nicht in Gefangenschaft verrotten lassen, selbst wenn der Kaiser sie in ehrenvoller Haft hielt, sondern auch noch seine letzte Schuld begleichen.
Er, Philipp, hatte getan, was er konnte, um die Haftentlassung seines Lehnsmanns – denn das war der englische König zumindest bezüglich seiner Festlandbesitzungen in seinen Augen – zu verhindern, war aber, wie schon so oft, wenn er sich gegen Richard gestellt hatte, gescheitert. Jetzt war dieser rheinaufwärts auf dem Weg nach England, um zuerst seine dortigen Besitzungen zu sichern. Doch wenn das erledigt wäre und die von Prinz John gehaltenen Burgen gefallen waren – und dass das passieren würde, daran zweifelte Philipp keinen Moment –, würde Löwenherz nach Frankreich kommen, um sich dort an Land zurückzuholen, was er in der Zeit seiner Gefangenschaft verloren beziehungsweise sein französischer Widersacher erobert hatte. Doch leicht wollte Philipp es ihm nicht machen und sich noch eine gute Ausgangsposition für den unzweifelhaft bevorstehenden Kampf sichern.
Richards Bruder John, der die Krone schon zum Greifen nahe gesehen hatte, hatte ihm große Territorien des angevinischen Reiches abgetreten, um ihn als Bundesgenossen zu gewinnen. Allerdings beanspruchte Philipp die Oberhoheit über alle Gebiete der Plantagenets auf dem Festland von den Pyrenäen im Süden bis hinauf nach Flandern. Es war also nur folgerichtig, diese zu besetzen und sich endgültig zu ihrem Herrn zu erklären. Viele der Grundbesitzer und Kastellane hatten das begriffen und sich ihm kampflos ergeben, so wie Gilbert de Vascœuil, der Herr über die starke und wichtige Grenzfestung Gisors im Vexin. Wie sehr hatte Philipp es doch genossen, den von Richard eingesetzten Burghauptmann vor sich knien zu sehen! Viele nannten diesen nun einen Verräter, und das war er zweifelsohne auch. Aber ihm war das nur zupassgekommen, hatte er seine Truppen deshalb doch nicht in einer endlosen Belagerung verschleißen müssen. Jetzt waren von den Franzosen die Schlüsselfestungen Tours, Amboise, Montbazon, Montrichard und vor allem Loches in der Touraine und Evreux, Neubourg und Vaudreuil in der Normandie besetzt worden, deren Besatzungen allesamt von John den Befehl bekommen hatten, Philipp die Tore zu öffnen. Damit hatte der französische König nun die Kontrolle über beide Ufer der Seine bis kurz vor Rouen, seinem nächsten Ziel. Jetzt musste nur noch die Hauptstadt dieses nördlichen Herzogtums der Plantagenets fallen, dann konnte Richard ruhig kommen und sich an den starken Mauern seiner einstigen Besitzungen die Zähne ausbeißen. Jede einzelne verlorene Burg, jede Stadt, jede Baronie würde ihm einen schweren Stich versetzen, und Philipp hoffte aus tiefster Seele, dass einer davon den rotblonden Hünen, dem er sich zeit seines Lebens unterlegen gefühlt hatte, fällen würde.
»Geoffrey, bringt endlich die Belagerungsgerätschaften in Stellung«, brüllte der König seinen Feldherrn an. »Oder soll ich vielleicht selbst in die Speichen greifen, um das Trebuchet zu schieben?«
Der Graf von Le Perche verdrehte hinter Philipps Rücken die Augen und fragte sich zum wiederholten Male, ob es nicht ein schwerer Fehler gewesen war, die Fronten zu wechseln. Er war mit einer Nichte von Richard Löwenherz verheiratet und hatte diesen auf seinem Kreuzzug begleitet und ihm treu gedient, bis der englische König in Gefangenschaft geraten war. Da danach niemand absehen konnte, wann und ob er überhaupt je wieder freikäme, und Philipp begann, die Ländereien der Plantagenets zu unterwerfen, wozu auch seine eigene Grafschaft gehörte, hatte er sich dazu gezwungen gesehen, diesem den Lehnseid zu schwören, um seine Besitzungen zu retten. Jetzt diente er dem Franzosen und fühlte sich dabei gar nicht wohl in seiner Haut. Wie würde Richard wohl reagieren, wenn er erfuhr, dass sein angeheirateter Verwandter und einstiger Kampfgefährte den Marsch auf seine normannische Hauptstadt Rouen befehligte? Sicherlich nicht erfreut, so viel stand fest, und Geoffrey von Le Perche hoffte inbrünstig, Löwenherz nie auf dem Schlachtfeld zu begegnen.
Während Geoffrey seinen Gedanken nachhing und gleichzeitig die Söldner antrieb, mit dem schweren Belagerungsgerät weiter vorzurücken, kam ein Späher auf ihn zu und redete sogleich aufgeregt auf ihn ein.
»Sprich langsam und deutlich, Kerl«, fuhr der Kommandeur den Mann an, der es sogar gewagt hatte, ihn am Ärmel zu packen, und aufgeregt nach vorn zeigte. »Ich verstehe das Gebrabbel aus deinem zahnlosen Maul kaum.«
»So schaut doch nur, Monsieur, wir brauchen uns vielleicht gar nicht weiter zu schinden. Die Tore der Stadt stehen sperrangelweit offen.«
Jetzt sah es der Graf gleichfalls, brauchte aber einen Moment, um den Anblick zu verdauen. Dann wandte er sich an den König, der offenbar auch noch nicht mitbekommen hatte, dass die Bürger und Verteidiger von Rouen ihnen die Stadt auf einem Silbertablett feilboten.
»Majestät, seht, es wird kein Kampf nötig sein! Sie übergeben uns die Stadt ebenso freiwillig wie die Festung Gisors. Damit gehört Euch so gut wie die gesamte Normandie, und Ihr könnt Euch nach Süden wenden, um in die Kernlande der Plantagenets vorzustoßen.«
Philipp glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen, und preschte nach vorn. Sollte ihm das stark befestigte Rouen wirklich wie ein reifer Apfel in den Schoß fallen und keiner seiner Krieger beim Kampf um die Stadt sein Leben lassen müssen? Nicht dass ihn das übermäßig berührt hätte, aber von den flämischen Söldnern, die sein Hauptkontingent stellten, hatte er nicht allzu viele, und so war ihm jeder einzelne Streiter kostbar.
Der Graf von Le Perche lenkte sein Pferd neben das des Königs, und gemeinsam starrten sie auf die weit offen stehenden Tore. Auch der gesamte Vormarsch war zum Stehen gekommen, und wie ein Lauffeuer sprach es sich herum, dass Rouen sich offenbar kampflos ergab.
»Ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, meinte Philipp nachdenklich. »So ganz ohne jede Gegenwehr wollen sich die Bürger ergeben? Sie standen doch bisher fest zu ihrem Herzog und wurden von ihm mit vielen Privilegien bedacht. Irgendwie will mir das Ganze nicht gefallen.«
Auch der Graf zog die Stirn kraus.
»Am besten, wir schicken eine Vorausabteilung in die Stadt, die die Lage erkunden soll. Am meisten verunsichert mich, dass überhaupt niemand auf den Mauern und Türmen zu sehen ist. Es weht keine einzige Fahne im Wind, und keine Abordnung kommt uns entgegen. So empfängt man jedenfalls nicht seinen neuen Herrn, noch dazu, wenn dieser der König von Frankreich ist.«
»Ihr habt recht, Le Perche. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man uns in eine Falle locken will. Lasst langsam vorrücken, dabei aber äußerste Vorsicht walten. Vielleicht sind die Tore auch nur geöffnet, weil die verdammten Normannen einen Ausfall planen.«
Doch das hatten die Verteidiger von Rouen nicht vor. Dafür fehlte ihnen – noch – der geeignete Anführer. Aber dass dieser kommen würde, das hatten sie am heutigen Tage erfahren, denn der Earl von Leicester, Robert de Beaumont, und zudem der Erzbischof der Normandie, Walter de Coutances, waren von König Richard vorausgeschickt worden, um die Verteidigung der Stadt zu leiten. Beide hatten den englischen König auf seinem Kreuzzug begleitet und waren kampferfahren. Wer Sultan Salah ad-Din in Palästina das Fürchten gelehrt hatte, dem konnte ein anrückender Philipp von Frankreich nur ein müdes Lächeln entlocken.
Die flämischen Söldner hatten schon fast die Stadttore erreicht, als plötzlich unzählige Verteidiger auf den Mauern und Türmen auftauchten und sie mit unbändigem Gejohle spöttisch willkommen hießen. Gleichzeitig wurden überall in der Stadt Fahnen aufgezogen, aber es waren keineswegs die Lilienbanner des französischen Königs, sondern in der frischen Brise, die vom Kanal herüberwehte, bauschten sich die Leoparden der Normandie und Aquitaniens und die goldenen Löwen Englands.
»Verdammt, ich habe es doch gewusst!«, fluchte Philipp wutentbrannt. »Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Los, Le Perche, reitet vor die Mauern, und fordert die Einwohnerschaft von Rouen auf, sich zu ergeben. Sagt ihnen, dass ich dann Gnade walten lasse und ihnen den schlechten Scherz vergeben werde. Aber strapazieren sie meine Geduld über, dann werden sie es bitter zu büßen haben.«
Und warum sagst du ihnen das nicht selbst?, fragte sich der Graf im Stillen, winkte aber gehorsam einen Bannerträger zu sich und gab seinem Pferd die Sporen. Im Galopp ritt er bis unmittelbar an die herabgelassene Zugbrücke heran, darauf vertrauend, dass schon niemand auf einen Unterhändler schießen würde.
Auf der Mauerkrone zwischen den Schießscharten erschienen zwei Männer, die Geoffrey von Le Perche nur zu gut kannte, hatte er doch mehr als nur einmal an ihrer Seite im Heiligen Land gekämpft. Ihnen hier in Feindschaft zu begegnen war nun wahrlich das Letzte, was er sich gewünscht hatte. Doch der Befehl seines neuen Lehnsherrn stand zwischen ihnen und ihm, und er musste tun, was dieser ihm aufgetragen hatte, wollte er nicht erneut in einen Loyalitätskonflikt geraten.
»Ergebt Euch, dann wird Euch allen nichts geschehen!«, rief der Graf zur Mauerkrone hoch. »Alle Bürger werden verschont, und Ihr bleibt Erzbischof von Rouen, Exzellenz. Das soll ich Euch im Namen von König Philipp garantieren.«
»Ihr dient Eurem neuen Herrn wirklich voller Hingabe, Le Perche«, höhnte der Earl von Leicester. »Wie war das noch? Hattet Ihr nicht König Richard anlässlich seiner Krönung unverbrüchliche Treue geschworen und gelobt, stets an seiner Seite zu kämpfen? So viel zu Euren Garantien.«
Der Gescholtene lief knallrot an, versuchte aber wenigstens, seine Beweggründe für den Frontenwechsel zu erklären.
»So versteht doch, Robert, alter Waffenbruder. Meine Besitzungen liegen allesamt in Frankreich und sind von Philipp während Richards Gefangenschaft überrannt worden. Was hätte ich denn tun sollen? Zusehen, wie meine Familie alles verliert und zu Bettlern wird oder gar im Kerker landet? Ihr habt doch selbst Land diesseits des Kanals. Was, wenn Philipp es Euch nimmt? Werdet Ihr Euch dann dem Lehnseid verweigern oder ihn nicht doch leisten, wenn er es von Euch verlangt?«
»Niemals werde ich zum Verräter an König Richard, so wie Ihr. Und Ihr selbst solltet Euch gut überlegen, ob Ihr Philipp weiterhin dient. Einem verfemten, einem exkommunizierten Feind der Christenheit, von dem sich jeder Fürst des Abendlandes mit Schaudern abwenden wird.«
Jetzt wechselte die Gesichtsfarbe des Grafen von Rot zu bleich. Was ging hier vor sich, von dem er nichts wusste? War Philipp womöglich vom Papst gebannt worden und hatte es bisher geheim gehalten? Und wenn ja, warum?
»Was erzählt Ihr da, Robert? Der König von Frankreich steht doch nicht unter dem Interdikt!«, rief Le Perche nach oben und hoffte auf Aufklärung, denn wenn dem so wäre, wären alle seine Treueschwüre dem König gegenüber hinfällig.
»Noch nicht, aber bald, wenn er sich weiterhin am Eigentum eines Kreuzfahrers vergreift«, warf der Erzbischof, der bis vor Kurzem noch Justiciar von England gewesen war und in Mainz die Freilassung von Richard Löwenherz verhandelt hatte, ein. »Der Besitz jedes Mannes, der das Kreuz genommen hat, wird von der heiligen Mutter Kirche geschützt. Ich selbst werde den Bann über Philipp von Frankreich sprechen, setzt er auch nur einen Fuß in diese Stadt. Er und Ihr alle könnt ruhig hereinkommen, die Tore stehen ja offen. Aber dann fahrt Ihr auch auf direktem Weg in die Hölle! Dafür werde ich zusammen mit den tapferen Bürgern von Rouen sorgen. So wahr uns Gott helfe!«
Le Perche wurde noch eine Spur blasser. Wenn es etwas gab, was schlimmer war als der Tod, dann war es, exkommuniziert zu sterben und damit auf ewig von der göttlichen Gnade ausgeschlossen zu sein. Diese Nachricht würde Philipp keineswegs gefallen, überbrachte er sie ihm. Und mit der Kapitulation der Stadt war es wohl auch Essig. Dabei hatte es doch gerade noch danach ausgesehen, dass die Übergabe ohne Kampf erfolgen würde. Noch einen Versuch wollte er wagen, seine ehemaligen Kampfgefährten zur Aufgabe zu bewegen, doch er ahnte schon, dass er auch diesmal scheitern würde.
»Bedenkt doch, meine Herren, was Ihr riskiert. Unser Heer besteht in erster Linie aus flämischen Söldnern, die für ihre Grausamkeit bekannt sind, erstürmen sie eine Stadt. Und dass uns das über kurz oder lang gelingen wird, seht Ihr schon daran, wie viel Belagerungsgerät wir mit uns führen. Dreiundzwanzig Trebuchets, schwere Rammböcke und Wandeltürme werden Euch beschießen und die Mauern erzittern lassen. Wie wollt Ihr dieser geballten Macht widerstehen? Das Blut der vielen Toten wird über Euch kommen, und in Euren Ohren werdet Ihr die Schreie der Geschändeten auf ewig hören. Und gehört Euch nicht die Burg von Pacys, Robert? Glaubt Ihr, dass sie standhalten kann, wenn Philipp von Frankreich vor ihr steht? Unterwerft Euch ihm, so wie ich es getan habe, und niemandem wird ein Leid geschehen.«
»Doch, ihm, streckt er weiter seine Hände nach Richards Besitzungen aus. Und Euch natürlich auch, fallt Ihr dem König in die Hände. Ihr wisst, wie er mit Verrätern umzugehen pflegt. Wird Euch nicht langsam klamm in Eurer Brouche, Geoffrey? Überbringt Eurem neuen Gönner diese Nachricht: Rouen ergibt sich ihm niemals, solange Richard Löwenherz lebt. Oder wartet, ich sage es ihm selbst.«
Der französische König hatte außer Pfeilschussweite die Unterredung am Haupttor von Rouen aufmerksam verfolgt, ohne allerdings zu verstehen, was gesprochen wurde. Er glaubte zu wissen, mit wem der Graf von Le Perche da verhandelte, sah er doch die Mitra eines Erzbischofs und die Farben des Earls von Leicester. Aber warum dauerte das nur so lange, und was hatten die Männer da nur so ausgiebig zu erörtern? Er sollte es gleich erfahren, denn auf einmal schüttelte der Erzbischof wütend seinen Krummstab in seine Richtung, und die laute Stimme Robert de Beaumonts schallte drohend über die sumpfige Ebene vor der Stadt:
»Rouen ergibt sich nicht! Kommt und sterbt in den Straßen der Stadt, die Tore stehen für Euch alle da draußen weit offen. Doch fürchte dich, Philipp von Frankreich, denn der englische Löwe ist zurück!«
Der derart Herausgeforderte konnte nicht verhehlen, dass es ihm eiskalt den Rücken herunterlief. Er wendete sein Pferd und befahl, um Contenance bemüht, das Lager aufzuschlagen und das schwere Gerät in Stellung zu bringen. Zwei Wochen lang, in denen es jeden Tag, den Gott werden ließ, wie aus Kannen schüttete und der Regen das Umland von Rouen in einen einzigen großen Sumpf verwandelte, ließ er die Stadt beschießen – ohne jeden Erfolg. Dann gab er auf und zog ab. Das Belagerungsgerät, das keine noch so starken Ochsen mehr durch den Morast ziehen konnten, ließ er notgedrungen zurück und anzünden, damit es nicht dem Feind in die Hände fiel. Auf dem Rückweg nach Paris eroberte Philipp noch die kleine Burg des Earls von Leicester. Sie wurde gestürmt, geschliffen und alle Bewohner hingerichtet. Doch selbst das verschaffte ihm keine Befriedigung. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass sein während Richards Gefangenschaft so hell erstrahlter Stern bereits wieder dabei war, unterzugehen.
1.
England, Frühjahr 1194
Nein!«
»Doch, Richard, du musst es tun. Es ist nur zu deinem Besten. Glaub mir!«
»Nein habe ich gesagt!«
Eleonore von Aquitanien rollte, mit ihrer Geduld am Ende, genervt mit den Augen.
Ihr Sohn, der König von England, seit der Einnahme von Messina auf Sizilien auch Löwenherz genannt, stand vor einem Rundbogenfenster im Palas der Burg von Nottingham und wandte ihr den Rücken zu. Er sah auf die Galgen im Vorhof hinunter und schien den Anblick zu genießen. In den Schlingen baumelten einige der Verteidiger der Burg, für die kein Lösegeld zu erwarten war. Die anderen schmorten in den Kerkern der Festung und warteten darauf, ausgelöst zu werden. Am liebsten hätte Richard die Aufrührer allesamt hinrichten lassen, doch das konnte er sich nach der gigantischen Summe, die der Kaiser für seine Freilassung gefordert hatte, schlicht nicht leisten.
Mitte März war Richard, aus Deutschland kommend, in Sandwich an Land gegangen und nur zwei Wochen später die letzte der von den Anhängern seines Bruders John gehaltene Burgen in England gefallen. Richard hatte, geradezu überberstend vor Tatendrang, der sich in den Monaten der Haft in deutschen Gefängnissen in ihm aufgestaut hatte, den Sturm auf Nottingham selbst befehligt. Seiner Urgewalt hatten die Verteidiger nichts entgegenzusetzen gehabt. Nur im Kettenhemd und mit visierlosem Helm war der König als einer der Ersten durch das von Rammböcken aufgebrochene Tor gestürmt und wäre um ein Haar von einem gezielt auf ihn abgeschossenen Armbrustbolzen getötet worden, hätte der Earl von Huntingdon dies glücklicherweise nicht im letzten Augenblick noch verhindert. Dafür und für die vielen Male zuvor, die er ihren Sohn behütet hatte, war Eleonore dem ehemaligen Geächteten aufrichtig dankbar. Doch jetzt lag der Mann, der in unzähligen Kämpfen Richards Schildarm gewesen war, selbst verwundet in einem Gemach der Burg und hatte bereits verlauten lassen, den König nicht auf seinem Rückeroberungsfeldzug nach Frankreich begleiten zu wollen, was die Sorgenfalten auf ihrer Stirn nicht unwesentlich vertiefte.
Richards Hoffnung, seinen verräterischen Bruder hier in der starken Festung vorzufinden, war leider in Schall und Rauch aufgegangen. Von John fehlte zu seinem Bedauern weiterhin jede Spur. Eleonore vermutete ihren jüngsten Sohn in Frankreich bei seinem Verbündeten Philipp. Von ihr aus konnte er auch dortbleiben. Zumindest so lange, bis Richard sich etwas beruhigt hätte und eine vage Chance bestand, dass er seinem Bruder dessen Verrat doch noch vergab, wenn auch nicht verzieh, und ihn nicht gleich bei ihrem ersten Zusammentreffen nach langer Zeit wie einen tollwütigen Hund erschlug. Verdient hätte er es, gab selbst seine Mutter in ihrem Innersten zu, hatte John doch große Teile des von ihr so mühsam zusammengehaltenen angevinischen Reiches einfach an Philipp verschenkt, um sich dessen Gunst und Unterstützung bei seiner Revolte gegen den eigenen Bruder zu sichern. Nun, der König von Frankreich würde sich an seinen neuen Besitzungen sicher nicht lange erfreuen, kehrte Richard erst auf das Festland zurück, dessen war sich Eleonore gewiss. Nur um John sorgte sie sich und war deshalb froh, dass er offenbar nicht in England weilte.
»Lass dich in Winchester nach deiner Rückkehr von diesem unsäglichen Kreuzzug und aus der anschließenden Gefangenschaft noch einmal krönen, das kann ich dir nur mit Nachdruck anraten«, ließ die Königinmutter nicht locker. »Niemand wird das mit deinem Lehnseid an den Kaiser in Verbindung bringen. Zeig allen, wer der wahre Herr im Lande ist und dass du niemandes Untertan bist.«
Eleonore wusste, wie sehr es ihren Sohn wurmte und innerlich zerfraß, dass Kaiser Heinrich in Mainz als Voraussetzung für die Beendigung seiner Gefangenschaft von Richard verlangt hatte, dass er ihm alle angevinischen Ländereien nebst dem Königreich England übertrug, um sie anschließend aus seinen Händen als Lehen wieder zu empfangen. Für Richard, der auch vor dem französischen König wegen der Festlandsbesitzungen der Plantagenets nie das Knie gebeugt hatte, war das unerträglich gewesen, und er hatte sich erst dazu breitschlagen lassen, als seine engsten Berater und auch seine Mutter ihn mit Nachdruck zu der Geste drängten, um die Freilassung nicht im letzten Augenblick noch zu gefährden, und ihm gleichzeitig anempfahlen, den Eid anschließend sofort wieder zu vergessen. Heinrich hatte seinen Willen bekommen, würde aber seine Ansprüche niemals durchsetzen können und Richard endlich seine Freiheit wiederhaben.
»Wozu soll das gut sein?« An der Stimmlage ihres Sohnes erkannte Eleonore, dass sie schon fast gewonnen hatte. »Ich kann einfach keinen Sinn darin erblicken, mir erneut von einem Pfaffen die Krone aufsetzen zu lassen. Außerdem wäre es eine immense Geldverschwendung. Und wird es nicht erst recht die Gerüchte befeuern, dass ich nur noch ein König von Kaiser Heinrichs Gnaden bin?«
»Im Gegenteil, Richard!« Eleonore wusste, dass sie ihrem Sohn nur noch ein paar Argumente liefern musste, damit er letztlich gesichtswahrend nachgeben konnte. »Wir wiederholen ja deine Inthronisierung bewusst nicht in Westminster, sondern im alten Krönungsort der angelsächsischen Könige in Winchester. Auch dein Urahn Wilhelm der Eroberer hat sich in Westminster und Winchester krönen lassen. Du kannst also immer sagen, dass du damit der zukünftigen, immerwährenden Verbundenheit zwischen Normannen und Angelsachsen Ausdruck verleihen und dich gleichzeitig mit der Zeremonie für die großen Opfer bedanken wolltest, die das Land für deine Freiheit gebracht hat.«
»Hm, wenn du es so siehst …« Richard war schon nahe daran, zu kapitulieren. Etwas, das noch kein Feind auf dem Schlachtfeld geschafft hatte, seit er die Krone trug. Nur seiner Mutter gelang es immer wieder, ihn zum Einlenken zu bewegen. »Doch dann sollte Berengaria schon an meiner Seite sein, meinst du nicht?«
Eleonore hatte die Tochter des Königs von Navarra selbst nach Sizilien begleitet, damit ihr Sohn sie noch vor Beginn des eigentlichen Kreuzzuges ehelichen und nach Möglichkeit einen Thronfolger zeugen konnte. Die Hochzeit war dann in Limassol auf Zypern gefeiert worden, nachdem die Insel, deren Herrscher sich als nicht sehr gastfreundlich erwiesen hatte, von Löwenherz und seinem Heer erobert worden war. Gleich nach der Vermählung hatte Richard seine Frau zur Königin von England krönen lassen. Zur Freude aller empfing sie bereits im Brautbett – oder auch schon davor auf Sizilien, wie Eleonore vermutete, die ihren Sohn kannte, der erfahrungsgemäß nichts anbrennen ließ. Doch dann verlor die Königin das Kind, einen Knaben, in Akkon, als sie mitansehen musste, wie Richard die Verteidiger der Stadt, darunter auch Frauen und Kinder, hinrichten ließ, weil Sultan Salah ad-Din die zuvor getroffenen Absprachen nicht einhielt. Das viele Blut und die unzähligen geköpften Leichen waren für die Frau, die ihr Leben eigentlich der Heilkunst verschrieben hatte, zu viel gewesen. Seither, so hatte Richard seiner Mutter berichtet, war das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau zumindest angespannt. Berengaria hatte zwar alles in ihrer Macht Stehende dafür getan, dass das Lösegeld für ihn zusammenkam, und war dafür in ihre alte Heimat Navarra gereist, um auch hier Gelder für ihren Gemahl aufzutreiben. Sogar ihren jüngeren Bruder Fernando konnte sie überzeugen, sich Kaiser Heinrich als Geisel zu stellen, während der ältere, Sancho, genannt der Starke, für Richard in Aquitanien kämpfte. Sie selbst pflegte zurzeit ihren Vater, der schwer erkrankt war, und hatte Richard ausrichten lassen, dass sie gegenwärtig in Navarra unabkömmlich war.
»Wenn du deine Frau dazu überreden kannst, ihren sterbenden Vater zu verlassen und zu dir zu kommen, nur zu«, meinte Eleonore lakonisch. »Doch hier geht es nicht um sie, sondern nur um dich. Berengaria ist in Limassol offiziell gekrönt worden, das sollte genügen. Außerdem hat sie als Königin von England im Gegensatz zu dir nie vor einem anderen Herrscher knien müssen.«
»Danke, dass du mich daran erinnerst, Mutter«, knurrte Richard mit kaum zu überhörendem Groll in der Stimme. »Ich wusste schon immer, wie zartfühlend du bist.«
»Sei nicht so empfindlich, Richard. Besser, ich erinnere dich daran und spreche mit dir darüber, als wenn es deine Lords hinter vorgehaltener Hand tun. Zeig dich ihnen in all deiner Pracht und Herrlichkeit als König von England und Herrscher über das angevinische Reich. Tritt vor sie als der ungeschlagene Kreuzfahrer, der den christlichen Pilgern wieder den Weg nach Jerusalem geöffnet hat. Gut, du konntest die Stadt nicht einnehmen oder hast es nicht gewollt, wie du sagtest, weil sie nach deiner Heimkehr nicht zu halten gewesen wäre. Es ehrt dich, dass du deshalb nicht sinnlos Menschenleben geopfert hast. Zumindest in meinen Augen, auch wenn andere das vielleicht anders sehen mögen.«
Eleonore spielte auf die Vorwürfe an, die sowohl der Papst wie auch der römisch-deutsche Kaiser gegen ihren Sohn erhoben hatten, weil er die heiligste Stadt der Christenheit nicht von den Muslimen befreit hatte.
»Das lass nur meine Sorge sein«, entgegnete Richard, jetzt wieder gefasst. »Ich glaube kaum, dass mir als Feldherr irgendetwas vorzuwerfen ist. Wir haben die Sarazenen vor Akkon, bei Arsuf und Jaffa geschlagen und sie vor uns hergejagt, sodass sie sich nur noch hinter schützende Mauern zurückziehen konnten. Wäre mir John hier in England nicht in den Rücken gefallen und hätte ich nur etwas mehr Zeit gehabt, wäre es mir sicherlich gelungen, das ganze Heilige Land zu erobern und auch zu sichern. Schau dir doch nur an, was jetzt dort nach Salah ad-Dins Tod vor sich geht. Seine Brüder und Söhne streiten sich um sein Erbe, gehen sich gegenseitig an die Kehle, und sein Reich bricht in unzählige Teile auseinander. Es wäre wahrlich keine große Kunst, diese Aasgeier einzeln zu schlagen und in die Wüste zu jagen. Doch anstatt genau das tun zu können, musste ich in einem deutschen Kerker hocken und mein Land ausbluten lassen, um überhaupt wieder freizukommen. Das verzeihe ich Leopold, Heinrich, Philipp und auch John, die sich gegen mich verschworen haben, niemals. Glaub mir, ich werde über sie kommen wie Gottes Zorn und erst ruhen, wenn sie sich vor mir im Staub winden und um Gnade flehen.«
Eleonore verdrehte erneut die Augen.
»Ist ja gut, ich kann dich ja verstehen«, versuchte sie, ihren Sohn zu besänftigen. »Und genau damit keinerlei Zweifel darüber aufkommen, dass es der König von England ist, der Rache an seinen Feinden nimmt, und nicht ein gedemütigter Vasall, musst du dich in Winchester noch einmal krönen lassen. Von mir aus setz dir wie damals in Westminster die Krone auch diesmal wieder selbst auf den Kopf, wenn du ihn vor niemandem mehr beugen willst. Aber tu es bald. Noch jubelt das Volk dir zu und steht der Adel hinter dir. Du hast Nottingham eingenommen und das Land in kürzester Zeit befriedet. Nutze dies, Richard, ich beschwöre dich. Solch eine Gelegenheit kommt vielleicht niemals wieder.«
Der König, der immer noch mit auf dem Rücken verschränkten Händen vor dem Fenster stand, wiegte nachdenklich den Kopf. Es war viel Wahres an dem, was seine Mutter soeben gesagt hatte. Vielleicht hatte sie wie so oft zuvor recht, und es war zu seinem Besten, wenn er tat, was sie wollte, und nachgab.
»Und noch eins«, fuhr Eleonore fort, um auch die letzten Zweifel ihres Sohnes hinwegzuwischen. »Lass deine Halbbrüder Geoffrey und William sowie König Wilhelm den Löwen hinter dir herschreiten und die Krönungsinsignien tragen. Das zeigt dem Volk und dem Adel gleichermaßen, dass es keinen Zwist im Hause Plantagenet gibt. Bedenke, wenn dir der schottische Herrscher dient und huldigt und damit anerkennt, dass du über ihm stehst, bist du schließlich selbst so etwas wie ein Kaiser.«
Richard begann der Gedanke an die erneute Krönung immer besser zu gefallen. Geoffrey, der Erzbischof von York, und William, den er demnächst durch Heirat zum Earl zu erheben gedachte, waren zwar auf der falschen Seite des Bettes geboren und uneheliche Kinder seines Vaters Henry, trotzdem aber am Hof mit den legitimen Nachkommen aus der Ehe des Königs mit seiner Mutter erzogen worden. Geoffrey, sechs Jahre älter als Richard, hatte seinem Vater sogar als Heerführer beim Aufstand seiner Brüder gegen ihn gedient und als einziger von dessen Söhnen am Totenbett des alten Königs gestanden. Er war klug, verschlagen, tapfer und machtbewusst. Richard hatte ihn vor seiner Abreise in das Heilige Land zwingen müssen, die Gelübde abzulegen und sich zum Priester weihen zu lassen, sonst wäre von ihm eine wesentlich größere Gefahr für seine Krone ausgegangen als von John. William hingegen, wegen seiner Vorliebe für sein langes Schwert, das er meisterlich zu handhaben wusste, Longsword oder auch Longespée genannt, war von eher sonnigem Gemüt, allerorten beliebt und viel zu unbedarft, um eine Gefahr darzustellen. Und der schottische König Wilhelm der Löwe im Krönungszug? Dessen Anwesenheit würde dem Ganzen natürlich Glanz verleihen und ihn, Richard, für alle sichtbar über den Schotten erheben. Aber ob dieser sich dazu auch bereitfand? Wilhelms Gebietsansprüche und Forderungen, die er glaubte stellen zu können, weil er einen Beitrag zu dem immensen Lösegeld geleistet hatte, ließen sich einfach nur als unverschämt bezeichnen. Aber etwas werde ich dem Schotten wohl entgegenkommen müssen, dachte Richard, will ich mich seiner Unterstützung versichern. Nur zu teuer durfte es nicht werden, denn zu verschenken hatte er rein gar nichts mehr.
»Zuerst müssen die weltlichen und geistlichen Lords aber zustimmen, dass die Verräter, die sich während meiner Abwesenheit gegen mich gestellt haben, vor Gericht gestellt werden. Spricht man sie schuldig – und davon gehe ich aus –, werden sie mit aller Härte bestraft, ihr Besitz eingezogen und sie selbst hingerichtet oder verbannt. Das gilt auch für John, Mutter. Nur dass du dich diesbezüglich keinen Illusionen hingibst.«
Eleonore wusste, dass es hier und heute wenig Zweck hätte, um Gnade für ihren jüngsten Sohn zu bitten. Das konnte warten und auf später verschoben werden. Deshalb stimmte sie auch, ohne zu zögern und ohne das Thema gegenwärtig weiter zu vertiefen, zu und wollte stattdessen lieber eine Frage beantwortet haben, die ihr schon lange unter den Nägeln brannte.
»Wenn du meinst, Richard. Aber vergiss nicht, dass auch John ein Plantagenet ist und damit aus einem Herrschergeschlecht stammt. Es sollte für alle unangreifbar sein, willst du das Gottesgnadentum nicht eines Tages einmal infrage gestellt sehen. Aber jetzt zu etwas anderem. Was schleppt eigentlich Hubert Walter da ständig für eine Truhe mit sich herum? Er lässt sie ja bewachen, als enthielte sie den Heiligen Gral. Hast du den womöglich im Heiligen Land gefunden und wartest mit der Präsentation nur auf eine günstige Gelegenheit?«
Eleonores Worte waren scherzhaft gemeint, doch als ihr Sohn sich jetzt zu ihr umwandte, sah sie zu ihrem Erstaunen, dass er keineswegs lächelte.
»Du liegst mit deiner Vermutung gar nicht so falsch, Mutter. Natürlich ist in der Truhe nicht der Kelch des letzten Abendmahls, mit dem auch noch das Blut Christi am Kreuz aufgefangen worden sein soll und der deshalb angeblich seinem Besitzer ewiges Leben und unendliche Macht verheißt. Das sind nichts als Ammenmärchen. Aber sie enthält etwas anderes, das die ganze Welt, so wie wir sie heute kennen, zum Einsturz bringen kann. Es ist ein Geschenk von Sultan Salah ad-Din, das er mir vor meiner Abreise hat zukommen lassen. Anstatt des heiligen Kreuzes, das ich von ihm gefordert hatte, wie mir sein Bote bei der Übergabe zu verstehen gab.«
»Nun spann mich nicht länger auf die Folter, Richard. Sag mir endlich, worum es sich handelt.«
»Nein, das werde ich nicht tun. Du weißt, ich vertraue dir, Mutter. Du hast mir das Reich bewahrt, und ohne dich würde ich heute noch in irgendeinem Kerker schmachten. Aber genau deshalb kann ich dir das Geheimnis nicht offenbaren. Jeder, der es kennt, schwebt in absoluter Lebensgefahr. Es gibt Kräfte auf dieser Welt, die mit allen, wirklich allen Mitteln versuchen werden zu verhindern, dass bekannt wird, was sich in der Truhe befindet. Glaub mir, in diesem Fall ist es besser, wenn auch du ihr Geheimnis nicht kennst.«
»Um Gottes willen, Richard, du kannst einem ja richtig Angst machen. Aber jetzt bin ich erst recht neugierig geworden. Willst du mir nicht wenigstens einen kleinen Fingerzeig geben, worum es sich handelt? Dann kann ich dir vielleicht raten, wohin du die Truhe bringen lassen solltest, damit sie nicht in falsche Hände gerät.«
»Noch einmal, Mutter. Ich werde das zu deinem eigenen Schutz nicht tun. Und hör auf, mich zu bedrängen, es ist nur zu deinem Besten. Erst muss sich der Inhalt in absoluter Sicherheit befinden, dann kann ich bei passender Gelegenheit einen Hinweis darauf verlauten lassen. Ich denke, von dem Moment an wird die größte Macht auf Erden fest und unverbrüchlich an meiner Seite stehen und diese aus Furcht vor dem eigenen Untergang nie wieder verlassen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Schon das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich zu viel gewesen. Du musst es unbedingt für dich behalten, hörst du? Schwöre es mir!«
»Richard, hältst du mich für eine Klatschbase? Du solltest mich wahrlich besser kennen! Bei mir ist dein Geheimnis so sicher wie in Abrahams Schoß. Aber wenn der Inhalt der Truhe wirklich so brisant ist, wieso lässt du sie dann in der Gegend herumschleppen und schließt sie nicht einfach im Tower ein?«
»Zu riskant, zu unsicher.«
»Der Tower von London?« Eleonore sah ihren Sohn ungläubig an. »Er ist noch niemals eingenommen worden und keiner je aus ihm entkommen. Ich jedenfalls kenne keinen sichereren Platz. Vielleicht noch die Festung von Chinon, aber das ist fraglich.«
»So sehe ich das auch, und deshalb werde ich eine Burg um die Truhe herumbauen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat und die wirklich uneinnehmbar ist. Zumindest solange ich lebe. Und bis dahin wird sie stets in meiner Nähe sein, umgeben von einer Hundertschaft mir treu ergebener Ritter unter der Aufsicht von Hubert Walter. Das ist der sicherste Platz auf Erden, der mir gegenwärtig einfällt.«
»Weiß dein Freund denn, was sich in der Truhe befindet? Kennt er deren Geheimnis?«
»Nein, auch er nicht«, schüttelte Richard den Kopf und drehte sich wieder zum Fenster, um noch einmal auf die gehenkten Feinde zu sehen. »Er hat mich nur einmal gefragt, was die Truhe beinhaltet, danach nie wieder. Ich habe die Gaben von Salah ad-Din damals auf dessen Bitten hin in Akkon allein entgegengenommen, und das Geschenk des mittlerweile verstorbenen Sultans hat genau den Zweck erfüllt, den er sich davon wahrscheinlich erhofft hatte. Ich habe mich zu Tode erschrocken, als ich es in den Händen hielt, und es in einem Kasten verwahrt, der sofort unter meinen Augen zugeschmiedet worden ist. Versucht man, ihn unsachgemäß zu öffnen, wird der Inhalt zerstört. Der Behälter steht nun in der mit starken Schlössern gesicherten Truhe und wird von Hubert Walter und meinen Rittern beschützt. Niemand greift schließlich einen Erzbischof an, ohne dafür im ewigen Höllenfeuer zu schmoren. Ich wüsste deshalb keinen besseren Wächter für die Truhe und ihren Inhalt als ihn.«
Hubert Walter war früher Bischof von Salisbury gewesen. Nach Richards Krönung hatte er den König auf seinen Kreuzzug ins Heilige Land begleitet und war dort zu dessen Waffenbruder und engstem Vertrauten aufgestiegen. Gleichermaßen im Kettenhemd zu Hause wie im klerikalen Gewand, hatte er sich sowohl in zahlreichen Kämpfen durch seine Tapferkeit als auch in vielen Verhandlungen durch sein Geschick und seine Klugheit ausgezeichnet. Richard hatte den Bischof deshalb auf einem anderen Weg als dem von ihm gewählten nach Hause geschickt und ihm die wertvolle Truhe zu treuen Händen anvertraut, die so unbeschadet nach England gelangt war. Noch aus seiner Gefangenschaft heraus bestimmte der König, dass Hubert Walter zum Erzbischof von Canterbury und damit ranghöchsten Kirchenfürsten im angevinischen Reich ernannt werden sollte. Gleichzeitig erhob er ihn zu seinem Justiciar und damit zum obersten Richter und höchsten weltlichen Amtsträger in England. Wie erwartet, nahm der Prälat daraufhin gemeinsam mit Richards Mutter Eleonore, William Marshal und weiteren Getreuen den Kampf gegen John auf und drängte dessen Einfluss im Königreich immer weiter zurück. Gleichzeitig kümmerte er sich um die Beschaffung des Lösegeldes für seinen Freund und scheute nicht davor zurück, dafür auch die Kirchenschätze heranzuziehen, was ihm viel Feindschaft unter dem Klerus einbrachte. Jetzt, nachdem er sich für kurze Zeit wieder zum Krieger gewandelt und das schwere Belagerungsgerät herangebracht hatte, das für die Einnahme von Nottingham unumgänglich nötig gewesen war, lagerte der Erzbischof wie alle anderen an der Erstürmung von Nottingham Beteiligten vor der Stadt und bereitete das Treffen des hohen Adels vor, auf dem über das Schicksal der inneren und äußeren Feinde des Reiches und die weitere Vorgehensweise gegen sie beraten werden sollte.
»Dann wollen wir einmal hoffen, dass du recht behältst, Richard«, meinte Eleonore nachdenklich. »Obwohl mich, zugegeben, die Neugier fast zerfrisst, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich nach deinen beängstigenden Worten wirklich wissen will, was sich in der geheimnisvollen Truhe befindet. Wo willst du denn diese ominöse, uneinnehmbare Burg bauen? Hast du denn dafür schon einen Ort gefunden?«
»Weit weg von jeder Stadt auf einem Berg oder Felssporn. Wo genau, wird sich noch finden. Und jetzt komm, Mutter, die Lords erwarten uns. Wir dürfen sie nicht gar zu lange auf uns warten lassen. Schließlich wollen wir viel von ihnen, sie hingegen nur wenig von uns. Und was sie letztlich bekommen werden, wird ihnen mit Sicherheit so gar nicht schmecken und behagen.«
Mit diesen Worten wandte sich der König zu Eleonore um und reichte ihr seinen Arm. Gemeinsam machten sie sich auf, um dem versammelten weltlichen und geistlichen Adel Englands zu verkünden, was in den nächsten Jahren auf ihn, die Bürger und Bauern diesseits und jenseits des Kanals und das ganze angevinische Reich zukommen würde. Zuerst einmal, das war allen klar, die Richard Löwenherz kannten – diesbezüglich gab sich niemand einer Illusion hin –, ein neuer Krieg.
Umgeben von Bannerträgern, Fanfarenbläsern und einer ausgewählten Ritterschaft ritten Richard und seine Mutter, die es strikt ablehnte, sich in einer Sänfte tragen zu lassen, von der auf einem Felsen über dem Trent thronenden Burg durch die zu ihren Füßen liegende Stadt, wo ihnen der Jubel der Einwohner entgegenschallte, zu dem riesigen Feldlager auf der Ebene vor Nottingham.
Die Straßen waren von Menschenmassen gesäumt, die die ersten Frühlingsblumen auf den Weg warfen, auch wenn sie von den Hufen der Pferde gleich darauf in den Schlamm getreten wurden. Der König grüßte huldvoll nach allen Seiten und sonnte sich in den Vivat-Rufen seiner Untertanen. Sie waren froh, endlich das Joch abschütteln zu können, unter dem sie jahrelang gelitten hatten. Prinz John und seine Parteigänger, allen voran der Sheriff, hatten die Menschen in der Grafschaft erbarmungslos ausgeplündert, anfangs unter dem Vorwand, die Steuern wären ausschließlich für den Kreuzzug und später dann für das Lösegeld Richards bestimmt. In Wahrheit hatten sie sich das Geld selbst in die Taschen gesteckt oder sogar damit zu verhindern versucht, dass der König aus der Gefangenschaft freikam. Jetzt, wo er endlich zurückgekehrt war, hofften alle, die über die Jahre hinweg treu zu ihm gestanden hatten, dass es endlich besser werden würde und Not und Pein ein Ende hätten. Ganz so, als wäre der Erlöser herabgestiegen, von dessen Erscheinen sie sich ewiges Seelenheil versprachen.
Seltsam, dachte Eleonore, die an Richards Seite ritt, dass sie ihn immer noch vergöttern. Damals, vor fünf Jahren, als er gekrönt wurde, konnte ich es verstehen. Denn Richard hat die Kriege beendet, die sein Vater bis zu seinem Tode gegen Frankreich und auch seine abtrünnigen Söhne führte, sodass zumindest kurzzeitig Frieden in dem großen Reich herrschte, das von den Pyrenäen bis nach Schottland hinaufreichte. Doch der unselige Kreuzzug und vor allem die Gefangenschaft ihres Sohnes hatten das Land nahezu ruiniert und unzählige Bauern, Handwerker und kleine Händler an den Bettelstab gebracht. Trotzdem jubelten die Menschen ihrem König nach wie vor begeistert zu. War das nicht verrückt? Aber andererseits wohl der Lauf der Welt. Ein strahlender Kriegerkönig in silberglänzender Rüstung besaß nun einmal eine Aura, gegen die kaum anzukommen war. Ihr Jüngster, John, hatte dies jedenfalls nie geschafft. Ihm war es nicht gelungen, die Herzen des Volkes zu gewinnen. Überall, ob in England, ob in Aquitanien oder der Normandie – war ihm nichts als Ablehnung entgegengebracht worden. Selbst als er versucht hatte, sich die Gunst und Loyalität der Bewohner mit Geld, viel Geld, zu erkaufen. Aber Richard? Der braucht nur auf ein Pferd zu steigen, huldvoll zu lächeln und mit einer Hand zu winken – und die Menschen sind bereit, ihr letztes Hemd für ihn zu geben, und würden ihm wahrscheinlich sogar in die Hölle folgen. Das soll einmal jemand mit klarem Verstand verstehen!
Richard hingegen, der nichts von den Gedankengängen seiner Mutter ahnte, ging das Herz auf, als er das große Zeltlager am Ufer des Trents sah, über welchem unzählige Fahnen und Wimpel im milden Frühjahrswind wehten. Von überallher waren die Lords gekommen, um ihm zu huldigen. Die Wappen vieler, die mit ihm im Heiligen Land gewesen waren, erkannte er ebenso wie die von Rittern, die seinem Ruf damals nicht hatten nachkommen können oder wollen. Da waren zum Beispiel die Marcher Lords, die die Grenze gegen Wales sichern mussten, damit die wilden Krieger aus dem Westen nicht ständig in die englischen Kernlande einfielen. Oder auch die aus dem Norden, die das Land gegen die kriegerischen Schotten schützten. Aber es gab auch etliche hohe Herren, die sich damals unter Vorspiegelung ihrer vorgeblichen Unabkömmlichkeit einfach gedrückt hatten. Nun, das schwor sich der König, noch einmal sollte ihnen das nicht gelingen. In seinen Krieg gegen Philipp von Frankreich zur Rückeroberung der verloren gegangenen Ländereien müssten ihn alle begleiten, das würde er ihnen schon begreiflich machen. Diesmal konnte er keine Ausreden gelten lassen, denn er würde jeden einzelnen Mann brauchen, um das angevinische Reich wieder in den Grenzen herzustellen, in denen er es von seinem Vater übernommen hatte. Er wollte seinen ehemaligen Freund Philipp, mit dem er einst Teller und Becher geteilt hatte, und jetzigen Todfeind jagen, bis ihm die Luft zum Atmen ausging und auch das letzte Bauerndorf zurückerobert worden war. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit gleich noch dessen kleine Île-de-France überrennen, um bis an den Rhein vorzustoßen, genauso wie er es Kaiser Heinrich geschworen hatte, als er ihm den angeblichen Friedenskuss gab und niemand anderes es hören konnte. Die Gedärme würde er ihm rausreißen und an seine Hunde verfüttern, hatte er ihm damals in Mainz ins Ohr geflüstert, und dass einmal ein Plantagenet über das römisch-deutsche Reich herrschen würde. Auch seinen Bruder John, diesen undankbaren Verräter, der ihn um ein Haar um die Freiheit und die Krone gebracht hätte, weil er alles in seiner Macht Stehende dafür getan hatte, damit das Lösegeld nicht zusammenkam und den Kaiser erreichte, galt es zu fangen und zu züchtigen. Die Zeit der Abrechnung war nahe, und er wollte seine Rache genießen, das versprach sich Richard zum wiederholten Male selbst. So wahr man ihn mittlerweile von den Wüsten Palästinas bis hoch zu den Fjorden der Wikinger Löwenherz nannte!
In der Mitte des Lagers hatte Hubert Walter ein riesiges Zelt aufschlagen lassen, das nur mittels Seilwinden und eines Belagerungsturms errichtet werden konnte. Ein ähnliches hatte der alte König Henry einmal dem deutschen Kaiser Barbarossa zu dessen Hochzeit geschenkt. Doch dieses hier sollte genügend Platz für die Ratsversammlung bieten, denn die Halle der Burg von Nottingham hätte nicht ausgereicht, um alle anwesenden Lords unterzubringen.
Als Richard sein Pferd vor dem Zelt zügelte, brandeten Hochrufe auf. Der Adel zeigte seine Demut durch den obligaten Kniefall, und laut wurde dem König von allen Seiten versichert, wie glücklich man über seine Heimkehr wäre und auch darüber, dass er ganz offenbar in der Zeit der Gefangenschaft keinen gesundheitlichen Schaden genommen habe. Richard bezweifelte sehr, dass die Wünsche allseits von Herzen kamen, wollte es aber zumindest für heute dabei bewenden lassen. Die Zeit, um Gericht zu halten, würde schließlich noch kommen.
Im prachtvollen, kirchlichen Ornat kam der Erzbischof – der gestern noch Kettenhemd und Normannenhelm getragen und den Streitkolben geschwungen hatte –, umgeben von den Edelsten des Reiches, Richard entgegen und verbeugte sich tief vor dem König. Dann hielt er ihm demütig den Steigbügel, eine Geste, mit der der römisch-deutsche Kaiser vor seiner Krönung dem jeweiligen Papst seine Unterwerfung unter die göttliche Macht bezeugte. Jeder Kleriker in der Runde verstand, was das Oberhaupt der Kirche von England damit sagen wollte – nämlich dass es sich im angevinischen Reich genau andersherum verhielt und der weltliche Herrscher über dem Klerus stand. Einer der Vorgänger des jetzigen Erzbischofs, Thomas Becket, der das hatte ändern wollen, war dafür auf den Stufen der Kathedrale in Canterbury von König Henrys Rittern erschlagen worden. Er, Hubert Walter, wollte auf keinen Fall so enden, denn er traute Richard ohne Weiteres zu, ebenso zu handeln. Und zum Märtyrer fühlte sich der amtierende Erzbischof und Kanzler des Reiches keineswegs berufen.
William Marshal, der Earl von Pembroke, war hingegen zu Eleonore getreten und half seinerseits der Königinmutter vom Pferd. Er diente ihr seit seiner frühesten Jugend, hatte für sie mehr als einmal sein Leben in die Waagschale geworfen und war auch derjenige gewesen, der ihr einst ihre Freilassung hatte verkünden dürfen. Sechzehn Jahre lang war sie von ihrem Gemahl in verschiedenen Gefängnissen eingesperrt worden, weil sie mit seinen Söhnen gegen ihn konspiriert und es auch nicht hatte dulden wollen, dass er sich neben seinen zahlreichen Mätressen noch eine Zweitfrau hielt, die sie mehr und mehr aus ihrer Position bei Hofe verdrängte. Richards erste Amtshandlung nach Henrys Tod war es gewesen, ihre Freilassung zu verfügen und William Marshal zu ihr zu schicken. Das würde sie beiden nie vergessen, hatte sich Eleonore damals geschworen.
Während sich die Edlen des Reiches tief vor dem König und seiner Mutter verbeugten, senkte ein Mann nur leicht grüßend das Haupt. Im Zelteingang, etwas hinter den Lords, stand hochaufgerichtet Wilhelm von Schottland, aufgrund seines Wappens – ein aufrecht stehender roter Löwe auf gelbem Grund – auch der Löwe genannt. Aber hinter vorgehaltener Hand wurde er aufgrund seines aufbrausenden Charakters, seines Eigensinns, seiner gelegentlichen Wutanfälle und Gewaltausbrüche auf Gälisch auch als An Garbh – der Raue – bezeichnet. Es gab nicht wenige in der Runde, die gespannt waren, wie das Aufeinandertreffen der beiden Könige vonstattengehen würde.
Richard und Wilhelm, Letzterer fast ebenso groß, aber wesentlich schmaler von Statur als der hünenhafte Löwenherz, waren in früheren Jahren Verbündete gegen König Henry gewesen. Der Schotte hatte die Engländer im Norden angegriffen und damit Kräfte gebunden, die dem König daraufhin in der Normandie und in Aquitanien fehlten, wo sich seine Söhne gegen ihn erhoben hatten. Dabei war Wilhelm weit nach Süden vorgestoßen, doch in der entscheidenden Schlacht von den Engländern besiegt und gefangen genommen worden. Henry hatte ihn in der Normandie in der Festung Falaise eingesperrt und mit seinen Truppen Schottland besetzt. Wilhelm war daraufhin nichts anderes übrig geblieben, als die Oberhoheit der Engländer über sein Land anzuerkennen, wollte er seine Freiheit wiedererlangen, auch wenn die Bedingungen dafür überaus demütigend waren. So musste er den englischen König als seinen Lehnsherrn anerkennen, die Kosten der englischen Garnisonen in Schottland tragen und sogar zustimmen, sich ohne englisches Einverständnis keine Gemahlin zu nehmen. Richard hatte nach seiner Amtsübernahme den Vertrag in weiten Teilen aufgehoben, wofür Wilhelm seinerseits unlängst eine große Summe zu dem vom deutschen Kaiser geforderten Lösegeld beigesteuert hatte. Löwenherz war klar, dass ihm dafür jetzt die Rechnung präsentiert werden würde, und er war gespannt, was der Schotte als Gegenleistung erwartete. Einiges davon war schon durchgesickert und ihm von Hubert Walter zugetragen worden, sodass er Wilhelm nicht gänzlich unvorbereitet gegenübertreten musste. Lange würde es sicherlich nicht dauern, bis dieser mit seinen Forderungen auf ihn zukam, doch vorerst galt es, den König angemessen zu begrüßen.
»Willkommen, Wilhelm von Schottland«, meinte Richard, als sich beide gegenüberstanden, und beugte sein Haupt etwas weniger tief als dieser zuvor. »Ich freue mich, dass Ihr meiner Einladung gefolgt seid und ich mich nun selbst bei Euch für die großzügige Spende bedanken kann, die Ihr zu meinem Lösegeld beigetragen habt.«
Spende, hat er gesagt, nicht Darlehen, grinste Eleonore in sich hinein. Ihr Sohn schien doch eine Menge von ihr gelernt zu haben.
Die Miene des Schotten, der fast fünfzehn Jahre älter war als Richard, verfinsterte sich auch prompt. Als milde Gabe hatte er die zehntausend Mark Silber, die ihm die Königinmutter in langen Verhandlungen abgeschwatzt hatte, nicht gesehen. Er würde dem englischen Löwen für seine Unterstützung schon noch die Rechnung vorlegen, die diesem im Halse stecken bleiben oder zumindest Bauchgrimmen verursachen sollte.
»Wir waren schon einmal Verbündete und sollten es auch nach wie vor sein«, merkte Wilhelm an und wollte zu sprechen fortfahren, doch Richard griff ihn am Ellenbogen und schob ihn mit sanfter Gewalt vor sich her in das Zelt hinein. Den Lords seines Reiches gab der König damit gleichzeitig ein Zeichen, ihnen zu folgen und ihre Plätze für die Ratsversammlung einzunehmen.
Der Schotte war über die Geste Richards so verblüfft, dass er glatt seine zurechtgelegte Rede vergaß. Dafür hörte er von seinem Gesprächspartner nun Worte, die ihn schlimme Verhandlungen erahnen ließen.
»Wie ich hörte, habt Ihr ein Bündnis mit Frankreich und den Dänen zwecks gegenseitigen Beistands geschlossen«, sagte Richard leise zu seinem Gast, während er ihn zu seinem Platz an der langen Tafel geleitete. »Gegen wen wird sich dieser Zusammenschluss wohl richten? Mir fällt dazu eigentlich nur mein Königreich ein. Oder sollte ich mich irren?«
Richard war die Höflichkeit in Person und seine Stimme so liebenswürdig, als würde er mit dem Frühjahrswind um die Wette säuseln. Doch Wilhelm spürte trotzdem den Eis- und Eisenhauch darin.
»Die Auld Alliance ist ein reines Defensivbündnis«, versuchte sich der Schotte zu rechtfertigen und sah sich von einem Moment auf den anderen bemüßigt, sich zu verteidigen. »Sie kommt ausschließlich zum Tragen, wenn ein Bündnispartner von einem Feind angegriffen wird. Also nichts, was Euch beunruhigen muss, Richard. Zumindest nicht, solange Ihr nicht in Schottland einmarschiert, so wie es Euer Vater getan hat.«
»Nehmt doch Platz, Wilhelm.« Der englische König rückte dem Schotten sogar den Sessel zu seiner Rechten zurecht, bevor ein Page herbeieilen konnte. »Aber sagt mir, wie ist das denn, wenn sich das angevinische Reich im Krieg mit Frankreich befinden sollte? Muss ich dann damit rechnen, dass ihr von Norden kommt, wie schon einmal vor einigen Jahren, und die Dänen womöglich über das Meer, um unsere Küsten zu verheeren?«
»Wo denkt Ihr hin?« Wilhelm gab den Entrüsteten, wand sich aber gleichzeitig wie eine Ringelnatter unter den Blicken seines Gesprächspartners. »Ihr versteht das völlig falsch!«
»So? Ich frage mich nur, was daran misszuverstehen ist.« Hubert Walter, der seine Ohren und Spione überall hatte, hatte Richard schon während seiner Gefangenschaft im römisch-deutschen Reich darüber ins Bild gesetzt, was sich da zusammenbraute. »Haben sich die drei Länder, die die Alliance geschlossen haben, etwa nicht dazu verpflichtet, sich gegenseitig zu unterstützen, Truppen zu stellen und den jeweils Angegriffenen ihrerseits durch Einfälle in die Ländereien seines Gegners zu entlasten? So etwas nennt man doch ein Schutz- und Trutzbündnis, nicht wahr? Ich dachte eigentlich, WIR wären Verbündete, Wilhelm. Sollte ich mich so in Euch getäuscht haben? Vielleicht war es vorschnell von meinem Vater, Euch aus der Haft zu entlassen, und auch von mir, Euch die Festungen Edinburgh, Roxburgh und Berwick zurückzugeben.«
Richard wandte sich nach diesen Worten lächelnd von Wilhelm ab, der um Fassung rang, und seinen Lords zu, die sich an der Tafel niedergelassen hatten und von Pagen und Knappen mit Wein und Bier – je nach Gusto – versorgt wurden. Der Schotte war derweil so bleich wie die Zeltleinwand hinter ihm geworden und fragte sich gerade, ob er nicht den Fehler seines Lebens begangen hatte, indem er hierhergekommen war. Eleonore hingegen, die links von Richard thronte, konnte ein Schmunzeln kaum verbergen. Sie hatte seit jeher versucht, ihren Lieblingssohn in der Staatskunst zu unterweisen, doch erst im Heiligen Land oder vielleicht noch später während seiner Gefangenschaft schien er es darin zu wahrer Meisterschaft gebracht zu haben.
Im Zelt wurde derweil heftig diskutiert, und es herrschte eine Lautstärke, die eine sachliche Unterhaltung kaum möglich machte. Richard sah sich das eine Weile lang an, dann gab er Hubert Walter ein Zeichen, für Ruhe zu sorgen, damit die eigentliche Beratung beginnen konnte. Wobei der König zwar die Absicht hatte, sich die Wünsche und Vorschläge seines Adels für die Zukunft des Reiches anzuhören, allerdings bereits seine eigenen Pläne verfolgte und nicht gewillt war, davon auch nur einen Deut abzurücken.
Dem Erzbischof gelang es relativ schnell, sich mit seiner volltönenden Stimme durchzusetzen, hatte er doch diesbezüglich ausreichend Erfahrung in Klöstern sammeln können, wo es oft wie auf einem Hühnerhof zuging und es wesentlich schwerer war, sich Gehör zu verschaffen, als hier, wo sowieso jedermann begierig war, den König sprechen zu hören. Doch zuvor wollte Hubert Walter seine mit Richard abgesprochene Ansprache halten, um die Lords auf das einzustimmen, was sie erwartete.
»Mylords und Myladys«, wandte sich der Erzbischof an die Versammelten und verneigte sich leicht in alle Richtungen, wobei sich die angesprochenen Ladys, Eleonore und zwei ihrer Hofdamen, eindeutig in der Minderzahl befanden. »Im Auftrag König Richards, für dessen Rückkehr wir Gott über alle Maßen danken sollten, haben wir uns hier versammelt, um über die Belange des Reiches zu beraten. An erster Stelle, da werdet Ihr mir sicherlich alle recht geben, steht aber die Frage, wie mit den Verrätern umzugehen sein wird, die sich während seines Kreuzzuges und seiner Gefangenschaft gegen unseren erhabenen Herrscher gestellt und damit sowohl gegen göttliches Gebot als auch weltliches Gesetz verstoßen haben. Nun, was meint Ihr, was soll mit diesen Verrätern geschehen? Der König ist begierig zu erfahren, was Ihr, die all die Jahre über treu zu ihm gestanden habt, darüber denkt.«
Die meisten der angesprochenen Lords witterten die Falle, die sich hier auftat, und hielten sich tunlichst zurück, ihre Meinung offen kundzutun. Doch Melton of Mowbrey, ein etwas unbedarfter Baron aus den Midlands, war der Meinung, etwas in die Stille hineinsagen zu müssen, sich damit ins rechte Licht zu setzen und auf diese Weise vielleicht in der Gunst Richards aufzusteigen.
»Sire, gestattet mir im Namen der hier Versammelten, Euch zu Eurer glücklichen Heimkehr zu beglückwünschen. Uns alle, die wir Eure treuen Diener sind und dies auch über die Zeit Eurer Gefangenschaft hinweg waren, erfüllt es mit unsagbarer Freude, Euch so strahlend und siegreich in unserer Mitte zu sehen. Umso erbarmungsloser sollte gegen all diejenigen vorgegangen werden, die sich während Eurer Abwesenheit am Eigentum der Krone vergangen haben und Euch in den Rücken gefallen sind. Für sie kann es nur eine Strafe geben – den Tod durch den Strang!«
Betretenes Schweigen machte sich in der Runde breit, hatte dieser unbedeutende Lord doch soeben nichts anderes gefordert, als dass der König seinen eigenen Bruder, der schließlich der Haupträdelsführer der Revolte gegen ihn gewesen war, hinrichten lassen sollte. Und das noch dazu in Anwesenheit von dessen Mutter, die zwar als wenig zimperlich bekannt war, schließlich aber beide Söhne geboren hatte. Da Richard sich bedeckt hielt und auch Eleonore, die sich durchaus nicht scheute, in Männerrunden ihre Meinung und ihren Standpunkt klar zu vertreten, nichts zu dem unsäglichen Vorschlag sagte, erhob sich seufzend William Marshal, der wusste, was von ihm erwartet wurde, um Mowbrey zu widersprechen.
»Sire, Madam«, ergriff der Earl von Pembroke das Wort und verneigte sich vor dem König und seiner Mutter mit dem rechten Arm vor der Brust. »Lasst uns Unrecht nicht mit Unrecht vergelten, sondern streng nach dem Gesetz vorgehen. Auch Angeklagte sollten das Recht haben, sich verteidigen und ihren Standpunkt zu den Anschuldigungen vortragen zu können. Deshalb schlage ich vor, bevor wir mit einer Heeresstreitmacht losziehen und die Burgen und Ländereien der Angeschuldigten zerstören und verwüsten, den jeweiligen Adeligen und Klerikern die Gelegenheit zu geben, sich vor einem eigens dafür einberufenen Adels- beziehungsweise Kirchengericht zu verantworten. Sollten sich die Beklagten allerdings nicht binnen vierzig Tagen selbst stellen, dann möge der berechtigte Zorn des Königs über sie kommen und es allein in seiner Hand liegen, ob er sie zum Tode verurteilt, unter Einziehung all ihres Vermögens verbannt oder auch begnadigt, wenn er es für wünschenswert erachtet. Wir alle sollten dann seinen Schiedsspruch anerkennen, denn Gott hat ihn nicht umsonst über uns alle erhöht, als er in Westminster Abbey mit dem heiligen Öl gesalbt wurde.«
William Marshal verneigte sich noch einmal, bevor er wieder Platz nahm, und ein Raunen der Zustimmung ging durch die Reihen, denn sein Vorschlag war wesentlich durchdachter als der des Barons von Mowbrey und zumindest diskussionswürdig.
»Wohl gesprochen, Mylord Marshal«, entgegnete auch sofort Hubert Walter und wandte sich dann an den König. »Wenn der Vorschlag des Earls von Pembroke auch Eure Zustimmung findet, Sire, würde ich Boten an alle Beschuldigten entsenden und sie auffordern, in Westminster vor einem königlichen Gericht zu erscheinen. Sollten sie der Ladung nicht nachkommen, dann wird sie die volle Härte des Gesetzes treffen, ihr Besitz beschlagnahmt, und sie werden für alle Zeiten als Verräter gebrandmarkt werden. Bischof Hugo von Coventry hingegen, der bis vor Kurzem noch ein enger Parteigänger des Grafen von Mortain war, lade ich nach Canterbury, wo er vor mir, dem päpstlichen Legaten und den Äbten der Klöster Rechenschaft über sein Tun ablegen soll.«
Wie geschickt du es vermieden hast, meinen Bruder beim Namen zu nennen, du alter Fuchs,