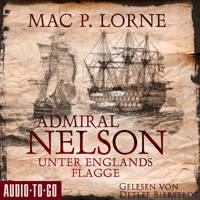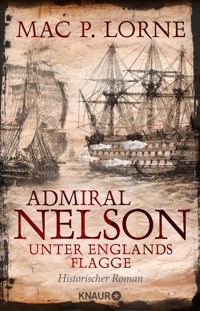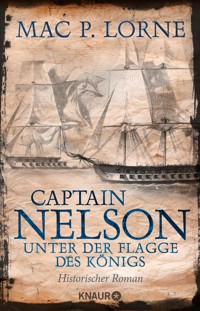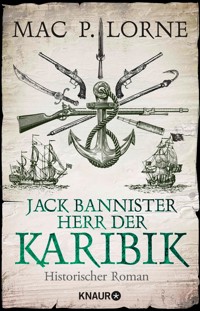9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Robin Hood-Reihe
- Sprache: Deutsch
England im Mittelalter: Der dritte Teil der Robin Hood Saga von Mac P. Lorne - aufwendig recherchiert, spannungsgeladen und temporeich. Die Fortsetzung von »Das Herz des Löwen« - Der König der Diebe kehrt zurück! Viele Jahre lebten Robin Hood und seine Frau Marian auf Geheiß Königin Eleonores unerkannt in der Gascogne, um König Richards illegitimen Sohn Fulke zu schützen. Als England in Gefahr ist, ruft William Marshal die Verbannten zurück. Doch bevor Robin wieder durch seinen geliebten Sherwood Forest streifen darf, muss er zuerst in Spanien gegen die Mauren in den Kampf ziehen. Zu Hause in England treibt derweil König John weiter ungehindert sein Unwesen. Noch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1088
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mac P. Lorne
Das Blut des Löwen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Fortsetzung von »Die Pranken des Löwen« und »Das Herz des Löwen« – Der König der Diebe kehrt zurück!
Viele Jahre lebten Robin Hood und seine Frau Marian auf Geheiß Königin Eleonores unerkannt in der Gascogne, um König Richards illegitimen Sohn Fulke zu schützen. Als England in Gefahr ist, ruft William Marshal die Verbannten zurück. Doch bevor Robin wieder durch seinen geliebten Sherwood Forest streifen darf, muss er zuerst in Spanien gegen die Mauren in den Kampf ziehen. Zu Hause in England treibt derweil König John weiter ungehindert sein Unwesen. Noch.
Der dritte Teil der »Löwen-Reihe« von Mac P. Lorne – aufwendig recherchiert, spannungsgeladen und temporeich.
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte 1
Karte 2
Wappen
Personenregister
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
Anmerkungen des Autors
Zeittafel
Glossar
Bibliografie
Für Svea,
meinen Augenstern
Spanien um 1212
England um 1214
Personenregister
(historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet)
John Plantagenet*, genannt »Johann ohne Land«, später »König Weichschwert« – geb. 24.12.1167 in Oxford, gest. 19.10.1216 auf Newark Castle, von 1199 bis 1216 König von England
Richard I. Plantagenet*, genannt »Löwenherz« – geb. 08.09.1157 in Oxford, gest. 06.04.1199 vor Chalus, sein Bruder und Vorgänger als König von England
Eleonore von Aquitanien* – beider Mutter, geb. ca. 1122 in Poitiers, gest. 01.04.1204 im Kloster Fontevrault
William von Salisbury*, genannt »Longsword« – Halbbruder von Richard I. und John I., geb. ca. 1170, gest. 07.03.1226
Robert Fitzooth, auch Robert von Loxley, später Robin Hood – geb. 1160 in Loxley, gest. 1247 in Kirklees Priory, ab Oktober 1190 Sir Robert von Loxley, ab August 1192 Earl von Huntingdon
Marian Leaford – seine Frau, geb. 1165 in Fenwick, gest. 1243 in der Gascogne
Fulke* – Sohn von Richard Löwenherz und Joan de Saint-Pol (Existenz spekulativ), Ziehsohn von Robin Hood und Marian Leaford
Little John, Will Scarlet, Much Millerson, Alan a Dale, Bruder Tuck – Gefährten von Robin Hood
William Marshal* – Earl von Pembroke, Mitglied des Kronrates, Regent von England, geb. 1144, gest. 1219
Guillaume Marshal* – sein Sohn, 2. Earl von Pembroke, Unterzeichner der Magna Carta, geb. 1190, gest. 06.04.1231
Stephen Langton* – Erzbischof von Canterbury, Kanzler von England, Mitinitiator der Magna Carta, geb. 1150, gest. 09.07.1228
Philipp Marc* – Highsheriff von Nottinghamshire und den königlichen Forsten von 1209 bis 1224
Nicola de la Haye* – Highsheriff von Lincolnshire als erste Frau in diesem Amt, geb. ca. 1150, gest. 1230
Savary de Mauléon* – aus Frankreich stammender Söldner, der König John treu bis zu dessen Tod diente, gest. 1236
Philipp II.* – seit 1188 König von Frankreich, ehemaliger Freund, später Feind von Richard I. und John I., geb. 1165, gest. 1223
Prinz Louis* – sein Sohn, später König von Frankreich, geb. 05.09.1187, gest. 08.11.1226
Thomas, Graf von Le Perche* – Heerführer unter Prinz Louis, geb. um 1193, gefallen in der Schlacht um Lincoln am 20.05.1217
Charles d’Artagnan – Herr auf Castelmore, Freund von Robin und Marian
Jean und François d’Artagnan – seine Söhne, Letzterer Steward auf Château de Lisse
Sancho VII.* – König von Navarra, genannt »der Starke«, Schwager von Richard Löwenherz, Held von Las Navas de Tolosa, gest. 07.04.1234
Ramiro* – sein Bruder, Bischof von Pamplona
Alfons VIII.* – König von Kastilien, genannt »der Edle«, geb. 11.11.1155, gest. 06.10.1214
Rodrigo de Rada* – Erzbischof von Toledo, geb. 1170, gest. 10.06.1247
Muhammad an-Nasir* – Kalif der Almohaden, gest. 25.12.1213
Prolog
Nottingham, April 1203
König John I. von England, Herzog der Normandie und Aquitanien, Graf von Mortain, Lord von Irland und dem Namen nach noch Herrscher über weitere Territorien, fand auch in dieser Nacht keinen Schlaf. Von den Dämonen getrieben, die ihn nach der grausamen Tat in Rouen ständig heimsuchten, streifte er ruhelos durch die Gänge der Burg von Nottingham, seiner Lieblingspfalz in England. Hierher hatte er sich aus der Normandie geflüchtet und gehofft, Ruhe und Vergessen zu finden.
Keiner seiner Gefolgsleute, ja nicht einmal die Kerkerwachen, waren bereit gewesen, dem königlichen Befehl Folge zu leisten. Seine sonst so getreuen, von ihm mit zahlreichen Lehen bedachten Favoriten William de Braose und Hubert de Burgh, hatten ihn nur entsetzt angeschaut, abwehrend die Hände gehoben und waren durch keinerlei Versprechungen zu bewegen, ihm die verlangte Gefälligkeit zu erweisen.
So hatte er selbst tun müssen, was er für unabdingbar hielt. Seitdem verfolgten ihn am Tag die Blicke und das Wispern der Höflinge und des Nachts die Schatten, die hinter jedem Mauervorsprung und Wandvorhang zu lauern schienen.
Verstand denn niemand, dass er nicht anders hatte handeln können? Arthur, von König Richard, genannt Löwenherz, schon vor Jahren auf Sizilien als sein Nachfolger benannt, stellte eine ständige Bedrohung für ihn dar. Auch wenn nach dem Tod seines Bruders er jetzt der gesalbte und gekrönte König von England war, dieses Bürschchen hatte seine Ansprüche auf den Thron nie aufgegeben! Also war es doch nur folgerichtig, sein Leben zu beenden, nachdem Arthur so unvorsichtig gewesen war, ihm, seinem Onkel, vor Mirebeau in die Hände zu fallen.
Wieso begriff das denn keiner? War er nur von Dummköpfen umgeben? Musste ein König wirklich alles selbst zu Ende bringen?
Und dieser sechzehnjährige Knabe hatte ihm auch noch ins Gesicht gelacht und sich als wahren Erben und Herrscher über das Angevinische Reich bezeichnet! Das war endgültig zu viel gewesen, und das Lachen hatte er ihm ausgetrieben. Niemand, nicht einmal Gott, sollte ihn jemals von dem Thron stoßen, für den er so viele Jahre lang betrogen, gelogen, intrigiert und sich mit allen – sogar den Feinden des Reiches – verbündet hatte, die ihm auch nur für kurze Zeit nützlich waren. Allzu lange hatte er darauf gewartet, endlich König zu sein, und jetzt musste er zu seinem Entsetzen feststellen, dass trotzdem nicht jedem seiner Befehle Folge geleistet wurde. Nun, die Widersetzlichen würden schon bald merken, was es hieß, ihm zu trotzen und den Gehorsam zu verweigern. Was er gegeben hatte, konnte er auch jederzeit wieder nehmen!
Ablenkung musste her, entweder eine Frau, lieber noch ein junges Mädchen, oder etwas zu essen! Am besten beides, davon konnte er nie genug bekommen. Er stürmte die Treppe hinunter zur großen Küche. Dort frönte er am liebsten der Völlerei, wenn keiner seiner Gefolgsleute ihn sah. Was zählten schon die Köche und Mägde! Und jetzt, mitten in der Nacht, würde sowieso nur die Herdwache anwesend sein.
John riss die schwere Holztür auf. Erschrocken sprang die Küchenmagd, die gerade Holz unter dem großen Herd nachgelegt hatte, dessen Feuer nie ausgehen durfte, zur Seite. Im ersten Moment erkannte sie den König nicht, glaubte, ein Geist wäre ihr erschienen. Wirres, dünnes, strähniges Haar umrahmte das eher gewöhnliche Gesicht, in dem die Augen fiebrig glänzten. Die untersetzte, zur Fülle neigende Gestalt war nur mit einem Hemd und einem lose darübergeworfenen ärmellosen Mantel bekleidet. Alles in allem wahrlich kein königlicher Anblick.
»Was glotzt du so?«, fuhr John die verstörte Frau an. »Los, bring her, was von dem gestrigen Festmahl übrig ist! Oder habt ihr hier unten womöglich alles aufgefressen, was meine Gäste nicht haben in sich hineinstopfen können? Bin ich nur von Dieben und Räubern umgeben?«
»Nein, Sire«, stotterte die Magd, die sich mühsam von ihrem Schreck erholte. »Die Köche bewahren alles auf, und niemand wagt es, die Speisen anzurühren. Seht selbst, die Kammer ist verschlossen!«
Tatsächlich standen in der Küche nur Abfälle herum, die für die Schweine bestimmt waren. Den Schlüssel für die Speisekammer verwahrte der oberste Hofkoch persönlich. Doch das primitive Schloss konnte John nicht aufhalten. Er griff sich einen Schürhaken, stemmte ihn hinter den Riegel und brach die Tür auf. Aus den Augenwinkeln sah er dabei, dass hinter dem Herd auf einer Strohschütte ein Kind, ein junges Mädchen von vielleicht elf oder zwölf Jahren, hockte. Ein schon teuflisch zu nennendes Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit.
»Gott hat mein Flehen erhört und mir geschickt, wonach ich begehre!«, dachte John bei sich. Mit der einen Hand griff er sich eine Platte mit kaltem Braten, mit der anderen grapschte er nach dem Kind. Hemmungen wegen ihres Alters hatte er keine. Seine zweite Frau, Isabella von Angoulême, war selbst erst zwölf Jahre alt gewesen, als er sie Hugo von Lusignan weggenommen hatte.
Das Mädchen versuchte, in die hinterste Ecke der Küche zu kriechen, und die Magd, offenbar ihre Mutter, flehte den König schluchzend und händeringend an, von ihr abzulassen. Doch John ließ sich die Beute, die sich ihm hier wider Erwarten präsentierte, nicht entgehen. Mit eisernem Griff fasste er dem Kind ins Haar und schleifte es hinter sich her, dem Ausgang und der Treppe hinauf zu seinem Gemach entgegen.
Die entsetzte Mutter fiel ihm in den Arm, versuchte, ihre Tochter zu befreien, und schrie voller Verzweiflung um Hilfe. Doch niemand kam. Jeder von der Dienerschaft oder aus Johns Gefolge wusste, dass man den König besser nicht störte, ging er seinen frivolen Vergnügungen nach.
John stieß die Magd mit dem Ellbogen zur Seite, ohne die Platte mit dem Braten oder das Mädchen loszulassen. Die Frau strauchelte und stürzte mit dem Kopf gegen die Kante des aus groben Feldsteinen gemauerten Herdes. Bewusstlos sank sie zu Boden, und eine Blutlache breitete sich neben ihr aus. John zuckte nur mit den Achseln und zog das um sich schlagende und weinende Mädchen weiter in Richtung Treppe. Keinen Blick verschwendete er auf ihre Mutter. Für ihn zählten Gesinde oder Bauern weniger als Vieh.
Natürlich waren der Lärm und das Geschrei nicht ungehört geblieben, und hinter mancher Tür blinzelte vorsichtig ein Auge hervor. Doch keiner stellte sich dem König in den Weg oder gebot seinem Treiben Einhalt. Oft ließ er sich die Töchter oder Ehefrauen der Ritter und Barone ins Bett legen, auf deren Burgen er sich auf seinen Reisen durch das Land einquartierte und die er nach seinem Abzug meist an den Rand des Ruins gebracht hatte. Einer der Köche eilte zumindest in die Küche und fand dort die Herdmagd in ihrem Blute liegend vor. Er konnte nichts mehr tun, als ihre gebrochenen Augen zu schließen und das Kreuz über der Toten zu schlagen. Hoffentlich würde sich wenigstens am Morgen ein Priester finden, der für ihre Seele betete.
Währenddessen hatte John endlich sein Schlafgemach erreicht. Kämmerer und Diener im Vorzimmer taten, als schliefen sie ganz fest und wären nur durch Gott zu erwecken. Er schleuderte das Mädchen auf das große Baldachinbett, wo es sich wimmernd zusammenkrümmte. Der König selbst beschäftigte sich erst einmal mit dem Braten, von dem er große Stücke mit seinen Zähnen abriss und in sich hineinstopfte. Wie ein Raubtier seine Beute beäugte er dabei das Kind von allen Seiten. Was er sah, gefiel ihm und schien vielversprechend. Sie war zwar nicht sehr sauber, doch langes blondes Haar fiel ihr fast bis auf die Hüften, und unter dem einfachen Kleid wölbte sich bereits eine kleine Brust.
John merkte, wie es in seinen Lenden anfing zu ziehen und sein Glied sich aufrichtete. Er warf das Stück Fleisch zurück auf die Platte und streifte den Mantel ab. Ohne sich auch nur die fettigen Hände abzuwischen, schwang er sich auf das Bett und näherte sich dem völlig verängstigten Mädchen. Mit einem einzigen Ruck riss er das dünne Kleid von oben bis unten entzwei und ergötzte sich an der jetzt nackt vor ihm liegenden Jungfrau. Das Schluchzen und Weinen störte ihn nicht. Im Gegenteil, es erregte ihn noch zusätzlich.
Mit beiden Händen spreizte John die Beine des zu keiner Gegenwehr fähigen Mädchens, raffte sein Hemd und drang mit einem einzigen Stoß in ihren jungfräulichen Schoß ein. Sein Opfer schrie und jammerte herzzerreißend, doch ihr Peiniger kannte keine Gnade und ließ nicht von ihr ab. Immer wieder stieß er in den jungen Leib hinein und zerfetzte ihn dabei innerlich. Als er sich endlich in sie ergoss und sein Glied schlaff wurde, strömten Blut und Samen aus dem Mädchen heraus.
Angewidert wandte sich John von ihr ab, rutschte vom Bett herunter und riss die Tür des Schlafgemaches auf.
»Wachen!«, brüllte der König in das Vorzimmer hinein, und sofort kamen zwei Kriegsknechte auf ihn zugestürzt. »Schafft dieses Drecksstück aus meinen Augen! Sie blutet wie ein Schwein und versaut mir die ganzen Laken! Bringt neues Bettzeug und Wein, und dann will ich keinen mehr von euch sehen!«
Wie die Wiesel huschte die Dienerschaft umher, den Befehlen des Königs Folge leistend. Das Mädchen, das eine gnädige Ohnmacht umfangen hatte, wurde in die verschmutzten Laken gehüllt und aus dem Zimmer entfernt. Man würde nach ihren Verwandten suchen und sie ihnen übergeben. Vielleicht konnte ja ein Bader oder eine Kräuterfrau die Blutung stillen und das Kind retten. Viel Hoffnung, dass sie die königlichen Zuwendungen überstehen würde, hatte allerdings niemand. Schnell war das Bett neu bezogen, und ein großer Pokal mit Würzwein stand auf einem Tisch neben dem thronartigen Sessel, in dem sich John ausgestreckt hatte und dem Treiben um ihn herum teilnahmslos zusah. Jeder war froh, als er endlich das Gemach verlassen konnte. Zurück blieb nur der einsame König inmitten seiner Ängste und Dämonen.
Wenige Tage später brach der Tross Richtung Süden nach Corfe Castle, einer weiteren königlichen Residenz, auf. William Briwere, der gegenwärtige Sheriff von Nottingham – sie wechselten unter Johns Regime ständig, da keiner seine Wünsche wirklich zu seiner Zufriedenheit erfüllen konnte –, begleitete die hohen Gäste von der Burg durch die Stadt bis zum südlichen Tor. Nur wenige Bürger waren zu sehen, und keine Jubelrufe hallten durch die Gassen. Wie anders war es doch gewesen, als König Richard vor seiner Krönung und fünf Jahre später nach seiner Freilassung aus deutscher Gefangenschaft hier geweilt hatte!
An einer Straßenecke kauerte ein Bettler, neben sich ein schmächtiges Kind an der Hand haltend, das verstört und zerbrochen wirkte. William Briwere warf ihm ein Almosen zu, doch der alte Mann ließ es in den Schmutz fallen und kümmerte sich nicht um die kleinen Münzen. Er streckte den Arm aus und zeigte mit seinem knochigen Finger direkt auf den König.
»Verflucht sollst du sein für deine Taten, Johann ohne Land!«, rief er mit erstaunlich kräftiger Stimme. »Doch sie werden nicht ewig ungesühnt bleiben! Eines Tages wird er zurückkehren, der Mann aus dem Wald. Und er wird dir alles nehmen, woran du hängst! Deinen Schatz, dein Leben und sogar deine Seele, damit du für alle Zeiten in der Hölle schmorst! An seiner Seite wird das Blut des Löwen reiten und die Herrschaft übernehmen, damit endlich wieder Gerechtigkeit und Freiheit in England Einzug halten!«
John drängte sein Pferd nach vorn und wollte in einer ersten Aufwallung des Zorns den Bettler und das Kind niederreiten. Schon lange hatte ihn niemand mehr bei dem verhassten Namen »ohne Land« genannt. War er nicht der Herrscher über ein Reich, das von den Pyrenäen bis nach Schottland reichte, auch wenn in den letzten Jahren große Teile davon in den Kriegen gegen Frankreich verloren gegangen waren? Erst im letzten Moment überlegte er es sich angesichts der vielen Anwesenden anders.
»Was faselst du da, alter Mann? Weißt du nicht, dass Könige von Gott eingesetzt sind und an seiner Seite im Himmel thronen? Wir können gar nicht in die Hölle kommen!«
Da richtete das Kind die Augen auf John, und er erkannte das Mädchen, mit dem er sich vor wenigen Tagen vergnügt hatte. Wahnsinn lag in ihrem Blick, als sie schrie:
»In deinem eigenen Blut sollst du verrecken, so wie du mich und meine Mutter darin hast liegen lassen. Und die Gnade Gottes wird dir verwehrt sein für alle Zeit!«
Kriegsknechte aus Johns Gefolge wollten die beiden ergreifen, doch der Sheriff drängte sich dazwischen. William Briwere war ein rechtschaffener Mann und konnte in seiner Stadt, in der es sowieso schon gärte, keine Revolte wegen zweier getöteter Bettler gebrauchen.
»Lasst sie, es sind doch nur arme Irre! Wer wird schon etwas auf ihre Worte geben? In einer Stunde sind sie vergessen.«
John wandte sein Pferd angewidert ab, gab ihm die Sporen und winkte seinem Gefolge, sich ihm anzuschließen. Er wollte kein weiteres Aufsehen, und da er die Stadt verließ, würde er es diesmal damit bewenden lassen. Obwohl es ihm bei den Worten des Alten und des Mädchens eiskalt den Rücken hinuntergelaufen war! Nichts fürchtete er mehr als die ewige Verdammnis.
Hubert de Burgh, der oberste Kämmerer des Königs, wandte sich leise fragend an William Briwere.
»Ich gebe ja nicht viel auf Prophezeiungen. Aber wen kann denn der Alte gemeint haben mit dem ›Mann aus dem Wald‹ und dem ›Blut des Löwen‹? Gibt es hier womöglich irgendeinen Heiligen, dem man solche Macht nachsagt?«
Der Sheriff zuckte mit den Achseln.
»Letzteres ist mir auch unerklärlich, und ein Heiliger ist mir bei uns nicht bekannt. Ich kann mir nur einen vorstellen, von dem der Bettler gesprochen haben könnte. Doch seit König Richards Tod ist er spurlos verschwunden.«
»Und wer bitte soll das sein? Ich habe noch nie von jemandem gehört, der in der Lage wäre, einem König den Schatz, das Leben oder gar die Seele zu nehmen.«
»Ich schon! Dem Earl von Huntingdon, Robert von Loxley, wäre es durchaus zuzutrauen. In dieser Gegend genießt er nach wie vor einen legendären Ruf. Einen meiner Vorgänger hat er an den Zinnen von Nottingham Castle aufgehängt. Mit John, damals war er noch Prinz und kämpfte gegen seinen Bruder Richard, ist er gleich mehrfach zusammengeraten. Er lebte früher mit seinen Männern im Wald von Sherwood, und die Menschen hier nannten ihn Robin Hood!«
1. Kapitel
Gascogne, Frühjahr 1204
Die schon recht hoch stehende Frühlingssonne wärmte den Rücken des einsamen Ritters, der auf einem Hügel sein Pferd gezügelt hatte und ausgiebig die vor ihm liegende Landschaft betrachtete. An Waffen trug er nur Schwert, Dolch und Schild bei sich. Den Helm hatte er abgenommen und an den Sattelknauf gehängt. Sein volles, schneeweißes Haar fiel in sanften Wellen bis auf die Schultern, und trotz des fortgeschrittenen Alters hielt er sich sehr aufrecht. Der Waffenrock, den er über seinem Kettenhemd trug, war aus feinstem Tuch gearbeitet und in seinen Wappenfarben Grün und Gelb gehalten. Auf Brust und Rücken prangte ein stehender roter Löwe, die Krallen kampfbereit ausgestreckt und das Maul angriffslustig geöffnet. Kein Knappe oder Gefolgsmann begleitete den Ritter, was in jener kriegerischen Zeit recht ungewöhnlich war. So brauchte er aber auch auf niemanden Rücksicht zu nehmen und konnte das vor ihm liegende Bild in aller Ruhe betrachten.
Weite Wiesen breiteten sich vor ihm aus, schon jetzt, Ende April, saftig grün. Die meisten von ihnen waren eingezäunt. Stuten mit ihren noch jungen, staksigen Fohlen, aber auch hochtragende, kurz vor der Abfohlung stehende Mütter und Jungpferde tummelten sich sorgfältig getrennt auf den weitläufigen Koppeln.
Dahinter, auf einem kleinen Hügel, stand eine von hohen Mauern geschützte Burg oder wohl eher ein den Charme südlicher Länder versprühendes Schloss. Das große, zweiflüglige Tor wurde von zwei Rundtürmen eingerahmt, die spitze Hauben trugen und an denen Efeu und wilder Wein emporrankten. Der Palas war von einem Arkadengang umgeben, und zahlreiche, von zierlichen Säulen gestützte Fenster ließen Luft und Sonne hinein. Auf dem höchsten Punkt der Burg bauschte sich das Banner des Hausherrn im Frühlingswind und zeigte an, dass er daheim war.
Der Ritter schmunzelte in sich hinein. Hier, inmitten der tiefsten Gascogne, ganz am Rand des immer weiter zusammenschmelzenden Angevinischen Reiches, entdeckte er ein kleines Stück England. Die Farben Grün und Gold, in der Mitte ein aufgesticktes braunes Jagdhorn, wehten auch über der Grafschaft Huntingdonshire in den Midlands. Unter dem ersten König, dem er gedient hatte, Henry II., und seiner Gattin Eleonore von Aquitanien war dieses Reich von den Pyrenäen bis hoch nach Schottland geschmiedet worden. Ihr gemeinsamer Sohn Richard, genannt Löwenherz, hatte durch seine lange Abwesenheit auf dem Kreuzzug und seine anschließende Gefangenschaft in Deutschland bereits Teile davon eingebüßt. Der jetzige Herrscher, sein Bruder John, würde zumindest die Festlandsbesitzungen wohl endgültig an Frankreich verlieren, sollte nicht ein Wunder geschehen.
Der Ritter gab seinem Pferd, das schon die ganze Zeit angesichts der vielen Artgenossen unruhig getänzelt hatte, die Sporen. Im leichten Galopp ritt er den Hügel hinab und hielt direkt auf die heruntergelassene Zugbrücke zu. Ein Hornstoß von den Zinnen der Burg zeigte, dass er nicht unentdeckt geblieben war, und kündigte sein Kommen an.
Ohne angehalten zu werden, passierte der Ritter das Tor und parierte erst vor der breiten Freitreppe, die zum Eingang des Palas emporführte, sein Pferd durch. Da wurde er auch schon von einer hellen Frauenstimme begrüßt, die ihre Überraschung geschickt verbarg und nur etwas im Unterton mitschwingen ließ. Es kam ihm vor, als wäre es erst gestern und nicht vor Jahren gewesen, seit er sie das letzte Mal gehört hatte.
»Willkommen, William Marshal! Ich freue mich, Euch bei bester Gesundheit zu sehen.«
Eine gertenschlanke Frau mit unbedecktem blondem Haar, am Hinterkopf nur durch ein schmales Band zusammengehalten, stand auf dem Podest vor dem Eingang zur Halle und trocknete sich gerade die Hände mit einem weichen Tuch ab. Wenn der Ritter nicht gewusst hätte, dass sie das vierzigste Lebensjahr fast erreicht hatte, zu erraten gewesen wäre es nicht. Als er die vielen Pferde vor dem Schloss gesehen hatte, wäre er jede Wette darauf eingegangen, wie sie ihn empfangen würde.
Marian war die Seele hinter der berühmten Pferdezucht von Fenwick, dem Gut in der Nähe von Nottingham, gewesen, und auch hier, am Fuße der Pyrenäen, schien sich daran nichts geändert zu haben. Statt eines Kleides oder züchtigen Rocks trug sie eine kurze Tunika und darunter eng anliegende Beinlinge, die in weichen Hirschlederstiefeln steckten. Genauso hatte sie König Richard, dessen Mutter Eleonore und ihn vor fünfzehn Jahren begrüßt! Jetzt ruhten seine zwei Begleiter von damals in geweihter Erde. Lady Marian hingegen schien den ewigen Jungbrunnen entdeckt zu haben.
Marshal stöhnte innerlich auf, als er daran dachte, was es wohl für einen Skandal in seiner Grafschaft Pembroke gäbe, würde seine eigene Frau so herumlaufen. Bei seiner Gastgeberin hingegen schien das allerdings völlig selbstverständlich zu sein.
Immer noch leichtfüßig schwang sich der Ankömmling aus dem Sattel und übergab sein Pferd einem herbeigeeilten Stallknecht. Dann schritt er, etwas steif vom langen Ritt, die Stufen empor, beugte vor der Dame des Hauses andeutungsweise das Knie, um ihr gleich darauf galant die Hand zu küssen.
»Lady Marian, Ihr habt Euch aber auch gar nicht verändert! Schön und strahlend wie eh und je! Offenbar geht das Alter an Euch völlig spurlos vorüber. Ich wäre glücklich, wenn ich das auch von mir sagen könnte!«
»Lasst das, Sir William! Ihr seid ein unverbesserlicher Charmeur! Immerhin ist es zehn Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben«, wies ihn die Hausherrin lächelnd zurecht und entzog dem Ritter leicht errötend ihre Hand. »Soeben habe ich damit noch ein Fohlen an das Euter seiner Mutter geführt. Der kleine, dumme Kerl scheint es allein nicht zu finden. Typisch Mann! Und diese Hand berührt Ihr mit Euren Lippen!«
William Marshal musste herzhaft lachen. Völlig unbefangen und sich über alle Konventionen hinwegsetzend, so kannte er Marian Leaford, ehemals Countess von Huntingdon und jetzige Baronin de Lisse. Sie war die Ehefrau von Sir Robert von Loxley, den man vor langer Zeit auch Robin Hood genannt hatte.
»Ich habe Eure Pferdezucht auf dem Weg hierher bereits bewundern können, Lady Marian. Kann es sein, dass sie noch besser gedeiht als damals in Fenwick?«
»Wir haben selbst zwanzig Stuten, aber die meisten Pferde, die Ihr gesehen habt, sind zur Bedeckung hier. Roncall erfreut sich reger Nachfrage als Deckhengst, auch wenn er langsam in die Jahre kommt. Ein Pferd, das seine Härte so nachdrücklich wie er auf dem Kreuzzug bewiesen hat, ist äußerst selten und als Vater heiß begehrt. Und ein Fohlen aus Snowwhite, der Stute Saladins, hat sich sogar König Alfons von Kastilien bestellt.«
Marian konnte den Stolz in ihrer Stimme nicht verhehlen. Die Pferde waren ihr Ein und Alles, und ihr Herz wäre beinahe zerbrochen, als Prinz John damals das Gut ihres Vaters hatte niederbrennen lassen, nachdem schon die wertvolle Zucht seiner Gier fast vollständig zum Opfer gefallen war. Doch dann war Robin aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, brachte ihren besten Hengst, den er durch alle Wirrnisse gerettet hatte, nach Hause, und noch zwei Pferde aus Sultan Saladins Marstall dazu. Roncall und ihre schneeweiße Araberstute waren auch der Grundstock ihrer Zucht gewesen, die sie hier tief im Süden des Herzogtums Aquitanien aufgebaut hatten, nachdem ihnen Königin Eleonore vor fünf Jahren die Heimkehr nach England untersagt hatte.
»Aber kommt doch herein, Sir William! Sicherlich seid Ihr von Eurem Ritt ermüdet und werdet eine Erfrischung bestimmt nicht ablehnen.«
Marian verging fast vor Neugier, was den Freund aus alten Tagen hierhergeführt hatte, war aber beherrscht genug, ihn nicht sofort danach zu fragen. Und William Marshal gedachte schon gar nicht, mit der Tür ins Haus zu fallen.
»Ganz im Gegenteil! Ich nehme Eure Gastfreundschaft gern an, denn ich habe eine wichtige Botschaft, oder besser gesagt eine Bitte, zu überbringen. Sir Robert ist auch anwesend, wie ich hoffe?«
»Wollt Ihr ihn sehen? Dann kommt mit, ich zeige ihn Euch!«
Mittlerweile waren sie in die Halle eingetreten, und Lady Marian eilte durch den großen Raum auf die gegenüberliegende Seite zu, die von zahlreichen Rundbogenfenstern durchbrochen wurde. Marshal trat neben sie und blickte in einen Garten, eher einen kleinen Park, der sich auf dieser Seite hinter dem Palas erstreckte.
Ein Mann in den besten Jahren, drahtig und ohne den geringsten Silberstreif im dichten blonden Haar, wie der Ritter leidvoll bemerkte, kämpfte mit einem Holzschwert gegen einen ebenfalls mit Schwert und zusätzlich einem Schild ausgerüsteten etwa achtjährigen Knaben, der hoch aufgeschossen war und auf dessen unbedecktem Haupt sich rotblonde Locken kräuselten. Mutig wie ein Löwe griff der Junge immer wieder kraftvoll an, doch sein routinierter Gegner ließ ihn das eine wie das andere Mal ins Leere laufen oder parierte die Schläge elegant.
»Du musst dich mehr bewegen, Fulke!«, forderte der ältere Kämpfer den Jungen auf. »Die Beinarbeit ist das Wichtigste! Blind drauf zuschlagen kann jeder. Schau immer, wo dein Feind sich eine Blöße gibt. Dann nutze seine Unaufmerksamkeit und stoß zu!«
Der Mann hatte den Schild des Jungen ausgehebelt und führte mit dem Schwert einen angedeuteten Stich von unten nach oben, der einem wirklichen Gegner die Eingeweide zerfetzt hätte.
»Ungefähr so muss Euer Mann den Anführer der französischen Ritter getötet haben, die König Richards Lösegeld stehlen wollten«, merkte Marshal trocken an. »Königin Eleonore hat oft davon gesprochen.«
Und dann, auf den Jungen deutend: »Ich nehme an, das ist er?«
»Ja, das ist unser Sohn Fulke«, erwiderte Marian, wobei ihre Stimme leicht zitterte.
Der alte Ritter sah die Frau an seiner Seite nachdenklich an. Niemand würde dieser Löwin ungestraft das Junge wegnehmen, dessen war er ganz sicher. Und vor allem war er froh, nicht den Auftrag dazu erhalten zu haben.
»Keine Sorge, Lady Marian. Ich bin nicht hier, um Euer Glück zu zerstören. Doch ich habe wichtige Nachrichten. Euer Mann sollte uns aber wohl Gesellschaft leisten, wenn ich Bericht erstatte.«
Marian fiel ein Stein vom Herzen, und ihre Stimme war wieder fest, als sie in den Garten hinunterrief:
»Robin, Fulke, wir haben hohen Besuch! Kommt herein, wir wollen doch den Earl von Pembroke nicht warten lassen!«
Robin sah überrascht auf, ließ das Holzschwert fallen und eilte mit wenigen Sätzen die Treppe hinauf, die von dieser Seite in die Halle führte. Dicht auf den Fersen folgte ihm der Junge, der nicht hinter seinem Vater zurückstehen wollte.
»Marshal, was für eine Freude!«, rief der Hausherr schon von Weitem aus, doch etwas Besorgnis schwang in seiner Stimme mit. »Komm her, Fulke! Begrüß den Earl von Pembroke, den treuesten Ritter Königin Eleonores und Statthalter des Königs in England.«
Artig verbeugte sich Fulke, der trotz seines jugendlichen Alters Robin fast bis an die Schulter reichte, während sein Vater den Ankömmling umarmte.
»Es ist mir eine große Ehre, Sir William. Meine Eltern haben mir viel von Euch erzählt, und ich bin sehr erfreut, Euch persönlich kennenzulernen.«
Der alte Ritter schmunzelte.
»Ich bin ebenso erfreut«, erwiderte er lächelnd und drückte Fulke fest die Hand. Wer ihn genau beobachtete, sah, wie sich eine Träne in seinen Augenwinkel stahl, die er rasch wegblinzelte. »Statthalter bin ich allerdings schon lange nicht mehr und vielleicht auch bald nicht mehr der Earl von Pembroke. König John verteilt seine Gunst auf die ihm eigene Art und Weise.«
Robin zog fragend eine Augenbraue in die Höhe, doch Marshal wollte offenbar vor dem Jungen nicht weitersprechen. Marian spürte das mit ihrem weiblichen Instinkt sofort und klärte rasch die Situation.
»Fulke, geh Gerald helfen! Er braucht jemanden, den er an der Longe auf den jungen Hengst setzen kann.«
»Oh, ja, gern! Ihr entschuldigt mich bitte, Sir William!«
Der Junge wartete die Antwort nicht ab und flitzte so schnell er konnte zu den Ställen. Marshal schaute ihm, in Gedanken versunken, nach. Vor vielen Jahren, er hatte gerade die Schwertleite bekommen und diente im Gefolge seines Onkels, des Earls von Salisbury, Königin Eleonore als persönliche Wache, hatte er schon einmal einen solch lebhaften Jungen mit flammend rotem Haar gesehen. Dieser hier hätte sein Zwilling sein können. Obwohl der andere damals nicht ganz so höflich und wohlerzogen auf ihn gewirkt hatte, musste er eingestehen.
Die Hausherrin war in die Küche geeilt und kam wenig später mit einem kleinen Imbiss, Wein und einer Karaffe Wasser zurück. Sie dachte gar nicht daran, sich schicklich zurückzuziehen, sondern setzte sich wie selbstverständlich zu den beiden Männern, die in bequemen Sesseln an der langen Tafel Platz genommen hatten.
»Nun erzählt schon, Marshal! Was ist der Grund Eures Besuches? Und wie vor allem habt Ihr uns überhaupt gefunden?«
Robin gab als Erster die vornehme Zurückhaltung auf, doch sein Gast ließ sich nicht drängen. Behutsam verdünnte er seinen Wein mit Wasser und nahm einen tiefen Zug von dem erfrischenden Getränk, bevor er antwortete.
»Ich wollte, ich hätte bessere Nachricht zu überbringen. Königin Eleonore ist tot. Sie verstarb in Frieden am 1. April im Kloster von Fontevrault. Jetzt liegt sie neben ihrem Mann und ihrem Sohn Richard, so wie sie es sich immer gewünscht hat. An ihrem Sterbebett erhielt ich noch einen letzten Auftrag von ihr. Sie beschrieb mir den Weg zu Euch und bat mich, Euch ihren letzten Wunsch auszurichten. Es sind ihre Worte, die da lauten: ›Hütet das Blut des Löwen‹!«
Schweigen herrschte längere Zeit im Raum, und es war Robin, der es als Erster brach.
»Gibt es einen Gott, so ist sie jetzt sicher bei ihm und erklärt ihm wahrscheinlich gerade, wie er den Himmel besser ordnen könnte. Und sie sieht ihre acht Kinder wieder, die vor ihr gegangen sind. Vielleicht versöhnt sie sich sogar wieder mit dem alten König Henry! Wenn nicht, wird es dort oben recht turbulent.«
»Robin!«, wies Marian ihren Mann zurecht. »Etwas mehr Pietät bitte! Schließlich war sie die Königin, und wir haben ihr viel zu verdanken.«
»Sie uns aber auch!«, konnte der Gescholtene sich nicht verkneifen zu erwidern.
»Für einen Mann, der auf dem Kreuzzug war, seid Ihr nicht gerade der frömmste Christ, Sir Robert«, merkte der alte Ritter schmunzelnd an. Es war bekannt, dass Robert von Loxley in Palästina ohne das Eingreifen König Richards fast auf dem Scheiterhaufen geendet hätte. Marshal selbst war im Glauben fest und nicht wie sein Gegenüber von ständigen Zweifeln geplagt.
»Wenn Eleonore uns hören könnte, würde sie sicherlich wollen, dass man genauso von ihr spricht«, stimmte der Gast in diesem Fall zu. »Sie war kein Kind von Traurigkeit und nahm das Leben, wie es kam. Nur untergeordnet hat sie sich nie. Keinem Ehemann, keinem König und noch nicht einmal dem Papst. Irgendwann, und darauf bin ich heute schon gespannt, werde ich sicherlich sehen, wie sie mit Gott umgeht.«
»Das hat aber hoffentlich noch Zeit, Marshal!«, mahnte Robin an. Es war ihm, als spürte er in diesem Moment den zarten Duft von Veilchen, der die alte Königin immer unaufdringlich umgeben hatte. Vor etwas mehr als zwei Jahren war er ihr das letzte Mal begegnet.
Eleonore hatte ihn gebeten, sie über die Pyrenäen nach Kastilien zu begleiten. Mitten im Winter, das konnte auch nur ihr einfallen! Ihn schauderte noch immer, wenn er an diesen Ritt durch Eis und Schnee, entlang an gefährlichen Abgründen und über himmelhohe Berge dachte. Doch Eleonore wollte ihre Enkeltochter Blanka von Kastilien mit dem französischen Thronfolger Louis vermählen, damit ihr Blut, wenn auch verdünnt, weiter über ihr geliebtes Aquitanien herrschen konnte. Und wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, war sie nicht mehr davon abzubringen.
So hatte Robin, wie damals in Deutschland, ihre Eskorte befehligt, in Spanien die Könige von Kastilien und Navarra kennengelernt und war an Eleonores Seite überall huldvoll aufgenommen worden. Langsam gewöhnte er sich daran, ständig mit hohen Herren zu verkehren.
Dass ihr Sohn John die angevinischen Stammlande würde halten können, das glaubte Eleonore damals schon lange nicht mehr. In kürzester Zeit hatte König Philipp von Frankreich die Territorien erneut besetzt, die Richard Löwenherz nach seiner Freilassung aus deutscher Geiselhaft mühsam von ihm zurückerobert hatte. König John konnte froh sein, wenn er in England würde weiter herrschen können. Auch dort rumorte es bereits bedrohlich. Was sollte nur werden, wenn jetzt nach Eleonores Tod die letzte Verbindung zwischen den durch die raue See geteilten Ländern verloren ging?
Als ob William Marshal Robins Gedanken lesen konnte, fuhr er eindringlich fort, auf das Ehepaar vor ihm einzusprechen.
»Ihr habt selbst erlebt, dass Eleonores Gedanken bis zum Schluss ihren Nachkommen galten. Zehn Kinder hat sie geboren, acht sind vor ihr ins Grab gelegt worden. Auch ihre Enkel rafft der Tod bereits dahin. Deshalb bittet sie Euch durch mich, nein, sie fleht Euch an, Fulke keiner Gefahr auszusetzen und auch jetzt, nach ihrem Tod, nicht nach England zurückzukehren. Sie hat mir erzählt, dass Ihr Euren Schwur damals in dieser Weise abgewandelt habt. Die Königin hatte es bereits geahnt, aber jetzt wissen wir ja alle, wie John mit jedem umgeht, der seinen Thron bedrohen könnte. Sieht er Fulke nur ein einziges Mal, so wie ich ihn vorhin, weiß er sofort, wer sein leiblicher Vater war. Und dann wird er alles in seiner Macht Stehende tun, um ihn sofort zu beseitigen!«
Vor Marians Augen stieg die Szene in der Klosterkirche von Fontevrault am Grab König Richards auf, als wäre es erst gestern gewesen. Eleonore hatte gedroht, Robin töten zu lassen und sie im Kloster einzusperren. Sie beide hatten, um dem zu entgehen, schwören müssen, bis zu ihrem Tod nicht nach England zurückzukehren. Doch ihr Mann hatte den Schwur in »bis zu Eurem« – also Eleonores Tod – abgewandelt. Die Königinmutter wollte damit ihren Sohn John schützen, dessen Stellung als König keinesfalls gefestigt war. Eine Auseinandersetzung mit dem Earl von Huntingdon – oder auch mit Robin Hood – hätte ohne Weiteres sein Ende oder zumindest Bürgerkrieg bedeuten können.
Sie und Robin hatten wirklich allen Grund der Welt, diesen Teufel in Menschengestalt, der heute König von England war, zu hassen, war er doch letztendlich der Schuldige am Tod ihres eigenen Kindes. Aber Eleonore hatte ihnen den Sohn Richards, dessen Mutter, eine ihrer Hofdamen, bei seiner Geburt gestorben war, an Kindes statt übergeben. Nur wenige wussten, dass Fulke nicht ihr leiblicher Sohn war, und er selbst schon gar nicht. Wenn es nach Marian ginge, würde das auch für immer so bleiben.
Und nun war es so weit. Sie konnten, ohne ihren Eid zu brechen, in die Heimat zurückkehren. Doch würden sie es auch wollen? Wieder gegen John kämpfen und vielleicht noch einen Sohn verlieren? Nach allem, was sie durchgemacht und sich jetzt hier aufgebaut hatten? Dass Marian darüber in Ruhe mit ihrem Mann würde reden müssen, stand fest. Und dass sie ihre Meinung mit Nachdruck vertreten konnte, wusste dieser genau!
»Was ist denn nun eigentlich tatsächlich mit Arthur von der Bretagne geschehen?«, erkundigte sich Robin gerade bei seinem Gast. »Wir haben hier nur Gerüchte über seinen Tod gehört, die wir aber nicht glauben können. Ich war damals auf Sizilien dabei, als Richard ihn, seinen Neffen, zu seinem Thronerben bestimmt hat. Bis heute kann ich nicht verstehen, wieso John nach allem, was er seinem Bruder angetan hat, trotzdem zum König gekrönt worden ist.«
Marshal seufzte schwer und nahm einen tiefen Zug aus seinem Becher.
»Nach Richards Tod waren die meisten, auch Eleonore, überzeugt davon, dass John die bessere Wahl sei und Arthur, der ja zusammen mit Prinz Louis am französischen Hof aufgewachsen ist, nur ein Vasall König Philipps wäre. Heute sehen das viele allerdings bereits anders. Meine Familie hat, wie andere auch, durch die ständigen Niederlagen Johns ihre ganzen Besitzungen in der Normandie verloren. Und in England drangsaliert er die Menschen, dass es kaum noch zu ertragen ist.«
Bevor Marshal das Thema vertiefen konnte und ihr Mann womöglich auf den Gedanken kam, jetzt in der alten Heimat dringend gebraucht zu werden, griff Marian das Gespräch an der Stelle wieder auf, die ihr Gast geschickt umschifft hatte.
»Ihr habt uns immer noch nicht erzählt, wie Arthur gestorben ist«, bohrte sie nach. »Man hört darüber so unglaubliche Dinge! Sie können doch nicht wirklich wahr sein?«
»Ich bitte Euch, Lady Marian, erspart mir die Einzelheiten! Ich selbst war ja auch nicht in Rouen dabei, als er starb.«
»Nein, das wollen wir jetzt schon genau wissen!«, schaltete sich Robin ein. So einfach würde er seinen Gast, der mit Sicherheit Bescheid wusste, nicht davonkommen lassen.
»Also gut, ich werde Euch berichten, was ich weiß. Aber vor allem, damit Ihr begreift, wie wichtig es ist, Fulke zu schützen!«
William Marshal nahm noch einen Schluck Wein, um sich zu sammeln, bevor er fortfuhr.
»Arthur wurde im Sommer anno 1202 von John gefangen genommen, als er Eleonore in Mirebeau belagerte. Manche sagen, er wollte nur seine Großmutter besuchen, aber dafür war sein Gefolge doch sehr kriegerisch ausgelegt. Jedenfalls gelang John endlich einmal etwas, und wenn es auch nur die Festnahme seines fünfzehnjährigen Neffen war. Er übergab ihn der Obhut von Hubert de Burgh, der ihn auf Falaise in ehrenvoller, leichter Haft hielt. Doch das gefiel John nicht, und so ließ er den Jungen in die Festung nach Rouen bringen. Wollt Ihr Euch das wirklich antun und hören, was dort mit ihm geschah, Lady Marian?«
»Fahrt fort, Marshal! Ich falle schon nicht in Ohnmacht und bin gespannt zu erfahren, was dieses Scheusal mit seinem Neffen angestellt hat«, kam die zu erwartende Antwort. Notgedrungen nahm der alte Earl den Bericht wieder auf, auch wenn er niemals von einem gesalbten König so gesprochen hätte, möge er auch getan haben, was immer.
»Arthur wurde in ein tiefes Verlies geworfen. Als König Philipp und der bretonische und normannische Adel davon erfuhren, forderten sie seine sofortige Freilassung. Das kam für John natürlich nicht infrage, gefährdete es doch seinen Thron. Arthur soll seinen Onkel bei dessen Besuchen sogar noch in Ketten verhöhnt und sich als wahren Herrscher des Angevinischen Reiches bezeichnet haben. Am Gründonnerstag vor einem Jahr muss es besonders heftig zugegangen sein. John befahl nach einer Auseinandersetzung mit seinem Neffen den Wachen, Arthur zu blenden und zu kastrieren, damit er niemals zum König gekrönt werden könne. Doch sogar die angeheuerten Söldner verweigerten den Befehl, und so tat es John, angeblich im Rausch, selbst. Arthur soll all seine Kräfte zusammengenommen und seinen Onkel, gefesselt wie er war, angespien haben. Da verlor John endgültig die Beherrschung und erschlug seinen Neffen mit einem Stein. Anschließend band er Gewichte an dessen Körper und warf ihn in die Seine. Aber wie immer, bei ihm ging auch hier etwas schief. Die Stricke lösten sich. Fischer fanden den erschlagenen und verstümmelten Jungen und brachten ihn in die Abtei Le Bec, wo er jetzt neben seiner Urgroßmutter ruht.«
»Friede seiner armen Seele«, flüsterte Marian entsetzt und wirkte sichtbar angegriffen von der sachlichen, nichts beschönigenden Schilderung. »Ich werde nie verstehen, wie ein Mensch so etwas tun, ja überhaupt so werden kann! Habt Ihr eine Erklärung dafür, Marshal? Oder ist John einfach nur die Verkörperung des Bösen?«
Der alte Ritter zuckte mit den Achseln.
»Ich weiß es nicht, Mylady. Als John geboren wurde, lebten sein Vater und seine Mutter im Streit. König Henry hat Eleonore, wie Ihr wisst, sechzehn Jahre lang, bis zu seinem Tod, in Old Sarum Castle eingesperrt. Ich selbst habe ihr damals die Nachricht von ihrer Freilassung überbracht. John hat seine Mutter in dieser Zeit kaum gesehen. Richard war immer ihr Lieblingssohn. Auf John hatte sie so gut wie keinen Einfluss. Um seine Erziehung haben sich Gouvernanten und Priester gekümmert. Sein eigener Vater hat nie viel von ihm gehalten. Die Brüder bekamen große Ländereien – ihn nannte man Johann ohne Land. Ständig bekam er die Intrigen am Hofe ungefiltert mit, und irgendwann begann er sich daran zu beteiligen. Seine Brüder kämpften beständig gegeneinander und oft genug auch gemeinsam gegen den Vater. Der hat das nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert, weil er sehen wollte, wer der Stärkste von ihnen und damit ein würdiger Nachfolger wäre. Wie in einem Wolfsrudel! Vielleicht ist John deshalb so geworden. Wer kann das schon sagen?«
Robin hatte am Ende von William Marshals Ausführungen die Luft angehalten. Jetzt fuhr er seinen Gast regelrecht an:
»Und das soll eine Entschuldigung für all das sein, was er den Menschen antut? Wie könnt Ihr einem solchen Ungeheuer nur die Treue halten? Wieso findet sich denn keiner, der diesem Unhold endlich ein wohlverdientes Ende bereitet?«
»Ich diente schon dem Haus Plantagenet, da wart Ihr noch gar nicht auf der Welt, Sir Robert!«, stieß Marshal wütend hervor. »Glaubt Ihr, ich werde zum Mörder an einem König? Würdet Ihr denn einen von Gott eingesetzten und mit heiligem Öl gesalbten Herrscher umbringen?«
»Ohne zu zögern! Und ich bereue zutiefst, es in Nottingham oder später an der Great Ouse nicht getan zu haben!« Robin war so empört, wie selbst Marian ihn kaum kannte.
»Damals war er noch ein Prinz! Auch ich hätte ihm Einhalt geboten, wäre er seiner Mutter zu nahe gekommen«, konterte der alte Ritter, der schließlich dabei gewesen war. »Doch heute ist John König von England und damit für jeden Sterblichen unangreifbar!«
»Das werden wir ja sehen, kommt er noch einmal vor meine Klinge oder gar meinen Bogen!« Nur mühsam konnte sich Robin zurückhalten, und Marian erfasste schnell, dass es höchste Zeit war, einzugreifen, damit der Streit zwischen den beiden Männern nicht eskalierte.
»Seid versichert, Sir William, niemand wird unserem Sohn etwas antun!« Das Timbre, das in ihrer Stimme mitschwang, erinnerte den Gast an das dumpfe, warnende Grollen von Löwinnen, die er im Orient gesehen hatte, wenn ein anderes Raubtier ihren Jungen zu nahe kam. Und er hatte natürlich registriert, dass die Betonung bei Lady Marian auf »unserem Sohn« lag. Doch was sollte es, der Junge hätte es viel schlechter treffen können. Als Bastard, der er war, hatte er keinen Thronanspruch. Ein Leben als Landedelmann konnte durchaus seine Reize haben und war vor allem nicht mit so vielen Fangschlingen versehen wie ein Aufenthalt bei Hofe.
»Ich hoffe nur«, fuhr die Gastgeberin mit mühsamer Zurückhaltung fort, »Ihr habt mit Eurem Besuch bei uns niemanden auf seine Fährte gelockt!«
»Seid versichert, Mylady, dass ich größte Vorsicht habe walten lassen«, entrüstete sich der Ritter. »Mein Gefolge ist beim Bischof von Agen zurückgeblieben, und dass meine Lippen versiegelt sind, werdet Ihr wohl nicht anzweifeln!«
»Schon gut, Marshal«, fühlte sich Robin veranlasst, beschwichtigend einzugreifen. »Niemand hier stellt Eure guten Absichten infrage. Trotzdem werden wir die Wachen verdoppeln und in nächster Zeit verstärkte Aufmerksamkeit walten lassen. Fulke wird nicht das gleiche Schicksal erleiden wie sein Cousin! Und sollte John doch von seiner Existenz wissen und etwas gegen ihn unternehmen, dann ist es das Letzte, was er in diesem Leben getan hat!«
Dass diese Worte keine leere Drohung waren, daran zweifelte Marshal nicht einen Moment. Keinen einzigen Silberpenny würde er auf das Leben von König John setzen, sollte Fulke etwas zustoßen. Dafür kannte er den Mann an seiner Seite zu gut. Es war nur dem Eingreifen Eleonores an der Great Ouse zu verdanken gewesen, dass John noch lebte. Ralf de Lacy, den Sheriff von Nottingham, hatte keine Macht der Welt retten können. Der Platz hier, weit abgeschieden vom höfischen Leben, unter dem Schutz dieser beiden Menschen, war für den Sohn des verstorbenen Königs Richard der sicherste, den es geben konnte. Eleonore hatte das gewusst, und auch ihm fiel keine bessere Lösung ein. Nun, dann sollte es eben so sein! War nur zu hoffen, dass das Paar mit dem Jungen, der zu ihrem eigenen Sohn geworden war, auch hier blieb und sie nicht die Sehnsucht nach der alten Heimat überkam. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Denn wer konnte schon sagen oder wusste, was die Zukunft bringen würde?
»Wie kommt Ihr denn so zurecht, und wie hat man Euch als Fremde in der Gascogne aufgenommen? Die Menschen hier sollen ja nicht ganz unkompliziert sein«, erkundigte sich der Ritter interessiert, auch um vom eigentlichen Thema abzulenken.
»Am Anfang war man uns gegenüber recht misstrauisch und zurückhaltend«, erzählte die Gastgeberin und lehnte sich entspannt in ihrem Sessel zurück. Sie war froh, das Gespräch in andere Bahnen lenken zu können. »Eleonore kam uns bald, nachdem wir uns eingerichtet hatten, besuchen. Sie wollte sehen, wie es ihrem Enkel ging. Sofort vermuteten die Herren der umliegenden Besitzungen danach in uns ihre Spione. Keiner scheint hier auch nur die geringsten Abgaben an die Krone zu leisten. Der Hof ist halt sehr weit weg. Als dann aber keine Steuereintreiber auftauchten und alles so blieb, wie es vorher gewesen war, schwand langsam das Misstrauen und machte der Neugier Platz. Der erste Winter war sehr hart. Die Wölfe kamen aus den Bergen bis hinunter in die Dörfer und rissen Ziegen und Schafe. Robin war tage- und nächtelang auf der Jagd und erlegte viele von ihnen. Das schuf Anerkennung unter den Bauern und Grundherren. Mit einigen Nachbarn, vor allem den d’Artagnans, sind wir seit dieser Zeit befreundet. Und er«, dabei deutete Marian auf ihren Mann und schmunzelte, »frönt sogar zusammen mit dem Grafen von Armagnac der Hexerei. Die beiden haben sich eine richtige Alchimistenküche eingerichtet!«
»Das meint Ihr jetzt nicht im Ernst, Lady Marian?«, erkundigte sich der besorgte Marshal. Das fehlte gerade noch, dass Richards Sohn bei Hexern aufwuchs. Zuzutrauen wäre es Robert von Loxley durchaus. Der hatte sogar im Heiligen Land an Gottes Existenz gezweifelt, obwohl sie sich dort doch wohl jedem offenbarte.
»Das hat mit Hexerei überhaupt nichts zu tun«, knurrte Robin. »Ständig muss ich mir das anhören!« Er stand auf und kam gleich darauf mit einem Krug und zwei Bechern zurück.
»Wir versuchen, aus dem nicht gerade vollmundigen Wein, der hier wächst, etwas Vernünftiges zu machen. Aus Spanien haben wir uns von den Mauren Apparaturen besorgt, die sie Destillationsgerätschaften nennen. Wenn man den Wein in einer Kupferblase erhitzt und anschließend in langen Leitungen abkühlt, erhält man ›aqua ardens‹, brennendes Wasser. Das lagern wir in Eichenholzfässern, und nach einiger Zeit kommt das dann dabei heraus. Hier, probiert einmal!« Robin hielt seinem Gast einen Becher hin, der zwei Finger breit mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt war. »Doch seid vorsichtig«, mahnte er. »Das Wasser brennt wirklich!«
Marshal schnupperte vorsichtig an seinem Becher. Er meinte, den Duft von getrockneten Pflaumen wahrzunehmen, und kostete einen kleinen Schluck. Sofort bekam er einen Hustenanfall und glaubte im ersten Moment, man wollte ihn vergiften. Die Flüssigkeit, die er genossen hatte, trieb ihm die Tränen in die Augen und brannte höllisch in Rachen und Nase, in die sie durch sein Husten gelangt war.
»Wollt Ihr mich umbringen?«, brachte er unter Krächzen heraus und wischte sich die Augen. »Was ist denn das für ein Teufelszeug!«
Robin tränten auch die Augen, aber vor Lachen.
»Ich habe Euch doch gewarnt! Ihr hättet einmal unsere ersten Versuche probieren sollen. Dieses Destillat ist bereits ganz gut gelungen und im Fass gereift. Zugegeben, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss! Wir arbeiten ja schließlich daran, es weicher auf der Zunge zu machen. Außerdem kann man davon nur ganz wenig trinken, man bekommt sonst zu schnell einen Rausch. Aber wartet nur, wenn wir erst den Dreh richtig raushaben, verkauft sich das Gebräu sicher besser als der Wein aus der Gascogne. Wir beziehen den unseren ja nicht umsonst aus Saint-Émilion und nicht von hier. Marian übrigens verwendet das ›aqua ardens‹ als Medizin und legt Kräuter darin ein, wie Josef von Salamanca es ihr in London gezeigt hat.«
Marshal war strenggläubiger Christ und der Meinung, dass gegen Krankheiten am besten Gebete halfen. Im äußersten Notfall vielleicht ein Aderlass. Von diesen neumodischen Medizinen hielt er nicht viel, und nie wieder in seinem Leben würde er etwas von diesem »brennenden Wasser« anrühren, dessen war er sich gewiss.
So verging der Abend mit Gesprächen über alte und neue Zeiten, bis William Marshal bat, sich zurückziehen zu dürfen. Er wollte morgen bei Tagesanbruch bereits wieder über Agen nach Bordeaux reiten, um von dort nach Pembroke, seine Grafschaft an der Grenze zu Wales, zu segeln. Bei John war er mehr und mehr in Ungnade gefallen. Jetzt, nach dem Tod Eleonores, würde wohl kaum noch etwas den König daran hindern, seine Hand nach den reichen Besitztümern seiner Familie, zu denen aus dem Erbe seiner Frau auch weite Teile Irlands gehörten, auszustrecken. Da war es schon besser, er war zu Hause und bot dem königlichen Räuber selbst die Stirn, als es seiner geliebten Isabel zu überlassen, die sich allerdings, ähnlich wie Lady Marian, durchaus zu helfen wusste.
Am nächsten Morgen brach Marshal wie geplant beim ersten Tageslicht auf, natürlich nicht ohne sich auf das Herzlichste von seinen Gastgebern zu verabschieden. Er hatte zwar von ihnen keine Zusicherung erhalten, dass sie nicht nach England zurückkehren würden, hoffte aber, dass die Sorge um Fulke sie davon auch in Zukunft abhielt. Sollte die Gefahr für Richards Sohn einmal geringer geworden sein, würde er sie selbst einladen, die alte Heimat zu besuchen. Das hatte er sich fest vorgenommen, und die Zeit würde weisen, ob es irgendwann möglich war. Der alte Ritter beugte sich zu dem Knaben hinab, und wie Robin vor fünf Jahren sah auch er in die graublauen Augen Richards.
»Ich kannte einmal einen Mann«, sagte er zum Abschied zu Fulke und merkte dabei, wie ihm die Augen feucht wurden, »der mutig war wie ein Löwe. Auf dessen Wort man vertrauen konnte wie auf einen Felsen und dem selbst seine Feinde Ehrerbietung entgegenbrachten. Ich würde mich freuen, wenn aus dir ein ebensolcher Mann werden würde, von dem alle mit Respekt und Achtung sprechen, wenn sein Name genannt wird.«
Fulke, der nur zum Teil verstand, was dieser alte Mann da vor ihm meinte, aber zu gut erzogen war, um ihm nicht seinen Respekt zu erweisen, hob das Haupt, sah dem Gast fest in die Augen und erwiderte mit heller, klarer Stimme:
»Sir, ich hoffe einmal ein ebenso tapferer Ritter zu werden wie mein Vater und verspreche Euch, ihm in allem nachzueifern!« Er meinte natürlich Robin an seiner Seite und ahnte nicht, dass er unbewusst von einem noch viel größeren und berühmteren Mann sprach. Der hatte allerdings nicht nur gute Eigenschaften gehabt, wie den Erwachsenen um ihn herum, die Richard Löwenherz gekannt hatten, durchaus bewusst war.
William Marshal schwang sich in den Sattel seines Streitrosses und versuchte, es vor Lady Marian so elegant wie in früheren Tagen aussehen zu lassen. Eine gewisse Eitelkeit war ihm durchaus eigen, und unter keinen Umständen wollte er seinen Gastgebern als schwächlicher Greis in Erinnerung bleiben. Die drei winkten ihm noch lange nach, und Robin und Marian kam es vor, als entschwände erneut ein Stück ihres alten Lebens.
In der folgenden Nacht und in der Abgeschiedenheit ihres Bettes sprachen sie lange über ihre weitere gemeinsame Zukunft. Marian war es erst nach heftigen Diskussionen, dem Einsatz der Waffen einer Frau und auch Tränen gelungen, ihrem Mann das Versprechen abzuringen, zumindest so lange nicht nach England zurückzukehren, bis Fulke auf eigenen Beinen stehen und selbst für sich sorgen konnte.
Es war Robin nicht leichtgefallen, ihr dieses Zugeständnis zu machen. Insgeheim hatte er sich schon ausgemalt, die alten Freunde zu besuchen und den Duft des Sherwood im Sommer einatmen zu können.
Doch wie fast immer war er zu der Einsicht gelangt, dass Marian recht hatte und das Unternehmen viel zu gewagt gewesen wäre. Fiele er den Schergen Johns in die Hände, wäre das nicht nur sein Tod, sondern mit Sicherheit auch der seiner Frau und Fulkes. Und das war die Sache bei aller Sehnsucht nun letztendlich wirklich nicht wert, musste er sich zu seinem Leidwesen eingestehen!
Robin wollte den Aufwuchs auf den Wiesen kontrollieren und schwang sich auf Roncall, der mit seinen zwanzig Jahren noch täglich seinen Auslauf brauchte. Bekam der Hengst keine ausreichende Bewegung, wurde er unleidlich wie ein alter Mann. Robin hatte sich einen Sohn von ihm aus Marians Stute Snowwhite gesichert und bildete ihn jetzt zu seinem Nachwuchspferd aus. Ewig würde sein vierbeiniger Freund, der ihn durch unzählige Gefahren getragen hatte, auch nicht leben, und zumindest sein Blut sollte seinem Herrn erhalten bleiben. Auf dem Ritt mit Eleonore über die Pyrenäen waren sie durch das Roncall-Tal gekommen, das die Basken Ronkari nannten. So hatte er gleich einen Namen für das Fohlen gefunden, das einmal in die großen Hufstapfen seines Vaters treten sollte.
Im lockeren Galopp ging es den Hügel hinunter, und sein Auge erfreute sich an dem satten Grün der Wiesen. Im Hochsommer, wenn die Sonne oft unbarmherzig herunterbrannte, sah es hier im Süden meist ganz anders aus. Dafür kam das Heu, anders als im regnerischen England, fast immer trocken herein.
Auf den Feldern arbeitete das Gesinde, das sich schnell an die neue Herrschaft gewöhnt hatte. Marian vor allem war es durch ihre Heilkunst bei Menschen und Tieren gelungen, das Vertrauen und die Achtung der Gascogner zu gewinnen. Dass der neue Baron ein umgänglicher Zeitgenosse war, meist einen Scherz oder ein freundliches Wort auf den Lippen, hatte sich bald herumgesprochen. So grüßten ihn die Knechte und Mägde mit freundlichem Winken, das Robin gern erwiderte.
Bei einer Gruppe, die frisches Gras für die aufgestallten, hochtragenden Stuten schnitt und auf einen zweirädrigen Karren lud, zügelte er Roncall und begrüßte den Vorarbeiter mit Handschlag.
»Wie sieht es aus, Philippe? Seid Ihr mit dem Aufwuchs in diesem Jahr zufrieden?«, erkundigte er sich interessiert und ließ den Blick über die Wiesen schweifen.
»Ja, Herr, das Gras könnte gar nicht besser stehen. Wir werden wohl bald mit dem Heuen beginnen können. Hoffen wir, dass uns kein Gewitter oder Hagel die Ernte verdirbt!«
Philippe war ein alter Bauer, der immer Sorgenfalten auf der Stirn trug und das Schlimmste befürchtete. Robin musste schmunzeln. Diesen Menschenschlag kannte er zur Genüge.
»Macht Euch nicht so viele Sorgen! Wie ich Euch kenne, werdet Ihr wie jedes Jahr den richtigen Zeitpunkt auf den Tag genau abpassen. Da vertraue ich voll und ganz Eurer Erfahrung.«
Der Vorarbeiter strahlte ob des Lobes über das ganze Gesicht. Es war keineswegs selbstverständlich, dass die Herrschaften so freundliche Worte für ihr Gesinde fanden.
Zudem gab es hier auch noch reichlich zu essen, keiner musste in Lumpen herumlaufen, und selbst die Alten, die nicht mehr arbeiten konnten, und die Kranken wurden versorgt. Bei Gott, es hätte viel schlimmer kommen können! Nur dass die alte Königin gestorben war – so etwas sprach sich auch unter den einfachen Leuten blitzschnell herum – und nicht mehr ihre schützenden Hände über ihr geliebtes Aquitanien halten konnte, das lag wie eine schwere Last auf seiner Seele.
»Haben Euch die Männer angetroffen, Herr?«, erkundigte sich Philippe. »Ich habe ihnen den Weg zum Château beschrieben.«
Robin war abgelenkt, weil er seine Blicke verträumt über das weite Land hatte streifen lassen. In Loxley, der von seinem Großvater und Vater gegründeten Freisass am Rande des Sherwoods, sah es ganz ähnlich aus. Wie würde es den Menschen, die jetzt dort lebten, wohl unter König John ergehen?
»Wer hat denn nach uns gefragt?«, wollte er eher desinteressiert wissen. So wichtig konnte das nicht gewesen sein. Er hatte niemanden unterwegs gesehen oder getroffen.
»Die zehn Reiter, die vor einer guten Stunde hier vorbeigekommen sind. Sie haben sich nach Euch und vor allem nach Eurem Sohn erkundigt und sind dann weiter Richtung Fluss geritten. Sehr vertrauenerweckend sahen sie nicht gerade aus.«
Wie der Blitz war Robin ohne ein weiteres Wort im Sattel, gab Roncall die Sporen, was dieser mit einem unwilligen Grunzen quittierte, und jagte im gestreckten Galopp auf dem kürzesten Weg zurück zum Schloss. Schon im Burghof brüllte er, dass die Mauern erzitterten:
»Marian! Wo ist Fulke?«
»Himmelherrgott, schrei doch nicht immer so!« Marian kam aus dem Stall geeilt. »Was ist denn los? Er ist mit Jean d’Artagnan zum Fischen gegangen.«
Robin hielt sich nicht mit Erklärungen auf. Er wendete Roncall so hart, dass dieser überrascht eine halbe Pirouette springen musste, und galoppierte schon wieder zum Tor hinaus, eine völlig verstörte und geängstigte Frau zurücklassend. Jean war Fulkes gleichaltriger Freund, und wenn die beiden am Fluss waren, konnten sie auf die fremden Männer gestoßen sein. Robin hatte einen furchtbaren Verdacht, um wen es sich hierbei handeln könnte.
Hatte William Marshal, ohne es zu bemerken, doch Verfolger im Schlepptau gehabt? Sie im Auftrag Johns hierherzuführen, das traute er dem alten Ritter nun wahrlich nicht zu. Oder waren es vielleicht nur friedliche Reisende, die nach Navarra oder Kastilien wollten und ein Nachtquartier suchten? All diese Gedanken schossen ihm durch den Kopf, doch die letzte Frage beantwortete sich gleich darauf von selbst.
Die Männer waren abgesessen. Ihre Pferde standen am Flussufer und schienen zu saufen. Jean lag offenbar bewusstlos oder gar tot zur Seite geschleudert am Boden. Einer der Kerle hatte Fulke von hinten gepackt und hielt ihn fest. Ein anderer stand vor ihm, den gezückten Dolch in der Hand, während die restlichen Männer einen Halbkreis um die Gruppe bildeten. Da ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Jungen gerichtet war und der weiche Waldboden den Hufschlag dämpfte, schoss Robin mit Roncall direkt unter sie, ohne vorher von ihnen bemerkt worden zu sein. Mit einem Hieb seines Schwertes trennte er dem Mann mit dem Dolch fast vollständig den Kopf vom Rumpf. Der zweite Schlag spaltete dem Kerl, der Fulke festhielt, den Schädel. Schon war Robin aus dem Sattel und stand als lebender Schild, das Schwert in der rechten, den Dolch in der linken Hand vor seinem Sohn.
Seine Gegner sahen aus wie Strauchdiebe. Einer von ihnen, offenbar der Anführer, trug ein abgewetztes Kettenhemd und Brünne, darüber einen verschlissenen Waffenrock, die anderen nur Gambeson oder Lederkoller.
Robin ließ die Männer nicht zur Besinnung kommen. Sie waren ihm immer noch achtfach überlegen, und er musste den Überraschungseffekt ausnutzen, um eine Chance gegen die Übermacht zu haben. Doch nicht umsonst war er durch die harte Schule der Assassinen in Masyaf gegangen und hatte gelernt, dass Schnelligkeit alles ist und Verharren auf der Stelle den Tod bedeutet. Sofort griff er erneut an, und die Damaszenerklinge seines Schwertes, das er aus dem Heiligen Land mitgebracht hatte, schnitt durch die leichten Rüstungen wie die Sense im Spätsommer durch trockenes Stroh.
Die Männer waren im ersten Moment erschrocken auseinandergestoben, sahen jetzt aber, dass sie es nur mit einem einzelnen Mann zu tun hatten. Wut über den Tod ihrer Kameraden kam zu ungezügelter Mordlust, und mit dem wütenden Knurren eines Wolfsrudels warfen sie sich ihrem Feind entgegen.
Robin stieß Fulke mit der Schulter die Uferböschung hinunter, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen, was diesen zu einem wüsten Fluch veranlasste, der seinen Vater verblüfft aufhorchen ließ. Das hätte ihn fast das Leben gekostet, denn Ablenkung konnte er sich bei den kampferprobten Angreifern wirklich nicht leisten. Er unterlief einen der Vordersten, dessen Angriff damit ins Leere ging, und stieß ihm den Dolch durch die ungeschützte Achselhöhle tief in die Brust. Gleichzeitig wehrte er mit dem Schwert einen weiteren Hieb ab, der so kräftig geführt war, dass es ihm um ein Haar die Waffe aus der Hand gerissen hätte. Dadurch kam Robin ins Straucheln und sank auf das rechte Knie. Instinktiv riss er die Klinge nach oben und blockte damit einen Schwertstreich ab, der ihm sonst die Schulter zerschmettert hätte. Der Angreifer, ein wahrer Hüne, holte zum nächsten Hieb aus, als er plötzlich aufschrie, sein Schwert fallen ließ und sich an sein Gemächt griff.
Jean d’Artagnan, der nur kurz das Bewusstsein verloren hatte, war durch die Beine des Mannes wie eine Schlange hindurchgeglitten und hatte ihm sein langes, schlankes Fischmesser in die Genitalien gestoßen.
Robin brachte das eine kleine Verschnaufpause. Aus dem Augenwinkel sah er hinter sich eine Klinge aufblitzen, der er nur durch eine rasche Drehung entging. Dabei stürzte er allerdings über den Banditen, dem er zuvor den Schädel gespaltet hatte, und lag nun auf dem Boden, drei Angreifer über sich.