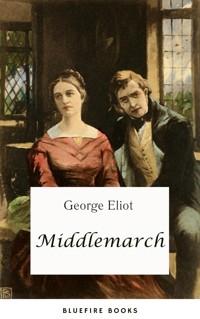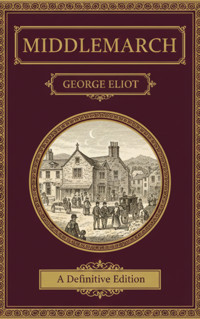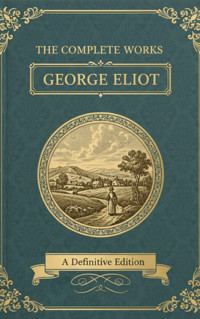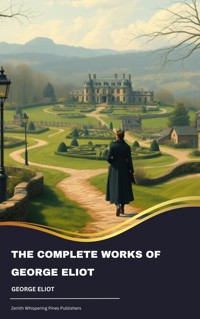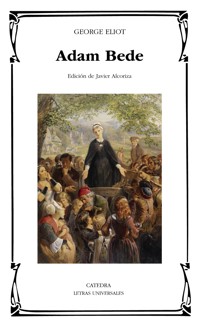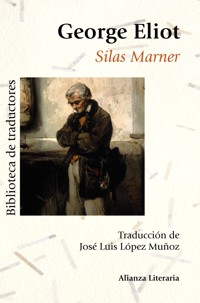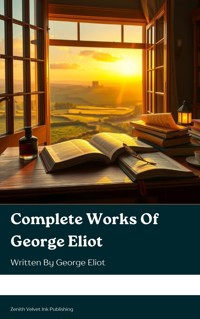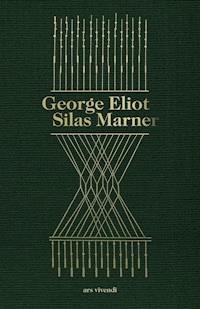
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Leinenweber Silas Marner verliert durch eine Intrige seines besten Freundes nicht nur seine Verlobte, sondern auch seinen Platz in der Gemeinde. Er sieht sich gezwungen, seine nordenglische Heimat zu verlassen, und zieht in das kleine Bauerndorf Raveloe. Dort erwartet ihn, der auch hier zum Außenseiter wird, ein bescheidenes, von Arbeit geprägtes Dasein. Als ihm sein gesammelter Goldschatz und damit sein letzter Lebensinhalt genommen wird, scheint er endgültig ein gebrochener Mann. Doch auf wundersame Weise kommt ein Findelkind in sein Haus – und öffnet ihm die Augen für die Schönheit der Welt. Als sich der Vater des Mädchens zu erkennen gibt, droht dieses Glück aber erneut in Gefahr zu geraten … Mit erzählerischer Raffinesse und psychologischem Feingefühl verknüpft George Eliot die schicksalsträchtige Existenz ihrer Hauptfigur zu einer bewegenden Geschichte um die Licht- und Schattenseiten des Menschseins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Eliot
Silas Marner
Der Weber von Raveloe
Roman
Aus dem Englischen
von Elke Link und Sabine Roth
ars vivendi
Die Originalausgabe erschien 1861 unter dem Titel
Silas Marner: The Weaver of Raveloe.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen überarbeiteten Neuausgabe 2018
© 2018, 1993 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten.
www.arsvivendi.com
Cover: Pauline Altmann, Berlin
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-260-0
Inhalt
Silas Marner
Nachbemerkung der Übersetzerinnen
Editorische Notiz
Nachwort
Die Autorin
»Ein Kind bringt, mehr als alle andren Gaben
der Erde an uns welkendes Geschlecht,
Hoffnung mit sich und lenkt den Blick nach vorn.«
Wordsworth
Silas Marner
ERSTER TEIL
1
In jenen Tagen, als in den Pächterhäusern noch emsig die Spinnräder schnurrten – und selbst vornehme Damen, angetan mit Seide und Zwirnspitze, ein poliertes Eichenrädchen in der Stube stehen hatten –, konnte es geschehen, dass man in abgelegenen Gegenden auf den Heckenwegen oder im Schutze der Hügel auf gewisse bleiche, kleingewachsene Männer traf, die neben dem stämmigen Landvolk wie die letzten Überlebenden eines enterbten Geschlechts erschienen. Der Hund des Schäfers schlug laut an, wenn einer dieser fremdartig aussehenden Gesellen sich auf dem Hochland zeigte, dunkel vor dem frühen winterlichen Sonnenuntergang; denn welchem Hund hätte je der Anblick einer unter einem schweren Sack gebückten Gestalt gefallen? – diese blassen Menschen nämlich machten sich fast nie ohne solch eine geheimnisvolle Last auf den Weg. Der Schäfer selbst hatte zwar allen Grund zu der Annahme, dass der Sack nichts weiter enthielt als Leingarn oder auch die dicken Ballen festen Leinens, das daraus gefertigt wurde, aber deshalb hätte er doch nicht schwören mögen, dass das Gewerbe des Leinwebens, so unentbehrlich es sein mochte, so ganz ohne den Beistand des Leibhaftigen auskam. In dieser fernen Zeit heftete sich der Aberglaube schnell an jede Person und jedes Ereignis, das in irgendeiner Weise ungewohnt war, und sei es nur deshalb, weil es unregelmäßig oder in größeren Abständen wiederkehrte, wie die Besuche des Hausierers oder des Scherenschleifers. Niemand wusste, wo diese Fahrenden zu Hause waren und woher sie stammten; und wie sollte man einen Menschen einschätzen, wenn man nicht wenigstens jemanden kannte, der wiederum dessen Vater und Mutter kannte? Für die Bauern der damaligen Zeit war die Welt außerhalb ihrer eigenen unmittelbaren Erfahrung eine Region der Zweifel und Geheimnisse; ihrem beschränkten Horizont schien jegliches nichtsesshafte Leben in ein ebensolches Dunkel gehüllt wie das Winterquartier der Schwalben, die mit dem Frühling zurückkehrten, und selbst ein Siedler wurde, wenn er nur von weit genug herkam, zeit seines Lebens mit einem Rest von Misstrauen betrachtet, sodass niemand überrascht gewesen wäre, wenn er nach langen Jahren des untadeligen Verhaltens plötzlich ein Verbrechen begangen hätte – zumal dann, wenn man ihm besondere Kenntnisse nachsagte oder er sich durch handwerkliches Können hervortat. Jegliche Gewandtheit, sei es im flinken Gebrauch jenes schwierigen Instruments, der Zunge, sei es in einer anderen Kunst, in der die Dorfbewohner nicht bewandert waren, galt an sich schon als verdächtig: Anständige Leute, deren Werdegang jedermann von Geburt an mitverfolgt hatte, waren zumeist nicht überklug oder gewitzt – zumindest nicht über die Fertigkeit hinaus, das Wetter vorherzusagen. Und wie irgendein Mensch sich Schnelligkeit und Gewandtheit jedweder Art aneignen konnte, war ihnen so durch und durch schleierhaft, dass sie gleich Zauberei dahinter vermuteten. So kam es, dass diese versprengten Leinweber – Städter allesamt, die es aufs Land verschlagen hatte – von ihren ländlichen Nachbarn bis an ihr Lebensende als fremdartige Wesen angesehen wurden und in der Regel auch die exzentrischen Gewohnheiten annahmen, die ein Leben in Einsamkeit mit sich bringt.
Zu Anfang dieses Jahrhunderts ging solch ein Leinweber mit Namen Silas Marner seinem Beruf in der Nähe des Dorfes Raveloe nach, in einer von Haselbüschen umstandenen Steinhütte am Rande eines stillgelegten Steinbruchs. Das befremdliche Geräusch von Silas’ Webstuhl, das so völlig anders klang als der fröhliche Trott der Worfelmaschine oder der einfachere Rhythmus des Dreschflegels, übte eine angenehm gruselige Faszination auf die Buben von Raveloe aus, die häufig ihren Haselnüssen oder Vogelnestern den Rücken kehrten, um durch das Fenster der Steinhütte zu spähen – wobei sie eine leichte Beklemmung beim Anblick der geheimnisvollen Bewegungen des Webstuhls dadurch bekämpften, dass sie seine wechselnden Geräusche und die gebückte Haltung des Webers am Tretwerk nachäfften; das verlieh ihnen ein wohltuendes Gefühl verachtungsvoller Überlegenheit. Manchmal jedoch geschah es, dass Marner seine Arbeit unterbrach, um eine Unregelmäßigkeit im Gewebe zu beheben, und dabei die kleinen Strolche bemerkte. Er hielt zwar sehr mit seiner Zeit haus, aber dieses Eindringen missfiel ihm derartig, dass er vom Webstuhl herabstieg, um die Tür zu öffnen und die Kinder mit einem Blick zu bedenken, der sie entsetzt davonrennen ließ. Wie sollten sie sich denn auch vorstellen können, dass diese großen, vorquellenden braunen Augen in Silas Marners bleichem Gesicht nichts erkennen konnten, was sich nicht in allernächster Nähe befand – wo es doch auf der Hand lag, dass ihr grausiges Stieren dem Jungen, der gerade das Schlusslicht bildete, Krämpfe, Rachitis oder Schiefmäuligkeit anhängen würde? Vielleicht hatten sie Vater oder Mutter andeuten hören, dass Silas Marner, wenn er geneigt war, den Rheumatismus zu heilen wisse, oder dunkler noch, dass er einem die Arztkosten sparen könne, wenn man sich nur mit dem Teufel gutstellte. Auf solch merkwürdige, hartnäckig verweilende Nachklänge der alten Dämonenverehrung trifft der aufmerksame Zuhörer bei der grauhaarigen Landbevölkerung selbst heute noch; denn für einen unbedarften Geist ist die Vorstellung von Macht mit der des Wohlwollens nur sehr schwer zu vereinen. Menschen, die ihr Leben lang nur harte Arbeit und primitivste Bedürfnisse gekannt haben und deren Dasein nie durch religiöse Begeisterung erleuchtet worden ist, stellt sich das Unsichtbare am ehesten als eine schattenhafte Macht dar, die mit großer Überredungskunst unter Umständen davon abgehalten werden kann, Schaden zu wirken. Schmerz und Ungemach nehmen für solche Menschen weitaus vielfältiger Gestalt an als Freude und Genuss; ihrer Phantasie ermangelt es fast völlig an Bildern, die Begehren und Hoffung wecken, vielmehr ist sie überwuchert von Erinnerungen, die stets wieder nur die Furcht nähren. »Können Sie sich denn gar nichts vorstellen, was Sie gerne essen würden?«, fragte ich einmal einen alten Tagelöhner, der seine letzte Krankheit durchmachte und all die von seiner Frau gereichten Speisen ablehnte. »Nein«, erwiderte er, »ich hab nie was andres gekannt wie einfache Kost, und die kann ich nicht mehr essen.« Die Erfahrungen eines ganzen Lebens hatten in ihm keinerlei Vorlieben geweckt, die ihm wenigstens einen Anflug von Appetit hätten vorgaukeln können.
Raveloe jedenfalls war ein Dorf, wo viele dieser alten Echos noch nachklangen, ohne dass sie von neuen Stimmen übertönt wurden. Dabei zählte es keineswegs zu jenen armen Gemeinden am Rande der Zivilisation – Heimstatt magerer Schafe und spärlich verstreuter Schäfer: Im Gegenteil, es lag in der fruchtbaren Ebene im Herzen jener Gegend, die wir so gerne als »Merry Old England« bezeichnen, und nannte Pächterhäuser sein Eigen, die, vom geistlichen Standpunkt aus betrachtet, höchstwillkommene Abgaben leisteten. Aber es duckte sich in eine behagliche, dicht bewaldete Senke, eine gute Reitstunde entfernt von jeder Chaussee, wo es die Töne des Posthorns ebenso wenig erreichten wie die der öffentlichen Meinung. Es war ein ansehnliches Dorf mit einer schönen alten Kirche und einem großen Kirchhof in der Mitte, und dazu ein paar großen Ziegelgehöften mit fest ummauerten Obstgärten und verzierten Wetterhähnen, die dicht an der Straße standen und mit noch imposanteren Fassaden aufwarteten als das Pfarrhaus, das hinter dem Kirchhof zwischen den Bäumen hervorspitzte: ein Dorf, das sofort alle Höhepunkte seines gesellschaftlichen Lebens offenbarte und dem geübten Auge auf den ersten Blick verriet, dass es in der Nachbarschaft kein großes Herrenhaus mit dazugehörigem Park gab, dafür aber mehrere Grundbesitzer in Raveloe selbst, die ihr Land in aller Ruhe so schlecht bestellen konnten, wie sie nur wollten – das Geld, das ihnen ihre Misswirtschaft einbrachte, reichte in diesen Kriegstagen immer noch aus, um ausgelassen zu leben und ein fröhliches Weihnachten, Pfingsten und Ostern zu feiern.
Silas Marner war vor nunmehr fünfzehn Jahren nach Raveloe gekommen; damals war er einfach ein bleicher junger Mann mit vorstehenden, kurzsichtigen braunen Augen gewesen, dessen Erscheinung einem durchschnittlich gebildeten und welterfahrenen Menschen gar nicht weiter aufgefallen wäre. Aber auf die Dorfbewohner, in deren Nähe er sich niedergelassen hatte, machte er einen geheimnisvollen, absonderlichen Eindruck, der ihnen ganz zu der außergewöhnlichen Natur seines Gewerbes und der unbekannten Gegend seiner Herkunft »droben im Norden« zu passen schien. Sein Leben verlief folgendermaßen: Er lud keinen Besucher ein, den Fuß über seine Schwelle zu setzen; nie fand er den Weg ins Dorf, um ein Glas im Rainbow zu trinken oder beim Wagner ein Schwätzchen zu halten. Wenn nicht gerade die Geschäfte es erforderten oder er sich mit Mundvorrat eindecken musste, suchte er weder Mann noch Frau auf; und bald war es den jungen Mädchen von Raveloe klar, dass er niemals eine von ihnen gegen ihren Willen drängen würde, die Seine zu werden – es war, als hätte er mitangehört, wie sie erklärten, nichts könne sie je dazu bringen, einen von den Toten Auferstandenen zum Mann zu nehmen. Dieses letztere Bild von Marner hatte seinen Ursprung nicht allein in seinem blassen Gesicht und den eigenartigen Augen; Jem Rodney, der Maulwurfsjäger, behauptete nämlich, ihn eines Abends auf dem Heimweg gesehen zu haben, wie er an einem Zaunübertritt lehnte, einen schweren Sack bei sich, den er auf dem Rücken behielt, statt ihn auf dem Übertritt abzustellen wie jeder vernünftige Mensch. Im Näherkommen habe er, Jem, bemerkt, dass Marner mit stieren Augen blickte wie ein Toter; er habe ihn angesprochen und ihn geschüttelt, doch seine Glieder seien steif gewesen, und seine Hände hätten den Sack umklammert, als wären sie aus Eisen; aber just, als er zu dem Schluss gekommen war, der Weber sei tot, habe der sich erholt, und zwar im Handumdrehen, habe ihm eine gute Nacht geboten und sei davonmarschiert. All das hatte sich wirklich so zugetragen, das schwor Jem, und zwar wusste er es deshalb so genau, weil es an dem Tag gewesen war, an dem er auf dem Land von Squire Cass Maulwürfe gejagt hatte, unten bei der alten Sägegrube. Manche meinten, Marner müsse einen »Anfall« gehabt haben, ein Wort, das Dinge zu erklären schien, die sich auf andere Weise nicht fassen ließen; aber der Küster des Kirchspiels, der streitbare Mr Macey, schüttelte den Kopf und verlangte zu wissen, ob man je von jemandem gehört habe, der einen Anfall gehabt habe und dabei nicht zu Boden gefallen sei. Ein Anfall war schließlich ein Schlag, oder etwa nicht, und ein Schlaganfall raubte einem Menschen bekanntlich die Herrschaft über einen Teil seiner Gliedmaßen, sodass die Gemeinde für ihn aufkommen musste, es sei denn, er hatte Kinder, die für ihn sorgten. Nein, nein, ein Schlaganfall war das nicht, wenn der Mann noch auf den Beinen blieb wie ein Pferd an der Deichsel und dann davonmarschierte, kaum dass man »Hü!« gerufen hatte. Aber es sollte ja auch vorkommen, dass sich die Seele vom Körper loslöste und aus- und einfuhr, wie ein Vogel aus dem Nest fliegt und wieder zurück; so war schon manch einer überklug geworden, denn in diesem hüllenlosen Zustand gingen die Leute zur Schule bei denen, die ihnen mehr beibringen konnten, als ihre Nachbarn mithilfe ihrer fünf Sinne und des Pfarrers je lernen würden. Und woher hatte Meister Marner sein Wissen über die Kräuter – und die Zaubersprüche, wenn er sie denn preisgeben wollte? Jem Rodneys Geschichte überraschte ja wohl keinen, der mitangesehen hatte, wie Marner Sally Oates kuriert und sie zum Schlafen gebracht hatte wie ein Kind in der Wiege, damals, als sie ein solches Herzrasen gehabt hatte, dass es ihr fast die Brust zersprengt hätte, und das über zwei Monate hinweg, trotz aller Bemühungen des Doktors. Wenn er wollte, konnte er gewiss noch mehr Leute kurieren; aber auch so stellte man sich besser gut mit ihm, und sei es nur, damit er einem nichts auf den Leib wünschte.
Nicht zuletzt dieser unbestimmten Furcht hatte Marner es zu verdanken, dass er vor den Nachstellungen, die seine Eigenheiten andernfalls auf sich hätten ziehen können, verschont blieb. Entscheidender noch war freilich, dass der alte Leinweber in der Nachbargemeinde Tarley gestorben war, sodass Silas’ Handwerk ihn zu einem hochwillkommenen Ansiedler machte, nicht nur bei den reichen Hausfrauen der Gegend, sondern auch bei den wohlhabenderen Häuslern, die zum Jahresende einen kleinen Garnvorrat angesammelt hatten. Das Bewusstsein, auf ihn angewiesen zu sein, wirkte jeglicher Abneigung oder Skepsis entgegen, solange der Stoff, den er für sie webte, nicht falsch bemessen war oder sonst einen Mangel aufwies. Und die Jahre waren verstrichen, ohne in der Einstellung der Nachbarn gegenüber Marner irgendeinen anderen Wandel herbeizuführen als den von der Neuheit zur Gewohnheit. Am Ende der fünfzehn Jahre sagten die Einwohner von Raveloe genau dieselben Dinge über Silas Marner wie am Anfang: Sie sagten sie nicht mehr ganz so oft, dafür aber mit umso größerer Überzeugung. Eine wichtige Ergänzung nur hatten die Jahre gebracht: dass Meister Marner nämlich irgendwo eine hübsche Summe beiseite gelegt habe, und dass er »gewichtigere Männer« als sich selbst aufkaufen könne.
Doch während die Ansichten über ihn beinahe gleich geblieben waren und seine täglichen Gewohnheiten kaum eine sichtbare Änderung zeigten, hatte Marners Innenleben mit der Zeit eine Verwandlung erfahren, wie sie bei jedem empfindungsstarken Menschen zu erwarten steht, wenn er in die Einsamkeit geflohen oder zur Einsamkeit verdammt ist. Vor seiner Ankunft in Raveloe war sein Dasein erfüllt gewesen von dem regen Gefühls- und Geistesleben und der engen Kameradschaft, durch die damals wie heute das Leben eines Handwerkers geprägt wird, der von klein auf in eine festgefügte religiöse Sekte eingebunden ist, in der noch der ärmste Laie Gelegenheit erhält, sich durch das Mittel der Sprache hervorzutun, und allermindestens das Gewicht eines stummen Wählers in der Führung seiner Gemeinschaft hat. Marner war hoch geachtet gewesen in dieser kleinen, verborgenen Welt, die sich die Kirche vom Lantern Yard nannte; man sah in ihm einen jungen Mann mit beispielhaftem Lebenswandel und glühendem Glauben; und seit er bei einer Gebetsversammlung in eine merkwürdige Starre und Bewusstlosigkeit verfallen war, die, da sie mindestens eine Stunde angedauert hatte, fälschlich für seinen Tod gehalten worden war, galt ihm ein besonderes Interesse. Eine medizinische Erklärung für dieses Phänomen zu suchen, hätte für Silas wie für den Prediger und die anderen Mitglieder ein vorsätzliches Sich-Verschließen vor einer möglichen spirituellen Bedeutung des Erlebnisses dargestellt. Ganz offensichtlich war Silas ein Bruder, an den eine besondere Berufung ergangen war; und obwohl die genauere Auslegung dieser Berufung dadurch erschwert wurde, dass Silas sich keinerlei religiöser Vision während seiner äußerlichen Trance entsinnen konnte, so waren doch er und die anderen fest davon überzeugt, dass die Wirkung sich in einem Zuwachs von Einsicht und Glaubenseifer bemerkbar machte. Ein weniger wahrheitsliebender Mensch als Silas wäre vielleicht versucht gewesen, im Nachhinein eine Vision zu erfinden, indem er so tat, als kehre sein Gedächtnis plötzlich zurück; ein Mensch mit weniger gesundem Verstand hätte von vornherein an eine solche Erfindung geglaubt; aber Silas war sowohl bei Verstand als auch ehrlich, wenn auch, wie bei so vielen ehrlichen und glaubenseifrigen Menschen, keine Bildung seinen Sinn für das Mysteriöse in angemessene Bahnen gelenkt hatte, sodass dieser den rechten Weg der Wissbegierde und der Erkenntnis überflutete. Von seiner Mutter hatte er einige Kenntnisse über Heilkräuter und den Umgang mit ihnen geerbt – ein kleiner Vorrat an Weisheit, den sie ihm als feierliches Vermächtnis anvertraut hatte –, aber in den letzten Jahren hatten ihn Zweifel beschlichen, ob er dieses Wissen auch wirklich rechtmäßig anwenden durfte: Die Kräuter, so glaubte er, konnten keine Wirkung zeigen, wenn man dazu nicht betete, und ein Gebet wiederum musste auch ohne Heilkräuter ausreichen; und so nahm seine ererbte Lust am Durchstreifen der Felder auf der Suche nach Fingerhut, Löwenzahn und Huflattich für ihn allmählich den Charakter einer Versuchung an.
Zu den Mitgliedern der Kirche zählte ein junger Mann, etwas älter als Silas, mit dem ihn lange eine so enge Freundschaft verbunden hatte, dass sie von ihren Brüdern im Lantern Yard nur noch David und Jonathan genannt wurden. Der wirkliche Name dieses Freundes war William Dane, und auch er galt als leuchtendes Beispiel jugendlicher Frömmigkeit, obwohl er sich schwächeren Brüdern gegenüber oft allzu streng zeigte und so geblendet war von seinem eigenen Licht, dass er sich für klüger hielt als seine Lehrer. Was für Mängel freilich andere in William erkennen mochten, seinen Freund dünkte er makellos; Marner nämlich gehörte zu jenen leicht zu beeindruckenden, unsicheren Menschen, die in unerfahrenem Alter gebieterisches Gehabe bewundern und sich jedwedem Widerspruch beugen. Der Ausdruck unschuldigen Vertrauens in Marners Gesicht, noch verstärkt durch die fehlende genauere Wahrnehmung, dieser wehrlose, rehhafte Blick, der großen hervortretenden Augen so gern anhaftet, stand in starkem Gegensatz zu dem selbstgefällig unterdrückten inneren Triumph, der in den schmalen, schrägstehenden Augen und zusammengepressten Lippen William Danes lauerte. Eines der häufigsten Gesprächsthemen zwischen den beiden Freunden war die Heilsgewissheit: Silas bekannte, dass er nie etwas Höheres erlangen zu können glaubte als eine Mischung aus Hoffnung und Furcht, und lauschte William mit sehnsüchtiger Verwunderung, wenn dieser erklärte, seine Zuversicht sei unerschütterlich, seit er in der Zeit seiner Bekehrung im Traum auf einer ansonsten weißen Seite der aufgeschlagenen Bibel die Worte »sichere Berufung und Gnadenwahl« gelesen habe – Gespräche, wie sie schon so manches Gespann von bleichwangigen Webern in ihrem Bann gehalten haben, deren unreife Seelen wie junge Flügelwesen verloren im Zwielicht flattern.
Dem arglosen Silas schien es, als habe diese Freundschaft auch dadurch keine Abkühlung erlitten, dass er eine Verbindung noch engerer Art eingegangen war. Seit einigen Monaten nämlich war er mit einem jungen Dienstmädchen verlobt; sie wollten mit ihrer Heirat lediglich warten, bis ihre gemeinsamen Ersparnisse noch etwas angewachsen waren, und es machte ihn überglücklich, dass Sarah nichts gegen Williams gelegentliche Anwesenheit bei ihren sonntäglichen Zusammenkünften einzuwenden hatte. In diese Zeit fiel Silas’ kataleptischer Anfall im Betsaal, und einzig Williams Kommentar stach heraus unter den vielen Fragen und allseitigen Bekundungen der Anteilnahme für einen Bruder, der auf diese Weise zu Besonderem auserkoren worden war: William nämlich erklärte, dass ihm der Trancezustand eher wie eine Heimsuchung Satans erscheine denn als göttlicher Gnadenbeweis, und ermahnte den Freund, nichts Gottloses in seiner Seele zu verbergen. Silas, der sich verpflichtet glaubte, Tadel und Ermahnung als Bruderdienst hinzunehmen, verspürte keinen Ärger darüber, dass der Freund so an ihm zweifelte, sondern nur Schmerz – zu dem sich schon bald eine gewisse Angst gesellte, als er in Sarahs Verhalten ihm gegenüber ein merkwürdiges Hin- und Herschwanken zwischen verstärkten, angestrengten Achtungsbezeugungen und unwillkürlichen Anzeichen des Zurückschreckens und des Widerwillens wahrzunehmen begann. Er fragte sie, ob sie die Verlobung lösen wolle, was sie jedoch von sich wies: Ihre Verlobung war in der Kirche angezeigt und in den Gebetsversammlungen anerkannt worden; sie konnte nicht ohne eine strenge Untersuchung gelöst werden, und Sarah hätte keinen Grund vorzulegen vermocht, der bei der Gemeinde auf rechtes Verständnis gestoßen wäre. Zu dieser Zeit erkrankte der Kirchenälteste schwer. Da er Witwer war und kinderlos, wurde er Tag und Nacht von einigen der jüngeren Brüder und Schwestern gepflegt. Silas teilte sich die Nachtwache des Öfteren mit William – der eine löste den anderen um zwei Uhr morgens ab. Wider alles Erwarten schien der alte Mann auf dem Wege der Besserung, da bemerkte Silas eines Nachts, als er am Krankenbett saß, dass die üblichen laut vernehmbaren Atemgeräusche aufgehört hatten. Die Kerze war fast heruntergebrannt, sodass er sie hochheben musste, um das Gesicht des Patienten deutlich sehen zu können. Er untersuchte ihn und stellte sehr schnell fest, dass der Kirchenälteste tot war – es schon seit geraumer Zeit sein musste, denn die Gliedmaßen waren bereits starr. War er am Ende eingeschlafen? Silas blickte auf die Uhr: Es war vier Uhr morgens. Weshalb war William nicht gekommen? In großer Angst holte er Hilfe, und bald waren mehrere Freunde im Haus versammelt, unter ihnen der Prediger. Silas machte sich unterdessen auf den Weg zu seiner Arbeit; er wünschte, er hätte William treffen können, um den Grund für sein Ausbleiben zu erfahren. Aber um sechs Uhr, gerade, als er sich auf die Suche nach dem Freund machen wollte, erschien dieser bei ihm und mit ihm der Prediger. Sie waren gekommen, um ihn zum Lantern Yard zu bestellen, wo er vor die Gemeindeglieder treten sollte; auf seine Frage nach dem Grund für diese Vorladung erhielt er einzig zur Antwort: »Das wirst du schon hören.« Mehr wurde nicht gesagt, bis Silas in der Sakristei ein Platz gegenüber dem Prediger zugewiesen worden war, während jene Versammlung, die für ihn das Volk Gottes darstellte, ernst den Blick auf ihn richtete. Da endlich brachte der Prediger ein Taschenmesser zum Vorschein, hielt es Silas hin und fragte ihn, ob er wisse, wo er dieses Messer liegengelassen habe. Silas antwortete, seines Wissens habe es sich zu keiner Zeit an einem anderen Ort befunden als in seiner Tasche, aber das sonderbare Verhör machte ihn zittern. Man forderte ihn auf, seine Sünde nicht zu verbergen, sondern sie zu bekennen und zu bereuen. Das Messer war in der Kommode neben dem Bett des Verstorbenen gefunden worden – da, wo ein kleines Säckchen Kirchgeld gelegen hatte, das der Prediger selbst am Tag zuvor noch dort gesehen hatte. Jemandes Hand hatte dieses Säckchen an sich genommen, und wessen Hand konnte es schon gewesen sein als die des Mannes, dem das Messer gehörte? Eine Zeit lang war Silas sprachlos vor Erstaunen, dann sagte er: »Gott wird mich von dem Verdacht befreien: Ich habe mit dem Auftauchen des Messers so wenig etwas zu tun wie mit dem Verschwinden des Geldes. Durchsucht mich und meine Wohnung; ihr werdet nichts als meine selbstgesparten drei Pfund und fünf Schilling finden, die ich schon seit sechs Monaten habe, wie William Dane bezeugen kann.« Darauf seufzte William; der Prediger aber sagte: »Der Anschein spricht sehr gegen dich, Bruder Marner. Das Geld wurde in der letzten Nacht gestohlen, und außer dir war niemand bei unserem verstorbenen Bruder, denn William Dane sagt aus, er sei durch eine plötzliche Übelkeit daran gehindert worden, wie üblich seinen Platz einzunehmen – du selbst hast ja gesagt, er sei nicht gekommen. Und du hast es versäumt, dich um den Leichnam zu kümmern.«
»Ich muss eingeschlafen sein«, sagte Silas. Dann, nach einer Pause, fügte er hinzu: »Vielleicht habe ich auch wieder eine Heimsuchung gehabt, wie damals, wo ihr alle dabei wart. Der Dieb muss gekommen und wieder verschwunden sein, während ich nicht in meinem Körper war, sondern außerhalb. Aber ich kann nur wiederholen, durchsucht mich und meine Wohnung, denn ich war an keinem anderen Ort.«
Die Durchsuchung fand statt – und endete damit, dass William Dane das wohlbekannte Säckchen hinter der Kommode in Silas’ Schlafkammer fand, leer! Daraufhin drängte William seinen Freund, alles zu gestehen und seine Sünde nicht länger zu verheimlichen. Silas warf ihm einen Blick voll bitteren Vorwurfs zu und sagte: »William, neun Jahre schon sehen wir uns tagtäglich, hast du je eine Lüge aus meinem Munde gehört? Aber Gott wird mich von jedem Verdacht befreien.«
»Bruder«, erwiderte William, »woher soll ich wissen, was du in den geheimen Kammern deines Herzens getan hast, dass Satan dich in seine Gewalt bringen konnte?«
Silas blickte seinen Freund noch immer an. Plötzlich färbte sich sein Gesicht tiefrot, und er wollte gerade ungestüm drauflos reden, als es ihm erneut die Sprache zu verschlagen schien wie von einem innerlichen Schock, der ihm die Farbe wieder nahm und ihn zittern machte. Aber schließlich hob er mit matter Stimme zu sprechen an, den Blick auf William gerichtet.
»Jetzt weiß ich es wieder – das Messer war nicht in meiner Tasche.«
William antwortete: »Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest.« Die anderen Anwesenden begannen freilich zu fragen, wo Silas das Messer denn gesehen haben wollte; der aber gab keine weitere Erklärung ab, sondern sagte nur: »Ich bin zutiefst betrübt; mehr kann ich dazu nicht sagen. Gott wird mich von jedem Verdacht befreien.«
Man kehrte in die Sakristei zurück, und die Beratung wurde fortgesetzt. Ein Rückgriff auf gesetzliche Maßnahmen zur Überführung eines Schuldigen hätte den Grundsätzen der Kirche vom Lantern Yard widersprochen, denen zufolge Christen keine Anklage erheben durften, nicht einmal bei einem Fall, der die Gemeinde weniger in Verruf gebracht hätte als dieser. Aber irgendwelche Maßnahmen zur Wahrheitsfindung mussten die Brüder ergreifen, und so einigte man sich darauf, Gebete zu sprechen und Lose zu ziehen. Dieser Beschluss kann niemanden überraschen, der mit dem verborgenen religiösen Leben in den Gassen unserer Städte auch nur halbwegs vertraut ist. Silas kniete mit seinen Brüdern nieder, in der Gewissheit, dass ein sofortiges Eingreifen Gottes seine Unschuld beweisen werde, aber gleichzeitig fühlte er, dass selbst dann noch Sorge und Trauer seiner harrten – dass seinem Vertrauen in die Menschheit eine grausame Wunde geschlagen worden war. Die Lose sprachen Silas Marner schuldig. Er wurde feierlich von der Kirchengemeinschaft suspendiert und aufgerufen, das gestohlene Geld zurückzugeben: Nur wenn er gestehe und so seine Reue bezeige, könne er wieder in den Schoß der Kirche aufgenommen werden. Marner hörte schweigend zu. Als sich schließlich alle zum Gehen erhoben, machte er ein paar Schritte auf William Dane zu und sagte mit vor Erregung bebender Stimme:
»Mein Messer habe ich das letzte Mal benutzt, als ich es herausnahm, um einen Riemen für dich durchzuschneiden. Ich kann mich nicht erinnern, es wieder in meine Tasche gesteckt zu haben. Du hast das Geld gestohlen und dann einen Plan geschmiedet, um mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber du wirst wohl dennoch dein Glück machen: Es ist kein gerechter Gott, der redlich über die Erde regiert; es ist ein Gott der Lügen, der wider die Unschuldigen Zeugnis ablegt.«
Ein Schauer durchlief die Versammelten bei dieser Lästerung.
William sagte sanftmütig: »Unsere Brüder mögen darüber urteilen, ob dies die Stimme Satans ist oder nicht. Ich kann nichts tun als für dich beten, Silas.«
Voller Verzweiflung in der Seele ging der arme Marner hinaus – sein Vertrauen in Gott und die Menschen war in einem Maße ins Wanken geraten, wie es für eine liebevolle Natur schon fast dem Wahnsinn gleichkommt. In der Bitterkeit seines verwundeten Geistes sagte er zu sich: »Auch sie wird mich verstoßen« – musste es doch ihren Glauben, falls sie sich dem Urteil gegen ihn nicht anschloss, ebenso in seinen Grundfesten erschüttern wie den seinen. Wer die kritische Prüfung der Formen, die das eigene religiöse Empfinden annimmt, gewohnt ist, wird sich nur schwerlich in diesen einfachen, ungebildeten Geisteszustand hineinversetzen können, bei dem Form und Empfinden nie durch einen bewussten Denkakt auseinandergespalten worden sind. Uns scheint es kaum vorstellbar, dass einem Mann in Marners Lage keine Zweifel kommen, ob das Ziehen von Losen wirklich eine gültige Anrufung des göttlichen Richterspruchs darstellen kann; aber für ihn hätte dies eine selbständige Geistesanstrengung bedeutet, wie er sie nie gekannt hatte – eine Anstrengung, die er noch dazu in einem Moment hätte unternehmen müssen, da seine gesamten Kräfte aufgingen in der Seelenqual enttäuschten Glaubens. Wenn es einen Engel gibt, der das Leid der Menschen ebenso aufzeichnet wie ihre Sünden, dann weiß er, welch mannigfaches und tiefes Leiden irrigen Annahmen entspringt, für die kein Mensch zur Rechenschaft gezogen werden kann.
Marner ging nach Hause und saß einen ganzen Tag alleine da, starr vor Verzweiflung, ohne irgendein Verlangen, zu Sarah zu gehen, um sie vielleicht doch von seiner Unschuld zu überzeugen. Am zweiten Tag floh er vor dem betäubenden Unglauben, indem er sich an den Webstuhl setzte und wie üblich arbeitete; und noch bevor viele Stunden verstrichen waren, überbrachten ihm der Prediger und einer der Ältesten Nachricht von Sarah: Sie ließ ihm mitteilen, dass sie ihre Verlobung mit ihm für beendet ansah. Silas nahm die Botschaft stumm entgegen; dann wandte er sich von den Überbringern ab, um am Webstuhl weiterzuarbeiten. Einen guten Monat später fand die Hochzeit von Sarah und William Dane statt; und nicht lange darauf erfuhren die Brüder im Lantern Yard, dass Silas Marner die Stadt verlassen hatte.
2
Selbst Menschen, die ihren Horizont durch Bildung erweitern konnten, haben bisweilen Mühe, an ihren gewohnten Lebensansichten festzuhalten, an ihrem Vertrauen in die unsichtbaren Mächte, ja sogar an der Gewissheit, ihre vergangenen Freuden und Sorgen wahrhaftig erlebt zu haben, wenn es sie plötzlich in eine fremde Gegend verschlägt, wo niemand um sie herum ihre Geschichte kennt oder irgendeine ihrer Vorstellungen teilt – wo Mutter Erde ihnen einen anderen Schoß zeigt und das menschliche Leben andere Formen annimmt als die, mit denen ihre Seelen genährt wurden. Wer alles loslassen musste, was er geglaubt und geliebt hat, sucht vielleicht eben diese vergessen machende Wirkung des Exils, wo die Vergangenheit wie ein Traum scheint, weil kein Zeichen mehr von ihr kündet, und auch die Gegenwart nur Traum ist, weil sich keinerlei Erinnerungen an sie knüpfen. Aber selbst ihn versetzt seine Erfahrung nicht in die Lage, voll und ganz nachzuempfinden, was es für einen einfachen Weber wie Silas Marner heißen musste, Heimat und Freunde zu verlassen und sich in Raveloe anzusiedeln. Nichts hätte Silas’ Geburtsstadt inmitten weitauslaufender Hügel unähnlicher sein können als diese niedrig gelegene, bewaldete Gegend, wo ihm der dichte Schirm von Bäumen und Hecken das Gefühl gab, selbst noch vor dem Himmel verborgen zu sein. Wenn er in der tiefen morgendlichen Stille aufstand und auf die taufeuchten Büsche und üppigen Grasbüschel blickte, so war da nichts, das in irgendeiner Weise an das Leben im und um den Lantern Yard hätte gemahnen können, der für ihn einst der Hochaltar göttlicher Offenbarungen gewesen war. Die weißgekalkten Wände, die schmalen Kirchenbänke, in die mit leisem Rascheln wohlbekannte Gestalten eintraten und aus denen sich die wohlbekannten Stimmen erhoben, um eine nach der anderen in jenem ganz eigenen Tonfall ihre Bitten vorzutragen, so geheimnisvoll und doch vertraut wie das über dem Herzen getragene Amulett; die Kanzel, von der herab der Prediger unter leichtem Sich-Wiegen eine von niemandem in Zweifel gezogene Lehre verkündete, die Hände an der Bibel auf lang gewohnte Art; ja, sogar die Pausen zwischen den einzelnen Verspaaren und das wiederkehrende Anschwellen der Stimmen im Gesang: Diese Dinge waren es, über die das Göttliche den Weg in Silas Marners Herz gefunden hatte – sie hatten sein religiöses Empfinden genährt – sie bedeuteten ihm Christentum und Gottes Königreich auf Erden. Ein Weber, der sich mit den Worten in seinem Gesangbuch schon schwertut, kennt keine Abstraktion; so wie ein Kleinkind nichts von elterlicher Liebe weiß, sondern nur ein Gesicht kennt und einen Schoß, denen es auf der Suche nach Geborgenheit und Nahrung die Arme entgegenreckt.
Was hätte wohl dem kleinen Kosmos vom Lantern Yard unähnlicher sein können als Raveloe – mit seinen Obstgärten, die träge dalagen in verwahrloster Überfülle; seinen Dörflern, die zur Gottesdienstzeit müßig in ihren Türen lehnten und zu der großen Kirche in ihrem weitläufigen Kirchhof hinüberblickten; mit rotgesichtigen Bauern, die die Wege entlangstapften oder im Rainbow einkehrten, und Gehöften, in denen die Männer üppig zu Abend aßen und im Schein des abendlichen Herdfeuers einschliefen, während die Frauen einen Leinenvorrat für das ewige Leben anzulegen schienen. In Raveloe gab es niemanden, über dessen Lippen ein Wort hätte kommen können, das Silas Marners betäubten Glauben zu schmerzhaftem Bewusstsein aufgerüttelt hätte. In der Mythologie früherer Zeitalter wurde bekanntlich jeder Landstrich von eigenen Gottheiten bewohnt und regiert, sodass man nur die Grenzhügel überqueren musste, um außer Reichweite seiner einheimischen Götter zu gelangen, deren Macht sich auf die Flüsse, Haine und Hügel beschränkte, zwischen denen man groß geworden war. Und der arme Silas empfand leise etwas, das den Gefühlen jener frühen Menschen sehr nahe kam, wenn sie, angetrieben von Angst oder Groll, aus dem Angesicht einer zürnenden Gottheit flüchteten. Ihm schien, dass die Macht, auf die er in den heimischen Gassen und bei den Gebetsversammlungen so töricht vertraut hatte, sehr fern war von diesem Land, in das er geflohen war. Hier lebten die Menschen in sorgenfreiem Überfluss und wussten oder brauchten nichts von dem Vertrauen, das sich bei ihm in Bitterkeit verwandelt hatte. Das wenige Licht, das er noch besaß, warf einen so spärlichen Schein, dass sein enttäuschter Glaube einen Vorhang bildete, groß genug, ihn in nachtschwarze Dunkelheit zu hüllen.
Nachdem jenes erste große Entsetzen abgeebbt war, hatte er sich mechanisch an den Webstuhl gesetzt, um zu arbeiten, und damit fuhr er nun ohne Unterlass fort. Nicht ein einziges Mal fragte er sich, warum er hier in Raveloe bis weit in die Nacht hinein aufblieb, um Mrs Osgoods Tischzeug früher fertigzustellen, als sie erwartete, und ebenso wenig verschwendete er einen Gedanken an das Geld, mit dem sie ihn entlohnen würde. Er arbeitete wie eine Spinne – ohne nachzudenken, aus einem reinen Impuls heraus. Jedermanns Tagwerk wird sich selbst zum Zweck, wenn es mit solcher Stetigkeit verrichtet wird, und überbrückt so die Abgründe eines Lebens, in dem die Liebe fehlt. Silas’ Hand warf das Schiffchen, sein Auge sah zu, wie sich die kleinen Vierecke im Stoff durch seine Anstrengung vervollständigten – das war ihm Erfüllung genug. Auch der Hunger verlangte nach seinem Recht: Silas musste in seiner Einsamkeit eigenhändig für Frühstück, Mittag- und Abendessen sorgen, sich das Wasser vom Brunnen holen und den Kessel aufs Feuer setzen, und diese Grundbedürfnisse, die es zu befriedigen galt, trugen zusammen mit dem Weben dazu bei, sein Leben auf die sture Emsigkeit eines spinnenden Insekts zu reduzieren. Die Erinnerung an Vergangenes war ihm zuwider; nichts weckte in ihm Regungen der Liebe oder Kameradschaftlichkeit den Fremden gegenüber, unter die er geraten war, und die Zukunft war düster, denn keine treusorgende unsichtbare Macht umgab ihn mehr. Jegliches Denken war zu einem ratlosen Stillstand gekommen, nun, da es seine alte schmale Bahn verbaut fand; jegliches Fühlen schien abgetötet durch den Schlag, der es an der empfindlichsten Stelle getroffen hatte.
Doch schließlich war Mrs Osgoods Tischzeug fertig, und Silas wurde in Gold dafür bezahlt. In seiner Heimatstadt hatte er für einen Großkaufmann gearbeitet, und sein Verdienst war niedriger gewesen; er hatte ein wöchentliches Gehalt bekommen und davon eine erkleckliche Summe für Devotionalien ausgegeben oder gespendet. Jetzt hielt er zum ersten Mal in seinem Leben fünf glänzende Guineen in der Hand; niemand erhob einen Anspruch darauf, und niemand stand ihm so nahe, dass er ihm einen Teil davon hätte anbieten wollen. Was aber bedeuteten die Guineen ihm, der doch keine andere Zukunft vor sich sah als zahllose Tage am Webstuhl? Danach fragte er nicht lang; es gefiel ihm einfach, sie in der Handfläche zu spüren und ihre blanken Oberseiten zu betrachten, die alle ihm allein gehörten: Wie das Weben und das Stillen des Hungers stellten sie einen weiteren Bestandteil seines Daseins dar, der kaum etwas gemein hatte mit dem Leben des Glaubens und der Liebe, von dem er ausgeschlossen worden war. Wie schwerverdientes Geld sich anfühlt, hatten die Hände des Webers bereits gewusst, als sie noch gar nicht ihre volle Größe erreicht hatten; zwanzig Jahre lang waren die geheimnisvollen Münzen ihm nur ein Symbol für irdische Güter gewesen, das vordergründige Ziel seiner Mühen. Er hatte wenig Liebe dafür aufgebracht in den Jahren, da er für jeden Penny einen Verwendungszweck gehabt hatte; denn damals war es der Zweck gewesen, den er liebte. Aber jetzt, wo es keinen Zweck mehr gab, bildete diese Gewohnheit, das Geld zu betrachten und es mit einem Gefühl verdienter Befriedigung durch die Finger gleiten zu lassen, einen Nährboden, der tief genug war für die Saat der Begierde; und auf seinem abendlichen Heimweg über die Felder zog Silas das Geld heraus und fand es in der aufkommenden Dunkelheit nur umso glänzender.
Etwa um diese Zeit trug sich etwas zu, das ihm eine Möglichkeit zu vertrauterem Umgang mit seinen Nachbarn zu eröffnen schien. Als er eines Tages ein Paar Schuhe zum Flicken bringen wollte, bemerkte er, dass die Frau des Schusters, die am Feuer saß, von den schrecklichen Symptomen von Herzkrankheit und Wassersucht gequält wurde, die er bei seiner Mutter als Vorboten des Todes mitangesehen hatte. Der Anblick, verstärkt durch die Erinnerung, ließ Mitleid in ihm aufwallen, und indem er sich auf ein einfaches Fingerhutpräparat besann, das seiner Mutter damals große Erleichterung verschafft hatte, versprach er Sally Oates einen Trank zur Linderung ihrer Beschwerden, da der Arzt ihr nicht helfen konnte. Bei diesem Akt der Nächstenliebe empfand Silas erstmals seit seiner Ankunft in Raveloe eine Einheit zwischen seinem früheren und seinem jetzigen Leben, die einen ersten Schritt zu einer Errettung aus der insektenhaften Kümmerform hätte darstellen können, zu der seine Existenz zusammengeschrumpft war. Aber Sally Oates war durch ihre Krankheit im Dorf zu einer Persönlichkeit von allgemeinem Interesse geworden, und so sprach es sich schnell herum, dass sie Linderung durch Marners »Arzenei« gefunden hatte. Wenn Doktor Kimble eine Medizin verabreichte, so war es nur natürlich, dass sie etwas ausrichtete; aber wenn ein Weber, der Gott weiß woher kam, mit einer Flasche bräunlicher Flüssigkeit Wunder wirkte, dann konnte doch eigentlich nur Zauberei dahinterstecken. Solch eine Geschichte hatte man nicht mehr gehört, seit die Kräuterfrau aus Tarley gestorben war, und die hatte Zaubersprüche ebenso angewandt wie »Arzenei«: Litt ein Kind an Anfällen, so war man immer zu ihr gegangen. Silas Marner musste auch einer von der Sorte sein, denn wie konnte er wissen, was Sally Oates von ihrer Atemnot befreien würde, wenn er nicht noch ein gut Teil mehr wusste? Die Kräuterfrau hatte Sprüche gekannt, die sie in sich hineinmurmelte, sodass man kein Wort davon verstand, und wenn sie dem Kind währenddessen ein Stückchen roten Faden um den Zeh band, dann stieg ihm kein Wasser mehr zu Kopf. Noch heute gab es in Raveloe Frauen, die mit einem von den kleinen Säckchen der Kräuterfrau um den Hals herumliefen und deshalb nie ein blödsinniges Kind bekommen hatten, so wie Ann Coulter. Silas Marner konnte bestimmt genauso viel, wenn nicht noch mehr; und jetzt war auch völlig klar, weshalb er aus einer unbekannten Gegend kam und so »komisch« aussah. Aber Sally Oates sollte bloß aufpassen und nichts dem Doktor erzählen, denn dem würde das gewiss ein Dorn im Auge sein: Er hatte sich schon immer über die Kräuterfrau geärgert und allen, die zu ihr gingen, gedroht, dass sie von ihm keine Hilfe mehr zu erwarten brauchten.
Silas fand sich und seine Hütte nun plötzlich von Müttern belagert, die ihn baten, einen Keuchhusten wegzuzaubern oder die Milch wieder einschießen zu lassen, von Männern, die Arznei gegen Rheumatismus oder Knoten in den Händen von ihm wollten; und damit sie auch ja nicht unverrichteter Dinge von dannen ziehen müssten, streckten die Bittsteller ihm Silbermünzen hin. Silas hätte mit ein paar Sprüchen und seinem kleinen Schatz an Heilmitteln ein gutgehendes Geschäft aufmachen können, aber auf solche Weise verdientes Geld stellte keine Versuchung für ihn dar; Betrug jeglicher Art war seinem Wesen fremd, und mit wachsendem Ärger schickte er einen um den anderen fort – die Kunde von seiner Zauberkunst hatte sich nämlich bis hin nach Tarley ausgebreitet, und es dauerte lange, bis die Leute nicht mehr die weiten Wege auf sich nahmen, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber die Hoffnung auf sein geheimes Wissen verwandelte sich schließlich in Furcht, denn keiner schenkte seinen Beteuerungen, weder Zaubersprüche zu kennen noch Heilungen vornehmen zu können, Glauben, und jeder, der nach dem Besuch bei Marner einen Unfall hatte oder den seine Krankheit erneut überkam, gab Marners Übelwollen und seinen zornigen Blicken die Schuld daran. So kam es, dass die Anteilnahme an Sally Oates’ Leiden, die ihm eine flüchtige Ahnung von Brüderlichkeit vermittelt hatte, die Kluft zwischen ihm und seinen Nachbarn nur vergrößerte und seine Isolation umso vollständiger machte.
Langsam wuchsen die Guineen, die Kronen und halben Kronen zu einem Haufen an, und Marner gab immer weniger davon für sich selbst aus, ganz darauf bedacht, die schwierige Aufgabe, sich für seinen sechzehnstündigen Arbeitstag bei Kräften zu halten, mit so geringen Unkosten wie möglich zu lösen. Zählen nicht Häftlinge in der Einsamkeit ihrer Gefangenschaft gerne die Tage, indem sie gleichlange Striche an die Kerkerwand malen, bis am Ende ihr einziges Interesse der wachsenden Zahl der zu Dreiecken angeordneten Striche gilt? Vertreiben wir alle uns Zeiten der Leere oder des müden Wartens nicht dadurch, dass wir irgendeine belanglose Bewegung oder einen Ton wiederholen, bis die Wiederholung ein Bedürfnis geschaffen hat, das den Grundstein der Gewohnheit legt? Umso leichter muss dann die Freude am Geldanhäufen bei einem Menschen zur verzehrenden Leidenschaft werden, der sich nicht einmal in den ersten Anfängen seines Hortens einen darüber hinausweisenden Zweck vorzustellen vermocht hat. Marner wollte die Zehnertürme zum Viereck anwachsen sehen und dieses Viereck zu einem größeren Viereck; und jede neue Guinee, so sehr sie an sich eine Genugtuung darstellte, entfachte ein neues Verlangen. Wäre er ein weniger empfindungsstarker Mensch gewesen, so hätte er in dieser merkwürdigen Welt, die für ihn zu einem hoffnungslosen Rätsel geworden war, weben und immer weiter weben können, seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Ende seines Musters oder das Ende seines Stoffes gerichtet, bis er das Rätsel vergaß – bis er alles vergaß außer seinen unmittelbaren Wahrnehmungen; aber nun gab es das Geld, das das Weben in Zeitabschnitte einteilte, und das Geld mehrte sich nicht nur, es blieb auch bei ihm. Ihm war fast, als könne es seine Nähe spüren, so wie sein Webstuhl auch, und um keinen Preis hätte er diese Geldstücke, die ihm so vertraut geworden waren, gegen Münzen anderer Prägung eintauschen wollen. Er wog sie in der Hand, er zählte sie, bis ihre Form und Farbe eine Art Durst in ihm stillten; doch er holte sie immer erst am Abend, wenn seine Arbeit getan war, hervor, um sich ihrer Gesellschaft zu erfreuen. Er hatte ein paar Ziegelsteine am Fuß des Webstuhls gelockert und darunter ein Loch gegraben; dorthinein stellte er den eisernen Topf, der seine Guineen und Silbermünzen enthielt, und jedesmal, wenn er die Steine zurücklegte, bedeckte er sie mit Sand. Nicht, dass die Angst vor einem Räuber ihn oft oder mit großer Gewalt überkommen hätte: Gehortet wurde damals in ländlichen Gegenden überall. Es gab genug alte Tagelöhner in der Gemeinde von Raveloe, von denen jedermann wusste, dass sie ihre Ersparnisse bei sich zu Hause aufbewahrten, aller Wahrscheinlichkeit nach in ihren Flockenbetten; aber ihre bäuerlichen Nachbarn, obschon nicht alle so ehrlich wie ihre Vorfahren in den Tagen König Alfreds, waren mit keiner so kühnen Phantasie begabt, als dass sie sich irgendwelche Diebereien hätten ausdenken können. Wie hätten sie schließlich das Geld in ihrem Heimatdorf ausgeben sollen, ohne sich zu verraten? Sie wären gezwungen gewesen, »sich aus dem Staub zu machen« – ein Unterfangen so dunkel und zweifelhaft wie eine Ballonfahrt.
So hatte Silas Marner Jahr um Jahr in dieser Einsamkeit gelebt, indes der Eisentopf sich mit Guineen füllte und sein Leben sich mehr und mehr verengte und verhärtete zu einem bloßen Pulsieren von Begierde und Befriedigung, das keinerlei Bezug zu irgendeinem anderen Lebewesen hatte. Sein Dasein hatte sich auf die Tätigkeiten des Webens und Geldhortens reduziert, ohne dass er sich je gefragt hätte, auf welches Ziel diese Tätigkeiten eigentlich zusteuerten. Eine ganz ähnliche Entwicklung haben auch weisere Menschen als Marner schon durchgemacht, wenn sie sich von Glauben und Liebe abgeschnitten fanden – nur dass sie statt eines Webstuhls und eines Haufens von Guineen ein hochgelehrtes Forschungsthema hatten, eine geniale Erfindung oder irgendeine wohldurchdachte Theorie. Auf seltsame Weise schrumpften und krümmten sich Marners Gesicht und Gestalt, bis sie in einer ständigen maschinenhaften Beziehung zu den Gegenständen zu stehen schienen, die sein Leben bestimmten, und er denselben Eindruck hervorrief wie ein Griff oder ein gebogenes Rohr, die für sich genommen völlig unbrauchbar sind. Die vorstehenden Augen, die einst so vertrauensvoll und träumerisch dreingeblickt hatten, wirkten nun, als wären sie einzig und allein dazu geschaffen, eine Stecknadel in einem Heuhaufen zu suchen; und er war so welk und gelb, dass die Kinder ihn, obwohl er noch nicht einmal vierzig war, alle den »alten Meister Marner« nannten.
Doch selbst in diesem Stadium des Welkens trug sich ein kleines Ereignis zu, das zeigte, dass noch nicht jegliches Fühlen in ihm erloschen war. Zu Silas’ täglichen Aufgaben gehörte es, sein Wasser von einem Brunnen ein paar Felder weiter zu holen, und dazu hatte er von seinem ersten Tag in Raveloe an einen braunen irdenen Krug benutzt, sein liebstes Gut unter den wenigen Annehmlichkeiten, die er sich gestattete. Seit zwölf Jahren hatte dieser Krug ihn begleitet, stets auf demselben Fleck gestanden und ihm allmorgendlich seine Dienste geliehen, sodass seine Rundungen für Silas einen Ausdruck williger Hilfsbereitschaft trugen und das Gefühl des Henkels in seiner Hand ihm eine Befriedigung verschaffte, die fast ebenso groß war wie die des frischen klaren Wassers selbst. Als er eines Tages vom Brunnen zurückkam, geriet er auf der Stufe des Zauntritts ins Stolpern, und sein brauner Krug fiel mit Wucht auf die Steine, die über den gleich dahinterliegenden Graben führten, und zerbrach in drei Stücke. Silas hob die Scherben auf und trug sie voll Kummer nach Hause. Von Nutzen konnte ihm der braune Krug nie wieder sein, aber er setzte die Teile zusammen und stellte sie zur Erinnerung an ihren alten Platz.
Soweit die Geschichte von Silas Marner bis zu seinem fünfzehnten Jahr in Raveloe. Den lieben langen Tag saß er am Webstuhl, das monotone Klappern in den Ohren; seine Augen sahen nichts als das langsame Anwachsen der immer gleichen bräunlichen Vierecke so dicht vor ihnen, und seine Muskeln bewegten sich in so gleichförmiger Wiederholung, dass eine Unterbrechung kaum eine weniger unnatürliche Anstrengung darstellte, als wenn er den Atem hätte anhalten wollen. Des Nachts aber kam seine Schwelgestunde: Nachts schloss er die Fensterläden, verriegelte die Türen und holte sein Gold hervor. Schon lange war der Eisentopf zu klein geworden für die Münzen, und Silas hatte sich zwei dicke Ledersäckchen genäht, die keinen Platz in ihrer Ruhestätte verschwendeten, sondern sich weich in jedes freie Eck schmiegten. Wie die Guineen glänzten, wenn sie aus den dunklen ledernen Mündern quollen! Das Silber hatte keinen großen Anteil, verglichen mit dem Gold, denn die langen Leinenbahnen, die den Großteil seiner Einkünfte ausmachten, wurden immer weitgehend in Gold bezahlt, mit dem Silber aber deckte er seine körperlichen Bedürfnisse, und zwar ausschließlich mit den Schillingen und Sixpencestücken. Seine Guineen waren ihm das Liebste, aber das Silber hätte er darum doch nicht eintauschen wollen – diese Kronen und halben Kronen, die sein ureigener Verdienst waren, hervorgegangen aus seiner Arbeit: Er liebte sie alle. Er breitete sie in Haufen aus, badete die Hände darin; dann zählte er sie und baute gleichmäßige Türme daraus, befühlte die gerundeten Kanten mit Daumen und Zeigefinger und gedachte dabei der Guineen, die er sich mit der angefangenen Arbeit im Webstuhl erst zur Hälfte verdient hatte, so liebevoll, als wären es ungeborene Kinder – gedachte all der Guineen, die sich im Lauf der Jahre noch ansammeln würden, sein ganzes Leben lang, das sich vor ihm erstreckte, einem fernen, von zahllosen Tagen des Webens gänzlich verdeckten Ende entgegen. Kein Wunder, dass er mit seinen Gedanken noch bei seinem Webstuhl und seinem Geld war, wenn er durch die Felder und Wiesen ging, um seine Arbeit abzuholen und heimzutragen; kein Wunder, dass er seine Schritte nie an die heckenbewachsenen Böschungen und Wegränder lenkte, um nach den einst vertrauten Kräutern zu suchen: auch diese gehörten der Vergangenheit an, von der sein Leben sich zurückgezogen hatte wie ein Bächlein von dem Gras am Rande seines zu groß gewordenen Bettes, um sich nun, zu einem kleinen, zitternden Rinnsal geschrumpft, durch den trockenen Sand zu graben.
Aber im fünfzehnten Jahr, um die Weihnachtszeit, kam eine zweite große Veränderung über Marners Leben, und seine Geschichte verknüpfte sich auf wunderliche Weise mit den Schicksalen seiner Nachbarn.
3